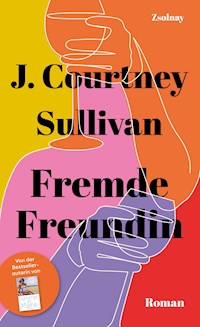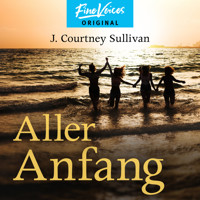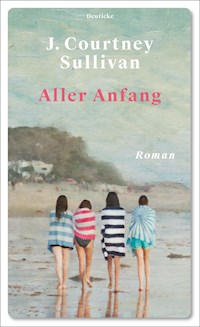
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Celia, Bree, Sally und April beginnen gemeinsam ihr erstes Jahr am College – doch sonst könnten die jungen Frauen kaum unterschiedlicher sein. Celia, streng katholisch erzogen, hat eine Flasche Wodka im Koffer; Bree, eine echte Schönheit, denkt nur an ihren Verlobten; Sally, zwanghaft ordentlich, leidet unter dem Tod ihrer Mutter, und die rothaarige April, eine radikale Feministin, möchte bloß eines: sofort in ein anderes Zimmer umziehen. Spannend, lustig und ganz schön böse ist dieser Roman, in dem wir die vier ungleichen Freundinnen auch durch die Jahre nach ihrem Abschluss an der Universität begleiten, in denen sie Spaß haben, streiten, sich wild verlieben und versuchen, ihre Träume zu verwirklichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Celia, Bree, Sally und April beginnen gemeinsam ihr erstes Jahr am College – doch sonst könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Celia, streng katholisch erzogen, hat eine Flasche Wodka im Koffer; Bree, eine echte Schönheit, denkt nur an ihren Verlobten; Sally, zwanghaft ordentlich, leidet unter dem Tod ihrer Mutter, und die rothaarige April, eine radikale Feministin mit wilden T-Shirt-Sprüchen, möchte bloß eines: sofort in ein anderes Zimmer umziehen.
Spannend, lustig und ganz schön böse ist dieser Roman, in dem wir die vier ungleichen Freundinnen auch durch die Jahre nach ihrem College-Abschluss begleiten, in denen sie Spaß haben, streiten, sich wild verlieben, Schönes und Schreckliches erleben und versuchen, ihre Träume zu verwirklichen.
J. Courtney Sullivan
Aller Anfang
Roman
Aus dem Englischen von Henriette Heise
Deuticke
Für meine Eltern, Eugene F. Sullivan Jr. und Joyce Gallagher Sullivan
Teil eins
Smith College Alumni-News
Frühjahr 2006
Neues vom Jahrgang 02
Robin Hughes schließt im Mai ihren Master in Public Health an der Northwestern ab. Sie lebt in Chicago mit ihrer Kommilitonin aus dem Hopkins House Gretchen (Gretch) Anderson … Natalie Goldberg (Emerson House) und ihre Partnerin Gina Black (Jahrgang 99) haben sich endlich ihren Traum erfüllt, nach Finnland zu ziehen und da eine Karaokebar aufzumachen! Wie ich höre, sind bisher schon die ehemaligen Emerson-House-Bewohnerinnen Emma Bramley-Hawke und Joy Watkins auf ein paar Strophen »Total Eclipse of the Heart« vorbeigekommen. Nach vier Jahren in einer Krankenstation in ihrem Herkunftsland Malaysia ist Jia-Yi Moa jetzt an der medizinischen Fakultät der New York University angenommen worden! … Und jetzt zu meinen persönlichen Lieblingen: Sally Werner, die in Harvard medizinische Forschung betreibt, heiratet im Mai ihren langjährigen Freund Jake Brown (und zwar auf dem Smith Campus!). Ihre Kommilitoninnen aus dem King House Bree Miller (Juraabschluss von Stanford 05), April Adams (die furchtlose Rechercheurin für Frauen in Not, Inc.) und meine Wenigkeit geben die Brautjungfern. Ihr könnt euch schon auf peinliche Trinkbilder in der nächsten Ausgabe freuen. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Frühling, und schickt weiter eure Updates!
Eure Schriftführerin
Celia Donnelly
Celia
Celia schrak aus dem Schlaf auf.
Ihr Kopf dröhnte, ihr Mund war trocken, und es war schon neun Uhr. Sie war spät dran für Sallys Hochzeit, oder zumindest für den Bus, der sie hinbringen sollte. Sie verfluchte sich dafür, am Vorabend ausgegangen zu sein. Was für eine Brautjungfer kam zu spät zur Hochzeit einer ihrer besten Freundinnen, und dann auch noch verkatert?
Die Sonne schien durch die Fenster ihrer kleinen Studiowohnung. Vom Bett aus sah Celia zwei Bierflaschen und eine offene Tüte Tortilla Chips auf dem Wohnzimmertisch beim Sofa und, grundgütiger Gott, auf dem Fußboden eine Kondomverpackung. Diese Frage war immerhin geklärt.
Der Typ neben ihr hieß entweder Brian oder Ryan, so viel wusste sie. Alles andere war eher verschwommen. Sie konnte sich vage daran erinnern, ihn auf der Treppe vor dem Haus geküsst zu haben, während sie nach ihren Schlüsseln kramte und sich seine Hand schon ihr Bein hinauf und unter ihren Rock bewegte. An Sex konnte sie sich nicht erinnern, aber an die Tortilla Chips schließlich auch nicht.
Glück gehabt: Sie könnte jetzt auch in Kleinteile zerstückelt sein. Ihr nüchternes Selbst musste mit der Info zu ihrem betrunkenen Selbst durchdringen, dass es alles andere als ratsam war, fremde Männer mit nach Hause zu nehmen. Das stand doch ständig in der Zeitung: Sie lernten sich auf einer Party kennen, er lud sie auf einen Spaziergang ein, zwei Tage später fand die Polizei ihren Rumpf in einem Müllcontainer in Queens. Sie wünschte, zwangloser Sex brächte weniger direkt die Möglichkeit mit sich, ermordet zu werden, aber so war es eben.
Jetzt beugte Celia sich über ihn, gab ihm einen Kuss auf die Wange und bemühte sich, ruhig zu wirken.
»Ich muss bald los«, sagte sie sanft. »Willst du noch in die Dusche springen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich muss heute nicht ins Büro«, sagte er. »Bin am Nachmittag mit Klienten zum Golfen verabredet. Hast du was dagegen, wenn ich liegen bleibe?«
»Äh, nein«, sagte sie. »Kein Problem.«
Celia betrachtete ihn. Blondes Haar, makellose Haut, wohlgeformte Arme, Grübchen im Gesicht. Er war süß, verdächtig süß. Attraktiver, als es gut für ihn war, würde ihre Mutter sagen.
Bevor sie ging, küsste sie ihn noch einmal. »Die Tür schließt automatisch, du kannst sie einfach hinter dir zuziehen. Da drüben steht Kaffee, wenn du willst.«
»Danke«, sagte er. »Ich ruf dich an, ja?«
»Gut. Tja, bis dann also.«
Aus seinem Ton schließend schätzte sie die Wahrscheinlichkeit eines Anrufs auf fünfzig Prozent. Gar nicht schlecht für eine besoffene Eroberung.
Celia machte sich auf den Weg zur U-Bahn. War es bedenklich, dass er gefragt hatte, ob er noch in ihrer Wohnung bleiben durfte? Hätte sie verlangen sollen, dass er mit ihr ging? Er sah anständig aus und hatte gesagt, dass er im Finanzwesen arbeite. Er wirkte nicht wie einer, der mit einem Mädchen nach Hause geht, um sie auszurauben, aber was wusste sie schon von ihm? Celia war sechsundzwanzig Jahre alt. Sie fand, mit Ende zwanzig war es Zeit für eine Liste der Männer, mit denen man nicht ins Bett gehen sollte. Als sie in die A-Linie einstieg, fügte sie Typen, die mich eventuell berauben könnten hinzu.
Zwanzig Minuten später sprintete sie über den Port-Authority-Busbahnhof und betete, der Bus möge fünf Minuten Verspätung haben. Nur fünf Minuten, mehr brauchte sie nicht.
»Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen«, murmelte sie. »Komm schon. Komm schon!«
Das war eine Angewohnheit von Celia, ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der sie wirklich an Gott geglaubt und immer ein Ave Maria gesprochen hatte, wenn sie in Schwierigkeiten war. Heute wusste Celia, dass das, was sie für Gebete gehalten hatte, eigentlich Wünsche waren. Sie erwartete nicht, dass die Heilige Jungfrau tatsächlich irgendetwas tat – selbst wenn es sie gab, war sie vermutlich nicht für die Expressbusse von Manhattan nach Northampton, Massachusetts, zuständig. Aber die vertrauten Worte beruhigten sie. Sie setzte sie so selten wie möglich ein, um die Mutter Gottes, an die sie eigentlich nicht glaubte, nicht zu erzürnen.
Ihre Mutter verehrte die Heilige Jungfrau Maria und sprach den Rosenkranz jeden Morgen während der Autofahrt zur Arbeit und hatte jahrelang eine Madonnenstatue im Vorgarten gehabt, bis eine presbyterianische Familie in das Haus gegenüber eingezogen war (um sie nicht zu irritieren, hatte sie die Statue ausgegraben und hinterm Haus aufgestellt). Sie glaubte, dass alle Macht in Marias Händen lag und Jesus zweitrangig war, weil er aus ihrem Schoß gekommen war. Celia wunderte sich oft darüber, dass ihre Mutter vielleicht die einzige Person auf der Erde war, für die der Katholizismus ein Matriarchat war.
Sie kam genau in dem Moment an, als der Busfahrer die letzten Tickets entgegennahm und die Türen schloss.
»Warten Sie!«, rief sie. »Bitte warten Sie!«
Der Fahrer sah sie schläfrig und überrascht an. Hoffentlich war er nicht so verkatert wie sie.
»Bitte! Ich muss unbedingt noch mit!«, sagte sie.
»Dann aber schnell«, sagte er. »Ein Platz ist noch frei.«
Celia fiel nicht gern auf, aber der Gedanke an Sallys immense Enttäuschung, wenn sie anrief, um zu sagen, dass sie sich verspäten würde, war einfach unerträglich. Außerdem freute Celia sich schon seit Monaten auf dieses Wochenende. Sie wollte keinen Augenblick mit den Mädels verpassen.
Sie drängte sich durch den Gang, vorbei an Frauen mit schreienden Babys auf dem Schoß, Teenagern mit dröhnenden Kopfhörern und Zwanzigjährigen, die lautstark Telefonate über wahnsinnig private Themen führten. Hölle auf Rädern, das sollte der Slogan von Greyhound sein. Sie hätte alles für mehr Kaffee gegeben und so viel Aspirin, wie möglich war, ohne daran zu sterben.
Trotz der ihr bevorstehenden viereinhalbstündigen Busfahrt musste Celia lächeln. Bald würde sie wieder bei ihnen sein: Sally, makellos und impulsiv, eine fünfundzwanzigjährige Millionärin in einem Hochzeitskleid aus dem Secondhandladen; April, mutig und eigensinnig, deren Waghalsigkeit den anderen oft Sorgen bereitete; und Bree, schön, mit strahlenden Augen, die in einer aussichtslosen Liebesaffäre feststeckte – sie war immer noch Celias Liebling, trotz aller Veränderungen und der Distanz, die zwischen ihnen entstanden war.
Celia setzte sich neben einen verpickelten Teenager mit einem Comic in der Hand. Sie schloss die Augen und atmete tief durch.
Vor acht Jahren hatte Celia am Tag vor Unibeginn auf dem Rücksitz des Lincoln Town Car ihres Vaters gesessen und die ganze Strecke bis zum Smith College geheult. Die Familie hatte auf einem Imbissparkplatz halten müssen, damit sie sich sammeln konnte, bevor sie ihre Mitbewohnerinnen traf. Als sie am Haupteingang ihres Studentenwohnheims, dem Franklin King House, ankam, trug sie ein falsches Lächeln und eine halbe Tube der Abdeckcreme ihrer Schwester. (Celia war immer stolz darauf gewesen, zu den Make-up-losen Mädchen zu gehören, aber in diesem Augenblick fiel ihr auf, dass sie eigentlich morgens meistens Puder, Mascara und Lidschatten auftrug, sie kaufte sie nur nie selbst.) Stundenlang hielt sie die Tränen zurück, während sie mit ihrer Familie eine Kiste nach der anderen nach oben trug und sich dann auf der Wiese bei den Naturwissenschaften unter die anderen neuen Studentinnen und deren Familien mischte. Dann war es schließlich so weit, die Familie musste abreisen, und es kam zu einem peinlichen, schmerzhaften Moment, in dem alle vier – Celia, Violet und ihre Eltern – im Kreis standen, einander umarmten und heulten, alle außer Violet, die fünfzehn war und es eilig hatte, wieder nach Hause zu kommen, um das Konzert der Ska-Band ihres Freundes in der Knights of Columbus Hall nicht zu verpassen. (Die Band hieß For Christ’s Sake, um Himmels willen, und Celias Mutter hielt sie für eine christliche Rockband. Was sie nicht wusste, war, dass das letzte Wort auf dem e betont wurde, wie der japanische Reiswein.)
Nachdem sie abgefahren waren, weinte Celia, bis sie sich hohl fühlte wie ein Halloweenkürbis. Das College war für sie sehr plötzlich gekommen, und im Gegensatz zu vielen ihrer Freunde, die es nicht hatten erwarten können, von zu Hause wegzukommen, hatte Celia an ihrem Leben nichts auszusetzen gehabt. Sie konnte sich nicht vorstellen, ins Bett zu gehen, ohne vorher ins Schlafzimmer ihrer Eltern zu schleichen und sich zu den Hunden ans Fußende zu kuscheln, während ihr Vater die Late Show with DavidLetterman sah und ihre Mutter einen Schundroman las. Sie konnte sich nicht vorstellen, das Bad mit irgendjemand anderem zu teilen als mit Violet – eine Mitbewohnerin konnte man nicht anschreien wie eine Schwester, wenn sie das ganze Heißwasser verbraucht hatte. Man konnte sich nicht in ein Handtuch gehüllt und vom Duschen noch klatschnass die Mitesser vor dem Spiegel ausdrücken, während die Mitbewohnerin sich auf dem Badewannenrand sitzend die Fußnägel schnitt.
Am Smith College, befürchtete Celia, würde sie sich vielleicht nie richtig wohlfühlen.
Zusammen mit Lebensmittelvorräten, von denen eine fünfköpfige Familie einen Monat lang hätte zehren können, hatte ihre Mutter ihr ein Andachtsbild mit der Heiligen Jungfrau und das goldene Wandkreuz ihrer Urgroßmutter mitgegeben.
»Dir ist klar, dass das kein Nonnenkloster ist, ja?«, hatte ihr Vater seine Frau gehänselt.
Nachdem sie jahrelang auf eine katholische Schule gegangen war, betrachtete Celia sich mittlerweile als Atheistin, aber sie hatte noch immer panische Angst davor, solche Gegenstände in den Müll zu werfen – das war für sie eine todsichere Methode, vom nächsten Blitz getroffen zu werden. Stattdessen stopfte sie die Sachen in die hinterste Ecke einer Schublade und legte Unterhosen und Socken darüber.
Celia zog zwei Flaschen Wodka aus dem Koffer, in dem diese eingewickelt in ein Snoopy-Badehandtuch gereist waren, das sie besaß, seit sie acht Jahre alt war. Sie stellte die Flaschen in ihren Mini-Kühlschrank und freute sich, als ihr klar wurde, dass sie sie vor niemandem mehr verstecken musste.
Sie packte ihre restliche Kleidung aus und räumte sie in den Schrank. Das Zimmer war klein mit schlichter, weißer Tapete an den Wänden und möbliert mit einem Einzelbett, einer Eichenkommode, einem Nachttisch und einem blinden kleinen Spiegel mit einem verblichenen CLINTON/GORE-96-Sticker am unteren Ende. Celia hatte die Zimmer von Freundinnen an der Holy Cross Universität und am Boston College gesehen, deshalb wusste sie, dass dieses hier vergleichsweise gemütlich und sauber war. Am Smith College gab es in jedem Zimmer kostenloses Kabelfernsehen, einen privaten Telefonanschluss und riesige Fenster mit breiten Fensterbrettern, auf denen man sitzen und stundenlang lesen konnte. Ihre Eltern hatten sich hoch verschuldet, um ihr das zu ermöglichen. (»Den Kredit werden wir noch abzahlen, wenn deine Kinder ins College gehen«, hatte ihr Vater vergangenen Frühling bei seinem letzten Versuch gesagt, sie zum Besuch einer staatlichen Uni zu überreden). Ihr war bewusst, dass sie allen Grund zur Dankbarkeit hatte. Trotzdem wurde Celia ein bisschen panisch bei dem Gedanken, die nächsten vier Jahre hier zwischen diesen Wänden zu verbringen.
Sie kämpfte so lange sie konnte dagegen, ihre Mutter anzurufen. Sie schaffte drei Stunden.
»Auf der Rückfahrt wollte ich fahren, damit dein Vater sich ein bisschen ausruhen konnte«, erzählte ihre Mutter. »Nicht einmal bis Abfahrt achtzehn habe ich es geschafft, da musste ich so weinen, dass ich an den Rand fahren und mit Daddy tauschen musste.«
Celia lachte. »Ihr fehlt mir schon jetzt so sehr.«
In diesem Augenblick erschien ein Mädchen in Celias offener Zimmertür. Sie sah aus wie ein Mann mittleren Alters, über die Shorts hing ein dicker Bierbauch, und auf dem weißen T-Shirt prangte ein kleiner brauner Fleck. Das Haar war nach hinten gegelt, und in der Hand hielt sie ein Klemmbrett.
Hoffentlich hatte die Frau nicht gehört, wie sie ihrer Mutter wie eine Fünfjährige etwas vorgeheult hatte.
»Ich muss auflegen«, sagte sie ins Telefon.
»Celia Donnelly?«, sagte das Mädchen mit einem Blick auf ihre Liste. Ihre Stimme war tief und rau. »Hocherfreut. Ich bin deine HP – steht für House President, die Präsidentin vom King House – Jenna der Monstertruck Collins. Erstlingstreffen im Wohnzimmer in fünf Minuten.«
Wenige Minuten später saß man unten im Wohnzimmer im Kreis auf dem Fußboden, und Celia musterte die anderen Neuen. Sie waren insgesamt fünfzehn, und die meisten sahen genauso aus wie die Mädchen, die sie von der Highschool kannte. Sie trugen Jeans oder baumwollene Sommerkleider, im Gesicht einen Hauch Lipgloss und Mascara, und hatten glattes, langes Haar. Dann waren da die Mädchen, die die Versammlung organisiert hatten: Monstertruck Jenna, zwei weitere Studentinnen im letzten Studienjahr von ähnlichem Format, die beide Lisa hießen und kurze Jungenfrisuren hatten, und eine Studentin im zweiten Studienjahr namens Becky, die das Zeug zu einer echten Schönheit gehabt hätte, wenn sie sich nur ein kleines bisschen für ihr Äußeres interessiert hätte. Ihr Haar fiel schlaff und strähnig vor Fett auf ihre Schultern, und ihr Gesicht glänzte so sehr, dass Celia zum ersten Mal der Gedanke kam, mit einem Abschminkpad die Haut einer Fremden zu bearbeiten. Abgesehen von Jenna trugen alle Flanellpyjamas.
Würde das auch aus ihr und den anderen werden? Das fragte Celia sich. Bedeutete der Eintritt in ein Frauencollege, dass man allen Pflegeprodukten entsagte und sich den Kohlehydraten hingab, als hätte man nur noch eine Woche zu leben? (Später fand sie heraus, dass, wenn man nicht vorsichtig war, die Antwort auf diese Fragen Ja und Ja war. Nach dem ersten Semester drehte etwa ein Viertel der Mädchen durch, füllte Versetzungsanträge an die Wesleyan University, das Swarthmore College oder eine beliebige andere gemischtgeschlechtliche Uni aus, bei der es eine Chance gab, dass sie sie mitten im akademischen Jahr annahmen.)
Monstertruck Jenna eröffnete die Versammlung, indem sie sich und die anderen vorstellte. Sie war HP, die Lisas waren HONS (diese sogenannten Heads of New Students waren für die Neuzugänge zuständig), und Becky war eine SAA (als Student Academic Adviser beriet sie die Studentinnen zu Fragen des Studiums). Hier gab es für alles eine Abkürzung, selbst für Dinge, bei denen es vermutlich einfacher gewesen wäre, den eigentlichen Begriff zu verwenden. Jenna ging die Liste der Namen durch und sagte dann: »Ihr seid übrigens Erstsemester oder Erstis. Ich möchte nicht hören, dass sich eine von euch als Freshman bezeichnet – Männer gibt es hier ja offensichtlich nicht.«
Ein schlankes Mädchen mit einem seidig braunen Pferdeschwanz und einem Lilly-Pulitzer-Kleid hob die Hand. Celia erkannte sie wieder, sie hatte sie an diesem Tag schon einmal gesehen. Ihr Zimmer lag nur drei Türen von ihrem entfernt, sie war allein angekommen und hatte einen übergroßen Koffer geschleppt, mit dem Celias Vater ihr schnell geholfen hatte.
»Du hast mich nicht aufgerufen«, sagte sie. »Ich bin Sally Werner.«
Monstertruck Jenna sah auf ihre Liste. »Hier steht, dass du zurückgetreten bist.«
»Das ist richtig«, sagte Sally mit einem traurigen Lächeln. »Eine lange Geschichte.«
Celia war gleich neugierig. Ihre Mutter sagte immer, Celia sei vom Schicksal anderer so fasziniert wie eine Romanautorin. Ein Jahr zuvor hatte sie aufhören müssen, ihre Familie zur Suppenküche zu begleiten, wo sie sich ehrenamtlich engagierten, weil sie sich mit jeder Person, die eintrat, ein schlimmeres und traurigeres Szenario ausgemalt hatte: Ein Mann in einem verschlissenen Ralph-Lauren-Sakko war mal Banker gewesen und hatte Vermögen und Familie in den Flammen eines Hausbrandes verloren (in Wirklichkeit, sagte ihre Mutter, war er nur ein fieser alter Säufer). Eine junge Frau mit einem traurigen Lächeln hatte irgendwo da draußen ein krankes Kind, für das sie anschaffen ging (nein, hatte ihre Mutter gesagt, das war aus Les Misérables).
»Die Sache ist die«, sagte Sally. »Meine Mutter ist gestorben, also musste ich meine Pläne in letzter Minute ändern.«
»Wann war das?«, platzte Celia heraus.
Kurz drehten sich alle nach ihr um, dann waren die Blicke wieder auf Sally gerichtet.
»Vor fast vier Monaten. 17. Mai. Deshalb bin ich zurückgetreten. Sie war krank, und wir dachten, sie hätte noch so ungefähr neun Monate zu leben, also beschloss ich, den Studienbeginn ein Jahr zu verschieben. Aber dann ist sie gestorben, und zu Hause gab es für mich nichts weiter zu tun, also –« Sie verstummte.
»Das tut mir leid«, sagte Monstertruck Jenna, und einige Mädchen im Kreis schlossen sich ihr an.
»Danke«, sagte Sally gedämpft, und Celia fragte sich, was in aller Welt man in so einer Situation sagen konnte, ohne völlig bescheuert zu klingen.
Celia wünschte, sie wäre mutig genug, aufzustehen und diese Fremde in den Arm zu nehmen. Sie wollte später zu Sally gehen, sich neben sie auf das schmale Bett setzen und ihre Freundin werden, die Schulter sein, an der sie sich ausheulen konnte.
Die Versammlung wurde fortgesetzt, sie wurden über Mensa-Zeiten informiert und darüber, wo man die Pille danach, andere Verhütungsmittel und Leckläppchen bekam. (Was zur Hölle war das denn?, fragte Celia sich. Sie nahm sich vor, es online zu recherchieren, sobald sie auf ihrem Zimmer war.) Jenna verteilte Hunderte bunter Flyer, die für Campus-Vereine, -Teams, -Läden und -Veröffentlichungen warben, und Celia wusste, dass sie jeden einzelnen davon wegwerfen würde, sobald sie oben war.
Ihre Beine schliefen langsam ein. Sie streckte sie aus und sah sich im Raum um. Er war vollgepackt mit protzigen Sofas und riesigen Orientteppichen, hatte einen echten Kamin und einen gigantischen Kronleuchter. Er erinnerte sie an eine der Villen in Newport, durch die ihre Mutter gern Führungen unternahm, um beim Anblick von Ottomanen and Récamieren »Ooh« und »Aaah« zu rufen und dann wieder in ihr bescheidenes Vorstadthäuschen zurückzukehren, in dem die abgenutzten Billigsofas von Tatzenspuren und jahrzehntealten Erdnussbutterflecken übersät waren.
»Ah, fast hätte ich die Duschregeln vergessen«, sagte Jenna, als es schon so aussah, als wären sie fertig. »Grundsätzlich gilt: Duscht bitte nicht während der Stoßzeiten mit eurer Liebsten – das ist üblicherweise zwischen acht und zehn Uhr morgens. Das ist einfach respektlos, denn mal ehrlich: Wer will morgens als Erstes zwei Lesben dabei zuhören, wie sie’s einander besorgen?«
Einige der Erstis krümmten sich, und Celia fragte sich, ob das eine Taktik der älteren Studentinnen war – sie alle kannten den Mythos von den Smith-College-Lesben, aber war Sex zwischen Mädchen in der Dusche wirklich so verbreitet, dass man deswegen eine Hausregel aufstellen musste?
Die schöne Filmstarblondine Celia gegenüber wirkte entsetzt und richtete sich kerzengerade auf. Celia betrachtete sie und bemerkte einen kleinen, glitzernden Diamantring an einem ihrer zarten Finger. Um Gottes willen, was war das denn für eine? Eine Art Kinderbraut? Eine Achtzehnjährige, die schon verlobt war. Na, das konnte ja was werden.
Der Blick des Mädchens traf ihren, Celia schenkte ihr ein großes Lächeln und konnte es bedauerlicherweise dann nicht lassen, ihr auch noch zuzuwinken. Immer musste sie es übertreiben, wenn sie nervös war oder gerade beim Spionieren erwischt worden war.
Als sie die Treppe zu ihren Zimmern hinaufstiegen, sah Celia sich die drei Mädchen genauer an, mit denen sie den Flur teilen würde: Bree, die schöne verlobte Blondine; Sally, deren Mutter vor kurzem gestorben war; und ein drittes Mädchen namens April mit einem Augenbrauenpiercing und einem T-Shirt mit der Aufschrift: RIOT: DON’T DIET auf der Vorderseite.
Die vier hatten die schlechtesten Zimmer im King House: die Mädchenkammern im zweiten Stock. Im King House hatten alle Einzelzimmer, und die meisten waren riesig, groß genug für ein Doppelbett, und mit je zwei oder drei Fenstern. Nur ein paar unglückliche Erstsemester mussten in den vier düsteren Kammern schlafen, die über dem Hauptstockwerk lagen, und in denen früher die Dienstmädchen der Studentinnen untergebracht gewesen waren.
An diesem ersten Abend ging jede von ihnen auf ihr Zimmer, schloss die Tür hinter sich und blieb vorerst ein Geheimnis.
Später, es war gegen dreiundzwanzig Uhr, hörte Celia ein Schluchzen durch die Wand, die ihr Zimmer von Brees trennte. Sie legte eine CD der Indigo Girls auf, um das Geräusch zu übertönen, und verbot sich die Neugier, aber nach der Hälfte des ersten Liedes konnte sie dieses Geräusch fremden Unglücks nicht länger ertragen. Außerdem brannte sie darauf zu erfahren, ob Bree und ihr Verlobter sich getrennt hatten. Sie kritzelte ein paar Sätze auf die Rückseite eines der Flyer von der Versammlung (Die Radikalen Cheerleaders brauchen dich: Dem Patriarchat eins aufn Deckel!) und schob ihn unter Brees Tür hindurch: Ich fühle deinen Schmerz. Lust auf Wodka und Oreo-Kekse nebenan? – Celia D. Zimmer 323.
Das Schluchzen hörte auf. Zehn Minuten später klopfte es an Celias Tür.
Bree steckte den Blondschopf ins Zimmer und wedelte mit Celias Zettel. »Danke«, sagte sie mit einem süßen Südstaaten-Akzent. »Gilt das Angebot noch?«
Celia lächelte. »Aber klar.«
Sie fragte sich, ob Bree ähnlich wie sie über die Versammlung dachte. Celia hatte aus Prinzip die dunkle Jeans und das smaragdgrüne Wickelkleid noch nicht ausgezogen: Nur, weil es hier keine Typen gab, hieß das noch lange nicht, dass sie sich gehenlassen würde. Bree trug eine rosafarbene Flanellpyjamahose und ein schlichtes, weißes Trägerhemd, aber Celia sah, dass sie Lidschatten und Lipgloss gerade noch einmal nachgezogen haben musste, und irgendetwas daran war zugleich witzig und rührend.
»Tut mir leid, dass ich so laut geweint habe«, sagte Bree. »Meine Brüder nennen mich die Drama Queen von Rosewood Court. So heißt unsere Straße zu Hause.«
»Kein Problem«, sagte Celia. »Ich glaube, ich habe seit meiner Ankunft heute früh mehr geweint als im ganzen vergangenen Jahr. Hast du Heimweh oder Herzschmerz?«
»Ein bisschen von beidem«, sagte Bree, ging zum Schreibtisch und setzte sich.
»Willst du Wodka oder Oreo-Kekse?«, fragte Celia.
»Ein bisschen von beidem«, sagte Bree wieder, und Celia lachte zum ersten Mal an diesem Tag.
Sie tranken Wodka aus Pappbechern, die Celias Mutter zusammen mit Plastikbesteck, Papierservietten und Tupperware in eine Einkaufstüte gestopft hatte, als ginge ihre Tochter auf ein Picknick, nicht aufs College.
Bree leerte ihren Becher und befüllte ihn nochmal bis zum Rand.
War sie trinkerfahren oder einfach nervös? Celia hielt Letzteres für wahrscheinlicher – wer erfahren war, stürzte puren Wodka üblicherweise nicht becherweise hinunter, sondern wusste, dass es darum ging, das Tempo zu kontrollieren. Sie dachte an die Partys zurück, an denen sie im letzten Schuljahr teilgenommen hatte: rote Plastikbecher mit rachenwärmendem Wodka, konsumiert in zahllosen modrigen Souterrains, während im Zimmer darüber ahnungslose Eltern vor dem Fernseher saßen; Tequila-Shots im Whirlpool von Reggie Yablonskis Mutter, wenn die zu Besuch bei ihrer Schwester in Kittery war; und eine Flasche Champagner, mit den Mädchen aus der Nachbarschaft zum Abschlussball geleert.
»Und du?«, fragte Bree. »Hast du jemanden zurückgelassen?«
»Ich hab’ mich gleich nach dem Abschluss von meinem Typen getrennt«, sagte Celia. »Wir waren so etwa vier Monate zusammen. Er wollte im Sommer im Ferienlager arbeiten, und mir war klar, dass Fernbeziehungen eine einzige Katastrophe sind.«
Sie bereute sofort, das gesagt zu haben.
»Für mich, meine ich«, stotterte sie. »Eine Katastrophe für mich. Das ist einfach nichts für mich.«
»Wieso sollte es eine Katastrophe sein?«, fragte Bree mit großen Augen, als wäre Celia ein Orakel, das das Schicksal ihrer Verlobung vorhersagen könne.
An Celias Highschool nannten die Mädchen den 1. September, an dem die Älteren die Schule verließen und zur Uni zogen, den D-Day – der Tag, an dem dein Freund dir ade sagt. Es hatte ihr immer leidgetan, wenn das einer ihrer Freundinnen widerfuhr, und sie hatte sich insgeheim geschworen, dass ihr das nicht passieren würde.
Also hatte sie die Sache mit Matt Dougherty beim Abschlussball der St. Catherine’s beendet. In der Sporthalle wurde getanzt, Punsch getrunken und Bier geschmuggelt, alle waren ganz aufgedreht. Celia und Matt saßen abseits des Trubels im Kraftraum auf einem alten Laufband. Sie hatten ihre Jungfräulichkeit gemeinsam genau hier in diesem verschwitzten, fensterlosen Raum verloren, zwischen Mittagessen und der vierten Stunde, erst einen Monat zuvor. Er war der Kapitän des Ringkampfteams und hatte einen Schlüssel. Während des Balls hatten sie sich wieder hierher geschlichen, um ein bisschen rumzumachen, aber Celia glaubte, etwas in seinen Augen zu sehen: Sie wusste, dass es nicht halten würde. Und war es nicht besser, etwas zu beenden, solange man noch Kontrolle darüber hatte, als dass es einem unter den Füßen weggerissen wurde, wenn man es nicht erwartete?
»Können wir es nicht wenigstens versuchen?«, hatte er gefragt.
»Wozu?«, sagte Celia. Er hatte vor, ins weit entfernte Berkeley zu ziehen, und niemand konnte wissen, wann sie sich wiedersehen würden.
Den Rest des Balls verbrachten sie getrennt voneinander und redeten mit ihren jeweiligen Freunden. Celia schluchzte irgendwann auf der Tribüne in Molly Sweeneys Jeansjacke und wusste die ganze Zeit, dass es eigentlich nicht um Matt ging, jedenfalls nicht nur. Es war die Angst vor dem Neuen und Unbekannten, es war der überraschende Schmerz bei dem Gedanken, dass sie vermutlich nie wieder in dieser Sporthalle stehen würde, obwohl sie den Sportunterricht immer gehasst hatte, mindestens zweimal im Monat geschwänzt und entweder mit Sharon Oliver auf der Behindertentoilette gesessen oder dem Lehrer, dem Mann mit schütterem Haar und einem Trainingsanzug aus Polyester, etwas von Krämpfen erzählt hatte. (Das schien ihn immer ausreichend anzuekeln, dass sie die Unterrichtsstunde über im Krankenzimmer dösen, aus einer winzigen Papppackung Tropicana schlürfen und Broschüren über Enthaltsamkeit und den richtigen Umgang mit Inhalatoren lesen konnte.)
»Vermisst du ihn?«, fragte Bree jetzt.
»Eigentlich nicht«, sagte Celia. »Vielleicht die Vorstellung von ihm. Ich habe da dieses Problem: Wenn ich Single bin, bin ich richtig glücklich, habe aber das Gefühl, dass mir was fehlt. Wenn ich dann in einer Beziehung bin, fehlt nichts, aber ich werde irgendwie traurig und verrückt. Schöne Scheiße, oder?«
Für den Bruchteil einer Sekunde sah Bree erstaunt aus, und Celia wünschte, sie hätte nicht »Scheiße« gesagt.
Dann sagte Bree: »Ja, so formuliert höre ich es zum ersten Mal, aber ich weiß genau, was du meinst.«
»Ich bin immer nach irgendeinem Typen verrückt«, gab Celia zu, »aber wenn ich ihn dann habe, weiß ich nie so richtig, was ich mit ihm anfangen soll.«
Bree lachte. »Wenn du so verrückt nach Jungs bist, darf ich dann fragen, was dich ans Smith College führt?«
Celia nahm einen kleinen Schluck Wodka. »Ich komme aus einem Vorort von Boston, und mir war immer klar, dass ich an eine Uni in der Nähe gehen wollte. Smith war das beste College, von dem ich eine Zusage bekommen habe. Dass hier nur Frauen sind, hat mir am Anfang Angst gemacht, aber solange Partys mit Männern stattfinden, komme ich schon klar. Um ehrlich zu sein, habe ich Frauen nie verstanden, die mit Männern befreundet sein wollen. Ich habe nur eine Schwester, bin mit den Mädels aus meiner Straße groß geworden, und, tja, ich weiß nicht – Frauenfreundschaften sind schon immer mein Ding gewesen.«
Bree nickte. »Meins auch.«
Sie strich mit einem Finger über den Verlobungsring.
»Und was ist mit dir?«, fragte Celia. »Warum Smith College?«
»Meine Mutter und meine Großmutter haben beide hier studiert«, sagte Bree. »Als ich klein war, sind meine Mutter und ich jeden Sommer für ein langes Wochenende nach Boston geflogen, haben dort ein Auto gemietet und sind hierher nach Northampton gefahren. Meine Mama hat mir immer von Ballkleidern, Kostümbällen mit den Jungs vom Amherst College und Candlelight-Dinners im Speisesaal vorgeschwärmt. Seit damals träume ich vom Smith College.«
»Aha«, sagte Celia. »Ich muss zugeben, dass mich die Vorstellung von Teegesellschaften, Abendgarderobe und dem ganzen Zeug fast vergrault hätte.«
Bree lachte. »Für mich war es das wichtigste Verkaufsargument.«
»Ist es nicht ein bisschen seltsam, dass es an dieser Uni mit ihren wöchentlichen Nachmittagstees in jedem Wohnhaus auch Duschregeln für Lesben gibt?«
»Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mama und Oma das auch schon kannten«, sagte Bree.
»Was machen die beiden heute?«, wollte Celia wissen.
»Was sie machen?«, fragte Bree.
»Was sie arbeiten, meine ich.«
»Ach so. Tja, sie waren Hausfrauen. Aber sie haben immer viel ehrenamtlich gemacht«, sagte Bree. »Arbeitet deine Mutter?«
»Ja«, sagte Celia. »Sie ist Vizepräsidentin bei einer Bostoner Werbeagentur.«
Bree machte große Augen. »Oh, wow«, sagte sie. »Ist ja toll. Ich weiß nicht – ich konnte es nicht erwarten, hierherzukommen, aber in den letzten Monaten hat mein Freund, äh, mein Verlobter, versucht, mich zum Uniwechsel zu bewegen.«
»Jetzt schon?«, fragte Celia. Sie versuchte sich auszumalen, wie es gewesen wäre, wenn Matt Dougherty sie gebeten hätte, nach Berkeley zu wechseln, aber das war unvorstellbar. Da, wo sie herkam, verlobte man sich nicht an der Highschool. Wenn sie etwas in der Richtung versucht hätte, hätten ihre Eltern zweifellos eingegriffen.
Bree nickte.
»Wie lange seid ihr zusammen?«, fragte Celia.
»Fast dreieinhalb Jahre«, sagte Bree.
»Wow.« Celias längste Beziehung hatte sechs Monate gehalten, und das hatte sich schon wie eine Ewigkeit angefühlt. Als sie zu Ende war, schaffte sie wochenlang nichts, als zur Schule zu gehen und ihre kleine Kolumne für die Schülerzeitung zu schreiben. Den Rest der Zeit verbrachte sie im Bett, wo ihr Vater ihr Eis servierte und versuchte, sie zum Lachen zu bringen, und ihre Schwester Ausgesuchtes aus der Gerüchteküche um ihre neuen Mitschüler lieferte, als würde Celia das interessieren. Plötzlich war ihr klar, warum Bree an ihrem Typen von zu Hause festhalten wollte.
»Man könnte denken, es sei 1952, und ich bin nur hier, um einen Abschluss in Hauswirtschaft zu machen«, sagte Bree. »Manchmal glaube ich, dass die Liebe es schwer hat, mit den gesellschaftlichen Veränderungen Schritt zu halten – ein Teil von mir will einfach nur weg von hier und zu ihm.«
»Und welcher Teil von dir will bleiben?«, fragte Celia.
»Der Teil, der mich geboren hat«, sagte Bree. »Meine Mutter findet Doug super, aber als ich ihr erzählte, dass ich über einen Uniwechsel nachdenke, hat sie fast einen Anfall gekriegt. Sie will unbedingt, dass ich Smith eine Chance gebe. Und ich will es auch. Glaube ich zumindest.«
»Ach, Mütter«, sagte Celia. »Meine hat mir heute Morgen ein Armband angelegt, und keine Stunde später höre ich von meiner Schwester: ›Es ist ein WHAT-WOULD-JESUS-DO?-Armband!‹ Meine Mutter hatte die Buchstaben W.W.J.D. für WAS WÜRDE JESUS TUN inwendig gemacht, damit ich es nicht merke. Die Kraft Jesu sollte unterbewusst wirken, schätze ich.«
Bree lachte. »Einige der Mädchen bei der Anmeldung hatten WAS-WÜRDE-JANE-AUSTEN-TUN?-T-Shirts an.«
»Genial«, sagte Celia. »So eins muss ich meiner Mutter schicken.«
Nach einer langen Pause bedankte Bree sich bei Celia für die Kekse. Ihre Stimme zitterte, und Celia fiel auf, dass sie beschwipst war.
»Ich müsste mich bei dir bedanken«, sagte Celia. »Du hast mich davon abgehalten, den Rekord für die schnellsten fünf Kilo extra auf der Hüfte als Freshman zu brechen.«
»Du meinst als Ersti«, korrigierte Bree lächelnd.
»Oh, stimmt. Und wenn ich mir die älteren Studentinnen ansehe, sollte ich daraus wohl die schnellsten fünfzig Kilo extra machen.«
Celia runzelte nachdenklich die Stirn. »War das zu gemein?«, fragte sie.
»Nein, ich hatte denselben Gedanken«, sagte Bree.
Sie senkte die Stimme zu einem Flüstern, als könnte sie jemand belauschen. »Hast du April schon kennengelernt?«, fragte sie. »Das Mädchen, das mir gegenüber wohnt?«
»Nein«, sagte Celia. »Noch nicht.«
»Ich bin ihr vor dem Essen im Bad begegnet«, sagte Bree. »Ich dachte, ich seh’ nicht richtig. Sie ist ein richtiger Hippie, weißt du? Sowas gibt es bei mir zu Hause gar nicht.«
Celia lachte. »Sie sieht tatsächlich … interessant aus.«
Bree kicherte. »Insgeheim würde ich sie am liebsten fesseln und ganz neu stylen. Mit dem richtigen Lidschatten und etwas Rouge könnte sie richtig hübsch aussehen«, sagte sie. »Apropos: Du hast echt schöne Farben. Das ist mir schon bei der Hausversammlung aufgefallen.«
»Meine Farben?«, fragte Celia.
Schöne Frauen machten Frauen mit mittelmäßigem Aussehen immer Komplimente über die seltsamsten Eigenschaften: Oh, für deine kleinen Füße würde ich töten. Deine Farben sind göttlich.
»Ja, ich habe mir immer diesen exotischen Look der dunkelhaarigen Irin gewünscht. Black Irish nennt ihr das, richtig?«, fragte Bree. »Das ist jetzt hoffentlich nicht beleidigend.«
Celia lachte. »Nein, ist es nicht. Aber da, wo ich herkomme, ist es alles andere als exotisch. Alle Mädchen, mit denen ich aufgewachsen bin, sehen haargenau gleich aus: schwarzes Haar, blasse, weiße Haut, Sommersprossen. Wir hatten einen gefälschten Ausweis, der von der älteren Schwester meiner Freundin Liz weitergereicht wurde, den haben wir uns in der Nachbarschaft zu fünft geteilt.«
»Du bist doch nicht blass!«, sagte Bree. »Du bist hellhäutig. Aber egal. In Irisch Boston aufzuwachsen muss supercool gewesen sein.«
Irisch Boston. Celia musste ein Lachen unterdrücken. Sie fragte sich, ob Bree sich ihre Familienmitglieder mit Schiebermütze und kaum verständlichem Akzent vorstellte, wenn sie in Wirklichkeit wie alle anderen in einem verschlafenen Vorort wohnten. Sie waren tatsächlich ein riesiger Familienclan mit Cousins und Cousinen in ganz Massachusetts, die fast jedes Wochenende in irgendeinem Garten irgendetwas feierten: einen Geburtstag, eine Firmung, einen Hochzeitstag. Und in einem kurzen Anfall von Patriotismus nach einer Reise nach Galway (sowie fruchtlosen Versuchen, Celias unheilbare Tollpatschigkeit zu beheben) hatte ihre Mutter Celia und Violet zum Stepptanzunterricht geschickt, dem Celia ihre perfekte Haltung und das absolute Unvermögen zu verdanken hatte, ganz normal zu tanzen. Abgesehen davon war sie nicht irischer als jede andere.
Natürlich machte sie mit Bree das Gleiche: Sie konnte sich dieses Mädchen problemlos beim Volkstanz in der Highschool und auf Debütantinnenbällen vorstellen. Sie sahen voneinander bisher nur die scharfen Kanten. Was in der Mitte lag, was verschwommen war, würden sie noch ausfüllen müssen.
Celia vermisste ihre Freunde von zu Hause. Liz Hastings mit dem bösen Humor und der kindlichen Angst vorm Dunkeln. Lauren O’Neil, die mit sechs Brüdern aufgewachsen war und bei der früher immer die wildesten Pyjamapartys stattgefunden hatten, bei denen ihre Brüder den Mädchen köstliche Angst machten, indem sie in Clownsmasken ins Zimmer stürmten oder ihnen Gruselgeschichten erzählten, bis sie kreischten. Diese Mädchen kannten alles von Celia. Wie lange würde es dauern, bis sie wieder mit jemandem zusammensaß und ein Gespräch ohne Smalltalk führte, ohne eine Vorgeschichte aufrollen zu müssen, ohne sich Gedanken über ihre Wortwahl machen zu müssen?
Bevor Bree eine Stunde später in ihr Zimmer ging, umarmte sie Celia und sagte: »Ich bin so froh, dass du gleich nebenan wohnst. Warst du schon mal in Savannah, Celia? Es ist so schön da. Überall hängt das lila Louisianamoos von den Bäumen. O ja, irgendwann zeig’ ich dir das. Du wirst durchdrehen.«
Darauf folgte ein niedlicher kleiner Hickser. »Ich trinke sonst eigentlich nicht.«
Celia lachte. »Ich freue mich auch, dass du nebenan bist.«
Am nächsten Morgen, ihrem ersten ganzen Tag am Smith College, wachte Celia vor acht Uhr auf. Der Unterricht sollte erst am nächsten Tag beginnen, aber sie konnte nicht mehr schlafen. Sie öffnete ihre Schlafzimmertür und warf einen Blick in den menschenleeren Flur. Sie wünschte, Bree gut genug zu kennen, um sie jetzt für ein extrafrühes Frühstück oder einen langen Spaziergang über den Campus aus den Federn holen zu können. Stattdessen ließ sie die Tür offen stehen, setzte sich allein auf ihr Bett und schrieb Tagebuch.
Einige Zeit später hörte sie ein Geräusch im Flur und sah rotes Haar aufblitzen. »Hey!«, rief sie. »Du bist April, oder?«
April steckte den Kopf durch die Tür. »Ja, die bin ich«, sagte sie.
Sie kam in Shorts und einem ausgeblichenen Trägertop ins Zimmer, und Celia sah, dass ihre Waden von dickem, braunem Haar übersät waren. Das waren aber gar keine Stoppeln. Dieses Mädchen hatte sich noch nie rasiert. Das rotgefärbte Haar war in einem unordentlichen Zopf zurückgebunden, und sie trug kein Make-up. Sie war etwa eins fünfundsiebzig groß, sehr dünn und hatte lange Beine, die trotz der Behaarung verblüffend sexy waren.
Typisch, dachte Celia. Die Mädchen, denen ihr Aussehen egal ist, sind immer groß und schlank, ohne etwas dafür zu tun. April hatte ein hübsches Gesicht, aber scharfe Züge: Die spitze Nase und die ausgeprägten Wangenknochen ließen sie streng aussehen, wenn sie nicht lächelte.
»Bist du so früh schon draußen gewesen?«, fragte Celia.
April nickte. »Ich habe bei den Vorbereitungen für einen Vortrag von der Leiterin von Gleichberechtigung jetzt geholfen, der heute stattfinden soll«, sagte sie. »Das wird super. Hier, das kannst du haben.«
Sie reichte Celia einen Flyer. Celia überflog ihn:
STOPPT EHRENMORDE! JETZT!
WUSSTEST DU, dass in Pakistan nach den Hadd-Strafen eine Frau entweder das Geständnis des Vergewaltigers oder die Aussagen von mindestens vier volljährigen, männlichen muslimischen Augenzeugen braucht, um beweisen zu können, dass sie vergewaltigt wurde? Sonst muss sie damit rechnen, der Unzucht oder des Ehebruchs angeklagt zu werden oder von ihrem Ehemann, ihren Brüdern oder ihrem Vater ermordet zu werden, weil sie Schande über den Namen der Familie gebracht hat. Durchschnittlich sterben in Pakistan jährlich eintausend Frauen durch Ehrenmorde. HILF MIT, DIESER GRAUSAMKEIT UND DEM LEID EIN ENDE ZU SETZEN!
Celia blinzelte. Sie war schon davon überfordert, sich an das Studentenwohnheim zu gewöhnen und die vielen neuen Leute kennenzulernen. Wie hatte April es fertiggebracht, sich dem Kampf gegen Ehrenmorde anzuschließen?
April setzte sich neben sie aufs Bett. Ihr Körpergeruch erinnerte an Bostoner Obdachlose: stechend, pikant und roh. Plötzlich dachte Celia daran, wie ihre Mutter eines Sommers, als sie noch an der Highschool war, einen Artikel über krebserregende Chemikalien in Haushaltsprodukten gelesen hatte und darauf bestand, dass die Familie auf bio umstellte. Sie zwang sie dazu, nur noch Zahnpasta, Shampoo und sogar Deo aus Naturprodukten zu benutzen. Jetzt fragte Celia sich, ob auch sie gerochen hatte wie das, was ihr gerade in die Nase stieg, bevor sie im Herbst der elften Klasse mit Joey Murray zusammengekommen war. Zu dem Zeitpunkt hatte sie angefangen, Soft & Dri Deo, Haarspray und Clearasil in ihr Zimmer zu schmuggeln, so wie andere Jugendliche kleine Tütchen mit Gras und verschweißte Ausgaben vom Playboy.
Aprils Blick blieb an der Flasche Absolut vom Abend zuvor in Celias Mülleimer hängen, und Celia hatte sofort ein schlechtes Gewissen, sie nicht auch eingeladen zu haben.
»Du weißt aber, dass es am College ein Recyclingsystem gibt, oder?«, sagte April.
Celia nahm die Flasche brav aus dem Müll und stellte sie in den blauen Eimer hinter der Tür. Später wollte sie Bree alles von der Begegnung erzählen. Wer zum Teufel war dieses Mädchen?, fragte sie sich.
»Wollen wir frühstücken gehen?«, fragte April und brach das unangenehme Schweigen.
»Klar«, sagte Celia.
»Auf dem Rückweg von der Stadt konnte ich an nichts anderes denken als Hash Browns und einen fetten Teller falschen Speck«, sagte April.
»Was ist denn falscher Speck?«, wollte Celia wissen.
April lachte. »Das ist ein Sojaprodukt und schmeckt genau wie echter Speck. Na ja, fast. Ich bin Veganerin«, sagte sie. »Aber ich esse gern.«
Celia lächelte. Immerhin das hatten sie gemeinsam.
Sie gingen zum Speisesaal hinunter. Celia war froh, jemanden – irgendjemanden – zu haben, der mitkam. Obwohl ihre Schwester drei Jahre jünger war und sie unterschiedliche Freundeskreise hatten, war Violet immer an ihrer Seite gewesen, wenn sie etwas Neues anfing: Ferienlager, Softball oder auch nur der dumme Schnorchelkurs im Club Med. Ihr Leben lang hatte sie sich mehr Zeit allein gewünscht und von einem Samstag geträumt, an dem sie nicht zu einer langweiligen Familienfeier mitkommen musste. Jetzt war sie zum ersten Mal allein und wusste überhaupt nicht, was sie mit sich anfangen sollte.
Im Speisesaal saßen hier und da Mädchen in Schlafanzughosen und Trägerhemdchen, weiten T-Shirts und Boxershorts. Doch die meisten Studentinnen im letzten Studienjahr waren noch gar nicht eingetroffen, sodass ein Großteil der Tische leer blieb.
Celia trug Jeans und eine rote Strickjacke, dazu Socken und Keds.
»Findest du es nicht seltsam, dass sich hier alle anziehen wie in der Psychiatrie?«, flüsterte Celia April zu und hätte am liebsten losgelacht.
April zuckte nur mit den Schultern. Sie zeigte auf ihre Shorts. »Ich bin echt keine Modeexpertin.«
Hoffentlich hatte sie April nicht verletzt. »Ich werde, so lange ich kann, dagegen ankämpfen, mich im Pyjama in der Öffentlichkeit zu zeigen«, sagte sie.
April zog die Augenbrauen hoch.
Sie nahmen sich Teller von einem Tisch am Ende der Buffetschlange und begutachteten das Essen. Da waren Platten, auf denen sich Doughnuts, Bagels und andere Backwaren stapelten, eine riesige Terrine mit dampfendem Haferbrei und Pfannen mit Speck, Wurst, Omeletts, Armen Rittern, Waffeln und Hash Browns, und neben jedem Fleischgericht gab es eine vegane Alternative.
Für Celia war das ganz neu. Hatte es an ihrer Highschool Veganer gegeben? Nein, entschied sie. Ganz bestimmt nicht. Die zwei oder drei Vegetarier, die sie kannte, hatten in der Cafeteria einfach immer die Pizza genommen, weshalb sie nicht weiter auffielen.
April belud ihren Teller mit grünlichem Ei-Ersatz und falschem Speck, der Celia an die Gummilebensmittel in ihrer Fisher-Price-Spielzeugküche von früher erinnerte.
»Das musst du probieren. Echt lecker. Und für die Herstellung musste kein Tier eines grausamen Todes sterben«, sagte April.
Celia hielt gerade eine Wurst in der Servierzange. Oje. Sie legte die Wurst auf ihren Teller und nahm sich noch zwei Plunder, einen mit Himbeere und einen mit Käse. Wenn sie je einen Anlass zum Frustessen gehabt hatte, dann jetzt.
Sie setzten sich und sprachen über die Hausversammlung vom Vorabend.
»Was hältst du von den Duschregeln?«, fragte Celia.
April zuckte mit den Schultern.
Also, die machte es einem wirklich nicht leicht.
»Hast du zu Hause einen Freund?«, fragte Celia.
April verschluckte sich und sagte Nein, als hätte Celia gefragt, ob sie eine My-Little-Pony-Sammlung in ihrer Handtasche hatte.
»Eine Freundin?«, fragte Celia. Jetzt war es auch egal.
»Nein«, sagte April. »Ich will nicht das Arschloch sein, aber ich fand die ganze Versammlung ziemlich kindisch. Dass ich dem King House zugeteilt wurde, muss sich irgendein Scherzkeks in der Verwaltung ausgedacht haben.«
»Wie meinst du das?«, fragte Celia.
»Ich bin nicht für das Sozialleben hier gemacht«, sagte April. »Ich interessiere mich nicht für die Scheißvereinigungen und Saufgelage mit braven weißen Jungs. Dafür bin ich nicht hergekommen. Wenn ich das gewollt hätte, hätte ich auch auf jede x-beliebige staatliche Uni in Illinois gehen können.«
»Ah, du kommst aus Illinois?«, sagte Celia mit viel zu viel Enthusiasmus für jemanden, der noch nie da gewesen ist.
»Chicago«, sagte April.
Celia nickte. »Und warum bist du dann hier«, fragte sie, »wenn nicht wegen der Partys und dem üblichen College-Kram?«
»Ich bin hier, weil das Smith College die Alma Mater von Gloria Steinem und Molly Ivins war. Ich dachte, das sei der beste Ort, um effektiv das Patriarchat in diesem gottverlassenen Land zu bekämpfen«, sagte April. Dann biss sie von ihrem falschen Speck ab und fügte hinzu: »Außerdem mag ich das Mensaessen.«
Celia fragte sich für einen Augenblick, ob sie die einzige normale Person an diesem College war. Zu Hause hatte sie immer als seltsam gegolten, weil sie im Gegensatz zu ihren Freundinnen lieber viktorianische Romane las als Gedichte von Dorothy Parker oder Frauenzeitschriften, lieber alte Technicolor-Musicals sah als moderne Filme. Aber jetzt kam sie sich vor wie Margarete Mustermann: ohne Kinderehe oder Aggressionen gegen das Establishment war man am Smith College offenbar ein Freak.
Als sie ihr Geschirr abräumten, erwähnte April, dass sie am Nachmittag noch bei einer Gruppe gegen Ausbeuterbetriebe mitmachen wolle, bevor sie zu dem Vortrag von Gleichberechtigung jetzt gehen würde. Das klang natürlich alles bewundernswert, aber Celia hätte sich am liebsten in ihr Bett verkrochen und den Rest des Tages mit Freundinnen von zu Hause telefoniert.
»Ich finde es wichtig, sich anderen zu widmen, zu helfen und zu begreifen, dass es nicht immer nur um den eigenen Mist geht«, sagte April. »Die meisten Frauen in unserem Alter heulen, weil irgendein Typ sie nicht mehr anruft, aber sie interessieren sich einen Scheiß für wahres menschliches Leid.«
Celia sagte sich, dass April ganz allgemein sprach und sich nicht unbedingt auf sie bezog. Trotzdem merkte sie, wie ihre Wangen zu brennen begannen, und verfluchte diese bescheuerte helle Haut, die ihre Gefühle verriet.
»Entschuldige«, sagte April. »Ich arbeite noch daran, die Predigerin in mir unter Kontrolle zu bringen.«
Celia lächelte. »Ist schon in Ordnung.«
Sie fragte sich, was für Freunde April zu Hause gehabt hatte.
»Sag mal, was hörst du so für Musik?«, fragte April.
»Ach, alles Mögliche. Ich mag die alten Sachen: Billie Holiday und so. In letzter Zeit gefällt mir auch Folk immer mehr, Bob Dylan und Joni Mitchell zum Beispiel.«
»Das ist doch ein Wort«, sagte April grinsend. »Ich finde beide toll. Und was ist mit Elliott Smith und Kris Delmhorst?«
»Von denen kenne ich nicht so viel«, sagte Celia, obwohl ihr die Namen in Wirklichkeit gar nichts sagten.
»Okay, alles klar, dann brenne ich dir eine CD, die dich umhauen wird«, sagte April.
Noch am selben Tag beklebte April ihre ganze Tür mit Slogans wie FEMINISMUS IST DIE RADIKALE IDEE, DASS FRAUEN AUCH MENSCHEN SIND und DEIN WORT IN DER GÖTTIN OHR. Sie schrieb ein Zitat aus Mary Poppins mit rotem Edding an die Flurwand: WENN WIR DEN MANN AUCH ZWEIFELLOS VEREHRN, WIRD ER DOCH ZUM GLÜCK IN GRUPPEN REICHLICH BLÖDE.
Celia schob noch einen Zettel unter Brees Tür hindurch: Sieh mal, was die Irre im Flur gemacht hat.
Kurz darauf kam Brees Antwort unter ihrer Tür durch: Hab ich doch gesagt: Die hat sie nicht alle!
Am nächsten Tag wollte Celia gerade zum ersten Seminar aufbrechen, als April in ihr Zimmer kam.
»Hast du was um neun?«, fragte sie.
Celia nickte.
»Ich auch. Wollen wir zusammen gehen?«
»Klar«, sagte Celia. Sie nahm ihren Rucksack, und die beiden traten zusammen in den Flur. In diesem Augenblick kamen vier Umzugshelfer mit riesigen Kisten durch die Tür zum Dienstmädchentrakt.
»Sally Werner?«, fragte einer von ihnen.
Celia zeigte auf Sallys Zimmer am Ende des Flurs.
»Sieht aus, als würde sie eine Villa beziehen«, bemerkte April.
Celia lächelte. Sie hatte ihr Outfit für den ersten Unitag irgendwann Mitte August ausgewählt: ein schwarzes Glockenkleid, darunter ein langärmeliges, lilafarbenes Oberteil, schwarze Strumpfhosen und lila Ballerinas. April trug eine Jogginghose und ein T-Shirt mit der Aufschrift DAS HAT WAS MIT SCHWARZSEIN ZU TUN, DAS VERSTEHST DU NICHT. Ihr rotes Haar hatte sie an der Luft trocknen lassen, und es lag in widerborstigen Wellen auf ihren Schultern. Celia konnte nicht anders: Sie fragte sich, was die anderen denken würden, wenn man sie zusammen über den Campus gehen sah.
Kaum hatten sie das King House hinter sich gelassen, kam eine Studentin mit einem grünem Iro die Stufen des Chapin House heruntergelaufen und rief: »Hey, April!«
»Gut siehst du aus, Miss April!«, sagte eine andere, an der sie vor der Bass Hall vorübergingen, und gab April einen dicken Kuss auf die Wange.
»Kanntet ihr euch schon vor der Uni?«, fragte Celia.
»Nein, die habe ich gestern Abend bei der Willkommensparty von Smith-Feministinnen-vereinigt-euch kennengelernt«, sagte April. »Komm doch zum nächsten Treffen mit.«
Celia lächelte schwach. An ihrer Highschool waren Mädchen wie diese die Herrscherinnen über die verqualmte Mädchentoilette und die Theater-AG gewesen, mehr nicht. Das Outfit, das sie noch vor einem Monat niveauvoll und hübsch gefunden hatte, erschien ihr plötzlich wie etwas, was man am ersten Tag der zweiten Klasse anzog. Eigentlich fehlten ihr nur noch ein Springseil und ein übergroßer Lolli.
Nach dem Unterricht ging Celia allein zum King House zurück. April hatte sie zu einem während der Mittagspause stattfindenden Vortrag von Rebecca Walker über die Überschneidungen zwischen Sexismus und Rassismus eingeladen, aber Celia wollte nur zurück in ihr Zimmer – zu der vertrauten Tagesdecke, die noch nach zu Hause roch, zu den E-Mails alter Freunde und zu ihrem Privattelefon, von dem aus sie Liz anrufen wollte, die im Nachbarhaus groß geworden war und gerade am Trinity College angefangen hatte. Das Studentenwohnheim, in dem sie sich noch am Vortag fremd und komisch gefühlt hatte, war plötzlich wie ein Refugium auf dem Campus, der überquoll von fremden Frauen und erschreckend langen Literaturlisten.
Als sie auf ihrem schmalen Flur angekommen war, standen vor Sallys Zimmer Kisten, aus denen Kleidung, Bücher und CDs quollen. Vielen der Mädchen, die aus weit entfernten Staaten und Ländern kamen, wurden ihre Sachen jetzt erst geliefert.
Aus Sallys Zimmer erklangen die Supremes, die Tür stand offen, und Celia ging hin. Seit der Hausversammlung hatte sie sich vorstellen wollen, aber Sally hatte immer mit gedämpfter Stimme am Telefon gehangen.
Sie stand in perfekten Jeans und einem schlichten grauen T-Shirt auf einem Stuhl. Hinter ihr bauschten sich lange, blumengemusterte Vorhänge im Wind. Sie brachte einen riesigen Bilderrahmen an der Wand an – mit etwa zehn zu Ovalen und Sternen geschnittenen Fotos von strahlenden, braven Mädchen, die bei der Highschool-Abschlussfeier ihr Zeugnis hochhielten oder im Bikini nebeneinander lagen. Weitere ähnliche Bilderrahmen lagen auf dem Bett und warteten darauf, aufgehängt zu werden, während sich daneben akkurat zusammengelegte Blusen, Sommerkleider und gebügelte Hosen stapelten und es aussah, als habe Sally eine J.-Crew-Filiale in ihrem Zimmer eröffnet.
»Hi«, sagte Celia, um auf sich aufmerksam zu machen.
»O Gott, entschuldige das Chaos«, sagte Sally. »Meine Sachen sind heute erst gekommen.«
»Macht doch nichts«, sagte Celia. »Woher kommst du?«
Diese Frage hatte sie in den letzten drei Tagen schon mindestens neunundfünfzig Mal gestellt. Interessierte tatsächlich irgendjemanden, wer woher kam? Aus Albuquerque oder Tokio, New Jersey oder vom Mond? Was machte das schon aus?
»Ich komme aus einem Vorort von Boston«, sagte Sally.
»Oh, ich auch«, sagte Celia. »Woher genau?«
»Wellesley. Und du?«
»Milton.« Celia dachte kurz nach und fragte dann: »Du bist nicht mit dem Auto gekommen?«
Sally schüttelte den Kopf. »Mit dem Zug. Mein Vater ist geschäftlich unterwegs, und mein Bruder ist so unzuverlässig, dass es wahrscheinlicher wäre, dass ein Einhorn mit einem Umzugswagen im Schlepptau vor meiner Haustür erscheint.«
Es entstand ein langes Schweigen, während Celia das sacken ließ und darüber nachdachte, was Sally nicht gesagt hatte. Wessen Familie lebte nur zwei Autostunden von der Uni entfernt und wollte einen nicht persönlich hinbringen?
»Das mit deiner Mutter tut mir wirklich leid«, sagte Celia. »Wenn du mal reden willst: Meine Tür ist immer offen. Und meine Mama hat meinen Schrank mit so vielen Lebensmitteln vollgestopft, die kann ich bis zum Ende meines Studiums nicht verbrauchen.«
Plötzlich fühlte sie sich schlecht, das Wort »Mama« auch nur gesagt zu haben, aber Sally lächelte und bedankte sich.
»Brauchst du Hilfe beim Auspacken?«, fragte Celia.
»Ach nein, danke«, sagte Sally. »Ich bin ein bisschen pingelig. Ich habe eine ganz genaue Vorstellung davon, wie alles sein muss. Aber wenn du Lust hast, mir Gesellschaft zu leisten, würde ich mich freuen.«
»Klar«, sagte Celia.
Auf dem Bett war kein Platz, und auch auf dem Schreibtisch und dem Stuhl stapelten sich die Kisten, also setzte Celia sich auf den Boden. Ihr fiel auf, dass jede einzelne von Sallys Kisten sorgfältig beschriftet worden war: BÜCHER, HAARPFLEGE, ORDNER UND DOKUMENTE, TURNSCHUHE, STÖCKELSCHUHE. Hatte Sally das alles selbst gemacht? Oder war es das letzte Projekt ihrer Mutter gewesen?
Sally nahm Blusen aus einem Karton auf dem Schreibtisch. Jede war einzeln in Seidenpapier verpackt.
»Es ist schön heute draußen, oder?«, fragte sie.
Celia nickte. »Immer noch ein bisschen heiß.«
»Ich war heute noch nicht vor der Tür«, sagte Sally.
»Hast du die anderen beiden auf unserem Flur schon kennengelernt?«, fragte Celia. »Bree und April.«
Sally nickte. »April ja. Wir haben die ganze erste Nacht geredet.«
Obwohl Celia die beiden nicht eingeladen hatte, sich zu ihr und Bree zu gesellen, fühlte sie jetzt einen kleinen Stich bei der Erkenntnis, dass sie von dem Gespräch ausgeschlossen gewesen war.
Sally lachte. »Ich glaube nicht, dass ich jemals weniger mit einem Menschen gemeinsam hatte, aber ich mag sie sehr. Es ist ein Klischee, aber ich hatte einfach das Gefühl, ihr alles sagen zu können.«
Mir kannst du auch alles sagen, dachte Celia, und dann merkte sie, dass sie an einem Ort um Nähe konkurrierte, an dem kaum jemand die andere länger als anderthalb Minuten kannte.
»Hast du schon entschieden, was dein Hauptfach werden soll?«, fragte Sally.
Sie war viel förmlicher als die Mädchen, die Celia hier bisher kennengelernt hatte, und stellte die Art von Fragen, die man von der Großtante einer Freundin erwartet hätte.
»Englische Literatur«, sagte Celia. »Und du?«
»Ich bereite mich aufs Medizinstudium vor. Oder werde mich vorbereiten«, sagte Sally. »Mein Hauptfach ist Bio. Ich hab’ über den Sommer ein paar Kurse gemacht, um einen Vorsprung zu gewinnen. Ziemlich spannend alles.«
Dann nahm sie eine riesige Kaffeedose aus einer rosa Einkaufstüte. »Die Asche meiner Mutter«, sagte sie und sah auf die Dose hinab.
Jesus, Maria und Josef.
Celia nickte. »Oh. Tja, wie schön, dass du sie bei dir haben kannst.«
»Ja, das war genau mein Gedanke«, sagte Sally.
Sie stellte die Kaffeedose auf den Boden des Wandschranks und schloss die Tür vorsichtig. Während sie das tat, kam Celia ein fürchterlicher Gedanke. Sie stellte sich vor, wie sie Monate später, wenn jede Spur von Unsicherheit zwischen ihnen verschwunden war und sie Freundinnen geworden waren, auf der Suche nach einem Kleid in den Wandschrank trat und geistesabwesend Sallys Mutter umstieß und die Asche sich überall verteilte, in den Dielenritzen und über Sallys makellose Schuhsammlung.
»Kennst du Jacob Wolf?«, fragte Sally. »Er war auf der Milton High.«
Celia schüttelte den Kopf. »Ich war von Anfang an auf einer katholischen Schule, das heißt –«
Das Telefon klingelte. Wäre es Celias gewesen, hätte sie es klingeln lassen, aber Sally ging ran.
Sie legte die Hand auf die Sprechmuschel. »Der Anruf muss sein«, sagte sie zu Celia. »Es ist meine beste Freundin Monica. Erwische ich dich später noch?«
»Oh, ja klar«, sagte Celia und stand umständlich auf.
»Machst du bitte die Tür hinter dir zu?«, bat Sally.
Celia sah Sally an diesem Tag nicht wieder, auch am Abend nicht. Als sie um drei Uhr nachts aufwachte und auf die Toilette ging, kam sie an Sallys Zimmer vorbei und hörte sie reden.
Celia wusste, dass es nicht in Ordnung war, aber sie legte trotzdem das Ohr an die Tür.
»Ich kann das nicht, Mon«, sagte Sally verzweifelt und mit belegter Stimme. »Ich glaube, es war ein Riesenfehler, nach allem, was passiert ist, jetzt schon herzukommen. Können wir noch ein bisschen telefonieren? Bitte leg nicht auf, meine Liebe. Bitte.«
Am nächsten Tag war die Eröffnungsfeier. Den Erstsemestern hatte man Flyer unter der Tür durchgesteckt, um sie daran zu erinnern, dass sich alle Bewohnerinnen vom King House um vier Uhr in der Lobby treffen und geschlossen zur John M. Greene Hall (natürlich JMG genannt) gehen würden.
Mittlerweile waren auch die älteren Studentinnen zurück, und die Gänge vom King House standen voller Koffer und prall gefüllter Müllsäcke mit Winterkleidung, die sie aus dem Keller geschleppt hatten.
Celia konnte sie von ihrem Zimmer aus hören. Die Studentinnen im letzten Studienjahr, von denen viele gerade erst von einem Auslandsjahr in Genf, Florenz, Sydney zurückgekommen waren, kreischten und brüllten und knutschten einander ab und klangen dabei, als hätte sie die einjährige Trennung fast umgebracht. Auch die Studentinnen, die im zweiten Jahr hier waren, waren aufgekratzt. Sie umarmten einander unnatürlich lang. Sie ließen ihre Türen offen stehen und hörten beim Auspacken Musik: die sanften Klänge von Jeff-Buckley-Songs, den Beatles und süßer, mädchenhafter Melodien, die Celia noch nie gehört hatte.
Sie blieb kurz stehen, wenn sie im Bad an einer von ihnen vorbeiging, die ihr Regalfach mit Haarbleichmittel und Tamponpackungen befüllte. Die älteren Mädchen hängten handgeschriebene Hinweise für Besucher über die Toiletten: WILLKOMMEN IN UNSEREM HAUS; BITTE DENK DARAN: ECHTE MÄNNER MACHEN DEN SITZ RUNTER. Celia hatte immer mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zusammengelebt, aber so einen gänzlich und hemmungslos femininen Ort hatte sie noch nie gesehen.
Der Tag war schwül und heiß geworden, ein Augusttag Anfang September.
Oder wie Bree es beim Frühstück ausdrückte: »Heiß wie Asphalt in Georgia.«
Einige der älteren Studentinnen liefen nur in BH und Boxershorts rum. Manche hatten wirklich wunderschöne Körper – straffe Bauchmuskeln und lange, schlanke Beine. Die meisten allerdings nicht. Sie ließen beim Aufreißen von Umzugskartons und beim Aufhängen von Vorhängen die Bäuche raushängen.
Celia sagte sich, dass sie in einem Jahr vermutlich wie sie sein würde: Dann würde sie sich hier wohlfühlen, zu Hause. Obwohl sie noch Zweifel hatte, was die Intensität der Beziehungen und das Ausmaß der Nacktheit anging. Von Strandausflügen einmal abgesehen, hatte sie selbst ihre Mutter nie in weniger als einem bodenlangen Frotteebademantel und Hausschuhen gesehen.
Um Punkt vier Uhr skandierten laute Stimmen die Haupttreppe hoch und runter und über die hellerleuchteten Flure.
»Auf zum King-House-Lauf. Auf zum King-House-Lauf. Auf! Lauf! Auf! Lauf!«
Es wurde immer lauter, bis Monstertruck Jenna mit einer Schar Mädchen auf dem Flur der Erstsemester erschien und sie eine nach der anderen aus den Zimmern holte.
Celia sah, wie auch Sally, Bree und April zur Treppe gezogen wurden, und lachte, als sich ihre Blicke trafen.
»Was zum Teufel ist das?«, fragte Bree, während sie die Treppe hinuntergetrieben wurden.
»Die Eröffnungsfeier«, sagte Sally. »Es werden Reden gehalten, es wird gesungen, und berühmte Alumni treten auf. Es ist das erste Mal, dass wir mit der ganzen Uni zusammenkommen, mit allen gleichzeitig.«
Sally machte den Eindruck eines Mädchens, das einer Studentinnenverbindung beigetreten wäre, wenn die hier nicht verboten gewiesen wären.
Im Foyer drängten sich die fünfundsiebzig Bewohnerinnen des King House, und Monstertruck Jenna verteilte Burger-King-Kronen. Ein anderes Mädchen zog violett-glitzernde Bettbezüge aus einem riesigen Pappkarton.
»Okay, Mädels«, sagte Jenna. »Es ist so weit: unsere erste Chance, allen am Smith College zu zeigen, was das neue King House ausmacht.«
»Und was steckt hinter den Kostümen?«, fragte eine Erstsemesterstudentin aus der Menge.
»Es ist Tradition, dass sich jedes Haus zur Eröffnungsfeier verkleidet«, sagte Jenna. »Wir tragen Krone und Robe, weil wir die Königinnen von King sind.«
»Hurra!«, brüllte da eine Studentin im letzten Semester namens JoAnn. Celia war ihr am Morgen beim Kaffeeholen begegnet, und für sich allein war sie ihr eher unscheinbar und zart vorgekommen. Im Kreis ihrer Freundinnen wirkte sie jetzt ganz anders.
»Nehmt euch bitte alle jeweils eine Krone und eine Robe, dann treffen wir uns in fünf Minuten wieder hier unten«, sagte Monstertruck Jenna.
»Wir sollen wieder bis nach oben in die Zimmer stiefeln, um uns eine Robe überzuwerfen?«, fragte April.
Einige ältere Mädchen fingen an zu lachen.
»Den besten Teil hast du vergessen, Monstertruck!«, rief jemand.
»Ach ja«, sagte Jenna. »Wir gehen in Unterwäsche.«
Einige der Erstis quietschten vor Vergnügen. Von anderen vernahm man ein banges Raunen.
April sagte: »Ihr wollt uns verarschen.«
»Nein, Herzchen, es ist wahr«, sagte Jenna, ging auf April zu und legte einen Arm um ihre Schulter. »Es zwingt dich natürlich niemand, aber die meisten von uns finden, dass es so mehr Spaß macht.«
Dann eilten alle die Treppe hoch. Celia hatte das Gefühl, das Blut würde schneller durch ihre Adern fließen als sonst. Sie sollte sich vor Hunderten Frauen ausziehen, die sie nicht einmal kannte? Sie packte Brees Hand in der Hoffnung, südstaatliche Sittsamkeit auf ihrer Seite zu haben – wenn jemand außer April die Sache ablehnte, würde Celia sich anschließen. Die Gründe waren nebensächlich.
»Machst du da mit?«, fragte sie Bree.
»Nicht in Unterwäsche«, sagte Bree lächelnd. »Ich glaube, ich zieh einfach einen Bikini an.«
Klar, warum auch nicht, wenn man eh wie ein verdammter Filmstar aussieht?
»Und du, Sally?«, fragte Celia, während die vier den anderen die Treppe hinauf folgten.
»Ich glaube schon«, sagte Sally. »Ja, warum nicht. Man muss mit den Wölfinnen heulen, sag ich immer.«
Mit aufgesetztem Lächeln brachte Celia nur ein »Aha« heraus.
In ihrem Zimmer angekommen, zog sie die oberste Kommodenschublade heraus und wäre fast in Ohnmacht gefallen. Sie war im Besitz einiger sexy, winziger Unterhöschen, die nur für die Augen von pubertierenden Jungs geeignet waren, die vom Anblick eines halbnackten Mädchens so überwältigt waren, dass sie ihre dicken Oberschenkel und Dehnungsstreifen gar nicht wahrnahmen. Abgesehen davon trug sie mädchenhaft gemusterte baumwollene Liebestöter. Sie seufzte und ließ die Hosen runter. Sie trug einen roten Baumwoll-BH und den Freitag aus ihrer Wochentage-Unterwäsche-Kollektion, dabei war Mittwoch. Sie sah bescheuert aus, aber auch nicht schlimmer als in den anderen Sachen, die zur Verfügung standen.