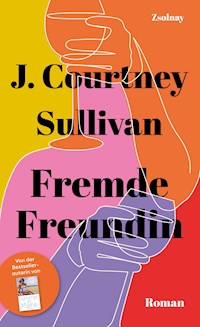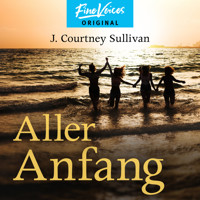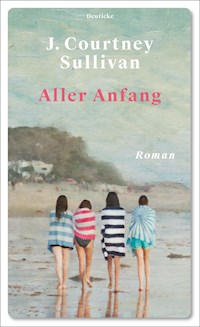20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender Roman über Familiengeheimnisse vor der atemberaubenden Kulisse Maines Auf einer abgelegenen Klippe an der Küste Maines steht ein Haus, das Geheimnisse aus einem ganzen Jahrhundert birgt. »Die Frauen von Maine« erzählt die Geschichte dieses besonderen Ortes und die Leben der Frauen, die mit ihm verwoben sind. Ein umwerfend schöner Generationenroman der amerikanischen Bestsellerautorin J. Courtney Sullivan. In ihrer Kindheit zieht es Jane Flanagan oft in das geheimnisumwitterte Haus, das einsam auf den Klippen von Maine steht. Als Erwachsene kehrt Jane in ihre Heimat zurück – nach einem schrecklichen Fehler, der ihre Ehe und ihren Beruf als Archivarin in Harvard bedroht. Erst ist sie skeptisch, als Genevieve, die neue Besitzerin des viktorianischen Hauses, sie bei den Nachforschungen zu dessen Geschichte um Hilfe bittet, doch dann erwacht ihr Spürsinn. Je tiefer sie gräbt, desto lebendiger werden die Frauen, die das Haus einst bewohnt haben, und mit ihnen ihre großen Sehnsüchte und Verluste. Und sie sind aufs Engste mit Janes eigener Vergangenheit verwoben – eine Entdeckung, die ihr Leben völlig verändert. "Die Frauen von Maine" ist ein inspirierendes Buch über Mütter, Ehen, Freundschaften und Selbstfindung. Ein Roman über die Frauen, die vor uns kamen und mit denen wir über alle Zeiten hinweg verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
J. Courtney Sullivan
Die Frauen von Maine
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Monika Köpfer und Henriette Zeltner-Shane
Klett-Cotta
Impressum
In diesem Roman kommt die Bezeichnung »Indianer« vor, die als diskriminierend und abwertend gilt und nicht mehr gebräuchlich ist. Sie wird an manchen Stellen dennoch verwendet, da sie zu der beschriebenen Zeit gebräuchlich war und dazu beiträgt, die Zeit und die Zustände zum Ausdruck zu bringen.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Cliffs«
im Verlag Alfred A. Knopf, New York
© 2024 by J. Courtney Sullivan
Für die deutsche Ausgabe
© 2024 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,
gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: © FAVORITBUERO, Buero für Gestaltung, München
unter Verwendung von © Lincoln Seligman / Bridgeman Images
© David Arsenault / Bridgeman Images
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98824-6
E-Book ISBN 978-3-608-12348-7
Für DONNA LORING,mit Dankbarkeit und Bewunderung
und im Gedenken anDEANNE TORBERT DUNNING
Prolog
Das Haus, seit Langem verlassen, hatte Geschichten zu erzählen. Das Haus war ein Widerspruch in sich selbst. Gewiss einst geschätzt und geliebt, war es jetzt dem Verfall überlassen.
Jane hatte es zunächst vom Wasser aus erblickt. Sie war damals siebzehn und erzählte den Teilnehmern einer Sonnenuntergangstour an Bord von Adams’ Hummerboot etwas über die Gegend.
Drei Monate zuvor, an einem Freitag Ende April, wurde sie zum ersten Mal ins Büro des Rektors gerufen. Mit Herzklopfen ging sie durch die verwaisten Flure. Ihre Schritte hallten auf dem Linoleumboden wider, auch wenn sie sich noch so bemühte, leise aufzutreten, und das war ihr peinlich. Damals hatte Jane die Angewohnheit, so wenig Raum wie möglich einzunehmen. Beim Gedanken an das, was sie womöglich falsch gemacht haben könnte, bekam sie rote Wangen.
Die Sekretärin, eine mollige Frau mit Kraushaar, die unter einer nackten Leuchtstoffröhre saß, grinste hinter ihrem Schreibtisch, als Jane eintrat. Aufmunternd deutete sie auf die offenstehende Tür des Schulleiterbüros, und Jane fragte sich, ob es ihr ein sadistisches Vergnügen bereitete, wenn sie durch die dünne Wand hindurch hörte, wie ein Teenager wieder einmal seine wohlverdiente Strafe bekam.
Dem Rektor gegenüber hatten Janes Englisch- und Sozialkundelehrer Platz genommen. Auch sie lächelten breit. Sie hätten sie herbestellt, sagte der Rektor, weil sie eine großartige Nachricht für sie hätten. Jane sei eine von fünfundzwanzig Prädikatsschülern im Bundesstaat Maine, die ausgewählt wurden, um an einem Sommerprogramm am Bates College teilzunehmen. Sehr prestigeträchtig, sagte er. Eine unglaubliche Gelegenheit. Das würde ihr, wenn sie sich nächstes Jahr um einen Studienplatz bewerbe, einen enormen Vorteil verschaffen. Sie habe die Gelegenheit, ein Seminar zu besuchen, das ihr auf die benötigten Scheine an einem College angerechnet würde, und könne sich in ein Thema ihrer Wahl vertiefen, und zwar auf einem Niveau, das weit über einen Leistungskurs hinausgehe. An diesem oder am nächsten Tag werde ihre Mutter einen Brief mit weiteren Details erhalten. Aber sie hätten es einfach nicht erwarten können, es Jane persönlich zu verkünden.
Janes erster Gedanke war, sie wünschte, es ihrer Großmutter erzählen zu können. Doch stattdessen ging sie nach Hause und wartete darauf, dass ihre Mutter auf den Brief zu sprechen kam.
Fünf Tage vergingen, ohne dass das Thema angeschnitten wurde. Sobald Jane nachmittags von der Schule nach Hause kam, ging sie als Erstes die Post auf dem Küchentresen durch, fand jedoch keinen Brief von der Schule. Bange malte sie sich aus, wie ihre Mutter ihn vor ihr verbarg oder ihn verbrannt oder weggeschmissen hatte.
Als Jane es nicht länger aushielt, fragte sie ihre Mutter, ob sie den Brief bekommen habe.
»Ach ja«, sagte diese in beiläufigem Ton. »Ich weiß nicht, Jane. Das kostet bestimmt einen Haufen Geld. Für mich klingt das nach einem Schwindel.«
Jane erklärte ihr, dass das Programm kostenlos sei, die Bücher, ja selbst die Busfahrten und alles andere würden bezahlt.
»Nichts ist je kostenlos, Jane. Sie nützen dich aus.«
»Inwiefern?«, fragte Jane empört.
»Du müsstest dir trotzdem einen Sommerjob suchen. Du kannst dich nicht davor drücken.«
»Habe ich mich je vor etwas gedrückt?«, sagte Jane und fügte, vor sich hinmurmelnd, hinzu: »Ich kann es nicht erwarten, von hier wegzukommen.«
»Ach ja, wo willst du denn hin? Gib mir einen Stift, dann skizziere ich eine Landkarte, und du zeigst es mir.«
Jane ging in ihr Zimmer, das sie mit ihrer älteren Schwester teilte, und schlug die Tür hinter sich zu. Holly lag auf dem Bett und blätterte in einer Zeitschrift. Sie sah nicht auf.
Janes beste Freundin Allison backte für sie Glückwunsch-Brownies und schenkte ihr ein Set mit ihren Lieblings-Tintenrollern. Die Freundschaft mit Allison bewies, dass sehr viel im Leben auf Glück hinauslief. Vermutlich hätte Allison nie einen Grund gehabt, mit Jane zu sprechen, wäre ihnen in der neunten Klasse nicht ein gemeinsamer Spind zugewiesen worden, dem Jahr, in dem Janes Großmutter gestorben und Jane mit ihrer Mutter und Schwester in deren Haus in Awadapquit gezogen war.
Davor hatten sie in einer Mietwohnung in Worcester, Massachusetts, gewohnt, zusammen mit dem Exfreund ihrer Mutter. Eine unangenehme Wohnsituation. Die beiden hatten einige Monate zuvor Schluss gemacht, aber keiner von ihnen wollte ausziehen. Jane und Holly mussten quasi auf Zehenspitzen um ihn herumschleichen, wenn er auf dem Sofa saß, das er fast rund um die Uhr für sich vereinnahmte. Zwar war ihre Mutter froh, als sie dieser Situation endlich entkommen konnte, schien aber trotzdem mit dem Haus zu hadern. Es war ein Geschenk, das sie nicht zurückweisen konnte, das sie jedoch an den Heimatort fesselte, dem sie für immer den Rücken hatte kehren wollen.
Jane war es schleierhaft, warum Allison sich bemühte, sie aus der Reserve zu locken, ihr so viele Fragen stellte und sie sogar zu sich nach Hause einlud. Alle auf der Schule kannten einander von Kindesbeinen an, schien es, und alle wollten Allisons beste Freundin oder bester Freund sein. Doch aus irgendeinem Grund entschied sie sich ausgerechnet für Jane, den Nerd, die Neue, die schon morgens an der Bushaltestelle Romane las, nicht nur, weil sie Romane liebte, sondern auch um zu vertuschen, wie einsam sie war.
Allisons Eltern hatten ein gutgehendes Bed and Breakfast. Sie saßen in jedem Gremium, jedem Komitee des Städtchens. Dienstagabends luden sie zu Bingo-Abenden im Feuerwehrhaus ein und halfen im Winter beim Pfannkuchen-Frühstück in der Schule mit. Allisons Vater trainierte eine Baseball- und eine Hockey-Mannschaft. Sie waren überaus aktiv. Und dennoch gaben sie sich immer erfreut, Jane zu sehen. Sie erkundigten sich nach ihrer Familie, vor allem Betty, Allisons Mutter, die im Gegensatz zu Janes eigener Mutter stolz auf sie zu sein schien.
In den drei Jahren, die sie einander schon kannten, hatte Jane öfter bei Allison zu Hause zu Abend gegessen als bei sich zu Hause. Nie hielten sie sich bei Jane zu Hause auf, eine unausgesprochene Abmachung, für die sie zutiefst dankbar war.
Ihre Mutter behauptete immer, überlastet zu sein, wobei Jane schleierhaft war, wovon. Anscheinend war sie unfähig, mit den Anforderungen des Lebens zurechtzukommen, die andere Erwachsene ganz selbstverständlich meisterten. Wenn die Leute sie fragten, welchen Beruf ihre Mutter ausübe, log Jane. Sie sagte, ihre Mutter sei Buchhalterin, denn das war sie tatsächlich einmal gewesen, wenngleich vor vielen Jahren, in einer Zeit, an die sich Jane nicht erinnern konnte. Noch immer redete ihre Mutter bisweilen davon, als könnte sie ihren früheren Beruf jederzeit wieder aufnehmen.
Ihr gegenwärtiger Job, sofern man es so nennen konnte, bestand darin, dass sie Garagen-Flohmärkte abklapperte, um die Sachen, die sie dort aufstöberte, anschließend mit einem winzigen Gewinn wiederzuverkaufen. Samstags und sonntags ging sie auf Stöbertour. Am Montag brachte sie ihre Schätze dann zu verschiedenen Secondhandläden und Händlern, in der Hoffnung, Profit zu machen. Den Rest ihrer Zeit verbrachte sie damit, auf dem schnurlosen Apparat mit dem jeweiligen Mann zu telefonieren, den sie gerade datete, Bier dabei zu trinken und in der Zeitung die Termine der kommenden Flohmärkte einzukringeln. Oder am Küchentisch den Plunder, den sie gekauft hatte, zu sortieren.
Das Zeug, das sie nicht verkaufen konnte, hortete sie in Küche und Wohnzimmer, sodass alles heillos vollgestopft wurde. Jede Arbeitsfläche war zugestellt mit Schüsseln voller alter Wahlkampf-Buttons, Ohrclips, Baseballkarten, Batterien und Netzkabeln, die zu keinem Gerät passten. Auf dem Rasen vor dem Haus lagerten unter blauen Plastikplanen dreibeinige Couchtischchen und Fahrräder ohne Ketten und weiß Gott, was noch alles.
An ihrem ersten Tag begleitete Allison sie mit dem Bus nach Bates, weil Jane so aufgeregt war. Danach absolvierte sie jeden Werktag allein die neunzigminütige Busfahrt zu dem vornehmen Campus mit den roten Backsteingebäuden und dicht belaubten Bäumen. Auf der ganzen Strecke hin und zurück las Jane, und ein so intensiver Stolz erfüllte sie, dass sie bisweilen fürchtete, andere könnten es wahrnehmen wie einen Geruch.
Sie hatte sich für das Seminar mit dem Titel »Frühe Schriftstellerinnen« entschieden. Die Dozentin, eine Frau um die sechzig mit Bubikopf, schrieb in der ersten Stunde an die Tafel: Die meisten Leben gehen an die Zeit verloren. Sie nannte die Namen von Frauen aus der Vergangenheit, bis ins sechzehnte Jahrhundert zurück, die ihre Lebensgeschichten zu einer Zeit aufgeschrieben hatten, als es für Frauen verpönt war, überhaupt zu schreiben. Indem sie das taten, lebten sie in ihren Werken fort.
Dieser Gedanke gab Jane Auftrieb. Sie verschlang die Gedichte von Lucy Cavendish und die detailreichen Tagebücher von Anne Clifford.
In ihrer vierten Woche des Sommerprogramms gab es mittwochnachts ein schweres Gewitter. Jane liebte Blitz und Donner. Das Bettlaken über den Kopf gezogen, las sie bis Mitternacht und lauschte dem Regen. War glücklich. Zweimal fiel der Strom aus, ging aber kurz darauf wieder an.
Am nächsten Morgen sah sie auf dem Weg zur Bushaltestelle mehrere umgestürzte Bäume, die dem Unwetter zum Opfer gefallen waren. Aber der Himmel war strahlend blau, als hätte es nie ein Gewitter gegeben.
An diesem Morgen kam sie recht früh in Bates an. Auf dem Weg zum Klassenzimmer hörte sie, wie ihre Dozentin mit jemandem redete.
»Dieses Mädchen, Jane, ist viel klüger und neugieriger als die meisten meiner Studenten im zweiten und dritten Studienjahr«, sagte sie. »Aber alle Schülerinnen und Schüler in meinem Seminar beeindrucken mich. Ich bin froh, dass ich mich dazu bereit erklärt habe, es zu halten. Es geht dabei ja darum, Jugendlichen aus prekären Verhältnissen mit guten schulischen Leistungen die Möglichkeit zu geben, rechtzeitig College-Luft zu schnuppern, sodass sie hoffentlich die Ersten in ihrer Familie sind, die ein Studium absolvieren. Die den Teufelskreis durchbrechen.«
Davon hatte niemand ein Wort zu Jane gesagt. Am liebsten hätte sie dieser Aussage widersprochen, der Dozentin mitgeteilt, dass sie falschliege, von ihr eine Erklärung verlangt, inwiefern sie als jemand identifiziert worden war, der aus prekären Verhältnissen stammte. Aber sie kannte die Antwort natürlich. Sie hatte eine alleinerziehende Mutter mit einem Alkoholproblem und notorischen Geldnöten. Und eine ältere Schwester, die es in die Abendnachrichten geschafft hatte, weil sie betrunken mit anderen Jugendlichen ein Boot gestohlen hatte, ein Vorfall, an den sich Holly, als sie am nächsten Morgen in einer Gefängniszelle aufgewacht war, nicht erinnern konnte, wie sie felsenfest behauptete.
Jane hatte gedacht, ihre Teilnahme an diesem Sommerprogramm sei Beweis dafür, dass sie es geschafft hatte, sich von ihrer Familie abzuheben. Doch nun wurde ihr klar, dass das Gegenteil der Fall war. Die Familie, aus der sie stammte, definierte sie, und das würde immer so sein.
An diesem Nachmittag las sie im Bus nicht, sondern starrte die ganze Zeit aus dem Fenster. Das Allerschlimmste wurde ihr erst da bewusst: Ihre Mutter wusste, warum Jane ausgewählt worden war. Deswegen hatte sie den Brief nicht erwähnt. Plötzlich fühlte sich Jane schuldig dafür, dass sie ihre Mutter in eine Lage gebracht hatte, in der ihr Scheitern ihr wie ein Spiegel vorgehalten wurde. Und sie war wütend auf ihre Mutter, weil sie eine solche Versagerin war.
Zu Hause stellte sie sich unter die Dusche und weinte, bis nur noch kaltes Wasser kam. Dann zog sie die Uniform für ihren Abendjob an – Khakihose und weißes Button-down-Hemd. Wie immer traf sie fünf Minuten vor dem Ablegen des Sieben-Uhr-Cocktail-Ausflugsboots am Kai ein und begrüßte Abe, ihren Chef, mit einem Lächeln.
In den beiden vorangegangenen Sommern hatte Jane tagsüber gearbeitet und Kinderwagen schiebende und mit Sonnencreme und Kaffeebechern bewaffnete Eltern willkommen geheißen, während diese mit ihrem aufgeregten Nachwuchs an Bord gingen. Jane sprach fröhlich in ein knacksendes Kabelmikrofon, sprudelte viermal täglich die gleichen Informationen hervor und erhielt jedes Mal nahezu identische Reaktionen von den Touristen.
Zum Beispiel sagte Jane: Awadapquits Fußgänger-Zugbrücke ist die einzige ihrer Art in den Vereinigten Staaten. Woraufhin die Passagiere einander zunickten – hm, interessant.
Oder sie sagte: Früher gab es so viele Hummer in Maine, dass Häftlinge sie zu jeder Mahlzeit bekamen. Fortschrittliche Reformer wetterten gegen diese Gepflogenheit, nannten sie grausam. Und so darf per Gesetz bis zum heutigen Tag Gefängnisinsassen nur noch zwei Mal die Woche Hummer vorgesetzt werden. Auf diese Information hin lachten die Passagiere leise in sich hinein, hatten sie selbst doch gerade erst fast zwanzig Dollar für ein gekochtes Exemplar und ein Viertelpfund Hartschalenhummer hingeblättert.
Wenn sich das Boot weit genug von der Küste entfernt hatte, holte Abe eine seiner Fallen ein, und Jane zog das beeindruckendste Exemplar hervor und hielt es hoch, sodass alle es sehen konnten. Sie wedelte mit der glitschigen Kreatur mit ihren sich krümmenden Beinen und Antennen vor den Augen der Kinder. Manche von ihnen wollten den Hummer unbedingt anfassen, andere kreischten und drückten das Gesicht an die Brust der Mutter. Eine andere Reaktion gab es nicht.
Weil Jane in diesem Sommer tagsüber Seminare besuchte, hatte ihr Abe die begehrte Abendtour angeboten, bei der es mehr Trinkgeld gab und weder Hummer noch Kinder an Bord waren. Stattdessen nippten Paare aus durchsichtigen Plastikbechern an ihren schwachen Wodka-Cranberry-Cocktails, und Abe hielt sich nahe der felsigen Küstenlinie, damit sie die größten ans Ufer grenzenden Anwesen bestaunen konnten sowie die etwas weiter zurückversetzten, die hinter Bäumen und langen gewundenen Zufahrten versteckt und nur von einem Boot aus zu sehen waren. An diesem Abend färbte sich der Himmel fünfzehn Minuten, nachdem sie abgelegt hatten, atemberaubend orange, und Jane konnte den Gedanken an das, was die Dozentin gesagt hatte, noch immer nicht abschütteln.
Trotzdem spulte sie ihr Programm wie gewohnt ab.
Wie jeden Abend lenkte sie die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörerschaft auf eine winzige Insel, ungefähr eine Viertelmeile vor den Klippen, wo Seehunde auf den Felsen ausruhten. Der geografische Name war Saint George’s, aber Jane hatte noch nie gehört, dass jemand sie so nannte. Die Insel schien einfach nicht groß genug zu sein, um einen Namen zu haben. Bei starkem Sturm verschwand sie gänzlich unter den Wellen.
»Die Insel zu Ihrer Linken wurde vom britischen Forschungsreisenden Archibald Pembroke, der diesen Teil der Welt 1605 entdeckte, Saint George’s getauft«, erklärte sie.
Jane war sich nicht ganz sicher, ob das stimmte. Irgendwann einmal hatte sie eine Karte von Pembrokes Reise gesehen, und der zufolge lag der weiteste Punkt, bis zu dem er gekommen war, etwa dreihundert Meilen südlich. Sie hatte Abe danach gefragt, und der meinte, Pembroke sei möglicherweise an verschiedenen Orten angelandet. Jane vermutete, Abe wollte der Sache nicht weiter auf den Grund gehen, weil er dann womöglich das Skript für seine Tour ändern müsste.
Ob Pembroke nun seinen Fuß in diese Gegend gesetzt hatte oder nicht, jedenfalls hatte der örtliche Geschichtsverein, die Antiquarian Society, 1930 auf der Insel zum 325. Jahrestag seiner Entdeckungsreise einen kleinen Gedenkstein errichtet.
Der Stein stand noch immer dort. Aus dieser Entfernung wäre er von den natürlichen Felsen nicht zu unterscheiden gewesen, wäre nicht er allein ständig einem Sperrfeuer aus Möwenausscheidungen ausgesetzt gewesen, die sich wie weiße Farbe darüber ergossen und die Inschrift unlesbar gemacht hatten.
Als Jane jetzt den Gedenkstein gegenüber den Passagieren erwähnte, stieß eine Frau in der vordersten Reihe ihren Mann mit dem Ellbogen an und deutete in die andere Richtung, zu den Klippen.
»Beim Anblick von dem da krieg ich Gänsehaut.«
Ihre Stimme war so laut, dass Jane innehielt und sich zu der Stelle umdrehte, zu der die Frau gedeutet hatte. Ihre Augen ahnten, was sie erwartete, wusste sie doch, was gegenüber der Insel zu sehen war – eine Felszunge, auf der zwei riesige Kiefern standen und die auf dramatische Weise spitz ins Meer ragte, während die Klippen zu beiden Seiten von Hecken überwuchert waren.
Doch einer der Bäume war vom Sturm gefällt worden. Die Wurzeln ragten wie lange Finger in die Luft. Durch die Lücke, die er hinterlassen hatte, konnte Jane ein Haus erkennen, sehr alt, mit blasslila Mauern, Türmchen und einer umlaufenden Stuckleiste, die an manchen Stellen grün, an anderen blau gestrichen war. Ein Fensterladen im ersten Stock hing nur noch an einem Scharnier. Das Fenster daneben war zerbrochen. Eine weiße Gardine blähte sich im Wind.
Die Frau hatte recht. Das Haus war unheimlich. Sofort spürte Jane den Drang, hinzugehen und es zu erkunden. Sie fühlte sich von verlassenen Orten magisch angezogen. Orte, wo man noch das Leben spüren konnte, das einmal dort stattgefunden hatte, jetzt aber nicht mehr. In New England gab es unzählige solcher Orte. Fabriken mit zugenagelten Fenstern und Türen und ehemalige staatliche Irrenanstalten. Ein aufgegebener Vergnügungspark, wo sie und ihre Schwester einmal die Sprossen der Wasserrutsche bis ganz oben hinaufgeklettert waren.
Jane betrachtete sich als überaus gesetzestreu. Nie würde sie in einem Laden etwas stehlen, ja nicht einmal bei Rot über eine Ampel gehen. Sie hatte noch nie auch nur einen Schluck Bier getrunken. Aber unerlaubt in solche Gebäude einzudringen, fühlte sich für sie nicht wie eine Straftat an. Vielmehr, als würde sie etwas, das einmal existiert hatte, ihren Respekt erweisen.
***
Als sich Jane am nächsten Morgen fürs College fertig machte, dachte sie wieder an das lila Haus und dass es niemand bemerken oder interessieren würde, wenn sie dieses eine Mal nicht nach Bates führe.
Ihre Mutter schlief auf dem Sofa, der Fernseher eingeschaltet, auf dem Couchtisch vier leere Bierdosen. Jane hatte sie spät nach Hause kommen hören.
Sie betrachtete sie einen Moment lang. Sie war noch immer schön, aber nicht auf eine Weise, wie eine Frau ihres Alters es sein sollte. Sie trug die gleichen tief ausgeschnittenen Tops und Push-up-BHs wie die zwanzigjährigen Mädchen, die in Charlie’s Chowder House hinter der Bar standen. Sie benutzte zu viel Eyeliner und rosa Lippenstift und rauchte, was ihre Haut kreppig hatte werden lassen.
Nicht zum ersten Mal malte sich Jane ein Freaky-Friday-Szenario aus, wie in dem Film Ein voll verrückter Freitag, bei dem ihre Mutter mit Betty Crowley, Allisons Mom, die Rollen tauschte. Dann könnte Jane endlich einmal erleben, wenn sie eines Morgens aufwachte, wie sie in einem geschmackvollen Sommerkleid und Dr.-Scholl-Sandalen am Herd stünde und Spiegeleier briete.
Ihre Mutter bewegte sich.
Jane schnappte sich schnell den Rucksack und ihr Fahrrad und fuhr los.
Sie radelte die Shore Road entlang und fuhr vorsichtig in jede private Zufahrtsstraße hinein, um, wenn etwas darauf hindeutete, dass das Anwesen bewohnt war – etwa ein Kombi oder eine Frau, die sich im Garten zu schaffen machte –, schnell umzudrehen und es bei der nächsten Einfahrt zu versuchen. Das lila Haus konnte unmöglich bewohnt sein.
Nachdem sie vierzig Minuten lang gesucht hatte, fand sie es. Zuerst verpasste sie die Abzweigung. Ein verrosteter Briefkasten an der Ecke der Küstenstraße war der einzige Hinweis darauf, dass da überhaupt ein Haus war. Jane folgte einem langen Schotterweg unter einem schattigen Dach aus Baumkronen, bis sie auf einem großen offenen Grundstück direkt auf der Klippe, mit Blick aufs Meer, anlangte. Und da war das lila Haus und daneben eine Scheune in der gleichen Farbe. Der ehemalige Rasen war jetzt eine wild wuchernde Wiese. Die Rhododendren vor dem Haus reichten bis zu den Fenstern im ersten Stock und bildeten eine blickdichte Hecke.
Jane verspürte einen herrlich kindischen Nervenkitzel, so als könnte jeden Moment jemand hinter den Bäumen auftauchen. Eine Angst, die sie elektrisierte, obwohl sie wusste, dass keine Gefahr drohte.
Sie stieg zur vorderen Veranda hinauf und achtete darauf, auf keines der verrotteten Bretter zu treten. Neben der Tür befand sich eine Tafel mit dem Namen des ersten Besitzers und dem Datum, wann es erbaut worden war: 1846. Jane spähte durch ein Fenster ins Wohnzimmer. Fast an jeder verfügbaren Stelle an den Wänden hing ein abstraktes Gemälde. Über dem Kamin befand sich ein Porträt mit zwei säuerlich dreinblickenden jungen Frauen. Auf einem eleganten Teppich standen zwei zusammenpassende grüne Samtsofas. In der Ecke ein Puppenhaus.
Durch ein Fenster auf der anderen Seite der Haustür sah sie einen Esstisch mit Stühlen und einen Kristallkerzenleuchter darauf. Auch die Diele konnte sie ausmachen. Das Geländer vom Flur im ersten Stock war heruntergefallen und lag wie ein Bahngleis auf dem Boden. Ein deckenhohes Wandgemälde zeigte einen Sonnenuntergang über dem Ozean.
Jane spazierte eine Weile auf dem Anwesen herum. Auf einer Seite des Hauses gab es eine Kieferngruppe, an deren hinterem Ende sie einen kleinen Friedhof entdeckte – nur eine Handvoll Gräber, die Grabsteine alt und zerbröckelnd.
Irgendwann setzte sie sich mit dem Rücken zu der umgestürzten Kiefer auf den grasbewachsenen Felsvorsprung, der wie ein dicker Daumen ins Meer ragte, und überließ sich der Aussicht auf die Insel, St. George’s, direkt gegenüber im Meer. So nah, dass sie hätte hinüberschwimmen können. Jane fuhr mit den Händen über das Wurzelgeflecht. Sie dachte, dass ein umgestürzter Baum etwas Trauriges und zugleich Heiliges hatte. Was ein solcher Baum nicht schon alles erlebt hatte!
Jane kramte ein Buch aus ihrem Rucksack hervor und begann die ihnen für den kommenden Tag aufgegebene Lektüre. Sie blieb den ganzen Nachmittag. In den folgenden Wochen las sie jeden Titel, der auf dem Lehrplan stand, auf diese Weise: Sie saß im Gras vor dem lila Haus, bis es an der Zeit war, für ihren Abendjob nach Hause zu radeln. Nach Bates ging sie nicht mehr.
Als Jane Allison mitnahm, um ihr das Haus zu zeigen, hatte sie bereits herausgefunden, dass die Hintertür nicht verschlossen war. Durch die Gesellschaft ihrer Freundin ermutigt, wagte sie sich zum ersten Mal hinein.
»Ich kann es kaum erwarten, in den ersten Stock hinaufzugehen«, sagte Jane. »Aber ich hatte Angst, dass der Boden zu morsch ist und ich mir die Beine breche.«
»Und dass ich dabei bin, macht das weniger wahrscheinlich … irgendwie?«, erwiderte Allison.
»Nein, aber du könntest wenigstens Hilfe holen.«
»Könnte sich als die schlechteste Idee erweisen, die du je hattest.«
Allison folgte Jane dennoch hinein, und gemeinsam machten sie sich daran, sämtliche Küchenschränke zu öffnen. Sie waren voller Geschirr, alles ordentlich gestapelt. Da waren Lebensmittel, deren Haltbarkeitsdatum 1968 abgelaufen war, also vor fünfundzwanzig Jahren. Tiere hatten sich durch die Kartons mit Haferflocken und Reis und Dosen mit Kaffee und Keksen genagt. Die Schränke waren von Tierexkrementen und zerfetztem Papier und Bröseln übersät.
In der Vorratskammer neben der Küche reihten sich in den Regalen Kristall- und Glasgegenstände jeder erdenklichen Form und Größe – Schüsseln und Kelchgläser und Platten und Salzstreuer.
»Puh, irgendwie ist es gespenstisch hier«, sagte Allison. »Ganz unheimlich, lass uns wieder rausgehen.«
»Nein, komm bitte zuerst noch mit nach oben«, erwiderte Jane, aus irgendeinem Grund flüsternd.
»Und was, wenn wir beide durch die Decke krachen und uns die Beine brechen?«, sagte Allison, während sie in die Diele hinausgingen, wo das hölzerne Treppengeländer von oben auf dem Boden lag.
Daran hatte Jane noch gar nicht gedacht. Sie wagten sich trotzdem nach oben. Nur die unteren Elemente der Geländersprossen waren stehen geblieben, zerklüftete, zersplitterte Stümpfe. Der Flurboden war mit Murmeln und Glasscherben bedeckt.
»Was zum Teufel ist das denn …«, sagte Allison.
Sie betraten eines der Schlafzimmer. Das Bett war ungemacht. In den Schränken hingen Kleider. Auf einem Nachttisch lag ein aufgeschlagenes Hardcover und auf dem Boden ein Stapel Life-Magazine.
Der Hausbesitzer musste ganz plötzlich gestorben sein. Aber warum war seitdem niemand mehr hier gewesen? Die Worte ihrer Professorin hallten in Janes Kopf wider: Die meisten Leben gehen an die Zeit verloren.
»Ich kann nicht glauben, dass du allein hierhergekommen bist«, sagte Allison. »An diesem Ort herrscht eine gruselige Energie, spürst du es nicht auch?«
Nein. Im Gegenteil spürte Jane hier einen Frieden wie seit dem Tod ihrer Großmutter nicht mehr. Fühlte sich irgendwie behütet.
Wie die meisten Dinge, in denen sie und Allison sich unterschieden, schob sie es auch diesmal auf eine Unzulänglichkeit ihrerseits. Vielleicht fühlte es sich für sie nicht gruselig an, weil die Alternative zu diesem Ort ihr Zuhause war – das laut und überfüllt und unvorhersehbar war. Also das genaue Gegenteil von diesem.
Das kleine Häuschen ihrer Großmutter zwang ihr eine ungewollte Intimität mit ihrer Mutter und Schwester auf. Überall im Haus konnte man den Fernseher, das Brummen des Kühlschranks, Telefongespräche und alle möglichen Badezimmergeräusche hören. Wenn ihre Mutter Speck briet, haftete der Rauchgeruch tagelang ihren Anziehsachen an.
Nur einmal machte sie den Fehler, ihre Schwester in das lila Haus mitzunehmen. Während sie nebeneinander auf dem Felsvorsprung saßen, sagte Holly ein ums andere Mal, wie cool es sei, dass man trotz der Entfernung die Stadt sehen, aber von dort aus niemand sie erkennen könne. Da wurde Jane klar, dass sie sich genauso seit jeher in Awadapquit gefühlt hatte.
Als Holly abends gegenüber ihrer Mutter das Haus erwähnte, erwiderte diese barsch: »Lasst euch ja nicht dabei erwischen, dass ihr noch mal dort hinausfahrt, habt ihr verstanden?«
Sie machte dabei ein Gesicht, als hätte es Jane in der Absicht getan, sie zu verletzen.
»Warum denn nicht?«, fragte Holly.
»Lasst es einfach bleiben, okay?«
Jane glaubte nicht, dass sie es aus einem bestimmten Grund verboten hatte. Es sah ihrer Mutter einfach ähnlich. Sie nörgelte an allem herum, was Jane tat. Oder aber sie malte sich im Geiste wilde Partys in dem verlassenen Haus aus, Dinge, die sie selbst an einem solchen Ort anstellen würde.
Jane ignorierte ihr Verbot. Sie fuhr wieder hin, den ganzen Herbst und Winter ihres letzten Schuljahrs hindurch, und auch im folgenden Sommer. Manchmal mit Allison, weil sie sich dort ungestört unterhalten konnten. Aber inzwischen hatte Allison einen Freund, Chris. Also fuhr Jane meistens allein. Um dort in Ruhe zu lesen, den diversen Dramen, die sich zu Hause abspielten, zu entkommen, den Ozean zu betrachten. Natürlich wusste sie, dass das verlassene Anwesen nicht ihr gehörte, aber es fühlte sich dennoch so an.
Im darauffolgenden September zog Jane aus Maine weg, um aufs College zu gehen, und vergaß mit der Zeit das lila Haus. Selbst wenn sie in den Ferien nach Hause kam, fuhr sie nicht mehr hinaus. Erst als sie David kennenlernte, erinnerte sie sich wieder daran und fragte sich, ob inzwischen jemand das Haus gekauft hatte, falls es überhaupt noch stand.
Zunächst besuchte Jane die Wesleyan University in Connecticut, um dort ihr Bachelor- und Masterstudium zu absolvieren. Dort wurden ihr die Augen für ererbten Reichtum geöffnet, las sie George Eliot und Virginia Woolf und Shakespeare, lernte sie Bourbon und Rotwein kennen und lieben und gewöhnte sich an, jeden Abend zu trinken. Allerdings nicht so wie ihre Mutter, denn im Gegensatz zu ihr konnte Jane aufhören, bevor die Sache aus dem Ruder lief. Meistens jedenfalls.
Für ihre Promotion ging sie nach Yale. Im Anschluss daran arbeitete sie zuerst als Assistentin am Emily Dickinson Museum in Amherst, Massachusetts, und dann als angehende Archivarin in der Abteilung für Sondersammlungen am Wellesley College. Mit achtundzwanzig bekam sie ihren Traumjob angeboten, in der Schlesinger-Bibliothek für die Geschichte der Frauen in Amerika am Harvard Radcliffe Institute in Cambridge.
Zwar hatte Jane Freunde und ging unter Leute, aber sie war immer noch eine sehr unabhängige Person. Sie zog es vor, allein in einem kleinen Apartment zu wohnen, statt Mitbewohner zu haben. Sie aß jeden Abend auswärts, setzte sich allein, nur mit einem Buch, an die Bar, selbst samstagabends. (»Das könnte ich nie und nimmer«, sagte Allison, als Jane es ihr erzählte.) Als sie genug Geld gespart hatte, brach Jane allein zu einer Reise durch Frankreich und Spanien auf und war froh, keine Rücksicht auf die Sightseeing-Wünsche von Reisegefährten nehmen zu müssen.
In ihren Zwanzigern fing sie gelegentlich etwas mit einem Mann an, doch meistens machte sie schlechte Erfahrungen, die nur durch ausreichende Mengen Alkohol zu ertragen waren. Ein paar Mal wachte sie im Bett eines Fremden auf und wusste nicht mehr genau, wie sie dorthin gelangt war. Das gab ihr zu denken. Aber sie war jung, fühlte sich frei. Die meisten jungen Menschen waren doch so, sagte sie sich. Andererseits fehlte Jane keinen einzigen Tag in der Arbeit oder kam je zu spät. Nie hatte sie einen solchen Kater, dass sie am nächsten Morgen nicht drei Meilen hätte joggen können. Daraus schloss sie, dass sie alles unter Kontrolle hatte.
Mit siebenundzwanzig hatte sie eine ernste Beziehung mit einem Chefkoch namens Andre. Er war sexy und lustig, aber wenn sie mit ihm zusammen war, ertappte sich Jane dabei, dass sie sich genau wie ihre Mutter benahm. Das alarmierte sie, war es doch ihre größte Angst. Für manche Leute war der Satz Was würde Jesus tun der oberste Leitsatz. Ihrer lautete: Was würde meine Mutter nicht tun? Und doch entstand zwischen ihr und Andre, während sie bis spätnachts in Bars abhingen und zu viele Tequilas tranken, schnell eine sich falsch anfühlende Nähe. Sechs Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, zog Jane zu ihm, obwohl sie sich unentwegt stritten. Drei Monate später zog sie wieder aus. Eine explosive Abschiedsszene, bei der reichlich Alkohol im Spiel war, endete damit, dass Andre zu schluchzen begann, als Jane drohte, seinen geliebten Teddybär anzuzünden.
Nachdem sie Schluss gemacht hatten, war sie am Boden zerstört. Dieses Gefühl hatte sie noch nie zuvor erlebt, und doch war es ihr vertraut. Jede weitere Liebesaffäre hatte ihre Mutter, wenn sie zu Ende ging, beschädigt und in ihrem Leben zurückgeworfen. Also beschloss Jane, es sei am sichersten und am klügsten, allein zu bleiben. Zu versuchen, gar nicht erst in dieses Fahrwasser zu geraten. Am liebsten mochte sie sich kontrolliert, gefasst, unverletzlich. Eine solche Frau wollte sie sein.
Mit David hatte Jane nicht gerechnet.
Sie lernten sich ein paar Monate vor ihrem dreißigsten Geburtstag kennen. Ihre Vorgesetzte in der Schlesinger-Bibliothek, Melissa, verkuppelte sie. Da Jane zu ihr aufsah, vertraute sie voll und ganz ihrem Urteil. David war ein guter Freund von Melissa. Er war Ökonomieprofessor und vier Jahre älter als Jane.
»Mit ihm machst du einen guten Fang, du wirst sehen«, sagte Melissa vor ihrer ersten Verabredung. »Wäre ich hetero, wäre er einer von den drei Männern auf dem Planeten, die ich in Betracht ziehen würde. Er ist nett und humorvoll. Er ist Marathon-Läufer. Liebt Kinder. Und, Jane, er backt, um Stress abzubauen. Im Ernst, David ist die männliche Version von Pearl.«
Pearl war Melissas Frau, eine engagierte, viel beschäftigte Sozialarbeiterin, die dennoch das Leben zu genießen verstand, wie nur wenige Menschen es vermochten. Jedes Jahr richteten die beiden Frauen eine Weihnachtsparty in ihrem Haus in Jamaica Plain aus. Jane liebte die wohlige Atmosphäre dort. Es war weder vollgestopft noch angeberisch, sondern einfach gemütlich und herzlich und anheimelnd und schön eingerichtet. Ein Haus, das Zufriedenheit ausstrahlte.
»Aber sei bitte lieb zu ihm«, sagte Melissa. »David hat schon allerlei durchgemacht. Seine Exfrau hatte eine Affäre. Sie hat ihn unentwegt angelogen. Er wusste es, schien es aber nicht wissen zu wollen. Bis ihm alles um die Ohren flog. Es war ein Albtraum.«
»Der Arme«, sagte Jane, dachte jedoch: Hilfe, beschädigte Ware.
Doch tatsächlich entpuppte sich David als genau so, wie Melissa ihn beschrieben hatte. Und er sah gut aus. Mit seinem fransigen blonden Haar und versonnenen Lächeln erinnerte er Jane an Robert Redford in So wie wir waren. Es stimmte, er war ein guter Fang, und Jane fühlte sich geehrt, weil Melissa sie offenbar als seiner würdig erachtete. Doch dahinter verbarg sich ein fast schon selbstzerstörerischer Gedanke: dass Jane sie beide ausgetrickst hatte, dass sie in Wahrheit die beschädigte Ware und es nur eine Frage der Zeit war, bis David es bemerkte.
Fast von Anfang an verbrachten sie jede freie Minute zusammen, abwechselnd mit Sex, Nickerchen und Spaziergängen am Charles River, in stundenlange Gespräche vertieft. Davids Wohnung war voller vom Boden bis zur Decke reichender Regale, jeder Zentimeter davon mit Büchern gefüllt. Jane liebte es, nach und nach die Rückentitel zu lesen und ihn so immer besser kennenzulernen. Manchmal fragte sie sich, wie viele dieser Bücher seiner Exfrau gehört hatten. Sie war auf irrationale Weise eifersüchtig auf diese Frau, die sie nie kennengelernt hatte, weil sie mit ihm hatte zusammenleben dürfen. Aber sie war ihr auch dankbar dafür, dass sie ihn freigegeben hatte.
An manchen Samstagen verließen David und Jane erst gegen vier Uhr nachmittags das Bett, wenn ihnen plötzlich klar wurde, dass sie einen Riesenhunger hatten. Dann gingen sie in ein französisches Bistro an der nächsten Straßenecke und aßen Cheeseburger und Schokokuchen und tranken eine Flasche Wein, als müssten sie sich für die Überwinterung Speck anfuttern. Bei solchen Gelegenheiten sah sich Jane um, beobachtete sich anschweigende Paare, die mit ihren Handys beschäftigt waren, oder sich streitende Eltern kleiner Kinder oder hie und da zwei junge, unbeholfen wirkende Menschen, die sich offensichtlich zum ersten Mal trafen. Sie alle taten ihr leid. Gewiss harmonierte keiner von ihnen – vielleicht sogar kein anderer Mensch auf der ganzen Erde – so gut mit dem jeweiligen Partner oder der Partnerin wie sie.
An Thanksgiving, nur drei Monate nachdem sie sich kennengelernt hatten, wollte David, dass sie ihn ihrer Familie vorstellte. Jane schlug mehrere Alternativprogramme vor – Thanksgiving in der Karibik! Thanksgiving in New York! –, aber er ließ nicht locker. Als sie endlich zustimmte, backte er in Nullkommanichts einen Kürbiskuchen, damit sie es sich in letzter Sekunde nicht noch anders überlegen konnte.
Auf der Fahrt nach Maine verfolgte sie hartnäckig ein Gedanke: Jetzt wird er dein wahres Ich kennenlernen.
Während sie im Stau standen, erzählte Jane ihm von früheren Thanksgivings bei ihr zu Hause.
Zum Beispiel dem, als sie und Holly noch klein waren und ihre Mutter schon mittags volltrunken auf dem Sofa lag und sie sie mit Federboas und Glitzeraufklebern schmückten und dann mit einer Einwegkamera Fotos von ihr machten, bis ihre Großmutter sie dabei ertappte und sie ermahnte, es bleiben zu lassen.
Oder dem Jahr, in dem ihre Mutter an Thanksgiving mit ihrem nichtsnutzigen Freund in Streit geraten war, während sie alle im Fernsehen die Macy’s Parade in New York ansahen. Irgendwann stand er auf, sie dachten, um pinkeln zu gehen, aber tatsächlich, um sie zu verlassen. Aus unerfindlichen Gründen nahm er den Truthahn samt Bratpfanne mit. Sie sahen ihn nie wieder. Janes Mutter verbrachte den Rest des Tages im Bett. Jane und Holly aßen getoastete Waffeln mit Kartoffelpüree und Truthahnfüllung und sahen sich ein Video mit Eine verhängnisvolle Affäre an. (»Ah, diesen alten Feiertagsklassiker«, sagte David.)
Es gab zwei Thanksgivings – jeweils in Janes letztem Jahr auf der Highschool und auf dem College –, als ihre Mutter auf Entziehungskur war, die Jane bei Allisons Familie verbrachte. Dort erlebte sie das Äquivalent dieses Feiertags, wie er im richtigen Leben praktiziert wurde, das sie bislang nur aus der Folgers-Kaffeewerbung gekannt hatte.
Auch Holly machte einmal eine Entziehungskur, und zwar über Weihnachten, in dem Jahr, als Jason, ihr Sohn, drei wurde. Jane wusste nicht, warum diese Dinge immer an Feiertagen passierten, aber in diesem Fall war Jason noch klein genug, um ihm weismachen zu können, dass der Weihnachtstag Anfang Januar war, nachdem Holly aus der Klinik zurückgekehrt war und sie den halb verdorrten Weihnachtsbaum der Nachbarn vom Straßenrand in ihr Haus gezerrt hatten.
Nichts davon war damals auch nur entfernt lustig. Aber Jane war Expertin darin geworden, diese kleinen Traumata ihrer Kindheit in lustige Anekdoten zu verpacken.
Es war ihre Art, David vor all den demütigenden Horrorszenarien zu warnen, die ihn im Haus ihrer Mutter erwarten könnten. Das einzige Mal, als sie Andre, ihren Ex, mit nach Hause gebracht hatte, trafen sie ihre Schwester und Mutter dabei an, wie sie in Bikinis in der Einfahrt eine alte Kommode abschliffen. Andre, dem nicht klar war, dass es das Haus von Janes Familie war, sagte: »Sieh dir mal diese Playboy-Häschen an.« Und in diesem Stil ging es dann weiter.
Schon immer waren für Jane ihre Mutter und Großmutter zwei völlig konträre Figuren. Ihre Großmutter, mit fünfunddreißig Witwe geworden, ging, soweit Jane wusste, nach dem Tod ihres Mannes nie mehr mit jemandem aus. Sie trank nicht. Wenn Holly und sie bei ihr in Maine die Sommerferien verbrachten, kochte sie Gemüse für sie; sie mussten früh zu Bett gehen, Gebete sprechen und sonntags mit in die Messe. Sie war genau so, wie ein Kind die verantwortliche Fürsorgeperson haben wollte. Verlässlich, beständig, augenscheinlich ohne das Bedürfnis, eigene Sehnsüchte zu befriedigen. Jane wünschte, sie hätte lange genug gelebt, damit sie ihr David hätte vorstellen können, repräsentierte sie doch einen anderen, positiveren Aspekt ihrer Familie.
Doch dieser erste Besuch mit ihm zu Hause verlief besser als erwartet.
Janes Mutter und Schwester zeigten sich von ihrer besten Seite. Inzwischen war Holly bei ihrer Mutter in deren Secondhandhandel mit eingestiegen, wobei sich der Schwerpunkt von Hofflohmärkten aufs Internet verlagert hatte, sodass sie nicht mehr oft das Haus verlassen mussten, um ihrer Arbeit nachzugehen. Holly hatte Visitenkarten und ein Logo entworfen. Ihre Webseite hieß Trash to Treasure – »Trödel für Liebhaber«.
(»Weil Trödel allein abwertend klingt«, erklärte Jane Allison.)
In den letzten Jahren hatte sich im Haus und dahinter im Garten noch mehr Gerümpel angesammelt. Aber als Jane und David eintrafen, hatten sie, zum ersten Mal überhaupt, die Abdeckplanen und Stapel weggeräumt. Vermutlich war die Garage jetzt bis unters Dach vollgestopft, dachte Jane, aber immerhin. Sie war gerührt, weil sich die beiden bemüht hatten.
David war höflich und liebenswürdig wie immer. Er übersah sowohl die von leeren Weinflaschen überquellende Glas-Recycling-Tonne als auch die offensichtliche Neigung ihrer Mutter, Dinge zu horten, und ihre nach wie vor aufscheinende zänkische Art. Er machte ihr Komplimente für die Dosensoße, und als Jane ihn später deswegen neckte, behauptete er, dass sie ihm tatsächlich geschmeckt habe.
Ihre Mutter war charmant, ohne übermäßig zu flirten. Sie tranken alle zu viel Wein, auch David, aber keiner benahm sich daneben. Jason war inzwischen zwölf und von Basketball besessen. Wie sich herausstellte, hatte David in der Highschool ebenfalls Basketball gespielt. Und beide waren Celtics-Fans. Beim Abendessen fachsimpelten sie über Spieler und Spielstatistiken, und am nächsten Morgen übten sie Würfe am Korb in der Einfahrt. Jason strahlte übers ganze Gesicht, und alle drei Flanagan-Frauen lächelten glücklich, denn wenn es etwas gab, das allen dreien am Herzen lag, dann das einzige Kind in der Familie.
»Das ist hübsch«, sagte David, als sie wieder gingen, und fuhr mit der Hand über das handgemalte Treibholzschild neben der Haustür, mit dem Namen Flanagan darauf. Es stammte noch von ihrer Großmutter. Es gefiel Jane, dass er es bemerkt hatte.
An diesem Nachmittag wurde Jane für alles entschädigt – ein Besuch bei Allison und Chris und ihrem Baby. Sie unterhielten sich über Chris’ Job als Manager eines Spitzenrestaurants in der Innenstadt und darüber, dass Allisons Eltern beim Thanksgiving-Essen verkündet hätten, in wenigen Jahren in Rente gehen und ihr Bed and Breakfast Allison und Chris übergeben zu wollen.
Chris und David hatten nichts gemein, verstanden sich aber dennoch gut, konnten gemeinsam lachen. Als das Baby zu quengeln begann, bot David an, mit ihm ein paar Runden ums Haus zu drehen, bis es sich wieder beruhigt hatte, ein Trick, den er, wie er meinte, gelernt habe, als seine Nichten und Neffen noch klein waren.
»Mein Gott, du bist echt der geborene Vater!«, rief Allison ihm hinterher. »Wirklich!«, fügte sie, an Jane gewandt, hinzu.
»Ja, ich weiß. Er liebt Kinder. Er kann gut mit ihnen umgehen.«
Allison fasste Jane am Arm und drückte ihn. »Wenn du diesen Kerl nicht heiratest, tue ich’s.«
Jane lächelte. Allisons Ermunterung bedeutete ihr sehr viel. Warum riefen ihre Worte trotzdem Panik in ihr hervor?
Allison meinte, ihre frühere Beziehung habe sie so skeptisch werden lassen, aber jetzt, mit David, das sei doch etwas ganz anderes, zumal Jane damals viel jünger und Andre ein ausgemachtes Arschloch und ihre Beziehung von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei.
»David ist tausendmal besser«, fuhr Allison fort. »Und er ist offensichtlich verrückt nach dir.«
Das zeigte mal wieder, in was für einer heilen Welt Allison aufgewachsen war, dachte Jane. Sie glaubte, wenn ein Mann nur gut genug sei, könne seine Liebe das, was in Jane zerbrochen war, reparieren und die emotionale Straftäterin, die sie seit jeher war, in etwas Besseres verwandeln.
Jane wusste nicht, wie sie ihrer Freundin erklären konnte, dass in ihrem Inneren eine beinahe gewalttätige Ambivalenz herrschte. Wenn sie mit David zusammen war, wollte sie sich ganz und gar auf ihn, auf ein gemeinsames Leben mit ihm, einlassen. Aber ein anderer Teil von ihr wollte genau das Gegenteil. Wenn sie nicht zusammen waren, wirbelten ihre Gedanken durcheinander. Dann war sie sich sicher, dass es nicht funktionieren konnte. Dass sie nicht dafür geschaffen war und ihn irgendwann gehen lassen müsse. Insgeheim versuchte Jane unentwegt herauszufinden, welcher Teil von ihr recht hatte. Zu David sagte sie kein Wort darüber, weil sie fürchtete, ihn zu kränken, obwohl es überhaupt nichts mit ihm zu tun hatte.
Während sie aus dem Städtchen hinaus in Richtung Cambridge fuhren, beschloss Jane aus einer Laune heraus, mit David einen Abstecher zu dem lila Haus zu machen.
»Ich möchte dir gern meinen Rückzugsort aus der Highschool-Zeit zeigen«, sagte sie.
Das verfallene Anwesen sah fast genauso aus wie damals, als sie es vor zwölf Jahren zuletzt besucht hatte, nur noch ein bisschen ramponierter. Das Scheunendach war eingesunken. Manches deutete darauf hin, dass inzwischen neues Leben hier stattgefunden hatte. Eindringlinge hatten Lebensmittelverpackungen und leere Bierflaschen zurückgelassen und offenbar Karten gespielt. Sie sah ein Sweatshirt, einen Turnschuh. Auf der Veranda eine Kaffeedose mit Nadeln darin. Und ihr geliebter alter Baum war nicht mehr da. Vermutlich war er von der Stadtverwaltung weggeräumt worden. Und das Gras war gemäht worden.
»Dieser Ort erinnert mich an Grey Gardens, genau die gleiche Atmosphäre wie in dem Film«, sagte David. »Aber es ist wirklich cool. Und was für ein Blick. Wow!«
Hand in Hand gingen sie bis zur Felskante vor und mimten ein Ehepaar, das das Anwesen gekauft hatte. Er meinte, sie müssten einen Zaun errichten lassen, andernfalls drohten ihre Kinder ins Meer zu stürzen, vor allem an der Schmalstelle, die ins Wasser hinausragte und förmlich darum bettelte, dass man hinabsprang.
Jane erzählte ihm, das sei als Teenager ihre Lieblingsstelle gewesen, ihr Leseplatz, und sie hoffe, dass ihre Kinder sie auf die gleiche Weise nutzen würden.
»Vielleicht Eleanor«, sagte er. »Aber die Zwillinge? Chad und Brad? Vergiss die beiden. Das sind regelrechte Monster.«
Jane zog die Augenbrauen hoch. »Chad und Brad, puh? Also dir überlasse ich die Auswahl der Namen sicherlich nicht.«
Er grinste.
»Sicherlich nicht«, wiederholte er.
Er küsste sie.
All das fühlte sich wie vorbestimmt an. Sie scherzten, aber dann auch wieder nicht. Sie kannten einander kaum, konnten aber ganz klar ihre gemeinsame Zukunft erkennen. Es schien, als könnte das jeder. Dennoch sagte ihr der eine Teil in ihr, dass es zu früh sei für solche Gedankenspiele. Sie musste vorsichtig sein. Ihr war, als spürte sie ein Zupfen an ihrer Schultertasche, als flüsterte ihr ihre Angst zu, sie sei nur zeitweise in das schöne Leben eines anderen Menschen hineinspaziert.
ZEHN JAHRE SPÄTER
2015
1
Genevieve
Während sie die Treppe hinaufging, bemerkte Genevieve einen Riss in der frisch gestrichenen Wand neben der Tür von Benjamins Zimmer. Er war tief und gezackt, ungefähr fünfzehn Zentimeter lang. Ein weiterer Beweis dafür, was sie in den Wochen seit ihrem Einzug schon die ganze Zeit gespürt hatte: dass sich trotz aller Anstrengungen ein solch altes Haus niemals komplett beherrschen ließ. Jedes Flackern des Lichts, jeder tropfende Wasserhahn fühlte sich wie ein weiterer Beleg dafür an, dass es töricht von ihr gewesen war, etwas anderes anzunehmen.
Paul würde ihr vorwerfen, sie dramatisiere mal wieder, aber wenn man darüber nachdachte, war ein Haus ein Fremdkörper, der in seine Umgebung eingedrungen war. Die Natur würde unentwegt versuchen, ihre Vorherrschaft geltend zu machen, sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Man musste nur durch die Gänge eines Eisenwarenladens stöbern, dann wurde es einem klar. Regale voller Schädlingsbekämpfungsmittel, Fallen und Werkzeuge, dazu geschaffen, um zurückzudrängen, was rechtmäßig an diesen Ort gehörte.
Selbst nachdem sie eine kostspielige Steindrainage hatten legen lassen, sammelte sich im Keller Wasser. Wenn die Pfützen trockneten, blieben an den Rändern mineralische Ablagerungen zurück, die wie ein weißer Pelzbesatz aussahen. An der Decke ihres Schlafzimmers bildete sich ein brauner Fleck, der sich erschreckend weich anfühlte, wie die Schädellücken eines Neugeborenen. Nachts hörte sie Kratzgeräusche, die aus den Wänden des Speichers kamen – von Eichhörnchen vermutlich, meinte der Kammerjäger. Eines Nachmittags waren mehrere Ziegelsteine aus dem vor Kurzem neu verfugten Kamin herausgebrochen und nur wenige Meter von der Stelle gelandet, wo sie und Benjamin standen, während sie Einkäufe aus dem Wagen räumten. Mehr als einmal hatte sie das unangenehme Gefühl gehabt, dass sich die Küchenfliesen bewegten, um im nächsten Moment zu merken, dass ihre Augen es ihr vorgegaukelt hatten – eine wimmelnde Schar Zuckerameisen machte sich an einem Brotkrümel zu schaffen.
Nur wenn sie samstags manchmal Besuch aus Boston hatten und auf der hinteren Veranda saßen, um den Sonnenuntergang zu bewundern, oder um die weiße Marmorkücheninsel herumstanden und an Cocktails nippten, erlebte sie das Haus genau so, wie sie es sich ganz zu Beginn vorgestellt hatte. Alle machten ihr Komplimente dafür, dass sie dieses Wunderwerk bewerkstelligt hatte, wie schön es hier war.
Paul zeigte ihren Gästen gern Fotos. Das Davor und das Danach. Das Dazwischen erwähnte er nicht. Die vielen Monate, die sie mit Diskussionen über die Kosten des Fliesenspiegels in der Küche und der Schränke und Parkettböden zubrachten, oder darüber, ob sie die alte Tapete in ihrem Schlafzimmer herunterreißen und womit sie sie ersetzen sollten. Genevieve sprach sich immer für die teuerste Variante aus, weil sie insgeheim glaubte, je höher der Preis, desto höher sei die Qualität. Ständig fragte sie ihn nach seiner Meinung, obwohl sie doch genau wusste, was sie wollte. Es war nur so, dass sie ihrem Urteil nicht ganz traute. Andererseits wusste Paul wiederum genau, was er nicht wollte, war aber in den meisten Fällen unfähig zu artikulieren, was er stattdessen wollte.
Mehrmals im zurückliegenden Jahr war Genevieve wortlos ins Bett gegangen, wütend über sein Desinteresse an dem Ort, an dem sie künftig ihre Sommerurlaube verbringen wollten. Dabei sollte dieses Haus doch der Grund dafür sein, warum er so viel arbeitete; die Kompensation dafür, dass sie in den letzten Jahren so wenig Zeit füreinander hatten, während er sein Business aufbaute. Hier sollten sie für die verlorene Zeit entschädigt werden, wieder zueinanderfinden. Doch ihr Mann war nicht dazu zu bewegen, zwischen zwei Telefonaten kurz den Blick zu heben und ihr zu sagen, ob er für die maßgeschneiderten Verandapolster lieber dieses gewagte Gelb oder jenes klassische Beige hätte – wie groß war dann die Wahrscheinlichkeit, dass er, bildlich gesprochen, überhaupt einmal den Blick heben würde?
Ihren Gästen erzählte sie nichts davon.
Bitte verschon unseren Besuch mit den Schattenseiten, ja?, pflegte Paul zu sagen, wenn die Türklingel ertönte.
Worauf sie erwiderte: Natürlich. Im Übrigen waren sie nicht ihre Freunde. Es waren ehemalige Kommilitonen ihres Mannes mit ihren Frauen. Oder Kunden oder Kollegen von Paul. Oder Männer, die er irgendwo auf einem Golfplatz kennengelernt hatte.
Genevieve fuhr mit der Fingerspitze über den Riss in der Mauer. Sie hatte sich wochenlang über die Farbe den Kopf zerbrochen und sich schließlich für einen hellgrauen Farbton namens »Schatten« entschieden. In allen Räumen kam, sobald die Farbe getrocknet war, der Moment der Wahrheit, in dem sich erwies, ob sie eine weise Wahl getroffen hatte. Das Meerschaumgrün im Gästebadezimmer war ein Reinfall. Es war so schrecklich, dass sie es nach einer Woche mit Weiß überstrichen hatte. Was den Flur im oberen Stockwerk betraf, war sie zufrieden mit ihrer Entscheidung. Aber was sollte sie jetzt tun? Es würde Wochen, wenn nicht gar Monate dauern, bis sie den Maler wegen eines läppischen Risses dazu bewegen könnte, erneut herzukommen, aber ihn selbst auszubessern, traute sie sich nicht. Sie fügte es dem gedanklichen Merkzettel mit Dingen hinzu, die sie schon einmal hatte reparieren lassen, jetzt aber erneut einer Reparatur bedurften. Eine Liste an Aufgaben, die, wie sie vermutete, nie vollständig abgearbeitet werden konnte.
Das winzige Zimmer ihres Sohnes befand sich hinter einer versteckten Tür, die, wenn geschlossen, gänzlich mit der Wand verschmolz – keine Leiste, kein Türgriff. Sie hatten mehrere weitere Zimmer, wesentlich geräumiger, aber Benjamin wollte unbedingt dieses haben. Ihm gefiel vermutlich, dass es so kuschelig war. Und ganz anders als das zu Hause.
Während sie vor der Wand dastand, hörte sie seine süße Stimme. Ihr Klang war so wohltuend.
Genevieve atmete tief durch.
»Und was hat sie dir gesagt?«, meinte sie ihn durch die Wand hindurch sagen zu hören.
Nach einer kurzen Pause kicherte er.
Eine halbe Stunde zuvor hatte sie sich vorsichtig von dem großzügigen Bett erhoben, um ihn ja nicht aufzuwecken. Ohne sie an seiner Seite konnte Benjamin nicht einschlafen. Paul meinte, sie verwöhne ihn zu sehr, ein vierjähriger Junge müsse sich von allein wieder beruhigen können.
Aber Genevieve ließ sich nicht davon beirren. Welchen Schaden konnte es schon anrichten? In ein paar Jahren würde Benjamin vermutlich keine Lust mehr haben, mit ihr zu reden, geschweige denn, neben ihr zu schlafen. Meistens schlief sie neben ihm ein, wachte erst im Morgengrauen auf, das Licht im Zimmer noch an.
Aber nachdem er an diesem Abend eingeschlafen war, spürte sie eine ungewöhnliche Energie in sich. Dazu trug gewiss die Tatsache bei, dass am nächsten Morgen die Putzfrauen kommen würden und sie vorher ein bisschen aufräumen müsste, wollte sie sich nicht ihrer stummen Kritik aussetzen, wenn im Spielzimmer wieder einmal Chaos herrschte und sich das schmutzige Geschirr in der Spüle türmte.
Sie quasselten unentwegt auf Portugiesisch und lachten. Lachten sie aus, dachte sie.
Nur die Chefin des Trupps, Cathy, sprach Englisch.
»So ein großes Haus und nur Sie und Ihr Junge wohnen darin«, sagte sie, als sie sich zum ersten Mal begegneten.
»Und mein Mann«, erwiderte Genevieve. »Er kommt meistens an den Wochenenden herauf.«
Cathy machte ein Gesicht, aus dem Genevieve nicht schlau wurde. Bemitleidete die Frau sie? Oder war es eine versteckte Kritik?
Kümmere dich nicht darum, würde Paul sagen. Und das stimmte auch. Sie kümmerte sich viel zu sehr darum, was andere dachten.
Benjamin plapperte noch immer, so leise, dass sie die Worte nicht verstehen konnte.
Normalerweise lief er, wenn er aufgewacht war, durchs ganze Haus und rief nach ihr, bis er sie gefunden hatte – unten vor dem Fernseher oder schlafend in ihrem Bett. Wenn Genevieve manchmal, wenn er nachts aufwachte, an sein Bett trat, erlebte sie ihn nie anders als heiter und angstfrei.
Irgendwo hatte sie gelesen, dass Mütter den früheren Versionen ihrer Kinder nachtrauerten. Man konnte nicht wissen, wann es das letzte Mal sein würde, dass man die Windeln wechselte oder das Baby in den Schlaf wiegte oder von einem Zimmer ins nächste trug, bis es dann so weit war. Wenn von dem eigenen Kind eines schönen Morgens nur noch ein mürrischer Gruß kam, hatte man das Gefühl, es plötzlich mit einer ganz anderen Person zu tun zu haben als mit der, der man einen Gutenachtkuss gegeben hatte.
»Das habe ich schon mal gemacht!«, sagte Benjamin jetzt mit lauterer Stimme. »Wirklich!«
Genevieve schob leise die Tür auf. Sie hatte eigentlich unbemerkt bleiben wollen, aber sofort schnellte Benjamins Kopf zu ihr herum.
»Mama. Du hast mir Angst gemacht.«
Er blickte wieder zum Fenster, wo sich der dunkle Himmel abzeichnete und das schwarze Meer, auf dem ein goldener Schimmer lag.
»Mit wem redest du?«, fragte sie neckend. Und erwartete, dass er lachen würde.
Aber Benjamin wirkte verwirrt. Er sah zwischen dem Fenster und Genevieve hin und her und sagte dann, als wäre es doch ganz offensichtlich: »Mit ihr.«
Erneut zögerte er kurz, ehe er hinzufügte: »Sie kommt jetzt jede Nacht herein und hört nicht auf zu reden. Und hält mich wach.«
Genevieve wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Merkwürdigerweise entschied sie sich für: »Wie sieht sie aus?«
Benjamin deutete auf das Fenster. »Dort ist sie!«
Sein Tonfall sagte ihr: Schau doch selbst. Doch dann schien ihm klarzuwerden, dass Genevieve sie nicht sehen konnte. Und er wurde plötzlich hysterisch.
Benjamins Schreien. Nie würde Genevieve es vergessen.
Sie brauchte eine halbe Stunde, um ihn zu beruhigen. Es gelang ihr nur, indem sie ihm versprach, dass er auf dem Sofa vor dem laufenden Fernseher schlafen könne und sie ihm eine Tasse Schokolade bringen werde.
Sie setzte sich neben ihn und tätschelte ihm den Kopf.
»Da war wirklich ein Mädchen«, versicherte er ihr.
Genevieve sagte: »Ich glaube dir«, und ihr wurde, während sie es sagte, klar, dass sie ihm wirklich glaubte.
Sie hatte beschlossen, gewisse Dinge zu ignorieren. Momente, die keinen Sinn ergaben. Einmal hatte sie ein Fenster zugemacht, weil es regnete, und hätte schwören können, eine fremde Hand zu spüren, die die untere Fensterhälfte herunterzog. Hin und wieder flackerte das Licht im Wohnzimmer oder in Benjamins Zimmer – aber nur, wenn er anwesend war. Stimmte das? Oder bildete sie sich dieses Detail nachträglich ein?
Ganz bestimmt bildete sie sich die Murmeln nicht ein, die unerklärlicherweise im gesamten Haus verstreut herumgelegen hatten. Trübe Glaskugeln, blau und rot und grün, altmodisches Spielzeug, etwas, das man Kindern heutzutage nicht mehr schenkte. Eine hatte sie auf den weißen Bodenfliesen gefunden, als sie in ihrem Badezimmer eines Tages aus der Dusche trat. Eine weitere auf der Brücke unter dem Esszimmertisch. Vier oder fünf hatten in einer ordentlichen Reihe auf dem Fernsehtisch gelegen. Paul meinte, die einzige Erklärung sei, dass die Murmeln schon immer dagewesen seien. Das Haus sei schließlich alt. Die Fußböden seien schief. Und so könnten die Murmeln hin und wieder unter einem Gegenstand hervorrollen.
Kurz nach elf beschloss Genevieve, Benjamin allein auf dem Sofa zurückzulassen, wo er engelsgleich unter einer blauen Strickdecke schlummerte. Sie ging in die Küche, schenkte sich ein großes Glas Wodka mit Eiswürfeln ein und rief ihren Mann an. Seine Mailbox schaltete sich ein. Sie stellte sich vor, wie er auf dem Sofa Fernsehnachrichten ansah oder die zusammengefassten Highlights der Baseballspiele und wie er, als er ihren Namen auf dem Display aufleuchten sah, beschloss, nicht abzunehmen.
Wieder rief sie an. Diesmal ging er dran.
Nachdem sie ihm den Vorfall berichtet hatte, sagte Paul: »Der Junge hat eine lebhafte Fantasie.«
»Nein, daran lag es nicht.«
»Was glaubst du dann, war es? Ein Gespenst?«, sagte er spöttelnd.
Es gab Momente, in denen sie ihn wegen seiner typisch männlichen Art hätte umbringen können.
Andererseits hatte sie ihm ja nicht erzählt, was sie getan hatte.
Ein Bild schob sich vor ihr geistiges Auge, und sie schloss die Lider, um es zu vertreiben. Doch er war immer noch da, der sehnige junge Mann. Das Letzte, was sie von ihm wahrgenommen hatte, während er sich von dem Haus entfernte, war das Tattoo auf seinem Nacken. Ein kompakter roter Stern. Er sah aus wie diese Stempel, die am Eingang eines Streichelzoos auf Kinderhände gedrückt wurden, als Beweis, dass der Eintritt bezahlt wurde.
»Kannst du bitte heute Abend noch herkommen?«, fragte sie Paul. »Ich würde mich besser fühlen, wenn du hier wärst. Ich weiß, es klingt albern, aber das Ganze ist wirklich sehr beunruhigend.«
Paul erinnerte sie an die eineinhalbstündige Fahrt und daran, dass er am nächsten Morgen arbeiten müsse. Sie solle ein Schlafmittel nehmen, meinte er.
Aber was, wenn Benjamin sie brauchte, was, wenn er nach ihr rief und sie ihn nicht hörte? Sie hatte ihn noch nie so verängstigt erlebt.
»Er hat es sich nicht ausgedacht«, sagte sie.
»Gen …« Pauls Stimme hatte einen warnenden Unterton. »Ich hatte dir von Anfang an gesagt, dass du bestimmt nicht gern allein in dem Haus sein würdest. Es tut dir nicht gut, du bildest dir alles Mögliche ein. Du brauchst Gesellschaft. Warum rufst du nicht deine Freundin an, diese Frau, die das Bed and Breakfast betreibt, und lädst sie auf einen Drink ein? Du sagtest doch, sie sei nett.«
Die Pensionsinhaberin, Allison hieß sie, war nur nett gewesen, weil Genevieve ein zahlender Gast war, die jeden Sommer eine Woche bei ihnen verbrachte und immer das teuerste Zimmer reservierte. Das war ihr klargeworden, als Genevieve auch diesmal wieder dort vorbeigeschaut und ihnen gesagt hatte, dass sie und Benjamin den ganzen Sommer in ihrem frisch renovierten Haus verbringen würden. Sie hatte Allison auf dem Handy Fotos von der Renovierung gezeigt.
»Ich kenne das Haus«, sagte Allison, ohne näher darauf einzugehen.
Sie war gerade dabei, Brotkrümel zwischen den weißen Korbtischen zusammenzufegen.
Dann hatte Allison die Unterhaltung ziemlich abrupt abgebrochen, indem sie sagte: »Ach so. Ich bin mir sicher, man sieht sich irgendwann. Meine Telefonnummer haben Sie ja. Wenn Sie etwas brauchen, schicken Sie mir doch einfach eine Textnachricht, ja?«
Und das hatte Genevieve getan, hatte ihr eine Nachricht geschickt, um ihr mitzuteilen, es sei nett gewesen, mit ihr zu plaudern, und ihr vorgeschlagen, sich einmal zu treffen, vielleicht mit den Kindern.
Ein Monat war seitdem vergangen, ohne dass eine Antwort gekommen war.
Sie hatte einfach keine Begabung für Frauenfreundschaften. Sie mochte nicht, wie Frauen einander Geheimnisse, sowohl eigene als auch die anderer Leute, erzählten und alles für bare Münze nahmen. Ihre Mutter war sehr reserviert, war überzeugt, dass man Probleme für sich behalten müsse. Genevieve hatte von früh an ihre Haltung übernommen, und wenn sie sich als Studentin am Bryn Mawr College wieder einmal allein auf dem Flur des Studentenwohnheims fand, während um sie herum Mädchen in Pyjamas über Jungen plauderten und über irgendwelche Professoren, in die sie verliebt waren oder die eine Affäre hatten, dachte sie: Dazu habe ich rein gar nichts zu sagen.
Im zweiten Studienjahr fuhr sie immer mit einem Mädchen aus demselben Jahrgang einmal in der Woche zur Chorprobe. Genevieve dachte, sie seien Freundinnen. Aber als sie eines Abends um die Ecke bog und den Speisesaal betrat, hörte sie das Mädchen sagen: »Die arme Genevieve ist so sehr in sich selbst vertieft, dass sie seit Monaten kein Tageslicht mehr gesehen hat.«
Kurz vor ihrem Abschluss lernte Genevieve auf einer Party außerhalb des Campus Paul kennen. Sie mochte, dass er nur so vor Selbstbewusstsein strotzte. Ihre Mutter war beeindruckt von seinem prestigeträchtigen Namen. Sie hatte im Time-Magazin einen Artikel über seinen Vater gelesen.
»Seine Vorfahren sind mit der Mayflower nach Amerika gekommen!«, sagte sie.
Wenn Genevieve einen solchen Mann heirate, meinte ihre Mutter, werde es ihr an nichts fehlen.
Nachdem Paul aufgelegt hatte, ging Genevieve mit ihrem Drink auf die überdachte Terrasse, knipste das Außenlicht an und trat an das Geländer. Sie blickte über den hügeligen Rasen und die Klippen hinweg aufs Meer, auf die von Straßenlampen erleuchtete Bucht und das Städtchen Awadapquit in der Ferne. Dieser Ausblick hatte sie, als sie das Anwesen entdeckte, am meisten angezogen.
Ihr Grundstück war nur vom Meer aus zu sehen. Zwischen dem Haus und der Hauptstraße lag eine Viertelmeile Kiefernwald. Bestimmt war sie Hunderte Male an der Abzweigung vorbeigefahren, ohne sie zu bemerken. Wer weiß, warum sie sie an jenem Augustnachmittag dann doch bemerkt hatte? Benjamin war, nachdem sie den Vormittag am Strand verbracht hatten, im Kindersitz auf der Rückbank eingeschlafen.
Als sie den rostigen Briefkasten an der Abzweigung der Shore Road entdeckte, bog sie aus einer Laune heraus ab und folgte dem von Baumkronen beschatteten Schotterweg. Und als sie dann am Ende des Weges wie aus einem Tunnel heraus in den Sonnenschein eintauchte, war es für sie wie eine Offenbarung. Sie sah eine riesige zugewucherte Wiese, deren Gras wie goldener Weizen in der Sonne schimmerte, und dahinter den Ozean. Auf einer kleinen Insel gegenüber der Küste sonnten sich Seehunde auf den Felsen.
Ein eingefallenes, unbewohnbares viktorianisches Haus mit abgeblätterter blasslila Farbe stand auf dem Grundstück. Genevieve ließ Benjamin im Wagen weiterschlafen, ging zu dem Haus und spähte durch ein Fenster. Machte Pläne. Als gehörte es bereits ihr.
Das Haus war vollständig möbliert. Es sah aus, als wären die Besitzer vor Jahrzehnten spazieren gegangen und nicht wiedergekommen.
Es waren keine benachbarten Häuser zu sehen. Das Haus wurde an drei Seiten von Bäumen eingerahmt und an der vierten vom Ozean.
Das, was sie an diesem Tag spürte, war eine Art Begierde. Genevieve musste es unbedingt haben.
Als sie das nächste Mal mit Paul herkam, um es ihm zu zeigen, machte er sie auf die zerbrochenen oder wer weiß wie lange schon offen stehenden Fenster aufmerksam, sodass das Innere schutzlos den Elementen ausgeliefert war. In manchen Räumen drohte die Decke einzustürzen. Das Geländer des oberen Flurs war in die Diele hinuntergefallen. Auf der Sonnenveranda war eine Wand eingeknickt. Das Mansarddach war mit Moos überwachsen. Neben dem Haus stand eine Scheune, eingesunken wie ein alter Kürbis.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: