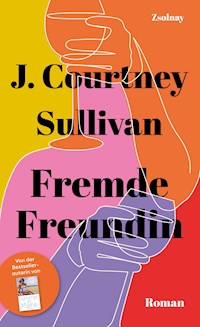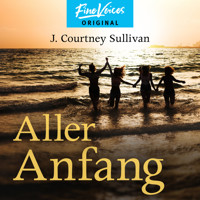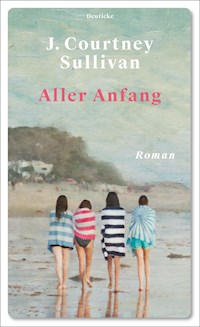Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wieso verlässt Teddy seine Frau und die beiden gemeinsamen Töchter – wegen einer Frau, die er an einer Hotelbar kennenlernt? James fragt sich, wieso Sheila ausgerechnet ihn, der doch nur ein Versager ist, geheiratet hat. Delphine verlässt ihren Mann und ihr Leben in Paris, um ihrem Geliebten nach New York zu folgen, und wird es bitterlich bereuen. Kate lehnt die Ehe ab, doch nun wollen ihre besten Freunde heiraten, und zwar so richtig prunkvoll: Jeff und Toby. J. Courtney Sullivan erzählt in diesem Roman meisterhaft die Geschichte von vier Paaren, die einander gefunden, geliebt, geheiratet, betrogen und verlassen haben. Geschickt verwebt sie die Fäden miteinander und zieht den Leser immer wieder in ihren Bann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 775
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deuticke E-Book
J. Courtney Sullivan
Die Verlobungen
Roman
Aus dem Amerikanischen von Henriette Heise
Deuticke
Die Originalausgabe erschien erstmals 2013 unter dem Titel The Engagements im Verlag Alfred A. Knopf, New York.
ISBN 978-3-552-06250-4
Copyright © 2013 by J. Courtney Sullivan
Published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2014
Schutzumschlaggestaltung:
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung einer Illustration von © Jack Vettriano 2001, »Betrayal. First Kiss«, www.jackvettriano.com
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Kevin
Was verleiht einem Diamanten seine harte, unbarmherzige Schönheit? Egal, ob er aus dem Tod eines Sterns oder aus lebendigem Plankton hervorgegangen ist: Dieser Splitter unseres Planeten ist nichts als ein leerer Käfig der Träume, ein weißes Blatt, auf das unser Herz seine nie gleichbleibenden Sehnsüchte zeichnen kann.
Tom Zoeller, »The Heartless Stone«
Wir bringen Diamanten ins Gespräch, indem wir ihre Trägerinnen präsentieren: Stars aus Film und Fernsehen, Politikerfrauen und -töchter, kurzum: jede Frau, bei deren Anblick die Gattin des Gemüsehändlers und die Freundin des Automechanikers seufzt: »Hätt ich doch, was die da hat.«
N.W. Ayer & Son, Strategiepapier, 1948
1947
Frances goss sich die letzten bitteren Tropfen aus der Kaffeekanne in die Tasse. Der kleine Küchentisch war von Papier übersät: Entwürfe, Kopien vertraulicher Gutachten, Zettel mit schlechten Ideen, die sie schon vor Stunden verworfen hatte, und dazwischen auch ein paar gute, die in Look, Vogue, The Saturday Evening Post, Life und Harper’s Bazaar erschienen waren. Sie sollten sie daran erinnern, dass sie es schon viele Male geschafft hatte, also konnte sie es auch wieder tun.
Endlich war es still. Normalerweise schrie immer irgendwo ein Baby, stritt sich ein Paar oder ging eine Toilettenspülung. Aber es war drei Uhr morgens, und die letzten Zecher lagen in ihren Betten und die Milchmänner waren noch nicht aufgestanden.
Ihre Mitbewohnerin war gegen zehn ins Bett gegangen. Als Frances sie im Nachthemd und mit Lockenwicklern im Haar in der Tür hatte stehen sehen, hatte sie Ann ein bisschen um ihren Job beneidet. Andererseits sah im Leben der Kanzleisekretärin jeder Tag gleich aus: Kaffee kochen und tippen.
Frances war gerade mit den Texten für die neue De-Beers-Kampagne fertig geworden. Es war eine Serie zum Thema Flitterwochen mit Bildern von schönen Reisezielen für die Frischvermählten: Die Felsenküste von Maine! Zauberhaftes Arizona! Paris! Und dann noch etwas fürs schlanke Portemonnaie, das sie unter der Rubrik Am Fluss laufen ließ.
Eigentlich war das der wichtigste Teil, weil sie es ja speziell auf Otto Normalverbraucher abgesehen hatten. Als ihre Agentur De Beers vor zehn Jahren als Kunden übernahm, hatten sie zunächst ausführlich die Stärken – und wichtiger noch: die Schwächen – des diamantenen Verlobungsrings unter die Lupe genommen. Damals war die Nachfrage verschwindend gering gewesen. Ein solcher Ring war für viele nichts als Geldverschwendung. Die Bräute wünschten sich eine Waschmaschine oder ein neues Auto, aber doch keinen teuren Diamantring. Dass sich das so drastisch geändert hatte, war unter anderem Frances zu verdanken.
Auf jeder der Flitterwochenanzeigen sollte stehen: Möge Ihr Glück so lange währen wie Ihr Diamant. Gar nicht schlecht, fand Frances.
»Jetzt aber ab ins Bett, Frank.« Als sie klein war, hatte ihre Mutter das fast jeden Abend zu ihr gesagt. Heute rief sie sich selbst auf diese Weise zur Ordnung.
Sie wollte gerade das Licht ausknipsen, als ihr Blick auf die leere Stelle fiel, die der Artdirector für den Slogan vorgesehen hatte, für den sie sich bis morgen etwas hatte einfallen lassen sollen.
»Mist.«
Frances setzte sich wieder hin, zündete sich eine Zigarette an und griff nach Bleistift und Papier.
Am Vortag hatte sie einen Anruf von Gerry Lauck erhalten, dem Leiter der New Yorker Agenturniederlassung: »Wir müssen das Ganze deutlicher als Diamantenwerbung ausweisen. Wir brauchen einen Slogan, meinen Sie nicht auch?«
Wenn Gerry Lauck jemanden nach seiner Meinung fragte, durfte man nicht glauben, dass er sie wirklich hören wollte. Frances hielt ihn für ein Genie. Manchmal war er vielleicht ein bisschen launisch und unberechenbar, aber wahrscheinlich waren alle Genies so.
»Gute Idee«, hatte sie gesagt.
Gerry sah aus wie Churchill, benahm sich wie Churchill, und manchmal hatte Frances den Eindruck, er hielt sich auch für Churchill. Er litt sogar unter Depressionen. Sie hatte vor ihrem ersten Besuch in der New Yorker Niederlassung, bei dem sie ihm ihre Ideen vorstellen sollte, eine Heidenangst gehabt. Er hatte ihre Unterlagen mit unbewegter Miene durchgeblättert. Nach ein paar Minuten der Folter, die ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen waren, hatte er dann lächelnd gesagt: »Sie schreiben sehr gut, Frances. Aber noch viel wichtiger: Sie wissen, wie man verkauft.«
Seitdem mochten die beiden sich. Bei N.W. Ayer hatte jeder Zweite entweder Angst vor Gerry Lauck oder konnte ihn nicht ausstehen. Für alle anderen war er ein Halbgott. Frances gehörte zu Letzteren.
»De Beers soll im Slogan natürlich nicht vorkommen«, hatte Gerry am Telefon hinzugefügt.
»Natürlich nicht.«
In den letzten neun Jahren hatte De Beers Millionen für Werbung ausgegeben, die den Namen der Firma nicht erwähnte. Den Diamantlieferanten nie direkt zu benennen war eines der wichtigsten Prinzipien der De-Beers-Werbung. Deshalb stellten die Kampagnen den Diamanten an sich in den Mittelpunkt, und zwar mit atemberaubend schönen Ergebnissen. Dafür sorgte Ayer schon. De Beers war eine harte Nuss für die Designer, weil sie keinen Diamantschmuck abbilden durften. Eigentlich war die Kreativabteilung nicht in Gerrys Zuständigkeitsbereich. Er war durch und durch Geschäftsmann und in erster Linie für die Vergabe der Aufträge verantwortlich. Aber er war auch ein Kunstliebhaber, und es war seine Idee gewesen, Gemälde bei Lucioni, Berman, Lamotte und Dame Laura Knight in Auftrag zu geben. Außerdem hatte er bei den größten europäischen Galerien für die De-Beers-Sammlung Werke von Dalí, Picasso und Edzard gekauft.
Das Ergebnis waren Werbeanzeigen in Farbe, in deren Mittelpunkt wunderschöne Landschaften, Städte und Kathedralen standen. Unter dem Gemälde waren in einem Kästchen Diamanten von unterschiedlicher Qualität zusammen mit einer unverbindlichen Preisempfehlung abgebildet. Gerry war der Erste gewesen, der Kunst zu Werbezwecken einsetzte. Ein, zwei Jahre später machte es die ganze Branche.
»Ich brauche den Slogan bis morgen früh«, hatte Gerry gesagt. »Ich komme kurz in Philadelphia vorbei. Am späten Nachmittag fliege ich weiter nach Südafrika.«
»Kein Problem«, hatte Frances gesagt und es dann total vergessen. Erst jetzt war es ihr wieder eingefallen. Mitten in der Nacht.
Sie seufzte. Wenn sie nicht immer alles in allerletzter Minute machen würde, käme sie vielleicht zwischendurch sogar zum Schlafen. Sie hatte doch gewusst, dass sie abends noch würde arbeiten müssen, und trotzdem war sie mit Dorothy Dignam ausgegangen, bis ihre Freundin sich verabschiedet hatte, um den Neunuhrzug nach New York nicht zu verpassen.
Dorothy hatte 1930 im Ayer-Hauptsitz in Philadelphia als Werbetexterin angefangen. Kurz nachdem Frances dazugekommen war – das war vor vier Jahren gewesen –, war Dorothy ins Rockefeller Center, dem Sitz der New Yorker Niederlassung, versetzt worden, wo sie Public Relations übernommen hatte. Wie Frances arbeitete sie vor allem an den De-Beers-Aufträgen. Außerdem hatten sie für De Beers noch Leute in Miami, Hollywood und Paris. Dorothy hatte mit Columbia Pictures die Produktion eines Kurzfilms über Diamanten ausgehandelt: Zauber eines Steins: Die Geschichte des Diamanten. Im September 1945 hatte der Film Premiere und wurde bis zum Ende seiner Laufzeit von mehr als fünfzehn Millionen Zuschauern gesehen.
Dorothy sprach nicht über ihr Alter, aber Frances schätzte, dass ihre Freundin mindestens fünfzehn Jahre älter war als sie, also so um die fünfzig. Im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs hatte sie für eine Werbeagentur in Chicago gearbeitet. Mit siebzehn wurde sie Promireporterin beim Chicago Herald, bis Mr Hearst kam und sie rauswarf. Die nächste Station war die Textabteilung bei Carnation, dem Produzenten der »Milch glücklicher Kühe«, wie ihre Werbung versprach. Von dort war sie zu Ayer gekommen.
Dorothys Karriere war unaufhaltsam, und sie wurde Frances’ Vorbild. In den Dreißigern war sie für Ayer in der ganzen Welt herumgereist, hatte in London, Paris und Genf die Ford-Werbung übernommen und war länger in Norwegen und Schweden gewesen, um sich die dortige Entwicklung von Haushaltsgeräten genauer anzusehen. Und sie war regelmäßig in Hollywood, wo sie im Trocadero aß, dem Restaurant der Stars. Einmal war sie Joan Crawford im Bullocks Wilshire begegnet und hatte das gleiche Kleid, das Joan in Größe 42 gekauft hatte, in 44 mitgenommen. Ein preiswertes, schwarzes Alltagskleid, das Joan und ich ganz bestimmt oft tragen werden, hatte sie auf der Postkarte geschrieben.
Der heutige Abend hatte als Geschäftsessen angefangen, aber nach dem zweiten Martini im Bookbinder’s hatten sie Austern geschlürft, sich Witze über die Kollegen erzählt und schallend gelacht. Am meisten über die Fragen, die ihre männlichen Kollegen ihnen stellten. Dorothy hatte seit ein paar Jahren immer ein Blatt Papier in der leeren Schublade unter ihrer Schreibmaschine, auf dem sie die absurdesten Fragen notierte.
Am Abend hatte Dorothy Frances die neuesten vorgelesen: »Wie sollte die Mutter eines Siebzehnjährigen aussehen? Was ist von einem mit einem Vogelnest dekorierten Winterhut zu halten? Macy’s – ist das Singular oder Plural? Trällern Frauen auch in der Badewanne? Was ist der Unterschied zwischen Wildleder und Nubuk? Hat Queen Mary einen schönen Teint? Wie oft muss ein Baby gefüttert werden? Ist das da eine Kellerfalte?«
Es war ein Riesenspaß gewesen, aber nun büßte Frances dafür.
Sie warf einen Blick auf das neueste Strategiepapier: Es geht um Massenpsychologie, denn unser Ziel ist es, den diamantenen Verlobungsring zu einer psychologischen Notwendigkeit zu machen. Zielgruppe: etwa siebzig Millionen Menschen im Alter von fünfzehn aufwärts, deren Weltsicht wir in unserem Sinne beeinflussen wollen.
Na dann war ja alles klar.
1938 war ein Beauftragter von Sir Ernest Oppenheimer, dem Firmenchef von De Beers Consolidated Mines, auf Ayer mit der Frage zugekommen, ob, wie er es ausdrückte, »der Einsatz propagandistischer Techniken« die Verkaufszahlen von Diamanten in den USA steigern könne.
Mit der Wirtschaftskrise war die Nachfrage weltweit eingebrochen. In den USA wurden nur halb so viele Diamanten verkauft wie vor dem Krieg, und die diamantenen Verlobungsringe, die dennoch verkauft wurden, trugen nur relativ kleine Steine. De Beers wurde seine Diamanten nicht mehr los. Oppenheimer war daran gelegen, den diamantenen Verlobungsring in die US-amerikanische Kultur einzuführen, und er hatte aus zuverlässigen Quellen erfahren, dass für dieses Projekt keine andere Agentur als Ayer & Son in Frage käme. Er schlug eine zunächst dreijährige Kampagne mit einem jährlichen Budget von einer halben Million Dollar vor.
Das Ergebnis stellte die Macht der Werbung unter Beweis: Bis 1941 stieg der Absatz von Diamanten um fünfundfünfzig Prozent. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wuchs die Zahl der Vermählungen in den USA, und damit die Verkaufszahlen im Diamantengeschäft. Daraufhin stieg natürlich auch der Preis des Edelsteins: Mittlerweile kostete ein Zweikaräter, der 1939 noch für neunhundert bis tausendsiebenhundertfünfzig Dollar zu haben gewesen war, zwischen tausendfünfhundert und dreitausenddreihundert Dollar.
Ayer hatte für die De-Beers-Kampagne eine neue Form der Werbung erfunden, die seither von anderen Agenturen kopiert worden war. Es ging weder um den Verkauf eines konkreten Produktes noch um die Einführung eines Firmennamens. Es ging um eine Idee: den emotionalen Wert des Diamanten.
Um seine Preise zu sichern, drosselte De Beers die Diamantenförderung in seinen Minen. Die Werbung steigerte nicht nur den Absatz, sondern stellte auch sicher, dass ein einmal verkaufter Diamant nicht auf den Markt zurückkehrte. Wenn Frances mit ihnen fertig war, würde keine Witwe, ja nicht einmal eine geschiedene Frau, sich jemals von ihrem Ring trennen.
Die Tatsache, dass Frances ihre Auftraggeber nie zu Gesicht bekommen hatte, regte ihre Phantasie an. Sie hätte gerne einmal die Reaktion gesehen, wenn sie Frances’ neueste Texte vor sich hatten. Überraschung? Schmunzeln? Ausrufe?
Es war ungewöhnlich, dass sie einen Kunden nicht persönlich kannte, aber De Beers’ Repräsentanten durften nicht einreisen. Die Firma kontrollierte den Weltmarkt, und allein der Besuch eines ihrer Mitarbeiter in den USA verstieß gegen das Kartellgesetz. Sie operierten von Johannesburg und London aus, und einmal im Jahr flog Gerry Lauck mit einem dicken Lederordner mit Frances’ Ideen im Gepäck nach Südafrika, wo ein Extraset Golfschläger auf ihn wartete, weil das doch viel bequemer war, als die schweren Dinger jedes Mal mitzuschleppen.
Auf dem Weg zu seinem ersten Besuch in Johannesburg, bei dem er die Marktanalyse vorstellen sollte, stürzte das kleine Wasserflugzeug vor der Küste Mosambiks ab, und Gerry rettete sich, indem er sich an den großen gerahmten Tabellen und Diagrammen festhielt, bis er Land erreichte. Die beiden anderen Passagiere kamen um, und die New York Times titelte: FLUGZEUGABSTURZ IM SÜDÖSTLICHEN AFRIKA: AMERIKANER ÜBERLEBT UNVERLETZT. Das Vortragsmaterial hatte Gerry im wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Vielleicht war er deshalb der De-Beers-Kampagne so verpflichtet.
Frances’ Gedanken wurden von dem lauten Schnarchen ihrer Mitbewohnerin unterbrochen.
Ann wartete auf den Heiratsantrag eines langweiligen Buchhalters, mit dem sie schon länger zusammen war. Dann würde Frances sich wieder eine neue Mitbewohnerin suchen müssen. Das passierte seit Kriegsende alle paar Monate. Rose, Myrtle, Hildy: Frances hatte eine nach der anderen an den Ehestand verloren. Aber eigentlich müsste Frances bald befördert werden, also würde sie sich nach Anns Auszug die Wohnung vielleicht allein leisten können.
Als Frances vier Jahre zuvor mit achtundzwanzig bei Ayer angefangen hatte, hatte sie ihre Eltern davon überzeugen können, dass es für sie Zeit war auszuziehen und in die Großstadt zu gehen. Aber sie hatte sich die Miete allein nicht leisten können. Seither träumte sie von einer eigenen Wohnung. Nie wieder Warmwassermangel an kalten Wintermorgen, nie wieder Anns nasaler Sopran, wenn das Radio spätabends Dinah Shore spielte. Was für andere alleinstehende Frauen der Traum von der Ehe war, war für Frances der Traum von einem Leben allein.
Frances strich über eine der neuen Anzeigen der Flitterwochenkampagne. Fragten die Frauen sich denn gar nicht, was nach der Hochzeit kommen würde? Für sie ging es anscheinend nur darum, jemandes bessere Hälfte zu sein, als wäre das Eheleben ein Zuckerschlecken. Frances war das genaue Gegenteil: Sie konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Manchmal verbrachte sie einen netten Abend mit einem neuen Mann und ließ sich zum Essen oder Tanzen ausführen. Aber wenn sie dann abends im Bett lag, klopfte ihr Herz vor Angst. Wenn sie sich jetzt mit ihm ein zweites Mal traf, würde vielleicht eine dritte Verabredung folgen. Irgendwann würde sie ihn dann ihren Eltern vorstellen müssen, und er sie den seinen. Dann der Heiratsantrag. Danach würde sie, wie alle anderen berufstätigen Frauen, die geheiratet hatten, von der Isolation des Daseins als Mutter und Hausfrau verschluckt werden.
Dorothy hatte ihr erzählt, dass ihr Freund George nach seiner Heimkehr aus dem Ersten Weltkrieg eine Fleischerstochter geheiratet habe. Frances erinnerte sich an Dorothys schlagfertigen Kommentar, den sie vermutlich nicht zum ersten Mal zum Besten gab: »Das schlug eine Wunde, wie nur Schlachtermesser sie schlagen. Aber die Heilung wurde dadurch beschleunigt, dass mir immerhin der Women’s Advertising Club treu geblieben war.«
Frances konnte sich Dorothy nicht gebrochenen Herzens vorstellen. Ihre Freundin war für so etwas doch viel zu unabhängig und intelligent. Was, wenn dieser George von der Front zurückgekehrt, um ihre Hand angehalten und sie in ein hübsches Haus mit weißem Gartenzaun eingesperrt hätte? Sie hätte sich schon nach wenigen Wochen zu Tode gelangweilt.
Dorothy war die Tochter von J.B. Dignam, Zeitungsmann und Pionier der Werbebranche. Sie war zwanzig Jahre alt gewesen, als er starb, und hatte seitdem für sich und ihre Mutter den Lebensunterhalt verdienen müssen. Früher hatten sie in Swarthmore, Pennsylvania, gewohnt; jetzt im Hotel Parkside in Manhattan. Wie Dorothy das bezahlen konnte, war Frances schleierhaft.
Nach fünf Jahren bei Ayer bekam man ein kleines Dankeschön. Es war eine Medaille mit dem Firmenmotto: KEEPING EVERLASTINGLY AT IT BRINGS SUCCESS – dranbleiben führt zum Erfolg. Wenn Frances das Ding bei einem Kollegen sah, dachte sie nur: Gute Idee. Wenn sie uns dafür auch noch anständig bezahlen würden, wäre alles wunderbar.
In der Branche sagte man über die Werbeagentur: Für Ayer zu arbeiten ist ein Traum, man muss es sich nur leisten können.
Frances war zum Großteil in Philadelphia aufgewachsen. Es hatte ihr an nichts gefehlt, aber sie hatten auch nicht im Überfluss gelebt. Die Familie hatte ein Dienstmädchen namens Alberta gehabt, von dem Frances backen und Zöpfe flechten gelernt hatte. Ihr Vater, Sohn irischer Immigranten, war Vorsteher in einem Kohlenlager. Die Familie ihrer Mutter stammte auch aus Irland, hatte sich aber in Kanada niedergelassen, wo sie eine sehr erfolgreiche Baufirma aufgebaut hatte, die in ganz Ontario Wolkenkratzer hochzog. Da oben im Norden waren die Pigotts allseits bekannt, in den Staaten kannte sie niemand. Ob Kanada oder Sansibar, hatte Frances’ Mutter oft gesagt, mache für US-Amerikaner keinen Unterschied: Sie hatten keine Ahnung, was jenseits der Grenzen vorging.
Als Frances’ Vater zu Beginn der Wirtschaftskrise die Arbeit verlor, mussten sie Alberta entlassen. Sie zogen nach Hamilton in Kanada, in die Heimatstadt ihrer Mutter. Damals war Frances fünfzehn. Erst fünf Jahre später hatte sich ihre Lage so weit verbessert, dass sie in die USA zurückkehren konnten. In Pennsylvania angekommen, kauften ihre Eltern Longview Farm, ein ausgedehntes Anwesen in Media, auf dem sie jetzt Pferde und Ziegen züchteten.
Der pubertierenden Frances war es schwergefallen, ihre Freunde zurückzulassen und sich an ihre Cousins und Cousinen zu gewöhnen, die in Kanada ein luxuriöses Leben führten. Mit der Zeit hatte sie sich aber eingewöhnt und war dort glücklich.
In Kanada waren sie und ihr Vater Außenseiter gewesen, was sie einander nähergebracht hatte. Frances war ein Einzelkind, und wenn ihr Vater sich, wie die meisten Männer, einen Sohn gewünscht haben sollte, hatte er sie das nie spüren lassen. Sie war für ihn weder Mädchen noch Junge, sondern einfach sein Ein und Alles, sein Liebling. Was auch immer Frances in den Sinn kam, er unterstützte sie dabei. Und wenn sie auf etwas keine Lust hatte, war das auch in Ordnung. So hatte er sie vor irischem Volks- und gemeinem Paartanz sowie unzähligen Abendgesellschaften bewahrt, Verpflichtungen, denen ihre Cousinen schutzlos ausgeliefert waren.
Als Mädchen hatte Frances Kurzgeschichten geschrieben, die ihr Vater sorgfältig gelesen hatte, bevor er ihr ehrlich und offen gesagt hatte, was er davon hielt.
»Aber du bist doch kein Lektor«, hatte ihre Mutter geschimpft. »Du bist ihr Vater. Deine Aufgabe ist es, die Geschichten toll zu finden, und basta.«
Aber Frances hatte nichts gegen seine Kritik, denn sie versüßte ihr jedes Lob. Außerdem fühlte sie sich dadurch wie eine echte Schriftstellerin.
Mit sechzehn übernahm sie bei einem Blättchen in Ontario eine Modekolumne. Damals ging sie noch zur Schule. Sie verkaufte die Werbeflächen, schrieb die Texte und verdiente damit mitten in der Wirtschaftskrise fünfundvierzig Dollar in der Woche. Jetzt hatte Frances Blut geleckt: Mit dem Schreiben Produkte an den Mann zu bringen war genau ihr Ding. Und ihr eigenes Geld zu verdienen auch. Ihr Vater war stolz auf sie.
Im Rückblick betrachtete Frances ihre Zeit in Kanada als eine gute Vorbereitung auf die Arbeit bei Ayer. Der Firmenchef Harry Batten war ein Selfmademan und stellte gerne reiche Absolventen amerikanischer Eliteuniversitäten ein, mit Vorliebe die aus Yale. Die meisten ihrer Kunden hatten auch einen solchen Hintergrund und trugen Namen wie Pont und Rockefeller. Frances war unter den Textern die Einzige, die nicht zur Uni gegangen war, aber ihr Selbstbewusstsein stand dem der anderen in nichts nach, und so schien es niemandem aufzufallen.
Batten gab gerne damit an, dass Ayer Mitarbeiter aus jedem der achtundvierzig Staaten hatte.
Wow, aus jedem Bundesstaat ein weißer Protestant, dachte Frances dann. Bravo! Für Katholiken hatte die Agentur wenig übrig, und Juden kamen überhaupt nicht in Frage. Aber das war nicht ungewöhnlich. Dass sie katholisch war, behielt Frances für sich. Sie meldete sich nur ein einziges Mal im Jahr krank, und zwar am Aschermittwoch.
Die ersten vier Jahre bei Ayer waren wie im Flug vergangen, und Frances’ Großmutter fragte jedes Weihnachten nachdrücklicher, wann sie sich endlich niederlassen und eine Familie gründen würde. Ihre Eltern hatten sich im Urlaub auf den Thousand Islands kennengelernt und 1911 geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war ihre Mutter achtundzwanzig und ihr Vater dreißig, für damalige Verhältnisse ungewöhnlich alt. Frances wurde erst vier Jahre später geboren. Ihre Mutter erinnerte sich noch gut an die besorgten Fragen ihrer älteren Verwandten, den Vorwurf, sie habe zu spät geheiratet und mit dem Kinderkriegen zu lange gewartet. Das alles hatte sie sehr verletzt. Aus diesem Grund hatte sie Frances lange Zeit damit in Ruhe gelassen. Als Frances dann das Alter erreichte, in dem ihre Mutter es angebracht fand, nun doch ein wenig Druck zu machen, blieb dafür zum Glück nicht mehr viel Zeit, denn Frances war schon fast zweiunddreißig, also in einem Alter, in dem die Familie schon jegliche Hoffnung aufgegeben hatte. Von einem Tag auf den anderen war sie nicht mehr der bemitleidenswerte Spätzünder, sondern eine alte Jungfer – was für eine Erleichterung.
Frances arbeitete bei der größten Werbeagentur der Welt. Ihre Arbeit interessierte sie viel mehr als alle Männer zusammen, mit denen sie je ausgegangen war. Sogar Nächte wie diese, in denen sie, angetrieben von der Angst, ihr könne diesmal doch nichts einfallen, bis in die Morgenstunden arbeitete – sogar das gefiel ihr.
Die Ironie der Sache war ihr nicht entgangen: Das größte Talent von ihr, einem überzeugten Single, war es, Paare vom Kauf eines Verlobungsrings zu überzeugen.
Als Frances ’42 bei Ayer eingestellt wurde, waren über hundert Mitarbeiter im Krieg – zehn Prozent aller Angestellten. Damals nahmen sie nur Aufträge von Boeing und dem Militär an. Werbung für Luxusgüter galt als geschmacklos, und von Juni 1942 bis September 1943 beschränkte sich die De-Beers-Werbung darauf, auf den Beitrag der Firma zu den Kriegsanstrengungen durch die Bereitstellung von Industriediamanten hinzuweisen. Nach Kriegsende nahmen sie die Schmuckwerbung wieder auf, zunächst aber noch sehr zurückhaltend. 1945 startete Frances dann eine Kampagne, wie sie noch nie dagewesen war. Die Anzeigen berichteten von den Hochzeiten echter GIs, deren Rückkehr ins Zivilleben und zu den Mädchen, die sie dort zurückgelassen hatten. Begleitend zu den Hochzeitsfotos schrieb Frances einen Text, der die Geschichte des jeweiligen Paares erzählte. Und der selbstverständlich über Diamanten informierte.
Während des Krieges musste Ayer mehr Frauen einstellen, und zwar nicht nur für die Schreibstube, sondern auch für leitende Positionen. Da waren Dolores in der Produktion, Sally in der Medienabteilung, außerdem zwei Frauen in der Buchhaltung und natürlich Dorothy in Public Relations.
In der Textabteilung arbeiteten jetzt insgesamt dreizehn Männer und drei Frauen. Die Frauen sollten vor allem bei der Konzeption von Kampagnen mit einer weiblichen Zielgruppe helfen.
Im Fall von De Beers halfen Frances’ eigene Sehnsüchte ihr leider nicht weiter. Deshalb beobachtete sie ihre Kolleginnen, Freundinnen und Mitbewohnerinnen. Was war ihr größter Wunsch? Die Frage war leicht beantwortet: Sie wollten heiraten. Und was war ihre größte Angst? Allein zu bleiben. Der Krieg hatte beides, sowohl den Wunsch als auch die Angst, intensiviert. Das machte Frances sich zunutze. In ihren Texten suggerierte sie, dass ein Diamant Schutz bot: An ihrer Hand funkelt der Diamant wie eine Träne – eine Freudenträne. Das Versprechen in ihrem Blick spiegelt sich in dem Edelstein. Das Versprechen eines sanften Neuanfangs, eines Lebens voll Reichtum und Ruhe. Der Diamant gibt ihr Gewissheit, erhellt jede Minute des Wartens und entfacht in ihr eine tiefe Vorfreude auf den Anfang eines neuen, gemeinsamen Lebens.
Meistens sollten die Texte Männer ansprechen, schließlich würden sie die Diamanten kaufen. Ayer brachte eine Reihe eleganter Anzeigen für den Gentleman von heute heraus, in denen es um Erfolg und guten Geschmack ging und darum, dass beides durch einen Ring für die Liebste zum Ausdruck gebracht werden konnte. Selbst dann, wenn man weder Geschmack noch Erfolg hatte.
Eine Freundin von Frances hatte ihr von einem Brief ihres Liebsten erzählt, in dem er darüber gesprochen hatte, was aus ihr werden würde, sollte er nicht aus dem Krieg zurückkehren. Wie viele andere dachte er an den Tod. Also schrieb Frances: Nicht jeder Mann gründet eine Stadt, gibt einem Stern einen Namen oder teilt ein Atom. Nur wenige bauen sich selbst ein Denkmal, vor dem spätere Generationen staunend stehen und ausrufen: »Das war unser Vorvater. Dort steht sein Name. Und dies alles war sein Lebenswerk.« Doch in einem Diamanten kann sich jeder Mann auf ganz eigene Art verewigen.
Es war ein bisschen düster und bedrückend, aber Gerry Lauck war begeistert.
Frances machte kurz die Augen zu. Wenn sie nicht bald ins Bett kam, würde sie bei der morgendlichen Besprechung wie eine Vogelscheuche aussehen. Also was war denn jetzt mit dem Slogan? Sie breitete ein halbes Dutzend Zeitschriften, bei ihren Anzeigen aufgeschlagen, vor sich aus.
In der Vogue stand: Ihre Diamanten sprechen von Anmut und besitzen zeitlosen Charme.
In Collier’s: Tragen Sie Ihre Diamanten wie die Nacht ihre Sterne: in alle Ewigkeit. Denn die Schönheit dieses Edelsteins kommt der des Funkelns am Firmament gleich.
Und in Life: Aus dem Diamanten an Ihrem Finger erstrahlen Ihre Erinnerungen in alle Ewigkeit.
Die Ewigkeit wurde Frances anscheinend nicht mehr los. Sie schloss die Augen und sagte: »Lieber Gott, schick mir eine Idee.«
Dann kritzelte sie etwas aufs Papier und nahm es mit ins Schlafzimmer, wo sie es auf den Nachttisch legte. Sie zog sich weder um, noch legte sie sich unter die Bettdecke, sondern fiel einfach aufs Bett und wenige Sekunden darauf in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Als sie der Wecker drei Stunden später weckte, las sie als Erstes, was sie da geschrieben hatte: A Diamond Is Forever.
Erledigt.
Ihre Füße traten auf den kalten Holzfußboden, und sie hörte Ann durch den Flur ins Bad gehen. Im Fall ihrer Mitbewohnerin konnte die Verlobung nicht früh genug kommen.
Frances frühstückte und duschte eilig. Dann zog sie sich ein langärmeliges braunes Kleid an und würdigte den Spiegel keines Blickes. Der Anblick ihrer flachen, breiten Wangen und ihres albernen Grinsens würde sie ja doch nur enttäuschen. Manche Männer, mit denen sie ausgegangen war, hatten sie hübsch genannt, aber sie machte sich nichts vor. Sie war größer als die meisten ihrer männlichen Kollegen. Überhaupt passte sie nicht in diese Zeit, in der das zarte Geschlecht sittsam und zurückhaltend sein sollte. Hosentaschenformat eben.
Mit dem Zettel aus der vergangenen Nacht in der Hand stieg sie in die Bahn und fuhr in die Innenstadt. Am Washington Square angekommen, eilte sie über den Platz zum Ayer Building. Sie war spät dran.
Als 1934 die ganze Welt pleite war, hatte N.W. Ayer & Son die Ressourcen gehabt, sich direkt gegenüber vom alten Rathaus seinen dreizehnstöckigen Hauptsitz hinzustellen. Es war ein beeindruckendes Art-déco-Gebäude aus Sandstein.
Wie stolz sie gewesen war, als ihr Vater bei seinem ersten Besuch leise gepfiffen und gesagt hatte: »Wow, Mary Frances! Das lässt sich wirklich sehen.« Ihren vollen Namen benutzte er nur, wenn er es ernst meinte.
Jetzt zog sie an der großen Messingtür, die so schwer war, dass man sie bei der leichtesten Brise kaum öffnen konnte. Die Wände der Eingangshalle waren marmorverkleidet. Elegant, aber nicht überladen oder pompös. Genau wie die Firma, die hier zu Hause war.
Hinter der Tür saß der in die Jahre gekommene Portier an einem Tisch aus Eichenholz.
»Guten Morgen, gnädige Frau.«
»Guten Morgen.«
Frances wartete auf den Lift. Na komm schon.
Endlich öffnete sich die Tür, und vor ihr stand in enger Uniform und weißen Handschuhen die blonde Aufzugführerin.
»Zehnter Stock?«, versicherte sie sich wie jeden Morgen.
Frances nickte.
Kleine Momente wie dieser machten sie irgendwie stolz: Jemand, über den man rein gar nichts wusste, wusste etwas ganz Spezielles über einen selbst. Frances freute sich bis heute wie ein Kind darüber, dass sie einem Taxifahrer in dieser Stadt nichts weiter sagen musste als: Zum Ayer Building, bitte.
Sie trat aus dem Aufzug und ging auf die Schreibstube zu. In dem Holzkasten wirkten die Stenografin Alice Fairweather und ihre vier Mitarbeiterinnen wie eingepferchte Nutztiere. Frances kam sich immer ein bisschen blöd dabei vor, sie über die niedrige Holzwand hinweg anzusprechen.
»Guten Morgen, Fräulein Gerety«, grüßte Alice. »Was haben Sie heute für uns?«
Frances reichte ihr die Texte zur Flitterwochenkampagne: »Kann ich die bis zur Besprechung haben?«
»Wird gemacht.«
Frances konnte sich darauf verlassen, die fehlerlosen Texte pünktlich zurückzuerhalten, um sie rechtzeitig zum Design einen Stock tiefer weiterzugeben. Der Leiter der Kreativabteilung, Mr George Cecil, war ein Fanatiker, wenn es um fehlerfreies Englisch ging. Ein Mitarbeiter der Textabteilung hatte nach zehn Jahren bei Ayer eine Annonce mit einem Tippfehler in Druck gehen lassen. Cecil hatte ihn auf der Stelle entlassen.
Um fünf nach neun saß Frances am Schreibtisch.
Die morgendliche Besprechung war für zehn Uhr angesetzt. Dann würde Mr Cecil sich die neuen Ideen ansehen und Aufträge verteilen. Er war altmodisch und steif, aber bei Ayer verehrte man ihn dennoch bedingungslos. Er galt als der weltweit beste Texter. Aus seiner Feder stammten einige der berühmtesten Werbesprüche, darunter Down From Canada Came Tales Of a Wonderful Beverage für Canada Dry und They Laughed When I Sat Down At the Piano – But When I Started to Play! für Steinway.
Zwei Arbeitsplätze weiter sprach Nora Allen lautstark ins Telefon. Die Zellen des Großraumbüros hatten zwar hohe, braune Wände und Türen, aber keine Decken. Bei geschlossener Tür sah man niemanden, aber hören konnte man alles.
Frances versuchte sich auf ein Memo zu konzentrieren, das sie auf ihrem Schreibtisch gefunden hatte. Sie war müde. Irgendwann würde sie sich an normale Arbeitszeiten gewöhnen müssen, aber sie war abends immer so frisch. Vielleicht wäre die Nachtschicht in einer Zeitungsredaktion etwas für sie.
Ein paar Schluck Kaffee hätten sie jetzt gerettet, aber nachdem ein Artdirector eine Tasse über ein Original gekippt hatte, das am selben Tag in Druck hätte gehen sollen, hatte Harry Batten ein generelles Kaffeeverbot ausgesprochen. Und die Tatsache, dass der Kaffeefabrikant Hills Bros. einer ihrer wichtigsten Kunden war, machte das auch nicht erträglicher: Überall standen Kaffeeproben herum und warteten nur darauf, mit kochendem Wasser übergossen zu werden. Mr Cecil hatte als Teil einer Werbekampagne in den Zwanzigern das Konzept der coffee break, der Kaffeepause, amerikaweit etabliert. Wie ironisch: Im Ayer Building würde es zu Battens Lebzeiten keine Kaffeepausen geben.
Frances hörte zwei Stimmen im Flur. Eine von ihnen erkannte sie sofort als die eines schlecht gelaunten Mr Cecil.
»Wer brüllt hier so rum?«, fragte er genervt.
»Das ist wohl Nora Allen«, antwortete seine Sekretärin.
»Was zum Teufel denkt die sich dabei?«
»Ich glaube, sie spricht mit New York, Sir.«
»Kann sie da nicht das Telefon benutzen?«, spottete er.
Frances kicherte. Aber als Mr Cecils schlechte Laune sich in der Besprechung dann auf sie entlud, verging ihr das Lachen. Als sie ihren Slogan vorstellte, stand er von seinem Stuhl auf und ging unruhig auf und ab. Das war kein gutes Zeichen.
»Wieso sind Leute wie Sie überhaupt in die Schule gegangen, wenn sie Grammatik dann doch nur mit Füßen treten?«, warf er ihr vor. »Wo, bitteschön, ist denn das Adjektiv? A diamond is expensive, A diamond is hard, das ist alles wunderbar. Sie könnten sogar sagen, A diamond can cut stone. Aber das hier? Ein Adverb? Was soll das?«
Frances wollte gerade antworten, da sagte Cecil: »Was sagen Sie dazu, Mr McCoy?«
Frances’ Blick begegnete Chuck McCoys. Er war kein schlechter Texter, aber auch nicht der selbstbewussteste.
Chuck räusperte sich und sagte: »Jede Liebe beginnt mit der Hoffnung, dass sie ewig halten wird. Und darum geht es doch auch in der Ehe, nicht wahr? Die Beziehung soll für immer halten. Also ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht.«
Frances nickte ihm genau in dem Augenblick dankbar zu, in dem er sich Mr Cecil zuwandte und die Worte hinterherschleuderte: »Aber Sie haben natürlich recht, Sir: Grammatikalisch ist es völlig daneben.«
Sie schüttelte den Kopf. Blöder Schleimer.
Dann ging Frances zum Gegenangriff über: »Ich sehe das anders: Das Verb ›is‹ kann synonym für ›existieren‹ verwendet werden. In diesem Fall wäre ein Adverb passend. Aber bitte ändern Sie es, wenn es Ihnen nicht gefällt. Ich kann mich trennen.«
»Soll das ein Wortspiel sein, Frances?«, kommentierte Chuck.
Frances verdrehte die Augen: »Wenn wir gemeinsam dran arbeiten, finden wir bestimmt etwas Ähnliches, das besser funktioniert.«
Fast hätte sie noch erklärend hinzugefügt: Die Idee kam mir mitten in der Nacht und ich habe höchstens fünf Minuten damit verbracht.
»Ja, arbeiten wir dran«, sagte Mr Cecil.
In den folgenden drei Stunden knobelten sie an dem Slogan herum. Der Aschenbecher in der Mitte des Tisches füllte sich, und Frances knurrte der Magen. Mittlerweile wäre sie mit allem einverstanden gewesen, wenn sie nur zum Automaten hätte gehen können, um sich ein Käsesandwich zu ziehen.
Schließlich steckte Gerry Lauck den Kopf zur Tür herein und sagte: »Ich muss zum Flughafen, George. Wie sieht’s mit dem Slogan für De Beers aus?«
In einem Ton, als würde er Frances verpetzen, antwortete Mr Cecil: »Frances hat A Diamond Is Forever vorgeschlagen.«
Gerry sah nachdenklich zur Decke.
Schließlich sagte er: »Versuchen wir’s. Mal sehen, was der Kunde sagt.«
»Aber das ist doch kein richtiges Englisch«, meinte Mr Cecil.
Darauf zuckte Gerry nur mit den Schultern: »Ist doch nicht so wichtig, George. Wir brauchen nur etwas, das die Leute wiedererkennen.«
Erster Teil
1972
Auf dem Tisch im Flur lag ein Stapel mit fünfzig frankierten, an ein Postfach in New Jersey adressierten Briefumschlägen. Evelyn schob sie sich vom Tisch auf den Arm.
»Ich bin dann jetzt weg, Schatz«, rief sie.
»Fahr vorsichtig!«, antwortete Gerald aus dem Arbeitszimmer im hinteren Teil des Hauses.
»Ich werfe deine Teilnahmeformulare ein, ja?«
»Bist ein Engel.«
Als sie die Eingangstür gerade hinter sich zuziehen wollte, hörte sie ihn etwas Unverständliches rufen.
Sie trat wieder ins Haus: »Wie bitte?«
Keine Reaktion. Evelyn stöhnte. Sie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, ihn an einem Wochentag morgens im Haus zu haben. Jetzt ging sie am Salon, dem Wohnzimmer und dem Esszimmer für besondere Anlässe vorbei, wo sie auf einer leinenen Tischdecke schon das gute Geschirr ihrer Mutter für drei Personen gedeckt hatte. In der Mitte stand eine große Kristallvase, die sie später noch mit langstieligen Blumen bestücken wollte. Warum sie sich für ihren Sohn so viel Mühe gab, wusste sie selbst nicht. Nach dem, was er sich geleistet hatte, sollte sie ihm eigentlich eine Butterstulle in die Hand drücken und ihn draußen vor der Garage im Stehen essen lassen. Sie hatte ihre Unfähigkeit, Wut zu zeigen, schon immer für eine ihrer schlechtesten Eigenschaften gehalten.
Im Arbeitszimmer saß Gerald vor der Schreibmaschine, neben seiner Kaffeetasse stand ein Karton mit Briefumschlägen.
»Noch mehr?«, fragte sie stirnrunzelnd.
»Die hier sind für ein anderes Preisausschreiben. Dieser Spaghettifabrikant verlost eine einwöchige Radtour in der Toskana!« Seine Augen leuchteten, und in diesem Augenblick sah er genau so aus wie der kleine Junge auf dem Porträt, das früher im Wohnzimmer seiner Mutter gehangen hatte.
Im Alter von sechsundsechzig Jahren machte ihren Mann nicht der Anblick einer schönen Frau oder eines schnellen Flitzers kribbelig, sondern die Teilnahme an allen möglichen Preisausschreiben und Wettbewerben. Die eifrigen jungen Sekretärinnen, die ihm die Versicherungsgesellschaft zugeteilt hatte, hatten Evelyn immer leid getan. Sie hatten vermutlich gehofft, an wichtigen Vertragsabschlüssen zu arbeiten, und stattdessen Stunde um Stunde mit dem Adressieren und Frankieren seiner Rückportoumschläge verbracht.
Seit er im Ruhestand war, hatte sich sein Hobby zu einer Manie ausgewachsen. Normalerweise gewann er nicht, aber wenn es dann doch mal geschah, machte es alles nur noch schlimmer. Gerald war überzeugt, dass er die besten Chancen hatte, weil die meisten Leute nur hin und wieder an einem Preisausschreiben teilnahmen (und manche auch nie, dachte sie insgeheim), nämlich dann, wenn es etwas zu gewinnen gab, das sie wirklich haben wollten. Gerald aber nahm einfach an allen Verlosungen teil, und zwar seit über zwei Jahrzehnten. In den vielen Jahren hatte er einige nicht besonders aufregende Preise gewonnen: zwei Tickets für ein Baseballspiel der Red Sox, ein Kajak, einen grässlichen braunen Kühlschrank, den sie in die Garage verbannt hatte, eine Flasche Motoröl, ein Gemälde, das Hunde auf einem Segelboot darstellte, und lebenslänglich Lieferungen von Kaboom Frühstückszerealien, die weder er noch sie mochten.
»Vielleicht haben Sie schon gewonnen!« Wie oft ihr dieser Satz schon begegnet war. Die meisten Verlosungen gab es seit ein paar Jahren nicht mehr, seitdem eine Untersuchung der Federal Trade Commission ergeben hatte, was Evelyn schon lange vermutete: Die größten Preise waren fast nie vergeben worden. Was übrig blieb, waren Preisausschreiben von Supermärkten und Tankstellen im Rahmen von Werbekampagnen.
Eines davon nannte sich Pferderennen. Dabei bekam man beim Einkauf in einer Filiale von Shop & Shop einen vorgedruckten Wettschein. Das Pferderennen wurde dann wöchentlich im Fernsehen übertragen. Wenn das Pferd auf dem Wettschein gewann, bekam man den großen Preis. Jeden Freitag saß ihr Mann mit dem Zettel in der feuchten Hand und dem Herzen voll Hoffnung vor dem Gerät. Und Evelyn brachte es nicht fertig, ihn darauf hinzuweisen, dass die Rennen höchstwahrscheinlich aufgezeichnet waren und die Anzahl der Gewinner schon beim Druck festgestanden hatte.
Irgendwie war ihr das alles unangenehm. Sie hatten doch alles. Aber ihr war inzwischen klargeworden, dass es ihm gar nicht um die Preise ging, sondern ums Gewinnen.
»Eine Radtour?«, sagte sie jetzt. »Wann hast du denn das letzte Mal auf einem Fahrrad gesessen?«
»Na ja, als kleiner Junge mit verschorften Knien eben, aber darum geht es ja: Ich bin jetzt Rentner und nichts ist unmöglich!«
»Stimmt. Andererseits musst du deine Teilnahmezettel jetzt eigenhändig ausfüllen.«
»Ja, leider«, sagte er. »Wenn ich nur meine liebe Frau für den Job gewinnen könnte.«
Sie hob warnend den Zeigefinger: »Da kannst du lange warten. Aber genug jetzt. Was hast du eben noch gerufen? Das ist bei mir nicht angekommen.«
»Ich wollte fragen, ob ich im Haus irgendwas machen soll, während du weg bist.«
Evelyn lächelte. Der Ruhestand hatte Gerald verändert, wenn vielleicht auch nur seine Pläne und weniger seine Taten. Früher hatte er nie seine Hilfe im Haushalt angeboten. Doch wenn sie sich während der letzten Monate tatsächlich einmal dazu hatte hinreißen lassen, sein Angebot anzunehmen, hatte sie es bereut: Das Geschirr war zwar mit Spülwasser in Berührung gekommen und irgendwie getrocknet, aber sauber konnte man es nicht nennen, und von der Hecke hatte er kaum etwas übrig gelassen: Sie sah so kläglich wie ein frisch geschorener Pudel aus.
»Nein, nein. Aber nett, dass du fragst«, sagte sie.
»Die Betten oben sind schon gemacht?«, wollte er wissen. »Wo bringen wir ihn denn unter?«
Evelyn war augenblicklich angespannt.
»Er bleibt nicht über Nacht«, sagte sie.
»Ach nein?«
»Nein.«
Aus genau dieser Überlegung hatte sie ihren Sohn zum Mittagessen und nicht zum Abendessen eingeladen.
»Dabei stünden ja sechs freie Schlafzimmer zur Auswahl«, merkte Gerald an.
Sie sah ihn mit großen Augen an. Sie hatte in dieser Sache viele Zugeständnisse gemacht, aber in diesem Punkt würde sie hart bleiben. Dass Teddy kommen wollte, war ein gutes Zeichen, und sie hoffte, dass er zur Vernunft gekommen war. Aber wenn sie an seine Familie dachte, die seit fünf Monaten allein in ihrem Haus am anderen Ende der Stadt saß, fühlte es sich an, als wringe jemand ihr Herz aus wie ein Geschirrtuch.
Teddy hatte nicht gesagt, ob er heute in seinem Haus übernachten würde. Wenn nicht, sollte er sich doch ein Hotelzimmer suchen.
»Entschuldige. Ich wollte nicht –«, sagte Gerald, bevor sie ihn unterbrach.
»Nein, nein. Es ist schon in Ordnung.«
Teddy hatte eine Woche zuvor angerufen und seinen Besuch angekündigt.
»Ich hab was mit euch zu besprechen«, hatte er gesagt. »Außerdem haben wir Papas Ruhestand noch gar nicht gefeiert.«
Es hatte Evelyn traurig gemacht zu sehen, wie sehr dieser letzte Kommentar Gerald gefreut hatte. Ihr Mann hatte offenbar schon vergessen, dass sein Sohn es nicht für nötig gehalten hatte, zu der großen Abschiedsfeier aus Florida zu kommen, die Geralds Firma zwei Monate zuvor zu seinen Ehren gegeben hatte. Ihr Mann sah immer nur das Gute in seinem Sohn, und nichts, was Teddy tat, schien das zu ändern.
Gerald war davon überzeugt, dass Teddy herkam, um seine Ehe zu retten. Evelyn wollte auch daran glauben, aber sie hatte da ihre Zweifel. Warum hatte Teddy darauf bestanden, sie allein zu treffen, als sie vorgeschlagen hatte, Julie und die Mädchen auch einzuladen? Gerald meinte, dass Teddy vielleicht mit ihnen sprechen wolle, bevor er zu seiner Frau ging.
»Vielleicht hat er sogar vor, sich bei uns zu entschuldigen«, mutmaßte Gerald.
Zu diesem Kommentar nickte Evelyn nur. Harmonie war ihr wichtig, ganz besonders zu Hause. Gerald und sie stritten fast nie, und wenn es doch einmal dazu kam, beendete sie den Streit so schnell wie möglich und sagte innerlich ein Gedicht von Ogden Nash mit dem Titel »Kleiner Tipp für Ehemänner« auf, das, wie sie fand, genauso auf Ehefrauen zutraf.
Damit in Ihrer Ehe
Die Schale der Liebe stets randvoll stehe:
Hat man unrecht, gibt man’s zu
Hat man recht, sagt man nichts dazu.
Aber was in den letzten Monaten mit Teddy passiert war, hatte die Beziehung zwischen ihr und Gerald ungewöhnlich belastet. Für Gerald war es gar keine Frage, dass sie zu Teddy halten mussten, egal was geschah, und dass Teddy, wenn sie das taten, seinen Fehler irgendwann einsehen würde. Als Teddy ein junger Mann gewesen war, hatte Evelyn sich aus seinen Beziehungen herausgehalten und sich nicht nur einmal auf die Zunge gebissen. Seine erste Freundin war eine Trinkerin gewesen, und am Ende hatten die beiden wegen ihrer lautstarken Auseinandersetzungen in fast jeder Bar in Boston Hausverbot gehabt. Die nächste hatte man festgenommen, nachdem sie sich eine Prügelei mit ihrer Mutter geliefert hatte, und Teddy hatte sich die Kaution von Gerald leihen müssen. Aber dann hatte er Julie geheiratet, diese wundervolle junge Frau, und mit ihr zwei reizende Töchter in die Welt gesetzt.
Bis dahin hatte Evelyn immer darunter gelitten, dass ihr nur ein Kind geschenkt worden war. Sie hätte gerne noch fünf weitere adoptiert, wenn Gerald sie gelassen hätte. Und als Julie in ihr Leben trat, war es für Evelyn, als hätte sie doch noch die ersehnte Tochter bekommen. Die beiden lachten viel und tauschten Bücher und Zeitschriften. Julie bat sie immer wieder um ihre Rezepte, bis Evelyn sie schließlich alle per Hand abschrieb und Julie ihre gesamte Rezeptesammlung zu Weihnachten schenkte. Die zehn Jahre, die ihr Sohn jetzt verheiratet war, gehörten zu den schönsten ihres bisherigen Lebens. Zum ersten Mal kam ihr das Haus nicht leer vor. Ein- bis zweimal pro Woche traf sich die ganze Familie zum Abendessen. Sonntags nach dem Gottesdienst fütterten die Mädchen die Enten im Gartenteich mit altem Brot, während Julie und sie es sich plaudernd mit einer Karaffe frischer Limonade auf der Veranda gemütlich machten. Einmal im Jahr machten sich die vier Damen richtig fein und gingen zum Tee ins Ritz. Dann waren auch die Lieblingspuppen der Mädchen dabei und wurden mit winzigen Schlucken Earl Grey aus zarten Porzellantässchen verwöhnt.
Evelyn und Julie hatten sich in der Highschool kennengelernt, an der sie unterrichteten. Zunächst hatte sie Julie beobachtet und schnell gesehen, wie leicht diese große, schlanke junge Frau Zugang zu den Schülern fand und wie viel Freude sie am Umgang mit ihnen hatte. In der Mittagspause waren die männlichen Kollegen verzweifelt darum bemüht, einen Platz neben ihr zu ergattern. Evelyn hatte sofort an Teddy gedacht. Das war genau die Richtige für ihn: Sie war kinderlieb, beständig und hatte ein gutes Herz.
Als Evelyn nach ein paar Wochen ein Gespräch mit dem Mädchen anknüpfte, war sie so nervös, als hätte sie sich selbst in die junge Frau verliebt. Sie erfuhr, dass Julie drei Monate zuvor aus Oregon hergezogen war und hier bisher kaum jemanden kannte. Sie war die Älteste von vier Geschwistern, die Tochter eines Akademikerpaares, das irgendwann in den Fünfzigern eine Kirschplantage aufgebaut hatte.
Dann hatte Evelyn ihre beste Freundin in ihre Pläne eingeweiht. Ruth Dykema unterrichtete Mathematik in der neunten Klasse und nahm kein Blatt vor den Mund.
»Verbrenn dir nicht die Finger«, sagte sie. »Deine Kuppelei könnte übel enden.«
Evelyn versuchte, sich das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, und ignorierte die Frage, ob die Warnung ihrer Freundin etwa etwas damit zu tun hatte, dass sie ihren Sohn für unzumutbar hielt. Aber weil Ruthie ihrem eigenen, hingebungsvollen Sohn sehr nahestand, verletzte Evelyn ihr Kommentar doch sehr.
Evelyn wollte doch auch für Julie nur das Beste. In diesen Zeiten bekam eine unverheiratete Frau mit Mitte zwanzig oft gar keinen mehr ab. Und Julie war doch schon dreiundzwanzig.
»Sie müssen unbedingt zu meiner kleinen Feier am nächsten Wochenende kommen«, hatte Evelyn am nächsten Tag in der Mittagspause zu Julie gesagt. Da würde sie die beiden einander vorstellen. Ihr war klar, dass man so etwas nicht erzwingen konnte, aber ein bisschen nachhelfen war doch nicht verboten.
Vor Sorge darum, wie man die beiden am besten miteinander ins Gespräch bringen könnte, tat Evelyn in der Nacht vor der Feier kein Auge zu. Wenn Teddy Wind davon bekam, dass Evelyn die Begegnung geplant hatte, würde er von Julie nichts mehr wissen wollen. Deshalb war Evelyn erleichtert, als die beiden zufällig gleichzeitig ankamen und sich schon vor dem Haus einander vorstellten. Als Evelyn die Tür öffnete, standen sie nebeneinander, und Teddy strahlte, wie sie ihn seit Jahren nicht hatte strahlen sehen.
Die beiden kamen bald zusammen, und sechs Monate später waren sie verlobt. Manchmal fragte Evelyn sich, ob Teddy Julie über seine Vergangenheit aufgeklärt hatte, oder ob es ihre Verantwortung war, dem Mädchen reinen Wein einzuschenken. Am Ende beschloss sie aber, sich darüber keine Gedanken zu machen, denn Julie schien ihn geheilt zu haben. Damals dachte Evelyn, dass ihr Sohn vielleicht einfach ein Spätzünder sei. Die Vorstellung, dass Teddy über die Jahre die gleiche Entwicklung wie sein Vater nehmen könnte, beruhigte sie. Dann kamen die Kinder, und für Evelyn war die Sache damit besiegelt. Jetzt gab es keinen Grund mehr zur Sorge, hatte sie gedacht. Wie hatte sie nur vergessen können, dass man im Leben nie sagen konnte, was als Nächstes kam.
Im vergangenen Frühjahr hatte sie es dann von Melody, der älteren ihrer beiden Enkelinnen, erfahren.
»Papa war auf Geschäftsreise in Neapel und da hat er sich verliebt.« Das hatte sie einfach so gesagt, als Evelyn mit einem Strauß Tulpen aus ihrem Garten vorbeigekommen war und ihre Schwiegertochter in Tränen aufgelöst am Küchentisch angetroffen hatte.
Evelyn strich Julie übers Haar, dann schenkte sie sich und ihrer Schwiegertochter Brandy ein. Sonst trank sie tagsüber nie, aber die Situation schien es zu verlangen. Sie versicherte Julie, das Ganze sei bestimmt nichts als ein dummer Fehler, den Teddy nach kürzester Zeit bereuen und für den er unweigerlich tausendfach um Verzeihung bitten würde.
»Er hat angerufen. Er will erstmal eine Zeitlang in Florida bleiben«, erklärte Julie, selbst noch ganz fassungslos. »Er hat gesagt, dass er sich noch nie so gut gefühlt hat wie bei dieser Frau. Und als ich wissen wollte, was das heißen soll, hat er gesagt, dass er sich bei ihr wie ein richtiger Mann fühlt. Und so frei. Er war richtig begeistert. Als würde er erwarten, dass ich mich für ihn freue.«
»Er muss den Verstand verloren haben«, sagte Evelyn.
An jenem Abend kochte Evelyn für sie und blieb, bis die Mädchen im Bett waren. »Morgen früh ruft er an und bittet dich um Verzeihung. Da bin ich mir ganz sicher«, sagte sie und fragte sich noch, ob er wieder mit dem Trinken angefangen hatte. Am liebsten hätte sie sich für ihn entschuldigt, wäre vor Julie auf die Knie gesunken und hätte sie angefleht, ihm zu verzeihen, aber das war natürlich Unsinn.
Als Evelyn nach Hause kam und Gerald alles erzählte, sagte der nur: »Was für ein Schlamassel.«
»Wie konnte er das nur tun, Gerald? Und was machen wir jetzt? Vielleicht solltest du nach Florida fliegen und ihn zur Vernunft bringen.«
Sie war davon ausgegangen, dass er die Sache genau wie sie sehen würde, aber Gerald hatte sie nur traurig angeschaut und den Kopf geschüttelt: »Wir müssen uns da raushalten, Evie. Wir können uns nicht auf Julies Seite schlagen. Er ist doch unser Sohn.«
Eine Zeitlang hatte sie den Rat ihres Mannes ignoriert und jeden Abend mit Julie an einer neuen Strategie gearbeitet, um Teddy zurückzugewinnen. Bis Julie plötzlich nicht mehr zwischen Evelyn und ihrem Sohn zu unterscheiden schien. Ab diesem Zeitpunkt bekam sie ihre Enkeltöchter immer seltener zu Gesicht, und irgendwann wollte Julie gar nicht mehr mit ihr sprechen.
Evelyn warf einen Blick auf die Uhr auf Geralds Schreibtisch. Um eins wollte Teddy kommen, also blieben ihr noch knappe vier Stunden, um das Fleisch zu besorgen, Blumen und Kuchen zu kaufen, das Mittagessen in den Ofen zu schieben und sich umzuziehen.
»Ich muss los, Liebling«, sagte sie. »Bis später.«
Gerald ging zu ihr und legte ihr die Hände auf die Schultern: »Was immer heute passiert: Wir schaffen das.«
Sie schenkte ihm ein warmes Lächeln: »Ich weiß.«
Als sie wenige Minuten später den Wagen startete, war sie voller Hoffnung. Sie musste jetzt positiv denken. Eigentlich war es nicht ihre Art, sich anderer Leute Sorgen aufzuladen. Noch vor einer Woche, vor Teddys letztem Anruf, hatte sie geglaubt, dass er vielleicht nie zurückkommen würde. Und jetzt war er schon fast wieder da. Eines Tages würde diese Zeit im Rückblick vielleicht nichts als eine dunkle Episode sein, vergangen und vergessen. Männer machen Fehler, und wenn sie um Vergebung bitten, dann vergeben Frauen ihnen. Das war doch nichts Neues.
Sie blieb noch einen Moment sitzen, um sich an dem klaren Herbsttag zu erfreuen. Die Blätter wurden schon bunt, und in der ganzen Stadt leuchteten die Bäume orange, rot und golden. Evelyn musste bei jeder Fahrt aufpassen, um nicht zu lange hinzustarren und am Ende noch im Graben zu landen.
Das anderthalb Hektar große Waldgrundstück in Belmont Hill, auf dem, von der Straße weit zurückgesetzt, ihr Haus stand, von dem aus man den Gartenteich glitzern sah, war ein Geschenk Gottes. Das Anwesen hatte den Herbst willkommen geheißen: Die bunten Blätter sahen vor der würdevollen Backsteinfassade einfach zauberhaft aus, und wegen der starken Regenfälle der letzten Zeit war der Rasen saftig und grün, besonders jetzt, nachdem die Jungs vom Gärtnereibetrieb O’Malley ihn zwei Tage zuvor gemäht hatten. Die ausladenden Flieder- und Rhododendronbüsche waren lange verblüht, aber ihr Blattwerk war noch sehr schön. Einige Jahre zuvor hatte sie hinter dem Haus Stauden und Rosenbüsche gepflanzt und einen Gemüsegarten angelegt. Gartenarbeit war ihre Leidenschaft. Einmal pro Woche arbeitete sie ehrenamtlich beim Arnold-Arboretum, dem botanischen Garten der Harvard University, machte Führungen für Schulklassen, organisierte die jährliche Benefizveranstaltung und bot auch Führungen zu denkmalgeschützten Anwesen in Massachusetts an, ihr eigenes eingeschlossen.
Evelyn öffnete das Autofenster und ließ die frische Luft herein. Auf dem Beifahrersitz lag Geralds Post, daneben die Liste mit ihren Erledigungen und ihr Portemonnaie. Im Radio lief eine vertraute, schöne Melodie aus Dvořáks Neunter, Aus der Neuen Welt. Sie drehte das Radio lauter und fuhr die lange Einfahrt zur Straße hinunter.
Ihr erster Halt war bei der Post, wo sie Geralds Teilnahmescheine einwarf. Diesmal gab es einen Plattenspieler zu gewinnen. Mit dem Geld, das Gerald für Briefmarken ausgab, hätte er sich einen kaufen können. Na egal.
In der Innenstadt angekommen, parkte sie vor dem Buchladen, nahm ihre Sachen und überquerte die Leonard Street auf dem Weg zum Sage’s-Market-Supermarkt ein paar Häuser weiter. Als sie an der Eingangstür ankam, spazierte gerade Bernadette Hopkins heraus, an ihrer Hand ein kleines Mädchen mit Zöpfen. Zehn Jahre war das schon wieder her. Bernadette hatte ein paar Kilo mehr auf den Hüften und trug ihr Haar hochtoupiert, aber das kindliche Gesicht hatte sich überhaupt nicht verändert. Evelyn erinnerte sich an jeden einzelnen ihrer Schüler. Viele von ihnen meldeten sich auch noch Jahre, nachdem sie in ihrer Klasse gesessen hatten, regelmäßig bei ihr, luden sie zu ihren Hochzeiten ein und schickten ihr dutzendweise Weihnachtsgrüße mit Fotos vom Neuzuwachs. Evelyn bewahrte jeden Brief in einer Kiste auf dem Dachboden auf.
»Frau Pearsall!«, sagte Bernadette und wandte sich dem Kind zu. »Rosie, das ist Frau Pearsall. Sie war meine Lieblingslehrerin.«
»Bitte, jetzt können Sie mich doch Evelyn nennen«, sagte sie lächelnd.
»Auf keinen Fall. Niemals. Das geht nicht.«
Evelyn lachte. So reagierten die meisten ihrer ehemaligen Schüler.
»Sind Sie zu Besuch bei der Familie?«, fragte sie.
Bernadette nickte: »Eine Cousine aus Newton hat gerade ein Kind bekommen.«
»Und wo leben Sie denn jetzt?«
»Wir wohnen in Connecticut. In Darien. Mein Mann ist da aufgewachsen. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Er war in Notre Dame, und ich natürlich in St. Mary.« Sie wandte sich wieder dem Kind zu: »Und Frau Pearsall hat die Empfehlung geschrieben.«
Evelyn unterdrückte ein Grinsen. Es war unwahrscheinlich, dass das Mädchen sich dafür auch nur im Entferntesten interessierte. Wahrscheinlich wollte Bernadette Evelyn einfach nur wissen lassen, dass sie es nicht vergessen hatte.
»Sie waren wirklich unsere absolute Lieblingslehrerin«, fuhr sie fort. »Erinnern Sie sich noch an Marjorie Price? Sie arbeitet jetzt in der Redaktion von Ladies’ Home Journal in New York. Sie erzählt allen, dass sie das mit dem Schreiben Ihnen zu verdanken hat.«
»Oh, das ehrt mich aber sehr«, sagte Evelyn. »Grüßen Sie sie bitte ganz herzlich von mir. Haben Sie denn noch zu vielen Mädchen aus der Klasse Kontakt?«
Sie erinnerte sich, dass Bernadette Schulsprecherin gewesen war, und wenn sie vielleicht nicht die Allerhellste ihrer Klasse gewesen war, dann doch die Motivierteste. Sie war beliebt gewesen und jedem mit Freundlichkeit begegnet. Das war eine seltene Kombination.
»Klar!«, sagte Bernadette, »Wendy Rhodes und Joanne Moore sind auch Hausfrauen. Wir haben alle drei jeweils ein zweijähriges und ein vierjähriges Kind. Joyce Douglas ist Dentalhygienikerin geworden. Witzig, wenn man bedenkt, dass ihre Brüder immer große Hockeyfanatiker waren. Und was der armen Nancy Bird passiert ist, haben Sie sicher schon gehört, oder?«
Evelyn schüttelte den Kopf, obwohl sie es schon ahnte.
»Vor anderthalb Jahren war ihr Mann Roy aus Vietnam auf Heimaturlaub da. Bei der Gelegenheit hat er erzählt, dass der befehlshabende Offizier ihnen versichert habe, dass alle amerikanischen Soldaten innerhalb der nächsten sechs Monate endgültig nach Hause könnten. Dann flog er wieder rüber, und ein paar Wochen später ist er gefallen.«
Evelyn spürte das Gewicht dieser Nachricht. Arme Nancy. Und sie war doch noch so jung.
»Wie geht es ihr?«, fragte sie.
»Sie ist total am Ende. Sie hat jetzt einen kleinen Jungen. Von der Schwangerschaft hatte sie eine Woche vor Roys Tod erfahren.«
Evelyn war kurz ein bisschen überrascht. Das war wohl das Alter. In ihrer Jugend hätte es niemand gewagt, das Wort schwanger in der Öffentlichkeit auszusprechen.
Sie nahm sich vor, Nancy zu schreiben und herauszufinden, ob sie irgendetwas für sie tun konnte.
Bernadettes Stimme wurde wieder fröhlicher, als sie sagte: »Als ich hörte, dass Sie Belmont High verlassen würden, tat es mir für meine Nichten so leid. Die haben nicht so viel Glück wie ich. Meine Schwester wohnt nämlich noch in der Stadt, gleich bei meinen Eltern um die Ecke.«
Evelyn überlegte kurz, Bernadette zu fragen, ob sie Julie kannte – die beiden waren etwa im gleichen Alter –, aber Bernadette redete ohne Atempause weiter. »Sie sehen toll aus. Aber Sie waren ja schon immer so hübsch. Die Jungs waren alle in Sie verliebt, dabei waren Sie doch so –«
»Alt?«, schlug Evelyn vor.
»Na ja, älter als wir eben«, sagte Bernadette. »Aber Sie haben sich wirklich kaum verändert.«
Das hörte sie von vielen, obwohl es natürlich nicht stimmte. Seit dem College trug sie die gleichen langen Röcke und hochgeschlossenen Blusen und das Haar zu einem lockeren Dutt hochgesteckt. Es war immer blond gewesen, wie das von Julie und den Mädchen, aber in letzter Zeit hatte es einen schönen Silberton angenommen. Für eine Frau war sie mit einem Meter achtzig relativ groß und schlank, ohne dünn zu sein. Sie war Schwimmerin gewesen und hatte als Studentin für Wellesley an Wettbewerben teilgenommen.
Als vor neun Jahren ihre erste Enkelin geboren wurde, war sie in den Ruhestand gegangen, um Julie besser unterstützen zu können. Das hatte sie gern getan, dennoch fehlte ihr das Unterrichten sehr. Ihr liebster Tag im Jahr war immer der 1. September gewesen, wenn die Sommerferien zu Ende waren und sie wieder zur Schule gehen konnte, um sich auf die neuen Klassen vorzubereiten. Sie erinnerte sich noch genau an die alljährliche Vorfreude, ausgelöst durch den Geruch frischer Kreide, den Anblick der auf Bastelpapier geschriebenen Zitate, die sie jedes Jahr am schwarzen Brett anbrachte, und den Blick in das nagelneue Klassenbuch, in dem bisher nichts als eine Liste vielversprechender neuer Namen stand.
Sie hatte die Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen in Literatur unterrichtet. Viele Lehrer mieden diese Altersgruppe wie der Teufel das Weihwasser, aber Evelyn hatte die Arbeit große Freude gemacht. Denn auch die schwierigsten, herausforderndsten unter ihren Schülern hatten etwas zu geben, man musste nur Geduld mit ihnen haben. Viele Lehrer wollten sich damit keine Mühe geben, aber Evelyn tat es mit Leidenschaft.
Das einzige Kind, zu dem sie keinen Zugang hatte finden können, war ihr eigener Sohn. In diesem Punkt hatte sie völlig versagt. Nach ihrer Hochzeit hatte man von ihr erwartet, dass sie ihren Job aufgab, weil das die meisten Frauen ihrer Generation taten. Und so hatte sie es auch tatsächlich gemacht, zumindest eine Zeitlang, um sich um Teddy zu kümmern und auch, um in den letzten Jahren der Wirtschaftskrise jemand anderem die Chance auf eine Stelle zu geben. Zu jener Zeit waren berufstätige Frauen nicht gern gesehen, besonders nicht diejenigen, die Ehemänner hatten, die sie versorgen konnten. Die meisten Schulen stellten auch gar keine Frauen mehr ein.
Doch sie hatte sich die ganze Zeit über nach dem Klassenzimmer gesehnt, und als Gerald dann aus dem Krieg zurückgekehrt war, unterrichtete sie das erste Mal seit über zehn Jahren. Es war nicht üblich, dass die Frau eines Mannes von Geralds Position arbeitete, aber er kannte sie besser als jeder andere und wusste genau, was ihr das Unterrichten bedeutete.
Als Lehrerin konnte sie gut beobachten, wie sich die Schüler über die Jahre veränderten, und fand es manchmal seltsam und zugleich aufschlussreich, alle Fünfzehn- bis Siebzehnjährigen der Stadt an sich vorüberziehen zu sehen. Die Eltern veränderten sich auch, zum Glück zum Guten. Sie wusste, dass schlechte Eltern meist selbst auf eine kaputte Kindheit zurückblickten – es war ein Teufelskreis. Und dennoch verabscheute sie gewalttätige Eltern, die ihre Kinder ohne schlechtes Gewissen mit blauen Flecken an Armen und Beinen in die Schule schickten. Obwohl es damals üblich war, hatte sie ihren Sohn nie geschlagen und hätte nie zugelassen, dass Gerald es tat.
Ihre Freundin Ruthie arbeitete noch an der Schule und hielt Evelyn auf dem Laufenden. Kürzlich war sie mit einer Broschüre der Parent Teacher Association vorbeigekommen. Sie trug den Titel: »Mein Kind – ein potenzieller Hippie? Tipps zur Prävention und zum Umgang mit Betroffenen«.
Evelyn hatte die Liste der Warnhinweise vorgelesen:
1. Plötzliches Interesse an sektenähnlichen Vereinigungen und gleichzeitige Abwendung von gesellschaftlich anerkannten Religionen.
2. Unfähigkeit, persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten; Tendenz, Liebe nur innerhalb der »Gruppe« erleben zu wollen.
3. Hang zum pseudophilosophischen Gesprächsstil, bei dem auf Genauigkeit und Eindeutigkeit oft ganz verzichtet wird.
4. Hohe finanzielle Erwartungen in Kombination mit einem ausgeprägten Unwillen zu arbeiten.
5. Ein intensives, allerdings stets vages Interesse für Poesie und Kunst allgemein.
6. Missachtung aller etablierten Regierungsformen.
7. Selbstgerechtigkeit; absolute Unfähigkeit, Fehler einzugestehen.
8. Erhöhte Fehlzeiten in der Schule.
9. In der Partnersuche: Beschränkung auf Mitglieder anderer Glaubensrichtungen und Hautfarben.
Auf der letzten Seite der Broschüre waren noch Hinweise eines Psychiaters abgedruckt, die Ruthie, einen übertriebenen Akzent aufsetzend, vorlas: »Natürlich treten viele dieser Anzeichen auch bei vollkommen normalen Jugendlichen auf. Wenn jedoch eine Vielzahl der Symptome zusammentrifft, ist damit zu rechnen, dass ihr Kind sich zu einem ›Hippie‹ entwickelt. Äußere Anzeichen wie struppiges Haar und Kleidung von der Art des allgemein als ›Mod‹ bekannten Stils können auch Indikatoren sein, allerdings wird man durch sie allein noch kein ›Hippie‹. In manchen Fällen handelt es sich nur um eine vorübergehende Modeerscheinung. Wichtig ist der ständige Dialog mit dem Kind – in manchen Fällen kann dieser äußerst schmerzhaft sein –, um den jungen Menschen wieder zum richtigen Glauben und den richtigen Werten zurückzuführen. Die Betroffenen werden ihre Feindseligkeit dabei lange bestreiten. Bis diese Feindseligkeit überwunden ist, wird sich das Kind jedoch widersetzen. Zeigen Sie Verständnis und Toleranz. Die Pubertät ist in jedem Fall eine ganz besonders schwierige Phase.«
Ruthie hatte nur gelacht, aber Evelyn hatte an ihre Enkelin Melody gedacht, die schon in wenigen Jahren mit all dem konfrontiert sein würde. Sie befürchtete, dass es nie zuvor so schwer gewesen war, ein Teenager zu sein.
Bernadettes Tochter war mittlerweile unruhig geworden, zappelte herum und sagte schließlich: »Können wir endlich gehen, Mama?«
Aber Bernadette ignorierte das Kind und gab ihr großes Halloweenkürbisgrinsen zum Besten: »Und was machen Sie jetzt so? Haben Sie viel zu tun?«.
»O ja«, sagte Evelyn. »Mit zwei Enkeltöchtern ist man immer schwer beschäftigt.«