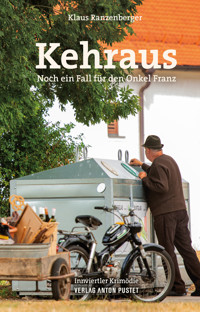Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Anton Pustet
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Onkel Franz für jeden Anlass Der Onkel Franz meldet sich zurück. Doch kaum wieder zu Hause, zurück von jener unfreiwilligen Odyssee, welche ihm im zuletzt erschienenen Band zugemutet wurde, schickt ihn sein Erfinder Klaus Ranzenberger erneut auf die Reise. Für die er allerdings sein geliebtes Innviertel nicht verlassen muss. Vielmehr ist es eine Reise durchs Kalenderjahr, auf die der Onkel Franz die geschätzte Leserschaft mitnimmt. Eine Sammlung von Anekdoten, Geschichten und Betrachtungen belegen auf höchst vergnügliche Weise, dass Feierlichkeiten wie etwa eine Hochzeit oder ein Geburtstag, Traditionelles – sei es der Fasching, das Oster- oder Weihnachtsfest – sowie Unternehmungen wie eine Urlaubsreise oder der Besuch des Oktoberfestes nicht immer reibungslos verlaufen müssen. Schon gar nicht dann, wenn der Onkel Franz und die Seinen mit einer gehörigen Portion Innviertler Eigensinn an die Dinge herangehen. Sollten die Leserinnen und Leser dort und da an selbst Erlebtes erinnert werden, sollte sich die eine oder andere Erkenntnis, aber vor allem Heiterkeit einstellen, so ist das vom Autor durchaus beabsichtigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Ranzenberger
Alles GutevomOnkel Franz
oder
der Innviertler im Jahreskreis
Für meine Eltern
Inhalt
Prolog
Ding-Dong
Das Neujahrsessen (Drama in einem Akt)
Zeitreise
Hausball
Fasten im Innviertel
Problemeier
Exkurs über die Feinheiten des Sprachgebrauchs
Habt’s schon ghört?
Gleiches Recht für alle
Hochzeit modern
All inclusive
Wellness
[sic!]
Erlkönig
Von null auf hundert
Die Vernissage
Unruhestand
Der Stammtischausflug
Alle heiligen Zeiten
Nikolo korrekt
Schenga dan ma uns nix
Sauber spät dran
Die Einladung
Epilog
Prolog
Der Onkel Franz meldet sich zurück. Zurück bei der geschätzten Leserschaft, zurück in seinem geliebten Innviertel. Hatte ich ihn doch im letzten Band, der „Odyssee eines Innviertlers“, auf eine Reise geschickt. Auf Wien hat er müssen, der Onkel, in Erbschaftsangelegenheiten. Ein bisserl ist er mir heute noch bös’, dass ich ihm Derartiges zugemutet habe. Denn, wie wir wissen, mag er es gar nicht, das Reisen. Andererseits, so hat er mir verraten, konnte er die eine oder andere Einsicht gewinnen auf seiner Irrfahrt. Einsichten, die der Onkel seinen Ansichten hinzugefügt, so manche davon auch etwas abgeändert hat.
„Reisen veredelt den Geist und räumt mit all unseren Vorurteilen auf“, wusste schon Oscar Wilde. Dem könnte man ein Zitat von Johann Nepomuk Nestroy entgegenstellen: „Meine Reisen, das war das letzte hinausgeworfene Geld! Ich hab’ sollen die Welt kennenlernen und hab’ gefunden, die Welt ist grad so, wie ich mir’s vorgestellt hab’.“ Die Onkel Franz’sche Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Wie dem auch sei, er ist wieder zurück. Besucht wieder in gewohnten Bahnen den Wochenmarkt, seine Stammtische und andere Schauplätze, wie wir sie schon aus dem ersten Onkel-Franz-Band, der „Typologie des Innviertlers“, kennenlernen durften. Trifft erneut auf langjährige Weggefährten, die geschätzte Verwandtschaft, aber auch auf bislang unbekannte Zeitgenossen.
Und so ist der „Innviertler im Jahreskreis“ auch wieder eine Sammlung verschiedener Betrachtungen und Anekdoten aus dem Universum des Onkels. Wurden diese jedoch damals – gleich dem großen Vorbild Friedrich Torberg – noch in scheinbar willkürlicher Abfolge aneinandergereiht, folgt vorliegendes Buch einem strengen zeitlichen Rahmen. Einem Rahmen, der, wie der Titel schon erahnen lässt, dem Jahreskreis geschuldet ist. Und so nimmt der Onkel Franz uns dann doch wieder mit auf eine Reise. In deren Verlauf wir uns mit ihm durch die Monate, die Jahreszeiten und deren jeweiligen Rituale sowie Feierlichkeiten bewegen. Und uns darin wohl mehr als einmal wiedererkennen werden. So läge es zumindest in der Absicht des Autors. Möge die Übung gelingen.
Dieses Buch wurde übrigens ebenso chronologisch geschrieben. In Echtzeit sozusagen. Will heißen, dass jede der folgenden Geschichten und Betrachtungen auch zu der Jahreszeit, in der sie spielt, von mir zu Papier gebracht wurde. Bei der Gelegenheit möchte ich mich herzlich bei jenen bedanken, die mir – meist unwissentlich – Inspiration waren, indem sie mich an ihren Erfahrungen zum jeweiligen Thema teilhaben ließen. Selbstverständlich wird im Folgenden das Inkognito meiner Informanten zu jeder Zeit gewahrt. Auch habe ich mir die literarische Freiheit genommen, dort und da Erfahrungen mehrerer zu einer zu verweben sowie auch die eine oder andere Abänderung oder Zuspitzung im Sinne einer satirischen Überhöhung vorzunehmen.
Bevor wir uns nun aber auf unsere Jahresreise mit dem Onkel Franz begeben können, ist noch kurz auf die Schreibweise der Dialektpassagen einzugehen. Haben wir in der „Odyssee eines Innviertlers“ davon abgesehen, das Idiom des Onkels buchstäblich wiederzugeben, kehren wir in vorliegendem Buch wieder zurück zur Praxis des ersten Bandes. Wie schon dort am Ende des Prologes beschrieben, folgt die Schreibweise dabei nun erneut nicht rein wissenschaftlicher Transkription, sondern vielmehr dem vagen Gefühl einer eher poetischen Lesbarkeit. Und so hoffen wir auch heute wieder, der geschätzten Leserschaft damit gedient zu haben.
Wir beginnen unsere Reise durchs Jahr – was nicht verwundern wird – am ersten Jänner. Somit ist der genaue Tag der folgenden Handlung bekannt, das Jahr, in dem sie spielt, bleibt unbestimmt. So wird es sich auch in allen weiteren Kapiteln verhalten. Man mag die jeweiligen Szenen in der Jetztzeit verorten oder aber auch in der jüngeren Vergangenheit. Manches könnte sich genauso gut in den Sechziger- oder Siebzigerjahren zugetragen haben oder eben erst im vorigen Jahr. Ich stelle es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, anheim, sich hier Ihren persönlichen Zeitrahmen zu imaginieren. Nur eines ist wie gesagt klar: Wir schreiben den ersten Jänner.
Der Titel dieser ersten Geschichte ist inspiriert von einem österreichischen Poeten der Neuzeit. Die Rede ist von Thomas Spitzer, dem Hauptverantwortlichen für die Texte der Musik-/Kabarett-Gruppe EAV. In seinem Werk „Ding Dong, Ding Dong, wer steht da vor der Tür?“ dichtete er:
„Mach nie die Tür auf, lass keinen rein.
Mach nie die Tür auf, sei nie daheim.
Ist erst die Tür auf, dann ist’s zu spät.
Denn du weißt nie, wer draußen steht!“
Ding-Dong
Der Onkel Franz schaut ein bisserl mitgenommen aus. Als wäre er etwas zu intensiv beim Stammtisch gewesen. Oder hat er gar recht wild Silvester gefeiert? Es war nämlich der Abend des ersten Jänners, an dem ich ihn in diesem Zustand – einem leicht leidenden, könnte man sagen – auf dem Stubensofa vorfand. Ich befragte ihn dahingehend. „Aber geh, Bua“, antwortete der Onkel, „Silvester is bei uns oiwei recht ruhig, und Stammtisch hob i erst wieder übermorgen.“ Der heutige Nachmittag wäre es gewesen, der ihn etwas desperat zurückgelassen habe. „Grad, wie i mi zur Jausen hinsetz’, is der Zirkus losgangen. I schenk’ mir grad mei Weißbier ein, da läut’s an der Tür.“
Zur Erklärung sei gesagt, dass dem Onkel Franz seine Abendjause heilig ist. Am Neujahrstag kann es vorkommen, dass er diese bereits am Nachmittag zu sich nimmt. Das Mittagessen ist schmal oder ganz ausgefallen, ein wenig hatte man doch gefeiert. Aber jetzt, gegen halb vier, sieht sich der Onkel in der Lage, ein Weißbier zu genießen, dazu etwas Speck, Käse und Bauernbrot. Vielleicht auch ein Scheiberl Sulz. Dementsprechend sakrosankt ist dieses Hochamt, umso störender der ungebetene Besuch.
Der Onkel Franz erhebt sich also widerstrebend, um die Tür zu öffnen. „Geh Franzl, bleib sitzen, i geh’ scho“, hätte die Tante jetzt gesagt, wäre sie zu Hause gewesen. Aber die ist vor einer Stunde „kurz auf einen Sprung“ zur Nachbarin rüber, das kann erfahrungsgemäß dauern. Noch bevor der Onkel jetzt sieht, wer da stört, hört er sie bereits – die Neujahr-Anbläser. Eh ein schöner Brauch, aber warum grad jetzt? Hilft nicht. Er grüßt freundlich, man kennt sich. Lauscht der dargebrachten Weise, nickt anerkennend. Denn schlecht spielen sie nicht, die vier Mann der Ortsmusik, die sich da in des Onkels Vorbau drängen. Bis auf einen, den mit der kleinen Trompete. Der trifft selten einen Ton, und das hat seinen Grund. Aber dazu später.
Für diejenigen unter der geschätzten Leserschaft, die mit dem Begriff Vorbau nichts anzufangen wissen, sei zuerst dessen architektonische Natur dargelegt. Unter einem Vorbau, auch Windfang genannt, haben wir uns eine Überdachung des Eingangsbereiches vorzustellen, an zwei Seiten von Mauern abgeschlossen, in die nicht selten lichtdurchlässige Glasbausteine eingelassen sind. Auf der dritten Seite ist das Gebilde offen. Da es an diesem ersten Nachmittag des Jahres mehr regnet als schneit, kommt den Musikern diese Möglichkeit des Unterstandes gelegen.
Warum der zuvor angesprochene Trompeter gar so schauerlich bläst, wird nun auch klar. Noch bevor nämlich der Kapellmeister, dem dies eigentlich zukäme, die üblichen Neujahrswünsche überbringen kann, tut er es. Das heißt, er versucht es.
„D’Ortsmusiburgham, Burghamerortsmusi, mechat Prostundaguatsneichs u…u…und“, er unterbricht sich selbst durch einen dezenten Rülpser, „Gsundheitundsoweidasowieso, u…u…und.“ Er verfranst sich etwas, verliert den Faden, was er durch seltsames Lachen zu überspielen sucht. „Hehehehehe!“ – „Is scho guat, Sepp“, übernimmt sein Vorgesetzter. „Da Franzl kennt si aus, goi Franz?“
Da liegt er richtig, der Onkel weiß Bescheid. Eine Geldspende wird nun von ihm erwartet sowie für einen jeden ein Schnapserl. Die Trompete hat anscheinend schon mehrere davon intus. Unter den Klängen des zweiten Musikstücks geht er ins Haus, um seine Börse und den Schnaps zu holen. Aus dem Tabernakel im Herrgottswinkel holt er die Flasche Grappa hervor, die ihm der Scharinger Jacques aus der Toskana mitgebracht hat, der gehört eh weiter. Der Onkel mag das Zeug nicht, die Flasche ist noch nahezu voll. Er begibt sich wieder zur Tür, nicht ohne noch einen sehnsüchtigen Blick auf seine Jause zu werfen. Da läutet es schon wieder. „Was ist denn, i komm’ eh scho“, denkt er sich, aber es sind nicht die Musiker, die ihn mit erneutem Klingeln antreiben wollen – wäre ja auch eine Frechheit gewesen –, es ist schon wieder wer da.
„Haaa – le – luu – ja, die heilgen drei König’ san da!“ Es wird jetzt ein bisserl eng in des Onkels Vorbau. Drei Kinder, eines davon trägt den Stern, und ein Erwachsener, alle in den traditionellen Kleidern der Weisen aus dem Morgenland, stehen da nun neben den Neujahr-Anbläsern. Trotz des schwarz angemalten Gesichts erkennt der Onkel Franz seinen Spezi, den Albert. Der gibt den Caspar, wohl zum ersten Mal. Beim Aufsagen des Gedichtes ist es nämlich er, der sich am wenigsten textsicher zeigt. Der Trompeter will helfen, versucht zu soufflieren. Das ist kontraproduktiv, bringt den Albert noch mehr draus. Nachdem dann der offizielle Teil der Sternsingerei mehr schlecht als recht vonstattengegangen ist, begrüßen sich die beiden Stammtisch-Freunde. Wie der Albert denn zu dieser Ehre gekommen sei, will der Onkel Franz wissen, und er erhält Auskunft. „Ja mei, Franzl, sie finden halt kaum nu Kinder, die mitgehn wollen, jetzt bin i eingsprunga. Drum san ma a scho heut’ da, dass ma bis zum achten alle Häuser schaffen. Und ’s Gsicht schwarz anstreichen, des is a an mir hängen blieben, da sind s’ dagegen, die Eltern vom Finn, von da Jessica und von da Naomi. Weil’s politisch ned korrekt wär’ oder so. Aber i glaub’, es is eher, weil’s beim Waschen so schwa obageht. Sog amoi, is des a Schnaps?“ Der Onkel versteht den Wink, geht nach drinnen, um ein weiteres Stamperl zu holen. Dabei kommt er wieder bei seiner Jause vorbei. Schnell schiebt er sich ein Stückerl Geselchtes in den Mund.
Ding-Dong. „Herrschaftzeiten, was is denn scho wieder!“ Noch kauend geht er zurück zur Tür. Obwohl schon leicht grantig, muss er dann doch lachen. Neben dem Albert steht da nun nämlich ein Neuankömmling – der, der gerade geläutet hat. Und der ist genauso schwarz im Gesicht wie der Sternsinger, aber halt von Natur aus. Stammt im Gegensatz zum Albert wahrscheinlich tatsächlich aus dem Morgenland. Es ist ein Paketbote, an seiner Jacke erkenntlich und an dem Packerl, das er auf dem Arm hat. Es ist an die Tante adressiert, das ist ungewöhnlich. Sie hat noch nie was bestellt, der Onkel Franz sowieso nicht. Trotzdem nimmt er es entgegen, unterzeichnet und bedankt sich. Nachdem diese Transaktion abgewickelt ist, wendet sich der Bote mit fragendem Blick an den dunkel Geschminkten, deutet auf dessen Gesicht. „Ist schon Fasching?“, will er in tadellosem Deutsch wissen. Der Albert erklärt den christlichen Brauch, die Miene des anderen hellt sich – sinngemäß gesprochen – auf.
Ein angeregtes Gespräch zwischen den beiden beginnt, alle stoßen mit ihren Schnapsstamperln an. Dem Neuankömmling wird auch eines angeboten, der lehnt ab. „Nein danke, ich darf nicht.“ – „Aaah“, lallt die Trompete, „wegn an Islam, goi?“ – „Keineswegs, mein Herr. Ich bin aramäischer Christ. Es wär’ eher wegen dem Führerschein, Sie verstehen?“ Dem Onkel ist das Ganze peinlich, er macht eine entschuldigende Geste und bietet dem Boten einen Tee an. Den dieser gerne annimmt, und so begibt er sich wieder ins Haus, um Wasser aufzustellen. Als er zurückkommt, haben die Musiker gerade die Kiste Bier entdeckt, die der Onkel Franz zwecks Kühlung im Vorbau aufbewahrt. Auf die entsprechende Bitte hin geht er Gläser holen und einen Öffner, langsam reicht ihm das Theater.
Ding-Dong. Der Onkel Franz hätte sich beinahe verschluckt. Er hat sich nämlich gerade etwas vom Weißbier genehmigt, zur Beruhigung. Auch ein bisserl was von der Jause wollte er zu sich nehmen. Sollen die da draußen doch ein paar Minuten ohne mich auskommen, hat er sich gedacht. Aber jetzt läutet es schon wieder. Er also erneut zur Tür.
Zu den drei Kindern der Sternsinger hat sich ein viertes dazugesellt. Auch maskiert. Es ist der Raifetshammer Marcel von schräg gegenüber. Der hat das Treiben in des Onkels Vorbau beobachtet und sich – in der irrigen Annahme, es wäre schon wieder Halloween – schnell sein Skelett-Kostüm übergeworfen. In dem steht er nun neben Caspar, Melchior und Balthasar und sagt seinen Text auf. „Süßes oder Saures!“, wiederholt er unablässig mit einer unangenehmen, krähenden Stimme, die der Onkel noch nie hat leiden können an dem Nachbarbuben. Er geht rein und holt ihm eine Senfgurke. Eine rechte Freude zeigt der Marcel nicht angesichts dieser Gabe. Noch bevor er sich aber darüber beschweren kann, verwickelt der Albert den Buben in ein Rekrutierungsgespräch. „Kommst halt nächstes Jahr zu uns, zur Jungschar. Da kannst di a verkleiden.“ Und zum Onkel Franz, auf die Senfgurke deutend: „Gibt’s a Jausen?“
Wer den Onkel kennt, weiß, dass sein Geduldsfaden eh recht dick ist, nicht so schnell reißt. An jenem ersten Jänner aber, da ist er schon recht strapaziert, dieser Faden. Dennoch geht der Onkel ruhig zurück ins Haus. Hat schon das Jausenbrettl in der Hand, um es der bunten Versammlung da draußen zu bringen. Besinnt sich aber in der gleichen Sekunde dann doch anders. Ja freilich, so weit kommt’s noch! Jetzt komm’ zuerst einmal ich dran, beschließt er und setzt sich an den Tisch. Schenkt sich Weißbier nach, nimmt einen tiefen Schluck. Richtet sich ein Brot mit Geselchtem und etwas Kren. Als er gerade genussvoll hineinbeißen will, ertönt erneut der Gong der Haustür-Glocke.
„Jahimmelherrschaftzeitennochamalwasisdennheitjetztreichtsaberbaldwassolldenndeswerisndesschowieder!“ Er schimpft selten, der Onkel Franz. Aber an dem Tag, angesichts dieser Besucher-Kaskade, die ihn da in beinahe biblischem Ausmaß heimsucht, und das dann auch noch bei seiner heiligen Jause, da verstehen wir, dass der erneute Gang zur Haustüre von gemurmelten Unmutsbekundungen begleitet wird.
Das Bild, das sich ihm nun in seinem Vorbau bietet, sei an dieser Stelle einmal zusammenfassend beschrieben. Die sternsingenden drei Kinder in ihren prächtigen Gewändern im angeregten Gespräch mit dem Skelett-Marcel, der mittlerweile doch an seiner Senfgurke lutscht. Zwei Nordafrikaner, ein echter und ein geschminkter, die mit Tee und Schnaps anstoßen. Vier bestens gelaunte Musiker, die sich mittlerweile alle auf den Alkoholpegel der Trompete vorgearbeitet haben und ab und zu ihren Instrumenten einzelne Töne entlocken. Eine Bierkiste, deren Inhalt sich bereits stark dezimiert hat, und eine auch beinahe leere Grappa-Flasche. Und davor, im Türrahmen stehend und dem Onkel mit leicht schief gelegten Köpfen freundlich entgegenblickend, zwei Herren mittleren Alters. Sauber gekleidet, mit Krawatte und Sakko.
Einer der beiden holt gerade ein Prospekt aus seiner Umhängetasche. Als der Onkel Franz schon sagen will, dass er keine weitere Versicherung brauche, wird ihm mitgeteilt, man wäre gekommen, um mit ihm über Gott zu sprechen. Grundsätzlich steht der Onkel Derartigem aufgeschlossen gegenüber. Aber er sucht sich seine Gesprächspartner dabei gerne selber aus. Sei es am Stammtisch, am Markt oder bei anderen Gelegenheiten. Aber sicher nicht an der Haustüre. Und sicher nicht heute.
All das will er den Zeugen Jehovas gerade mitteilen, da läutet es schon wieder. Aber kein Ding-Dong ist es, das nun ertönt, eher ein Rrring-Rrring. Das Telefon. Festnetz, versteht sich. Er macht den beiden Missionaren die Tür vor der Nase zu und nimmt drinnen den Hörer ab.
Meldet sich, seiner Laune entsprechend, nicht gerade überfreundlich. Bei meinem Glück heute ist das jetzt eine Umfrage, denkt er sich gerade, aber nein, Entwarnung. Es ist die Tante. Sie entschuldigt sich, dass sie so lange ausbleibt, man habe sich „verratscht“. Erkundigt sich nach seinem Wohlbefinden und kommt dann zum eigentlichen Grund ihres Anrufs.
Die Nachbarin würde gerade eine Jause richten und fragt, ob er nicht herüberkommen möchte. Eine Sulz gebe es und ein saures Rindfleisch. Geselchtes, Käse und Aufschnitt sowieso. „Gibt’s a Weißbier a?“ – „Ja freilich, Franzl, die kennt di ja. Was is, kummst umma?“ Natürlich kommt er, der Onkel. Er schleicht zur Haustür und dreht leise den Schlüssel um. Schlüpft ebenso leise in Schuhe und Weste und verdrückt sich heimlich durch den Hinterausgang. Im Garten steigt er über den Zaun und gelangt so ungesehen zur Nachbarin. Dort warten schon seine Gattin, eine herrliche Jause und ein frisch eingeschenktes Weißbier.
Ob und wie lange dem Onkel Franz seine ungebetenen Gäste ihre spontane Neujahrs-Party noch weitergefeiert haben, ist nicht überliefert. Als er mit der Tante zwei Stunden und drei Weißbier später heimgekehrt ist, waren sie auf jeden Fall schon alle weg und der Onkel hat sich gleich ein bisserl hinlegen müssen. Zusammenräumen und die Türglocke abmontieren wird er dann morgen. Wenn Sie ihn also in Zukunft einmal besuchen wollen, den Onkel Franz, dann müssen S’ beim Küchenfenster klopfen, gell.
Manchem geschätzten Leser mag ein derartig konzertiertes Zusammentreffen ungebetener Besucher eher unwahrscheinlich vorkommen. Ich aber sage Ihnen: Genau so und nicht anders hat es sich zugetragen. Und ich muss es wissen, ich habe das Ganze ja schließlich erfunden. Übrigens: Was in dem Packerl, das der Bote aus dem Morgenland beim Onkel abzuliefern hatte, drin war, bleibt vorerst ungeklärt. Vielleicht erfahren wir es in einer der nächsten Geschichten. Oder auch nicht, wer weiß.
So hat sich also der erste Tag des Jahres beim Onkel Franz abgespielt. In gänzlich anderer Umgebung, am selben Tag, wenn auch nicht unbedingt im gleichen Jahr, gestaltete sich der Neujahrstag ähnlich turbulent. Wenn auch auf durchaus andere Art.
Um dies zu beschreiben, begeben wir uns auf den Stadtplatz einer unserer Bezirkshauptstädte. Denn hier residiert sie, die Familie Haubinger. Stammlesern ist sie bekannt aus dem ersten Band, neu Hinzugekommenen sei das altehrwürdige Innviertler Kaufmannsgeschlecht kurz vorgestellt. Diplomkaufmann Gerold Haubinger nebst Gattin Irma betreiben im Parterre ihres ererbten Stadtplatzhauses ein feines Schreibwarengeschäft. Edelste Füller und handgeschöpftes Büttenpapier werden dort ebenso feilgeboten wie schnöde Journalhefte. Man beschäftigt eine stattliche Anzahl an Personal und rechnet sich selbst dem gehobenen Bürgertum zu. In den oberen Gemächern des Palais, dem privaten Refugium der Haubingers, befindet sich unter anderem der Salon, aus welchem an diesem ersten Jänner gerade eben die Melodien des Neujahrskonzertes herüberklingen in das angrenzende Esszimmer. Und eben dieses dient nun als Bühne des folgenden Dramas.
Das Neujahrsessen (Drama in einem Akt)
Auftretende Personen:
Diplomkaufmann Gerold Haubinger
Irma, seine Gattin
Elisabeth, sechzehnjährige Tochter der beiden
Leopold, Freund von Elisabeth
Sohn Konrad, sieben Jahre
Weitere Protagonisten werden zugunsten des
Spannungsbogens erst im Laufe der Handlung vorgestellt.
Ort der Handlung:
Großbürgerliches Esszimmer, Eiche und Nussbaum
Anmerkung:
Man spricht in einem der deutschen Hochsprache ähnlichen Jargon. Ein bisserl Salzburg, ein bisserl Schönbrunn. So hören sie sich selbst am liebsten, die Haubingers.
Erster (und einziger) Akt
Gerold Haubinger:
Wunderbar, wie das duftet. Erstklassig wie immer, dein Rinderbraten, liebe Irma.
Irma Haubinger:
Zu gütig, mein Lieber. Bin auch lang dafür in der Küche gstanden. Wenn mir auch die gute Martha etwas zur Hand gangen ist.
Gerold Haubinger:
No, dafür hat man ja eine Zugehfrau, nedwahr? Sag, wo ist s’ jetzt, die Martha, trägt s’ uns gar nicht auf heut’?
Irma Haubinger:
Ich hab’ ihr freigeben, nachdem s’ die Knödl und den Bratenansatz bracht hat. Soll ja auch was vom Neujahr haben, nicht? Aber sag du, mein Lieber, was hast’ da herinnen die getönte Brille auf?
Gerold Haubinger:
Bei der Clubfeier gestern is mir wohl was ins Aug’ gflogen, jetzt is’ a wengerl entzündet, fürcht’ ich.
Elisabeth:
Man riecht’s.
Gerold Haubinger:
Kind, was meinst?
Elisabeth:
Dass du eine Fahne hast, lieber Herr Papa. Man riecht’s bis daher.
Konrad:
Da Papa stinkt!
Irma Haubinger (streng):
Sissy, so spricht man nicht mit seinem Vater. Und du, Bub, was fällt dir ein? Halt den Mund und iss!
Leopold:
I mecht mi ja ned einmischen, oba an Mund hoitn und essen geht schlecht, ha?
Gerold Haubinger (nach einem stirnrunzelnden Seitenblick auf Leopold zu seiner Gattin):
Na ja, a bisserl was drunken hamma schon beim Korpsabend. War ja auch Silvester, gell.
Irma Haubinger (gekränkt):
Wo ich nie mitgehen darf. Weil’s noch immer keine Frauen zulasst, bei euerm komischen Verein. Immer bin ich allein an Silvester.
Gerold Haubinger:
Hab’ ich dir schon mehrfach erklärt, meine Liebe. Die „Eulalia“ ist halt a reine Männerverbindung, da kann ich nix dafür. Außerdem hätt’ ich auf Mitternacht angrufen bei dir, hat aber niemand abgnommen. Wo warst du?