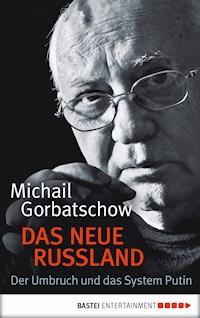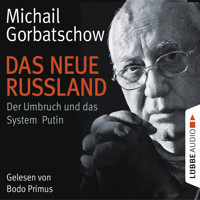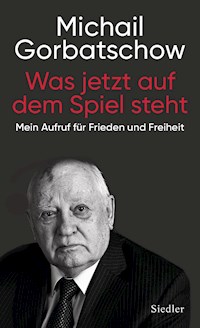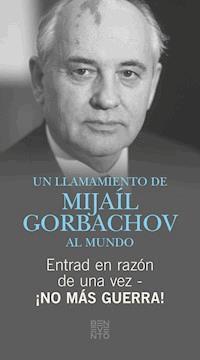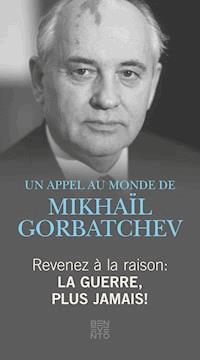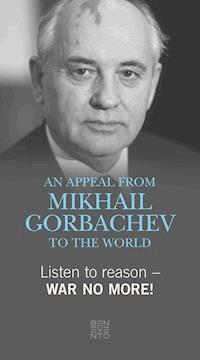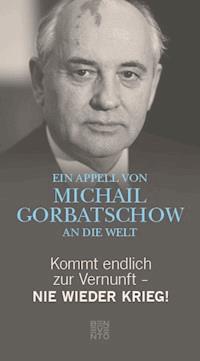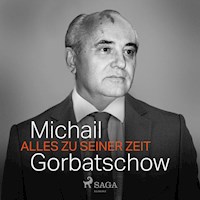
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die beeindruckende Autobiographie eines großen Staatsmanns und eine berührende Liebesgeschichte. Der Friedensnobelpreisträger, der das Ende des Kalten Krieges einleitete, lässt sein Leben Revue passieren: Er erzählt von den wichtigsten Stationen seines politischen Werdegangs und den für ihn prägendsten persönlichen Erfahrungen - das beeindruckende Zeugnis eines der mächtigsten Männer des 20. Jahrhunderts. Fast fünfzig Jahre lang lebte Michail Gorbatschow an der Seite seiner Frau Raissa, die er während des Studiums in Moskau kennenlernte. Beide verband eine innige Liebe und ein intensiver geistiger Austausch. Der Krebstod seiner Frau 1999 in Deutschland traf den einst mächtigsten Mann der Sowjetunion tief. In diesem Buch geht er unter anderem der Frage nach, ob er ihn hätte verhindern können. Anlässlich ihres Todes ruft er sich die aus heutiger Sicht wichtigsten Stationen seines Lebens ins Gedächtnis zurück. Flankiert werden seine Erinnerungen von Tagebuchaufzeichnungen, die kurz nach dem Tod seiner Frau entstanden. - Eine reife Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk, die durch Aufrichtigkeit überzeugt.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michail Gorbatschow
Alles zu seiner Zeit
Mein Leben
Aus dem Russischen von Birgit Veit
Hoffmann und Campe Verlag
Dem Gedenken an meine Frau
Prolog
Aus dem Tagebuch
Ein Jahr ohne Raissa. Wir, die Angehörigen und enge Freunde, haben uns heute versammelt, um den Grabstein zu enthüllen. Er stammt von dem Bildhauer Friedrich Sogojan. Eine farbige Marmorplatte – wie ein blühendes Feld. Große Steine. Die Inschrift: »Raissa Maximowna Gorbatschowa. 5. Januar 1932–20. September 1999«. Die Gestalt einer jungen Frau, die Raissa sehr ähnlich sieht. Sie bückt sich, um Feldblumen auf die Grabplatte zu legen.
Ein Jahr ist vergangen, das allerschwerste vielleicht. Mein Leben hatte seinen eigentlichen Sinn verloren. Ich brauchte Monate, um zu mir zu kommen. Was mich gerettet hat, ist die Nähe zu meiner Tochter Irina, meinen Enkelinnen Xenia und Anastasia sowie Freunde.
Nach Raissas Tod stellte ich für einige Monate meine Reisen und öffentlichen Auftritte ein. Ich verbrachte die ganze Zeit auf meiner Datscha. Nie zuvor habe ich mich so furchtbar einsam gefühlt. Fast fünfzig Jahre waren Raissa und ich zusammen, einer an der Seite des anderen, und nie haben wir das als Last empfunden, im Gegenteil: Es ging uns immer gut zu zweit. Wir liebten uns, obwohl wir auch unter vier Augen nicht groß darüber sprachen. Die Hauptsache war: Wir wollten all das bewahren, was uns in unserer Jugend zusammengebracht hatte. Wir verstanden uns und hüteten unsere Beziehung.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich schuld bin an Raissas Tod. Ich rufe mir alles ins Gedächtnis zurück, um herauszufinden, wie es möglich war, dass ich sie nicht habe retten können. Ich habe gesehen, wie sehr ihr die Ereignisse der letzten Zeit zusetzten: Wie konnte es geschehen, dass unanständige, gewissen- und verantwortungslose Menschen in unserem Land die Oberhand gewonnen hatten? Raissa kam ständig auf dieses Thema zu sprechen, und wenn ich ihr vorhielt, man könne nicht die ganze Zeit an ein und dasselbe denken, zog sie sich in ihr Schneckenhaus zurück und schwieg. Sie tat mir leid. Es quälte mich, dass sie litt.
Immer wieder kommt mir die Erinnerung an die letzte Nacht, die sie lebte, die Nacht vom 19. auf den 20. September. Raissa starb am 20. September 1999, um 2 Uhr 57. Sie starb ohne Schmerzen, lag im Koma. Wir konnten einander nichts zum Abschied sagen. Sie starb zwei Tage vor der geplanten Stammzellentransplantation aus dem Knochenmark ihrer Schwester Ljudmila – fünf Tage vor dem 46. Jahrestag unserer standesamtlichen Trauung in Moskau.
Bis zum Ende glaubte ich an ihre Rettung und konnte das Geschehene lange nicht fassen. Hilflos und verstört standen Irina und ich an ihrem Bett: »Geh nicht fort, Sacharka.[1] Hörst du?« Ich ergriff ihre Hände in der Hoffnung, sie würde mir vielleicht mit einem Händedruck antworten. Raissa schwieg – sie war tot.
Vor der Krankheit hatten Raissa und ich wiederholt über unsere Zukunft gesprochen. Einmal hörte ich von ihr: »Ich möchte nicht ohne dich zurückbleiben. Das ist kein Leben für mich. Du, du heiratest dann eben und lebst weiter.« Ich war erschüttert darüber, was ihr durch den Kopf ging. »Was redest du?! Wie kommst du darauf? Wieso sprichst du vom Tod? Du bist jung, schau dich im Spiegel an. Hör, was die Leute sagen. Du bist einfach müde!«
»Ich will keine alte Frau sein«, sagte sie oft. Als dann die Enkel kamen, musste entschieden werden, wie sie uns beide anreden sollten. Sie wollte »Babulja« genannt werden. »Babuschka, das klingt so klapprig, aber Babulja, da steckt doch Energie drin!« So war sie eben …
Raissa mochte den Spruch vom Alter einer Frau: »Kind, Mädchen, junge Frau, junge Frau, junge Frau, junge Frau – eine alte Frau ist eine tote Frau.«
In den letzten Jahren unseres Zusammenlebens träumte sie oft davon, dass einer von uns stirbt. Immer häufiger merkte ich, dass sie Angst hatte. Manchmal sagte sie: »Lass uns weniger reisen.« Es fiel ihr zunehmend schwer, weite Reisen mit mir zu unternehmen. Doch wie ich an ihren traurigen Augen ablas, fiel es ihr noch schwerer, allein zurückzubleiben.
In jener Nacht standen Irina und ich an ihrem Bett. Wir weinten und konnten nichts mehr machen.
Raissas Geburtstag. Sie wäre 69 Jahre alt geworden. In unseren Gesprächen über die Zukunft hat sie oft gesagt: »Wenn ich bis zum Anbruch des neuen Jahrhunderts und Jahrtausends leben würde, wäre das vollkommen ausreichend.« Sie hat dieses Ziel um drei Monate verfehlt. Dabei hatten wir einen Plan: Wir wollten das Jahr 2000 so begrüßen, dass wir es nie vergessen würden. Und da Irina und die Kinder noch nie in Paris waren, hatten wir vor, das Jahr 2000 auf den Champs-Élysées in dieser wunderbarsten Stadt der Welt zu begrüßen.
Darauf freuten wir uns, bis uns dieser schreckliche Verlust traf. Und trotzdem bin ich mit den Mädchen nach Paris gefahren, ihr Weihnachtsgeschenk von Raissa.
Heute waren wir auf dem Neujungfrauenfriedhof. Wir haben viele Blumen mitgebracht – Vorweihnachtszeit. In der Nacht ist Schnee gefallen. Ich habe Raissas Lieblingsblumen mitgebracht: rote Rosen. Ein unvergessliches Bild: die roten Rosen auf dem blütenweißen Schnee. Auf der Grabplatte.
Als wir zurückkamen, haben wir uns an den Tisch gesetzt. An der Wand ein großes Porträt von ihr, im Zimmer Blumen, brennende Kerzen, der geschmückte Weihnachtsbaum und der Duft von Nadelholz. Auf dem Tisch alles, womit sie uns immer verwöhnte. Kurz: eine russische Tafel mit sibirischem Anstrich in Gestalt von Pelmeni und der Torte namens »Avantgarde«, die in der Kreml-Konditorei zubereitet wurde und deren Name von Raissa stammt. Wir hoben die Gläser und standen schweigend da …
Mit Irina, Anastasia und Xenia, 2009
Quelle: A. Trukhachew
Nach dem Abendessen ging ich nach oben in mein Arbeitszimmer. Ich machte kein Licht und stand am Fenster. Das von Laternen beleuchtete Datschengrundstück, der dichte russische Wald und der unentwegt fallende Schnee – ich kam mir vor, als säße ich im Bolschoi-Theater, im Nussknacker. Wir hatten eine Familientradition, nach der wir jedes Jahr an Silvester ins Bolschoi-Theater gingen. Wir schauten uns den Nussknacker an, und wenn wir nach Hause kamen, feierten wir den Ausklang des alten Jahres und verteilten die Geschenke, die Väterchen Frost trotz der erhöhten Sicherheitsstufe in die Präsidentenvilla geschleust und uns unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte. Musik, fröhliches Beisammensein …
All das sind nun Erinnerungen an ein vergangenes Leben, an die Zeit, da wir alle noch zusammen waren.
Raissa liebte den russischen Winter, besonders wenn es ordentlich stürmte und schneite. So war es schon, als wir noch in der Region Stawropol wohnten, wo wir uns sogar einmal bei einem Schneetreiben verirrt haben. Und so war es auch in Moskau. Raissa stammt aus dem Altai-Gebirge und wuchs in Sibirien auf. Ein paar Jahre lebte die Eisenbahnbauer-Familie auch im Nordural in der Taiga.
Oft erzählte sie von Schlittenfahrten, bei denen die drei Kinder Raissa, Shenja und Ljudotschka in Pelzmäntel eingepackt an einen neuen Wohnort gebracht wurden. An Winterabenden war es in den Familien Brauch, die berühmten Pelmeni zu kneten, sibirische Teigtaschen, die man einfror und in einem Sack an der eiskalten Luft aufbewahrte. Pelmeni, das war Raissas Leibgericht.
Wieder komme ich auf ihre letzten Tage zurück. Tapfer kämpfte sie um ihr Leben und ertrug geduldig alles, was die Ärzte mit ihr anstellten. Es war eine Qual, das mit ansehen zu müssen. In Minuten der Verzweiflung suchte sie in meinen Augen und in denen ihrer Tochter nach einer Antwort auf die Frage, wie es mit ihr weitergehen würde.
Als Raissa am 19. Juli nach der Diagnose ins Krankenzimmer gebracht wurde, ging ich zu ihr. Sie schaute mir in die Augen und fragte: »Was haben die Ärzte gesagt?«
Vorsichtig sagte ich: »Sie sagen, es handle sich um eine akute Blutkrankheit.«
»Ist das das Ende?«, fragte sie.
»Nein. Wir haben beschlossen, morgen mit dir nach Deutschland zu fliegen, wo man zusätzliche Untersuchungen vornehmen wird, um sich ein genaues Bild von der Krankheit zu verschaffen. Dort wird auch entschieden, wie sie zu heilen ist.«
Wir flogen nach Münster mit der Hoffnung auf Raissas Genesung. Am 21. September mussten wir mit der toten Raissa zurückkehren.
Ich beschloss, ein Buch über unser Leben zu schreiben. Das hatte ich schon lange vor, brachte es aber nicht fertig. Dieses Buch ist mir schwergefallen. Ich stand die ganze Zeit unter dem Eindruck des mit Rotstift geschriebenen Titels, den Raissa ihrem Buch geben wollte: Was mir auf der Seele liegt.
Meine Erinnerungen widme ich dem Andenken an Raissa.
Mit Raissa, 1986
Vorbemerkung
Dieses Buch ist anders als alle Bücher, die ich bisher verfasst habe. Es gibt keine feste Struktur, es handelt sich um keine Memoiren im eigentlichen Sinne, sondern einfach um meine Sicht unseres Lebens.
Diejenigen, die ich gebeten habe, dieses Buch zu lesen und zu beurteilen, haben gesagt, es gefalle ihnen. Wenn sie keinerlei Beanstandungen gehabt hätten, hätte ich das als Wunsch gewertet, mir nach dem Mund zu reden, um mich zu unterstützen. Aber neben der positiven Bewertung hat es durchaus auch sehr nützliche Kritik gegeben, die ich bei der Schlussredaktion nach Möglichkeit berücksichtigt habe.
Ich hoffe, es ist mir gelungen, eine umfassende Vorstellung von der Geschichte meines Lebens zu geben. Dieses Buch ist meine Antwort auf die Frage nach den Faktoren, die letztlich ausschlaggebend waren für meinen politischen Weg.
Teil I
Meine Universitäten
1. Kapitel
Wo ich herkomme
Von den etwas über achtzig Jahren meines Lebens habe ich zweiundvierzig in der Region Stawropol verbracht, die anderen in Moskau. Im Nordkaukasus treffen verschiedene Kulturen und Religionen aufeinander. Die facettenreiche Geschichte dieser Region hat mich immer lebhaft interessiert.
Mit der Erstarkung des Russischen Reiches suchten die Kaukasusvölker Schutz bei ihm vor allen möglichen Eroberern. Im August 1555 kehrte Andrej Schtschepetow, von Iwan dem Schrecklichen in den Nordkaukasus entsandt, mit einer Botschaft der Fürsten von Adygeja zurück. Der Zar erklärte das Reich von Pjatigorsk zu russischem Territorium. Die russische Seite legte Grenzbefestigungen an. Unter Katharina der Großen begann der Bau der Grenzlinie von Asow bis Mosdok mit sieben Festungen, darunter die Festung von Stawropol. Die ersten Grenzwächter waren Kosaken vom Fluss Chopjor (Gouvernement Woronesch) und Grenadiere des Wladimir-Regiments (Gouvernement Wladimir).
Und dann entstand eine Kosakensiedlung nach der anderen. Erst flüchteten die Bauern vor der Leibeigenschaft in den Süden. Später siedelte man sie zwangsweise dort an. Das Gouvernement Stawropol, ein Vorläufer der Region Stawropol, der ich später vorstehen sollte, ist eine relativ späte Verwaltungseinheit des Russischen Reiches. Den Status eines Gouvernements bekam es erst 1848, Hauptstadt ist das auf dem höchsten Punkt gelegene Stawropol, das von einem vorwiegend ebenen Steppengebiet von 400 Kilometern Länge und 200 Kilometern Breite umgeben ist. Vom eigentlichen Kaukasus trennten es die Ländereien der Terek-Kosaken sowie im Südwesten die Ländereien der Kuban-Kosaken, die Katharina die Große von der Ukraine in den Nordkaukasus umgesiedelt hatte. Im Nordwesten erstreckte sich das Territorium der Don-Kosaken, im Nordosten das Gouvernement Astrachan.
Die Region Stawropol gehört zum Nordkaukasus. Sie liegt an der Grenze zwischen Europa und Asien. Im Osten, an der Grenze zu Tschetschenien, gibt es 14 Prozent Sandboden und 31 Prozent Trockensteppe; die restliche Fläche bilden fruchtbare Kastanien- und Schwarzerdeböden.
Die Winter sind streng. Oft fällt die Temperatur auf minus 20 bis minus 30 Grad. Aber das Hauptproblem sind die heißen Winde, die Staubstürme regenarmer Jahre. Es ist statistisch belegt, dass diese in den letzten hundert Jahren stark zugenommen haben. Der Aprilsturm des Jahres 1898, der 200000 Stück Vieh vernichtete, ist in die Geschichte eingegangen. Die Staubstürme des Frühlings 1948 fegten die oberste Schicht des Bodens weg, 1975/76 (als ich Erster Sekretär des Regionskomitees der KPDSU war) herrschte eine katastrophale Dürre.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten ca. eine Million Menschen in der Region. Das waren im wesentlichen Russen (beziehungsweise »Großrussen«, wie sie damals offiziell hießen), ein Drittel waren Ukrainer (offiziell: »Kleinrussen«), dann Nogaier, Turkmenen, Kalmücken, Armenier, Grusinier, Griechen, Esten, Juden und Polen. Die Deutschen mit ihren großen, reichen Farmen lebten abgesondert von den anderen in der Steppe. Es gab auch reiche russische Höfe. Einer, der seinerzeit ziemlich bekannt war in der Region Stawropol, gehörte der Familie, aus der Solschenizyn stammt. 40 Prozent der Fläche des Gouvernements Stawropol war von Nomaden bevölkert: Nogaiern, Turkmenen und Kalmücken. Die eigentlichen Bergvölker des Kaukasus (Karatschaier, Tscherkessen und Abasinzen) kamen erst in der sowjetischen Zeit hinzu.
Im Gouvernement lagen zwei Städte (die Stadt Stawropol hatte vor der Revolution etwas mehr als 40000 Einwohner) und 130 Dörfer, darunter zehn größere (das heißt mit einer Einwohnerzahl von bis zu 15000). Es gab elf Bahnstationen, neun Telegrafenämter, 21 Postämter, 22 staatliche Ärzte in der Stadt, zu denen ebenso viele frei praktizierende hinzukamen, ein paar Krankenhäuser auf dem Land mit je fünf Betten, fünf Mittelschulen, 313 Schulen mit nur einer Klasse und drei Buchhandlungen, die alle in der Stadt Stawropol ansässig waren.
Vorherrschend war die Landwirtschaft: Ackerbau, Vieh- und Schafzucht. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse waren zum Export bestimmt: nach Petersburg, Moskau und Paris. An Industrie gab es: Müllerei- und Wachsbetriebe (die auch Kerzen herstellten), Buttereien, Schnapsbrennereien, Ledergerbereien, Ziegeleien, kurz: alles, was charakteristisch für ein ländliches Gouvernement ist.
Die soziale Schichtung war charakteristisch für die Provinz jener Zeit: eine recht große Zahl von Adligen, Großgrundbesitzer, Geistliche, Kaufleute und Händler, Kleinbürger (Angestellte, Beamte, Hausbesitzer); die Bauernschaft (mit Ländereien einer Ausdehnung von 2 bis 5 Desjatinen[2]) stellte 90 Prozent der Bevölkerung; hinzu kamen Arbeiter unterschiedlicher Art (darunter viele Tagelöhner) und arme Leute ohne bestimmte Beschäftigung. So sah das Gouvernement Stawropol vor dem Ersten Weltkrieg und der Revolution von 1917 aus.
Die Geschichte dieses Landstrichs ist reich an Ereignissen. Über einige sind bis heute Legenden im Umlauf. Mit der Zeit erfuhr ich, dass 25 der Offiziere, die 1825 am Dezemberaufstand gegen den Zaren teilgenommen hatten, hierhin verbannt worden waren. Das Leben vieler von ihnen endete während der Kaukasuskriege in den zahllosen Zusammenstößen mit den Bergbewohnern. Unter den Verbannten war auch der Dichter Alexander Odojewskij, der Verfasser einer in Versform gefassten Antwort auf Puschkins Sendschreiben an die Dekabristen, das die berühmte Zeile enthält: »Der Funken wird zu einer Flamme.«
Im Lermontow-Museum in Pjatigorsk ist ein Tagebuch Odojewskijs ausgestellt. Auf den vergilbten Seiten begegnet man Namen, die einem aus der Schule bekannt sind. Hier freundete sich Odojewskij mit Lermontow an und traf Ogarjow, den Freund Alexander Herzens. Und als ich in einem Lehrbuch las, »die Dekabristen haben Herzen aufgerüttelt«, erschien mir das wie eine lebendige Verbindung zu den früheren mir bekannten und vertrauten Menschen meiner Heimat.
Wie der Fluss nach dem Frühjahrshochwasser große und kleine Seen an den Ufern zurücklässt, so haben auch die Umsiedlungen und Wanderungen verschiedener Völker in den Steppen und Vorgebirgen des Stawropoler Landes viele Spuren hinterlassen. Neben russischen Namen begegnet man immer wieder Namen wie Antusta, Dshalga und Tachta, die mongolischen Ursprungs sind, oder Atschikulak und Arsgir, die turksprachig sind.
Eine solche Mischung von Ethnien auf kleinem Raum, einen solchen Reichtum von Sprachen, Kulturen und Religionen haben nur wenige Regionen der Welt aufzuweisen. Außer den Russen, die 83 Prozent ausmachten, lebten im Stawropoler Land zu meiner Zeit Karatschaier, Tscherkessen, Abasinzen, Nogaier, Osseten, Griechen, Armenier und Turkmenen. Es ist unmöglich, alle aufzuzählen. Und jedes Volk bringt nicht nur seine Sprache, sondern seine Bräuche, Sitten und Trachten mit, ja sogar seine jeweilige Gestaltung und Aufteilung des Hofs.
Heute sehen die Siedlungen ganz anders aus, sie sind einheitlicher geworden. Aber noch Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man den typischen kaukasischen Aul der Bergbewohner antreffen und daneben eine Kosakensiedlung oder ein russisches Dorf mit Samankaten unter einem Stroh- oder Schilfdach. Und um jede Kate zog sich ein Zaun, geflochten aus den Ruten junger Bäume. Ich verstand mich damals auch nicht schlecht auf diese Flechtkunst, und genauso wusste ich, wie man ein Dach deckt und mit welcher Lösung man das Stroh begießen muss, damit die Vögel es nicht rauben.
Die Bewohner des Landstrichs sind gesellig und kompromissbereit. Das Auskommen mit Menschen verschiedener Ethnien war ja die wichtigste Voraussetzung für ein Überleben im Nordkaukasus. Sich in einem mehrsprachigen, multikulturellen Milieu bewegen zu müssen, erzog zu Toleranz und einem respektvollen Umgang miteinander. Wenn man einen Bergbewohner beleidigte oder kränkte, hatte man sich einen Todfeind gemacht. Respekt vor der Würde und den Bräuchen eines Bergbewohners hieß, einen treuen Freund gewonnen zu haben. Ich hatte eine Vielzahl solcher Freunde, denn schon damals kam ich, ohne entsprechende hochtrabende Worte zu kennen, immer mehr zu der Einsicht, dass nur Toleranz und Eintracht den Frieden zwischen den Menschen sicherstellen können.
Hier in meiner Heimat bekam ich den ersten Unterricht in internationaler Erziehung. Nicht in der Theorie, sondern als fundamentalen Bestandteil des Alltagslebens. Im Nordkaukasus leben Menschen verschiedener Ethnien nebeneinander, manchmal sogar in ein und demselben Dorf, derselben Siedlung, demselben Aul oder derselben Ortschaft. Sie bewahren ihre Kultur und ihre Traditionen, helfen einander aber auch, besuchen sich, bemühen sich, eine gemeinsame Sprache zu finden, und arbeiten zusammen.
Als ich Präsident der UDSSR wurde und es mit den Konflikten der Nationalitäten in meinem Land zu tun bekam, war ich kein Neuling in diesen Fragen: Hier in der geistigen Atmosphäre des Nordkaukasus sehe ich den Ursprung meiner Neigung, in Konfliktfällen nach einem Kompromiss zu suchen; nicht aus Charakterschwäche, wie einige meinen. Rebellen gab es im Nordkaukasus mehr als genug. Gerade hier haben viele Anführer echter Volksbewegungen ihr Heer um sich geschart und ihren Vormarsch begonnen: Kondratij Bulawin, Ignat Nekrassow, Stepan Rasin und Jemeljan Pugatschow. Der Überlieferung nach stammt auch Jermak, der Eroberer Sibiriens, aus dieser Gegend.
Die zahllosen Überfälle von Eroberern in alter Zeit und die langjährigen Kaukasuskriege in jüngster Vergangenheit haben eine Menge Menschenleben gekostet. Auch der Bürgerkrieg des vergangenen Jahrhunderts hat eine furchtbare Blutspur in unserer Gegend hinterlassen. Die Sowjetmacht drang von Rostow aus in Richtung Stawropol vor. Unsere Orte waren die ersten auf diesem Weg, und so formierten sich auf dem Boden meiner Region die ersten Abteilungen der Roten Garde. Bekannt ist Lenins Grußschreiben an die »Front von Medweschje«.
Am 1. Januar 1918 wurde die Stawropoler Sowjetrepublik ausgerufen und ein Rat der Volkskommissare gebildet. Eine halbe Million Bauern erhielten Land von der neuen Regierung. Man führte den Achtstundentag ein, errichtete eine Arbeiterkontrolle in den Fabriken, und der Schulunterricht war von nun an kostenlos. Doch schon im März kam es im Landkreis Medweschje zu Kämpfen mit Offizierseinheiten des weißen Generals Kornilow und im April mit der Freiwilligenarmee des Generals Alexejew. Im Juli 1918 schloss sich die Stawropoler Sowjetrepublik mit der Kuban- und Schwarzmeerrepublik sowie der Republik Terek zur Sowjetrepublik Nordkaukasus zusammen, die bis zum Januar 1919 Bestand hatte. Danach übernahmen die weißen Generäle Denikin und Schkuro die Macht.
Die Kämpfe im Nordkaukasus wurden mit äußerster Erbitterung geführt. Ein Teil der Kosaken ging in die Rote Armee, sodass in der zweiten Hälfte des Jahres 1918 an der Südfront vierzehn rote Kosakenregimenter im Einsatz waren, die später zu Brigaden und Reiterarmeen umformiert wurden. Wie unsere örtlichen Veteranen versicherten, waren in der berühmten 1. Reiterarmee von Budjonnyj und Woroschilow nahezu 40 Prozent der Soldaten aus Stawropol. Ein anderer, nicht unbeträchtlicher Teil der Kosaken dagegen schloss sich den Weißen an. Als es am Don zu einer Meuterei kam und General Krasnow mit Hilfe deutscher Truppen eine Militärdiktatur errichtete, wurden 45000 mit der Sowjetmacht sympathisierende Kosaken erschossen oder erhängt. Aber auch die Roten machten keine Umstände und schreckten nicht vor den brutalsten Maßnahmen zurück, sogar gegen Alte, Frauen und Kinder. Ich erinnere mich noch an folgende Episode, von der General Kniga erzählte.
1967 feierte man den 50. Jahrestag der Sowjetmacht. Zahlreiche Teilnehmer des Bürgerkriegs fuhren in die Städte und Dörfer und erzählten von ihren Erinnerungen. Besonders viele Begegnungen fanden für die Jugendlichen statt. Auch General Kniga, ein Held des Bürgerkriegs, wurde gebeten, seine Heimat im Norden des Gouvernements aufzusuchen, wo er für die Sowjetmacht gekämpft hatte. Der General erklärte sich einverstanden, bat aber zur allgemeinen Verwunderung um Begleitschutz.
»Wofür brauchst du denn Begleitschutz, Wasilij?«
»Ich brauche ihn unbedingt. Wir haben dort im Bürgerkrieg ein ganzes Dorf niedergesäbelt.«
»Wie – niedergesäbelt?«
»Na so …«
»Alle Dorfbewohner?«
»Möglicherweise eben nicht alle, deshalb denke ich, vielleicht hat einer überlebt und erinnert sich daran.«
Wie oft habe ich zu hören bekommen, beim Übergang zu einer neuen Gesellschaft sei Gewalt nicht nur gerechtfertigt, sondern eine Notwendigkeit. Dass sich Blutvergießen bei Revolutionen tatsächlich oft nicht vermeiden lässt, ist ein Faktum. Aber in der Gewalt ein Allheilmittel für die Lösung von Problemen zu sehen, zu ihr aufzurufen, um irgendwelche vermeintlich »hehren« Ziele zu erreichen, also im Zweifelsfall wieder das Volk niederzusäbeln, das ist unmenschlich.
Die Familie der Gorbatschows war nach der Aufhebung der Leibeigenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in das Stawropoler Land gekommen. Mein Urgroßvater, Moisej Gorbatschow, siedelte sich mit seinen drei Söhnen Alexej, Grigorij und Andrej am Rand des sehr viel früher entstandenen Dorfes Priwolnoje an. Die Gorbatschows wohnten zuerst alle zusammen, eine Großfamilie von 18 Personen. In der Nähe lebten ihre nahen und fernen Verwandten, ebenfalls Gorbatschows. Später wurden für die Söhne mit ihren Familien Hütten gebaut. Auch mein Großvater Andrej Moisejewitsch, der meine Großmutter Stepanida heiratete, trennte sich mit der Familiengründung von seinen Eltern. 1909 kam Sergej zur Welt, mein Vater.
Am Rand des Dorfes Priwolnoje, das von den Gorbatschows und ihren engen Verwandten besiedelt war, wohnten auch Pantelej Jefimowitsch und Wasilisa Gopkalo. Auch sie waren zugereist: Er stammte aus der Gegend um Tschernigow, sie aus der Gegend um Charkow, ihrem Ursprung nach waren sie also Ukrainer. Offenbar kamen sie zur selben Zeit wie die Gorbatschows und ließen sich am Rande des Dorfes nieder. Sie hatten eine Tochter Maria, meine Mutter.
1929, als mein Vater zwanzig und meine Mutter achtzehn war, heirateten sie. Aus der mündlichen Familienüberlieferung ist bekannt, dass meine Mutter meinen Vater nicht heiraten wollte, die Großväter sich aber abgesprochen hatten. Meinem Vater gefiel meine Mutter. Er liebte sie. Er liebte sie sein ganzes Leben und kümmerte sich um sie. Er verzieh ihr vieles. Wenn er wegfuhr, brachte er bei der Rückkehr immer Geschenke mit. Geschenke für Maria!
Ich wurde am 2. März 1931 geboren und in der Kirche des Nachbardorfs Letnizkoje getauft. Infolge der Revolution von 1917 wurde die Religion ja verfolgt, und die Kirchen in Priwolnoje waren zerstört worden. Meine Mutter und mein Vater hatten mir bei der Geburt den Namen Viktor gegeben. Doch bei der Taufe antwortete Großvater Andrej auf die Frage des Geistlichen nach meinem Namen, ich solle Michail heißen. Dann packte man mich in einen warmen Schafpelz und brachte mich nach Priwolnoje zurück. Dies geschah weniger, damit ich nicht erfror, sondern weil es Reichtum verspricht – so will es der Brauch.
Die Hütte von Großvater Andrej erstreckte sich von Osten nach Westen und bestand aus drei Räumen. Zuerst kam die gute Stube, wo Großvater und Großmutter schliefen. Die Ostecke dieses Zimmers nahm eine große, wunderschöne Ikonenwand ein. Der Lehmboden war mit selbstgewebten Läufern bedeckt. Der zweite Raum war der Gemeinschaftsraum für die Familie mit einem russischen Ofen, an den ein kleiner Ofen angebaut war. An der Fensterwand standen ein Esstisch und eine Bank. Im großen Ofen wurde das Brot gebacken, alles andere wurde in dem Öfchen zubereitet. Die kleinen Kinder schliefen oben auf dem Ofen.
Als Vater und Mutter geheiratet hatten, wurde ein Teil dieses Zimmers für die beiden abgetrennt. Dann gab es noch einen Flur. Der dritte Teil der Hütte diente als Vorratsraum, wo man Getreide, Futter und Saatgut aufbewahrte. Unter dem Dach hingen Säcke mit Zwieback. Als ich schon größer war, ging ich gern auf den Speicher dieses Raums und suchte mir ein stilles Plätzchen, wo ich oft einschlief. Einmal entdeckte ich zwei Säcke mit merkwürdigen farbigen Scheinen. Es stellte sich heraus, dass das Kerenki waren, Geldscheine, die 1917 unter der von Kerenskij angeführten provisorischen Regierung ausgegeben worden waren. Sie lagen da noch lange. Großvater hoffte wohl darauf, sie könnten noch einmal von Nutzen sein. Wie Bauern eben so denken!
Im vierten Raum war das Vieh untergebracht. Daneben befand sich Futter und ein Teil des Heizmaterials. So war die Hütte aufgeteilt.
Vor vielen Jahren erzählte meine Mutter meiner Tochter Irina, ihrer ersten Enkelin, wie ich auf die Welt gekommen bin. Als die Wehen einsetzten, brachte man meine Mutter in den Vorratsraum. Man legte Stroh auf den Boden und bettete sie auf ein Lager. Zwischen dem Wohnraum und dem Stall, da wurde ich also geboren. Als Irina erwachsen war, kam sie auf diese Geschichte zu sprechen und sagte: »Papa, hör mal, du bist ja geboren wie Jesus Christus.«
»Ja! Schreib es dir hinter die Ohren. Aber sag es niemand weiter«, sagte ich aus Spaß.
Ich möchte jetzt von meinen beiden Großvätern erzählen. Ihr Schicksal ist typisch für das Schicksal der Bauern unter der Sowjetmacht. Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte Großvater Pantelej von der türkischen Front zurück, Großvater Andrej von der österreichischen. Beide Familien waren bettelarm. Großvater Pantelej verlor mit 13 Jahren seinen Vater und hatte noch vier jüngere Geschwister. Obwohl von Natur aus ruhig, stand ihm der Sinn nach Veränderungen, er gründete erst eine Bauernkommune und dann eine Genossenschaft zur gemeinsamen Bearbeitung des Bodens, eine damals berühmte Form des Zusammenschlusses.
»Die Sowjetmacht hat uns nicht gerettet, sie hat uns Land gegeben«. Diese Worte habe ich von Großvater Pantelej immer wieder gehört. Und das war entscheidend für sein Verhältnis zur Sowjetmacht. Die Kollektivierung begann. Er wurde Organisator und Vorsitzender einer Kolchose.
Großvater Andrej, von Natur aus schroff, erkannte die Kolchose nicht an und bewirtschaftete sein Land allein. Mein Vater schlug sich auf die Seite von Großvater Pantelej, trat in die Kolchose ein, wurde Traktorist und riskierte den Bruch mit seinem Vater.
Bei Großvater Andrej lief alles gut. Er bekam vom Staat Auflagen, wie viel Getreide er zu säen und wie viel er abzugeben habe, und erfüllte sie gewissenhaft. In beiden Familien normalisierte sich das Leben allmählich, wenn auch auf unterschiedliche Weise.
Da kam das Jahr 1933 mit der schrecklichen Hungersnot. Großvater Andrejs Familie war in einer äußerst kritischen Lage. Sie wussten nicht, wie sie die Kinder ernähren sollten. Drei von ihnen verhungerten im Winter. Als der Frühling kam, hatten sie kein Saatgut. Die Behörden werteten das als Sabotage, als Nichterfüllung des Aussaatplans. Großvater Andrej wurde zu Holzfällerarbeiten nach Sibirien verbannt. Er kam vor der Zeit frei, 1935, und brachte einige Auszeichnungen mit. Er rahmte die Urkunden ein und hängte sie neben die Ikonen. Nach seiner Rückkehr aus der Verbannung trat Großvater in die Kolchose ein und arbeitete dort bis zu seinem Tod. Und fast immer wurde seine Arbeit als die beste ausgezeichnet, und er bekam eine Prämie.
1938 brach ein neues Unglück über uns herein. Großvater Pantelej wurde auf einmal verhaftet und des Trotzkismus beschuldigt. Sie verhörten und folterten ihn vierzehn Monate lang.
Als sie ihn verhaftet hatten, zog Großmutter Wasilisa zu uns. Sofort änderte sich vieles. Die Nachbarn besuchten uns nicht mehr, und wenn doch, dann nur nachts. Es war, als stünde das Haus unter Quarantäne: »Das Haus eines Volksfeindes!«
Man bemühte sich in der Familie, die schreckliche Zeit zu vergessen. Ich habe nie Einzelheiten gehört. Zu fragen war unangenehm. Später begriff ich dann, dass sie sich nicht so verhielten, um so schnell wie möglich zu vergessen, sondern einfach aus Angst. Solche Gespräche sah die Sowjetmacht nicht gerne.
Fast zwanzig Jahre kam ich nicht aus Priwolnoje heraus. Nur einmal fuhr ich in einem Lastwagen mit einer Gruppe von Mechanikern nach Stawropol, wo uns Auszeichnungen der Regierung für besondere Arbeitsleistungen ausgehändigt wurden. Und noch davor fuhren Tante Sanja (eine Schwester meines Vaters) und ich mit dem Getreidewagen-Tross zum staatlichen Getreidespeicher der Bahnstation Pestschanokopsk.
Das war unheimlich interessant: meine erste weite Reise mit einer Übernachtung in der Steppe am Brunnen, wo sich alle niederließen. Wir aßen zusammen zu Abend und schliefen auf den Getreidewagen. Und am Bahnhof, da sah ich zum ersten Mal eine Lokomotive!
Oft war ich bei Großvater Pantelej und Großmutter Wasilisa, die mit der Zeit ins Nachbardorf zogen, wo Großvater zum Kolchosvorsitzenden gewählt worden war. Darüber waren nicht nur meine Großmutter (das wurde sie übrigens, als sie gerade mal achtunddreißig war) und ich sehr glücklich, sondern besonders meine Eltern. Manchmal versuchten sie, mich im Dorf Priwolnoje zu behalten, aber ich wollte wieder zu Großvater und Großmutter zurück. Alle Versuche meiner Eltern endeten mit einem Sieg meinerseits. Ich lief einen und anderthalb Kilometer hinter dem Fuhrwerk des Großvaters her, bis er sich erbarmte und mich mitnahm.
Mit der Mutter Maria Pantelejewna, 1941
Großmutter wusste später immer wieder davon zu erzählen, wie gut wir miteinander auskamen, wie ich sie zum Beispiel im Haus einsperrte, weil sie mir nicht so viel Zucker gab, wie ich wollte. Was ist da nicht so alles vorgekommen! Ihr ganzes Leben blieb ich der Lieblingsenkel.
Krieg
Ende der dreißiger Jahre bürgerte es sich ein, dass man an Sonn- und Feiertagen in den Waldgürtel der Steppe ging, um sich zu erholen. Ganze Familien zogen los, auf Pferden, Stieren oder, wenn es nicht weit war, zu Fuß. Allen gefiel das friedliche Leben. Die Kinder spielten Schlagball, warfen Stöcke in die Luft, die man auffangen musste, oder jagten hinter einem selbstgebastelten Ball hinterher. Die Mütter schwatzten und klatschten. Die Väter besprachen ihre »Männer«-Probleme. Dabei wurde getrunken und gesungen. Und wenn einer zu viel getrunken hatte und außer sich geriet, kam es auch zu Schlägereien. Nur die Frauen konnten die Raufbolde auseinanderbringen, indem sie sich mit vereinten Kräften auf sie stürzten.
Während eines solchen Ausflugs ins Grüne, am Sonntag, dem 22. Juni, kam auf einmal ein Reiter an und meldete: »Es ist Krieg! Alle müssen um 12 Uhr auf dem Zentralen Platz in Priwolnoje sein. Molotow wird eine Rede halten.« In Priwolnoje gab es kein Radio. Es wurde extra eine Funkanlage herbeigeschafft.
Wir Kinder nahmen das anders auf als die Erwachsenen, die mit versteinerten Gesichtern dastanden. Wir meinten: »Wir werden es den Faschisten schon zeigen!« Dann setzte die Mobilisierung ein, und im Herbst kamen die ersten Gefallenenmeldungen. In der Regel trafen sie abends ein. Wir standen da und lauschten, wo der Berittene stehenbliebe, bei welchem Haus. Es waren junge Männer, die umkamen: unsere Väter, Brüder und Nachbarn.
Heute wissen wir: Die Ersten, die in den Kampf mit den Faschisten verwickelt wurden, waren unsere Grenztruppen. Jungen der Jahrgänge 1921/22 und etwas älter. Die Mehrheit von ihnen kam nicht zurück. Etwa fünf Prozent der Männer dieses Alters überlebte. Ein entsetzlicher Schlag für die Mütter, Frauen, Kinder und Bräute.
Mein Vater und ein paar Mechaniker wurden für die Erntezeit zurückgestellt. Er wurde erst am 3. August 1941 einberufen. Ich war dabei, als er mit anderen Eingezogenen fortgebracht wurde. Die einen fuhren auf Karren, die anderen liefen hinterher, um zum letzten Mal mit den ins Unbekannte Aufbrechenden zu sprechen. Die Menschen nahmen voneinander Abschied, denn niemand wusste, ob er zurückkommt.
20 Kilometer trennen Priwolnoje von der Kreisstadt. Sie kamen mittags an der Einberufungsstelle an. Vater spendierte mir ein Eis, das beste meines Lebens. Es war heiß, das Eis zerfloss. Ich aß einen ganzen Becher. Und dann kaufte Vater mir auch noch eine Balalaika. Als er von der Front zurückkam, war sie noch da und blieb dann noch viele Jahre in unserer Familie.
Gerade erst waren die Menschen nach den Erschütterungen des Welt- und Bürgerkriegs, der Kollektivierung und der Repressionen zu sich gekommen, gerade hatte sich das Leben gebessert, es gab einfache Schuhe zu kaufen, Kattun, Salz, Haushaltswaren, Hering, Anchovis, Streichhölzer, Petroleum, Seife – und schon wieder stand Russland vor einer extremen Prüfung, bei der es um das nackte Überleben ging.
Ich erinnere mich immer noch an meine Fassungslosigkeit, als unsere Truppen zurückweichen mussten und die Faschisten ins Landesinnere vorrücken konnten. Wir Kinder waren nicht weniger entsetzt darüber als die Erwachsenen. Für uns war das einfach eine Tragödie. Wie war das möglich? Im Winter 1941/42 waren die deutschen Truppen bei Moskau, 27 Kilometer vom Kreml entfernt, und bei Taganrog, das ca. 200 Kilometer von Priwolnoje entfernt war.
Mein Vater hatte viele Jahre die kleine Kreiszeitung und die Prawda abonniert, die wir auch weiterhin bekamen. Besonders im Herbst und Winter versammelten sich die Frauen häufig abends in unserer Hütte, und ich las ihnen die Meldungen von der Front vor. Sie legten Karten, während ich auf dem Ofen lag und sie betrachtete. Ich verstand nicht, was sie einander beweisen wollten und was die Karten »sagten«. Es ging alles um ihre Männer.
Die Sorge um das tägliche Überleben nahm die ganze Zeit in Anspruch. Man brauchte Essen, man brauchte Wasser, man brauchte Wärme, und man musste sich um das Vieh kümmern.
Der Winter des Jahres 1941 war hart. Bei uns im Süden fiel schon am 8. September der erste Schnee, ein einzigartiges Vorkommnis. Schneefall und Wind hielten ein paar Tage an. Alle Hütten, die sich dem Ostwind entgegenstellen, waren eingeschneit. Nur die Schornsteine ragten heraus. Als sich das Wetter beruhigt hatte, halfen diejenigen, die aus ihrem Haus herauskamen, den anderen, sich freizuschaufeln. So einen Winter habe ich mein Lebtag nicht mehr erlebt.
Ein paar Tage lang gab es keine Post und auch keine andere Verbindung zur Außenwelt. Und gerade da tobte die erbitterte Schlacht auf Leben und Tod vor Moskau. Später erfuhren wir, dass die Deutschen bei Moskau vernichtend geschlagen worden waren. Moskau hatte standgehalten. Einer der Zeitungen lag ein Büchlein bei, das von der Heldentat der Soja Kosmodemskaja erzählte. Die Zeitung hieß Tanja. Alle waren entsetzt über die Brutalität der Deutschen, und alle weinten.
Die Gefallenenmeldungen rissen nicht ab. Der Krieg verschlang alles: das Leben der Menschen, Städte und Dörfer. Große Teile des Landes waren von den Faschisten besetzt: die Ukraine, Weißrussland, das Baltikum, Moldawien und der Westen Russlands.
Der Schnee blieb bis zum Frühling liegen, ein richtiges Schneereich. Nur dass einem in diesem Reich das Leben schwer wurde. Mit dem Essen ging es noch, im Jahr 1941 waren ja noch Vorräte da. Aber zum Heizen gab es nichts. Man fällte alte Gartenbäume. Die Betreuung des Viehs war schwierig. Und ganz schlecht stand es um das Futter für das Kolchosvieh: Das Heu stand auf den Feldern, aber die Wege waren eingeschneit. Es musste unter den Bedingungen dieses entsetzlichen Winters transportiert werden. Und all das war den jungen Frauen aufgebürdet, darunter auch meiner Mutter.
Eines Tages kehrten Mutter und einige andere Frauen nicht vom Einfahren des Heus zurück. Es vergingen ein, zwei Tage, und sie waren immer noch nicht da. Erst am dritten Tag kam die Meldung, die Frauen seien verhaftet und ins Kreisgefängnis gebracht worden. Wie sich herausstellte, hatten sie sich verirrt und die Schlitten mit dem Heu von Heuschobern beladen, die einer staatlichen Aufbereitungsorganisation für Viehfutter gehörten. Die Wache hatte sie verhaftet. Damals konnte man für so etwas hart bestraft werden. Ihre Rettung war, dass alle »Diebe« Ehefrauen von Frontsoldaten waren, alle Kinder hatten und das Futter nicht für den eigenen Gebrauch, sondern für die Kolchose genommen hatten, und auch das nicht mit Absicht, sondern irrtümlich.
Es ist schwer, alle Belastungen aufzuzählen, denen die Frauen in jenen Jahren ausgesetzt waren: die kräftezehrende Arbeit in der Kolchose, der Haushalt, der Mangel an allem und jedem, Kinder, die nichts anzuziehen und nichts zu essen hatten, die Angst um die Männer.
Vater schrieb uns oft Briefe und fragte nach allem. Und ich ließ mir manchmal von Mutter etwas diktieren oder antwortete ihm selbst, was häufiger vorkam. Ich glaube, er verstand unsere »Notlügen« in den Briefen.
Mit dem Weggehen meines Vaters an die Front musste auch ich viel im Haus tun. Ab dem Frühjahr 1942 mussten wir uns um den Gemüsegarten kümmern, der die Familie ernährte. Frühmorgens machte sich Mutter schnell im Haushalt zu schaffen, ging dann in die Kolchose aufs Feld, und von da an lag alles auf meinen Schultern. Meine wichtigste und schwerste Arbeit bestand in der Aufbereitung des Heus für die Kuh und in der Beschaffung von Heizmaterial.
Das Leben hatte sich total verändert. Wir, die Jungen der Kriegszeit, übersprangen unsere Kindheit und mussten abrupt das Leben Erwachsener führen. Spaß und Spiele waren vergessen, Schule gab es nicht. Tagelang war man allein und musste sich um den Haushalt kümmern. Aber manchmal … Manchmal vergaß ich auf einmal alles auf der Welt, in den Bann geschlagen von einem Schneegestöber im Winter oder von den raschelnden Gartenblättern im Sommer, und tauchte in Gedanken in eine entfernte, irreale Wunschwelt ein. Ins Reich der Phantasie …
Von Rostow aus überrollten im Sommer 1942 mehrere Rückzugswellen unsere Gegend. Die erste Welle bestand aus Tausenden von Evakuierten aus der Ukraine. Die einen waren mit Rucksack oder Säcken bepackt, die anderen hatten Kinderwagen oder Handkarren. Sie trieben Vieh-, Pferde- und Schafherden vor sich her.
Großmutter Wasilisa und Großvater Pantelej packten ihre Habseligkeiten und brachen ins Ungewisse auf. Die Ölzisternen des Dorfes wurden geöffnet, man leitete den ganzen Brennstoff in das seichte Flüsschen Jegorlyk, die Getreidefelder wurden abgefackelt, alles, damit es nicht dem Feind in die Hände fiel.
Die zweite Welle erreichte uns in der zweiten Hälfte des Monats Juli 1942 nach der Aufgabe von Rostow. Der Rückzug war ungeordnet. In großen und kleinen Gruppen trafen finstere und müde Soldaten bei uns ein, denen Trauer und Scham ins Gesicht geschrieben stand. Der Krach der detonierenden Bomben und der Donner der Geschütze kamen immer näher. Zusammen mit unseren Nachbarn hoben wir an dem Flusshang einen Graben aus, von dem aus ich zum ersten Mal eine Katjuscha[3]-Salve sah: Ein entsetzliches Pfeifen begleitete die Feuerpfeile, die über den Himmel flogen …
Und dann wurde es auf einmal still – für volle zwei Tage. Am 3. August 1942, genau ein Jahr, nachdem mein Vater in den Krieg gezogen war, tauchten Motorräder mit deutschen Kundschaftern auf. Innerhalb von drei Tagen zogen die deutschen Truppen in Priwolnoje ein. Um sich vor den Bombenangriffen zu schützen, tarnten sie sich und fällten alle unsere Gartenbäume, die wir in jahrzehntelanger Arbeit hochgezogen hatten.
Von Rostow drangen die Deutschen bis zur Hauptstadt von Kabardino-Balkarien Naltschik vor, ohne auf Widerstand zu stoßen. Die sowjetischen Truppen waren in Auflösung begriffen. Aber hinter Naltschik traten Sperrabteilungen in Aktion, zu deren Aufgabe die Umsetzung des Befehls Nr. 227 von Stalin gehörte: »Keinen Schritt zurück.« Aus den zurückweichenden Soldaten wurden in Windeseile Einheiten gebildet, die sofort an die vorderste Linie geschickt wurden. Durch den Großeinsatz bei der Stadt Ordschonikidse (heute: Wladikawkas) wurden die deutschen Truppen, die an das Öl von Baku herankommen wollten, gestoppt, und diesmal endgültig.
Als die deutschen Einheiten nach Osten weiterzogen, ließen sie eine kleine Garnison in Priwolnoje zurück, die später von einem Trupp abgelöst wurde, dessen ukrainischer Dialekt mir in Erinnerung geblieben ist. Nun hatte das Leben unter fremder Besatzung begonnen.
Ein paar Tage später kehrte Großmutter Wasilisa zurück. Sie war mit Großvater fast bis Stawropol gelangt, aber dort holten die angreifenden deutschen Truppen sie ein. Großvater hatte querfeldein, durch Schluchten und über Maisfelder die Frontlinie überschreiten können, aber Großmutter war mit ihren Habseligkeiten zu uns zurückgekehrt. Wohin auch sonst?
Die Deserteure aus unserer Armee krochen aus dem Untergrund. Der größte Teil von ihnen kollaborierte mit den Deutschen, in der Regel als Geheimpolizisten. Einmal kamen sie zu uns und führten eine Hausdurchsuchung durch. Ich weiß nicht, was sie suchten. Danach nahmen sie im Pferdewagen Platz und befahlen Großmutter, ihnen aufs Revier zu folgen. Sie musste durch das ganze Dorf. Alle sollten sehen: die Frau des Kolchosvorsitzenden! Lange wurde sie verhört. Ich weiß nicht, was sie herausfinden wollten und was sie hätte sagen können. Alles lag auf der Hand: Ihr Mann war Kommunist, der Kolchosvorsitzende war in der Evakuation, Sohn und Schwiegersohn kämpften an der Front.
Wenn Mutter vom Arbeitsdienst für die Deutschen zurückkam, erzählte sie wiederholt von den Ängsten einiger Dorfbewohner: »Das ist nicht wie bei den Roten!« Gerüchte über Massenerschießungen in den Nachbarstädten kamen auf, Gerüchte über Autos, die die Menschen mit Gas umbrachten (nach der Befreiung bestätigte sich das alles). Zigtausende Menschen, größtenteils Juden, wurden bei der Stadt Mineralnyje Wody erschossen. In Priwolnoje verbreiteten sich Gerüchte über die bevorstehende Abrechnung mit den Familien der Kommunisten.
Unserer Familie war klar, dass wir als Erste drankommen würden. Mutter und Großvater Andrej versteckten mich auf einer Farm hinter dem Dorf, wo Großvater arbeitete. Die Strafaktion war für den 26. Januar 1943 angesetzt, doch am 21. Januar befreiten unsere Truppen Priwolnoje.
Ich habe diese Tage in Erinnerung behalten. Wir sind wohl noch relativ glimpflich davongekommen. Das ist auch das enorme Verdienst unseres Dorfältesten, des hochbetagten Sawatej Sajzew oder »Großvaters Sawka«, wie wir ihn nannten. Er hatte sich lange und hartnäckig geweigert, die Funktion des Ältesten zu übernehmen, aber die Dorfbewohner überredeten ihn, denn er war wenigstens einer von uns. Wir im Dorf wussten, dass Sajzew alles versuchte, um die Menschen zu retten. Aber als die Deutschen verjagt waren, wurde er wegen Hochverrat zu zehn Jahren Lager verurteilt. Wie viele Eingaben meine Dorfgenossen auch machten, in denen stand, er habe das Amt des Ältesten nicht freiwillig übernommen, er habe Leuten das Leben gerettet, nichts half. Großvater Sawka starb als »Verräter« im Gefängnis.
Ich werde nie vergessen, wie wir uns mitten in der Nacht aus dem Haus schlichen, meine Mutter und ich. Ich sollte mich auf der Farm verstecken, wo Großvater Andrej arbeitete, ein paar Kilometer vom Dorf entfernt. Überall war Schlamm. Das kommt in der Region Stawropol häufig vor, sie liegt ja im Süden Russlands. Anfangs schien uns, wir seien auf dem richtigen Weg, aber dann verirrten wir uns. Pechschwarze Nacht, nirgends ein Licht, kein Weg, nur Finsternis. Wir gingen und gingen, in der Hoffnung, auf irgendetwas zu stoßen, und tauchten immer weiter ein in die Finsternis. Auf einmal flammte in dieser Winternacht ein Blitz auf, und es donnerte. Die Finsternis lichtete sich für einen Augenblick, und wir sahen in der Nähe die Farm. Dort versteckte ich mich dann für ein paar Tage.
Die Deutschen traten in aller Eile den Rückzug an. Aus Angst, wie bei Stalingrad in einen Kessel zu geraten, zog ihr Kommandostab die Truppen vom Nordkaukasus schleunigst ab. Wie begeistert wir die Einheiten der Roten Armee begrüßten! Wir mussten uns nicht mehr vor den »Junkers« fürchten, die aus der Luft unsere Truppenbewegungen verfolgten …
Noch einmal rückte die Front in unsere Gegend vor, diesmal auf dem Weg nach Westen. Wieder mussten wir von vorn anfangen, die Kolchose wieder einrichten. Aber wie? Alles war zerstört, es gab keine Maschinen, kein Vieh, kein Saatgut. Der Frühling kam. Wir pflügten die Erde mit Kühen aus dem eigenen Bestand.
Dann sammelten wir Saatgut, jeder lieferte so viel ab, wie er konnte. Die Ernte des Jahres 1943 war natürlich schlecht. Woher hätte sie auch kommen sollen! Alles, was wir angebaut hatten, lieferten wir dem Staat für die Front ab. Im Winter und Frühling 1944 kam der Hunger. Meine Mutter fuhr mit anderen Dorfbewohnern zusammen an den Kuban. Es hieß, man könne dort Mais kaufen. Wir holten Vaters Sachen aus der Truhe: zwei Paar neue Chromlederstiefel und einen Anzug, den er kein einziges Mal getragen hatte, um die Sachen gegen Getreide einzutauschen. Als Mutter losfuhr, maß sie mir für jeden Tag eine Handvoll Mais ab, aus den letzten Beständen, die wir im Haus hatten. Ich mahlte die Maiskörner und kochte mir aus dem Mehl einen Brei.
Eine Woche verging, zwei Wochen, immer noch war Mutter nicht zurück. Erst ein paar Tage später tauchte sie auf und brachte einen Sack Mais mit. Der war unsere Rettung. Und dann kalbte auch noch unsere Kuh, sodass wir sowohl Milch als auch Mais hatten. Das war damals eine Menge wert. In anderen Familien hatten sie zu wenig zu essen und waren aufgeschwemmt vor Hunger. Häufig kamen befreundete Nachbarkinder zu uns und standen schweigend an der Tür. Mutter stöhnte ein wenig, bevor sie sich erweichen ließ und ihnen etwas zu essen gab.
Wie ein Gottesgeschenk gab es im Frühling zu unser aller Freude Regenschauer. Auf dem Feld und im Gemüsegarten, überall begann es zu sprießen. Auch diesmal war Mutter Erde unsere Rettung.
Im April 1943 starb die Mutter meines Vaters, Großmutter Stepanida. Sie starb langsam, unter entsetzlichem Leiden und in fürchterlicher Sorge um ihren Sohn. Es war noch kein Brief von der Front gekommen, buchstäblich ein paar Tage nach ihrem Tod traf er ein. Großmutter Stepanida hatte Großvater sechs Kinder geboren. Drei von ihnen waren 1933 verhungert. Im Unterschied zu Großvater Andrej war sie herzensgut und fürsorglich: Sie hatte mit allen Mitleid, besonders mit kleinen Kindern. Ihre älteste Tochter, meine Tante Nastja, blieb allein mit drei Kindern zurück, als ihr Mann an die Front musste. Wie sehr sich Großmutter um die Enkel kümmerte! Alle überlebten und wurden groß, während ihr Vater an der Front umkam. Großmutter Stepanida und ich waren Freunde. Ich hatte Glück.
Wir bekamen nun oft Briefe von Vater. Alles, was wir brauchten, war: Wir sind am Leben, er ist am Leben. Mutter dankte dem Herrgott. In diesen schwierigen, schrecklichen Tagen dachten die Leute auf einmal wieder an Gott.
Ende des Sommers 1944 kam ein rätselhafter Brief. Er enthielt Papiere, Familienfotos, die Vater, als er an die Front musste, mitgenommen hatte, und eine kurze Meldung, Starschina[4] Sergej Gorbatschow sei den Heldentod in den Karpaten gestorben.
Als ich Präsident der UDSSR wurde, machte mir der Verteidigungsminister Jasow ein einzigartiges Geschenk: Er überreichte mir ein Buch über die Truppenteile, bei denen mein Vater in den Kriegsjahren gekämpft hatte. Mit großer Erregung habe ich damals und auch heute wieder dieses Buch gelesen. Mir wurde noch deutlicher klar, wie schwer der Weg zum Sieg war und was für einen Preis unser Volk dafür hat zahlen müssen.
Die Division, in der mein Vater diente, beteiligte sich an der großen Panzerschlacht am Kursker Bogen, bei den Operationen im Raum Ostrogoschsk und Rossosch, an den Kämpfen bei Charkow, an der Überquerung des Dnepr im Raum von Perejaslawl-Chmelnizki und bei der berühmten Verteidigung des Brückenkopfes von Bukrin.
Für das Übersetzen über den Dnepr erhielt Vater die Tapferkeitsmedaille, auf die er sehr stolz war, obwohl er später auch noch andere Auszeichnungen bekam, darunter zwei Orden des Roten Sterns. Im November und Dezember 1943 beteiligte sich seine Division an der Operation um Kiew, im April 1944 an der um Proskurow und Tschernowitz, im Juli und August desselben Jahres an der um Lemberg und Sandomir und an der Befreiung der Stadt Stanislaw. Die Division hatte in den Karpaten 461 Tote und mehr als anderthalbtausend Verwundete zu beklagen. Wie hatte Vater ein so blutiges Gemetzel überstehen und dann doch in den Karpaten umkommen können?
Drei Tage weinte die ganze Familie. Doch dann kam ein Brief von Vater, in dem stand, er sei wohlauf und gesund.
Beide Briefe stammten vom 27. August 1944. Ob er uns geschrieben, dann in die Schlacht gezogen und umgekommen war? Vier Tage später erhielten wir einen weiteren Brief von Vater, datiert vom 31. August. Also war Vater am Leben! Ich schrieb ihm einen Brief und äußerte meine Empörung über diejenigen, die uns den Brief mit der Todesmeldung geschickt hatten. In seinem Antwortbrief verteidigte Vater die Frontsoldaten: »Nein, mein Sohn, schimpf nicht auf die Soldaten – an der Front kommt alles Mögliche vor.« Ich nahm mir Vaters Worte zu Herzen.
Nach Kriegsende erzählte er uns dann, was im August 1944 passiert war. Am Vorabend eines Angriffs erhielten die Pioniere den Befehl, nachts am Berg Magur einen Gefechtsstand einzurichten. Der Berg ist mit Wald bedeckt, nur der Gipfel ist kahl und bietet eine gute Sicht über den Westabhang. Also richteten sie den Gefechtsstand dort ein. Die Kundschafter gingen vor, während Vater mit seinen Pionieren zu arbeiten begann. Die Tasche mit seinen Papieren und Fotos legte er auf die Brustwehr des ausgehobenen Grabens. Plötzlich gab es Lärm von unten, dann ertönten Schüsse. Die Pioniere stoben auseinander. Die Dunkelheit rettete sie. Sie verloren keinen einzigen Mann. Ein Wunder! Vater witzelte: »Meine zweite Geburt!« In diesem freudigen Zustand schrieb er uns dann den Brief: »Ich bin wohlauf und gesund«, ohne Einzelheiten.
Am Morgen, als der Angriff begann, entdeckten die Infanteristen oben Vaters Tasche. Sie dachten, er sei bei der Erstürmung des Bergs Magur ums Leben gekommen und schickten einen Teil der Papiere und die Fotografien zu uns nach Hause.
Und doch hat der Krieg Starschina Gorbatschow für das ganze Leben seinen Stempel aufgedrückt … Nach einem schwierigen und gefährlichen Streifzug ins Hinterland des Gegners, bei dem sie das Gelände entminten, die Verbindungslinien zerstörten und einige schlaflose Nächte hatten, bekam die Gruppe eine Woche Urlaub. Sie wurden ein paar Kilometer von der Front abgezogen und schliefen sich die ersten Tage einfach aus. Um sie herum: Wald, Stille, eine absolut friedliche Situation. Die Soldaten entspannten sich. Aber ausgerechnet über dieser Stelle kam es zu einem Luftkampf. Vater und seine Pioniere beobachteten, wie er wohl enden würde. Da warf ein deutsches Flugzeug auf der Flucht vor unseren Jägern auf einmal seine ganze Bombenlast ab.
Pfeifen, Geheul, Explosionen. Alle warfen sich auf den Boden. Eine der Bomben schlug nicht weit von Vater ein, und ein riesiger Bombensplitter riss ihm das Bein auf. Ein paar Millimeter weiter, und er hätte ihm das Bein abgerissen. Aber Vater hatte wieder Glück, der Knochen war unversehrt.
Das passierte in der Tschechoslowakei, bei der Stadt Košice. Damit war Vaters Frontleben zu Ende. Man brachte ihn ins Krankenhaus nach Krakau, und dann kam auch schon bald der 9. Mai 1945, der Tag des Sieges.
Wie die anderen habe auch ich in den Kriegsjahren vieles durchgemacht. Aber wenn die Rede auf den Krieg kommt, taucht vor meinen Augen sofort ein entsetzliches Bild auf. Ende Februar, Anfang März 1943 kam ich auf der Suche nach Kriegstrophäen mit anderen Kindern auf einen fernen Waldstreifen zwischen Priwolnoje und dem Nachbardorf am Kuban: Belaja Glina. Wir stießen auf die Überreste von Rotarmisten, die hier im Sommer 1942 ihren letzten Kampf ausgehalten hatten. Nicht zu beschreiben: verweste Körper, Schädel in verrosteten Stahlhelmen, aus den vermoderten Feldblusen ragten gebleichte Hände. Daneben ein leichtes Maschinengewehr, Granaten, Patronenhülsen. So lagen sie da, unbeerdigt, in der dreckigen Brühe der Schützengräben und Bombentrichter, und glotzten uns aus ihren riesigen schwarzen Augenhöhlen an …
Die anonymen Soldaten wurden in einem Massengrab beerdigt. Wir haben sie nie als fremde, nicht zu uns gehörige Menschen betrachtet. Im Zentrum von Priwolnoje gibt es jetzt einen kleinen Obelisken. Darauf stehen die Namen derer, die nicht aus dem Krieg zurückgekehrt sind. Auch Gorbatschows sind darunter.
Als der Krieg zu Ende ging, war ich vierzehn. Bis heute sehe ich das verwüstete Nachkriegsdorf vor mir. Statt Häusern Lehmhöhlen, überall Zeichen der Verwahrlosung, der Armut. Meine Generation ist die Generation der Kriegskinder. Wir sind gebrannte Kinder, der Krieg hat auch unserem Charakter und unserer ganzen Weltanschauung den Stempel aufgedrückt.
Was wir in unserer Kindheit durchgemacht haben, ist wohl die Erklärung dafür, warum gerade wir Kriegskinder die Lebensweise von Grund auf ändern wollten. Wir Jungen, auf deren Schultern die Verantwortung für das Überleben der ganzen Familie und für das eigene Durchkommen lag, wurden von einem Tag auf den anderen erwachsen. Der Zusammenbruch des Lebens, ja der Welt, den wir sahen und an dem wir beteiligt waren, hat uns direkt aus der Kindheit in das Erwachsenenleben katapultiert. Wir haben uns weiter am Leben gefreut wie Kinder, wir haben weiter die Spiele von Heranwachsenden gespielt, aber irgendwie blickten wir schon halb mit den Augen von Erwachsenen auf unsere Spiele.
Schul- und Nachkriegsjahre
Den Unterricht in der Schule nahm ich 1944 nach zweijähriger Unterbrechung wieder auf. Ich hatte keinerlei Lust zum Lernen. Nach all dem, was ich erlebt hatte, erschien es mir zunächst als nicht ernst zu nehmende Beschäftigung. Außerdem hatte ich nichts Rechtes anzuziehen, um zur Schule zu gehen.
Vater hatte Mutter einen Brief geschickt, in dem stand: »Verkauf alles, kauf ihm Kleidung, Schuhe, Bücher, Michail muss unbedingt lernen.«
Aber schon am ersten Tag blieb ich nicht bis zum Ende des Unterrichts. Zu Mutter sagte ich: »Ich gehe nicht mehr in die Schule.« Sie verließ das Haus und kehrte abends mit einem Stapel Bücher zurück. Nachdem ich einmal angefangen hatte zu lesen, las ich bis in die Nacht hinein. Am Morgen stand ich auf und ging zur Schule.
Nicht ohne Bewegung denke ich an die Schule jener Jahre, an die Lehrer und Schüler. Die Schule war in mehreren Gebäuden des Dorfes untergebracht, die zu ganz anderen Zwecken gebaut worden waren. Sie hatte eine lächerliche Anzahl Schulbücher, ein paar Landkarten, Anschauungsmaterial und mühsam aufgetriebene Kreide. Das war alles. Der Rest musste von Lehrern und Schülern in Handarbeit hergestellt werden. Hefte gab es überhaupt nicht. Ich behalf mir mit Vaters Büchern über die Mechanisierung. Auch Tinte machten wir selbst. Für Heizstoff musste die Schule selber sorgen, also hielt sie sich Pferde und ein Fuhrwerk. Ich weiß noch, wie die ganze Schule im Winter die Pferde vor dem Verhungern zu retten suchte. Sie waren so ausgezehrt und entkräftet, dass sie sich nicht auf den Beinen halten konnten. Woher wir nicht alles Futter für sie anschleppten! Das war gar nicht so einfach, denn das ganze Dorf hatte die gleiche Sorge: das private Vieh zu retten. Von den Viehhöfen der Kolchose, von denen jeden Tag Kadaver abtransportiert wurden, will ich erst gar nicht reden.
Noch eine Erinnerung: Nach seiner Genesung und schon nach Kriegsende, im Sommer 1945, führte Vater eine Dienstreise in unsere Nähe, und er bat, seine Familie für zwei Tage besuchen zu dürfen. Er erhielt die Erlaubnis, und wir trafen uns.
Ich saß im Hof und bastelte etwas. Da schrie jemand: »Mischa, da kommt dein Vater!« Das kam so unerwartet, dass ich ganz verwirrt war. Aber dann lief ich ihm entgegen.
Ein paar Schritte voneinander entfernt blieben Vater und ich stehen, wir blickten uns an. Vater hatte sich sehr verändert, er war in Uniform, trug Orden, ich war groß geworden. Aber die Hauptsache war: Vater sah, wie dünn und abgerissen ich aussah. Da hörte ich auf einmal seine Worte, die er so verbittert aussprach, dass ich sie nicht vergessen kann: »So weit hat uns dieser Krieg gebracht!«
Unsere Dorfschule hatte acht Klassen. Es mussten noch ein paar Jahre ins Land gehen, bis in Priwolnoje endlich eine moderne Mittelschule gebaut wurde. Damals musste man noch in die Kreisstadt fahren, um die neunte und zehnte Klasse abzuschließen. Wie die anderen Kinder aus meinem Dorf wohnte ich zur Miete und ging ein Mal pro Woche etwas zu essen einkaufen, sodass ich zu dieser Zeit durchaus schon ein selbständiger Mensch war. Niemand kontrollierte meine schulischen Fortschritte. Man fand, ich sei alt genug, um meine Aufgaben eigenständig zu erledigen, ohne dass mich jemand dazu anhalten musste. Nur einmal in all den Jahren habe ich meinen Vater mit Mühe und Not dazu gekriegt, zur Elternversammlung der Schule zu gehen.
Ich lernte leidenschaftlich gern. Ich hatte eine unstillbare Neugier und wollte allem auf den Grund gehen. Mir gefielen Mathematik und Physik. Geschichte und Literatur zogen mich besonders stark an.
Die Journalisten haben mich oft mit der Frage gelöchert: »Wer hat Sie am stärksten beeinflusst?« Ich habe unterschiedlich darauf geantwortet. Einmal habe ich spontan gesagt: die russische Literatur. Heute bin ich überzeugt, dass das stimmt.
Schon in unserer Dorfbibliothek von Priwolnoje hatte ich mir einen neuen Band von Belinskij[5] ausgeliehen. Ich war begeistert und las ihn mehrere Male. Als ich zum Studium nach Moskau fuhr, schenkte man mir dieses Buch, weil ich der Erste aus unserem Dorf war, der an der Staatlichen Moskauer Universität angenommen worden war.
Ansonsten mochte ich natürlich, wie alle Russen, Puschkin, Lermontow, Gogol, später Tolstoj, Dostojewskij, Turgenjew … In meiner Jugend war ich ein Lermontow-Fan, ich hatte viel übrig für seine erhabene Romantik. Dann kam die Zeit der Begeisterung für Majakowskij und Jesenin. Noch heute verblüfft mich, wie diese noch ganz jungen Menschen so weitsichtig sein konnten.
An Vaters Seite
Unterdessen forderte die Realität unerbittlich von jedem ihren Tribut, auch von mir. 1945 wurde Vater aus der Armee entlassen und kehrte zu seiner Arbeit als Mähdreschermechaniker zurück. Von 1946 an arbeitete ich jeden Sommer mit, als sein Gehilfe. Die Schule in Priwolnoje war zwei Kilometer von unserer Hütte entfernt. Nach dem Unterricht lief ich zu Großvater Pantelej, der im Dorfzentrum wohnte, zog mir Arbeitskleidung an und rannte zur Maschinen-und-Traktoren-Station, um Vater bei der Instandsetzung des Mähdreschers zu helfen. Abends gingen wir zusammen nach Hause. Ich spüre, wie sehr es mich bewegt, wenn ich das so niederschreibe …
Dann kam die Getreideernte. Ende Juni bis Ende August musste ich draußen auf dem Feld arbeiten. Selbst wenn die Ernte wegen Regens unterbrochen wurde, blieben wir auf dem Feld, setzten die Maschinen instand und warteten auf heiteres Wetter. An solchen »Ruhe«-Tagen führten Vater und ich viele Gespräche über Gott und die Welt, die Arbeit, das Leben. Unser Verhältnis war nicht nur das von Vater und Sohn, sondern auch eins zwischen Menschen, die eine gemeinsame Aufgabe haben, die zusammen arbeiten. Vater behandelte mich mit Respekt, wir waren richtige Freunde.
Vater galt als bester Mähdreschermechaniker und lernte mich an. Nach zwei, drei Jahren konnte ich die Mechanik des Mähdreschers allein bedienen. Besonders stolz war ich, dass ich einen Fehler des Mähdreschers sofort dem Gehör nach einordnen konnte. Nicht weniger stolz war ich, dass ich von jeder beliebigen Stelle auf den Mähdrescher klettern konnte, sogar von da aus, wo die Schneideapparate kreischten und sich die Haspel drehte. Wenn man sagt, die Arbeit mit dem Mähdrescher war schwer, ist das eine starke Untertreibung. Schwerstarbeit war das: 14 oder sogar 20 Stunden am Tag bis zur totalen Erschöpfung.
Die Arbeit der Bauern in der Kolchose war hart. Aber wir hatten nichts davon. Die Rettung war das private Hofgrundstück. Dort baute man an, was irgend ging, aber nicht alles gehörte uns. Jeder Bauernhof war zu allen möglichen Steuern und Lieferungen an den Staat verpflichtet. Noch Jahre später, als ich Vorträge zur Agrarpolitik hielt, mied ich tunlichst scharfe Bewertungen und Formulierungen, weil ich sehr wohl wusste, was das Leben und die Arbeit eines Bauern bedeuten.
Unsere Familie hatte es leichter als andere: Mechaniker bekamen Geld und Naturalien. Zwar waren diese Löhne erbärmlich, sodass wir das, was wir in unserer Privatwirtschaft angebaut hatten, verkaufen mussten, um davon wenigstens das Nötigste an Kleidung oder Haushaltsgerätschaften kaufen zu können. Dazu mussten wir nach Rostow, Stalingrad oder Schachty auf den Markt fahren. Kurz: Es reichte hinten und vorne nicht.
In diesem Zusammenhang ist mir in Erinnerung, immer war Mutter in der Nähe, immer unterstützte sie uns. Ich liebte sie. Und auch Vater liebte sie bis zu seinem Tod. Sie war eine wunderschöne Frau, sehr stark und zupackend. Vater war stolz auf sie, verzieh ihr ihre hektische Art und half bei allem. Das spornte meinen Bruder Alexander und mich an. Eins allerdings nahm ich ihr übel: wenn sie mich bei Vater verpetzte, dass ich mir zu viel herausgenommen hatte. Wenn ich mich hier an unsere Familie erinnere, von der nur ich noch am Leben bin, bedaure ich, nicht mehr für sie getan zu haben, besonders für meinen Bruder. Auf meinen Rat absolvierte er die Höhere Militärschule in Leningrad, war bei der Nachrichtenabteilung der Raketentruppen im Moskauer Umland tätig und zuletzt bei den Raumfahrttruppen. Er war ein sehr guter Mensch.
Familie Gorbatschow mit den Söhnen Michail und Alexander, 1950
Schwer, sehr schwer verdiente man sein Brot in jenen Jahren. 1946 gab es eine Missernte. Ausgerechnet in den Getreideanbaugebieten kam es zu einer Dürre. 1947 war ein besseres Jahr für unser Land. 65,9 Tonnen Getreide wurden geerntet. Aber im Stawropoler Land hatte es auch dieses Jahr eine Missernte gegeben. Irgendwie kamen wir über den Winter. Unsere ganze Hoffnung richtete sich auf die Ernte des Jahres 1948. Und da kam es Anfang des Frühjahrs, im April, zu Staubstürmen, dem Begleitphänomen einer Dürre. »Schon wieder eine Katastrophe«, sagte Vater, »schon das dritte Jahr in Folge nach dem Krieg.« Doch ein paar Tage später kam ein warmer, warmer Regen. Es regnete einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und das Getreide begann zu wachsen.
Die Ernte des Jahres 1948 war die erste ordentliche Ernte im Stawropoler Land. In unserer Kolchose ernteten wir 22 Dezitonnen pro Hektar. Für die damalige Zeit – besonders nach den jahrelangen Missernten – ein einzigartiges Ergebnis. Seit 1947 war ein Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UDSSR in Kraft: Wer 10000 Dezitonnen Getreide mit dem Mähdrescher schafft, erhält die Auszeichnung »Held der Sozialistischen Arbeit«, wer 8000 schafft, bekommt den Leninorden. Vater und ich hatten 8888 Dezitonnen geschafft. Vater bekam den Leninorden, ich den Orden des Roten Banners. Ich war erst siebzehn, und dieser Orden ist mir bis heute der teuerste. Die Nachricht von der Auszeichnung kam im Herbst. Es gab eine feierliche Versammlung in der Schule. Ich erlebte so etwas zum ersten Mal, und obwohl ich sehr verlegen war, war ich natürlich trotzdem froh. Damals musste ich meine erste öffentliche Rede halten.
Das Jahr 1948 war für meine Familie zwar kein Glücksjahr, aber ein erfolgreiches Jahr.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: