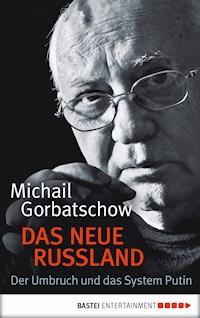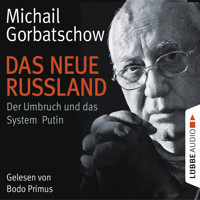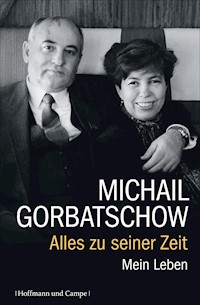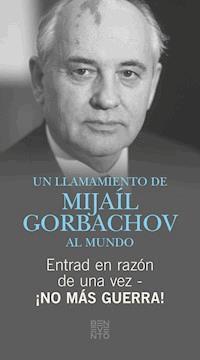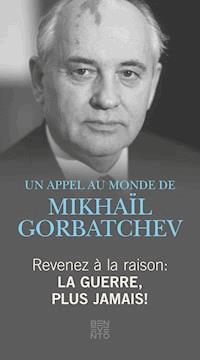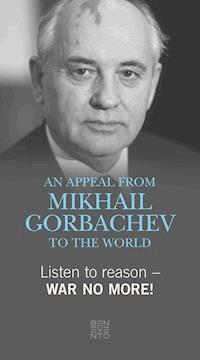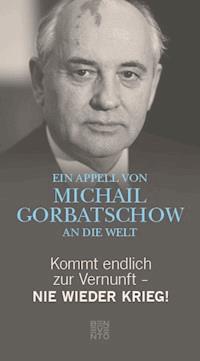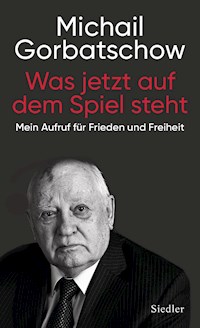
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michail Gorbatschow über die gefährliche Unordnung der Welt
Dreißig Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ist der Frieden in der Welt wieder in Gefahr. Der US-Präsident kündigt das Abrüstungsabkommen mit Russland, Europa zerfällt, China drängt nach vorn und eine Welle von Nationalisierung und Ideologisierung gefährdet die Freiheit und die Selbstbestimmung der Völker.
Michail Gorbatschow, der letzte große Staatsmann der Revolution von 1989, warnt angesichts der gefährlichen Weltlage vor einem Krieg aller gegen alle. Er beschreibt die Unfähigkeit und den Unwillen der aktuellen politischen Führer, an internationalen Lösungen zu arbeiten. Er widmet sich den großen Herausforderungen unserer Zeit, etwa der Krise der Demokratien und dem Vormarsch von Populisten und Ideologen, und setzt auf Dialog und Verständigung. Nicht zuletzt widmet er sich Deutschland, dem er, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, noch heute besonders verbunden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Dreißig Jahre nach dem Ende des Ost-West-Konflikts ist der Frieden in der Welt wieder in Gefahr. Der US-Präsident kündigt das Abrüstungsabkommen mit Russland, Europa zerfällt, China drängt nach vorn und eine Welle von Nationalisierung und Ideologisierung gefährdet die Freiheit und die Selbstbestimmung der Völker.
Michail Gorbatschow, der letzte große Staatsmann der Revolution von 1989, warnt angesichts der gefährlichen Weltlage vor einem Krieg aller gegen alle. Er beschreibt die Unfähigkeit der aktuellen politischen Führer, an internationalen Lösungen zu arbeiten. Er widmet sich den großen Herausforderungen unserer Zeit, etwa der Krise der Demokratien und dem Vormarsch von Populisten und Ideologen, und setzt auf Dialog und Verständigung. Nicht zuletzt widmet er sich Deutschland, dem er, dreißig Jahre nach dem Mauerfall, noch heute besonders verbunden ist.
Der Autor
Michail Gorbatschow, 1931 geboren, war von 1985 bis 1991 Generalsekretär des ZK der KPdSU und 1990 / 91 Staatspräsident der Sowjetunion. In Abrüstungsverhandlungen mit den USA und durch die Politik von Glasnost und Perestroika leitete er das Ende des Kalten Krieges ein. Im Februar 1990 stimmte Gorbatschow bei einem Treffen mit Bundeskanzler Helmut Kohl im Kaukasus der deutschen Einheit zu. Im gleichen Jahr erhielt er den Friedensnobelpreis.
Michail Gorbatschow
Was jetzt auf dem Spiel steht
Mein Aufruf für Frieden und Freiheit
Aus dem Russischen von Boris Reitschuster
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.Copyright © by Michail Gorbatschow, 2019
© 2019 für die deutsche Ausgabe by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-25261-8V001www.siedler-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Erster Teil Unsere gemeinsame Sicherheit
Die Militarisierung der Weltpolitik
Gleiche Sicherheit für alle – die Charta von Paris
Den Teufelskreis durchbrechen!
Wir müssen gemeinsam handeln
Zweiter Teil Die globale Welt verstehen
Wem nützt die Globalisierung?
Die ökologische Herausforderung
Die Erd-Charta
Dritter Teil Ideen und Politik
Die Welle des Populismus und der Niedergang der Demokratie
Sind Politik und Moral vereinbar?
Vierter Teil Wer ist wer in der globalen Welt?
Die USA: monopolistische Führung oder Partnerschaft?
Europa: unser Kontinent, unser Zuhause
China und Indien: die neuen Giganten
Der Nahe Osten: nervöser Knoten der Weltpolitik
Die Krise der Demokratie
Die Verantwortung der Medien
Zivilgesellschaft und internationale Organisationen
Das neue Russland
Fünfter Teil Deutschland und Russland: Wie geht es weiter?
Ein Wort an die Deutschen des 21. Jahrhunderts
Erinnerungen an Deutschland
Die friedliche Revolution von 1989
Was die Geschichte lehrt
Vorwort
Dieses Buch trägt den Titel »Was jetzt auf dem Spiel steht«, und es geht dabei um nicht weniger als die Zukunft der globalen Welt. Ist das nicht vermessen? Wer kann schon voraussagen, wohin die Menschheit sich künftig bewegen wird?
Die Prognosen, die vor hundert oder selbst vor zwanzig Jahren gemacht wurden, lösen heute nur noch mitleidiges Lächeln aus. Doch in diesem Buch möchte ich keine Prognose stellen. Ich möchte reflektieren, wie wir heute handeln, wonach wir streben und was wir vermeiden sollten, wenn wir unsere Welt für künftige Generationen erhalten wollen.
Die aktuellen Ereignisse, Entwicklungen und Pläne, von denen ich in letzter Zeit erfahren habe, machen mir große Sorgen.
Das in Chicago veröffentlichte »Bulletin of the Atomic Scientists«, das seit 1945 die Gefahr eines Atomkrieges ermittelt, hat kürzlich die Zeiger der »Weltuntergangsuhr« eine halbe Minute vorgestellt. Es ist, symbolisch gesprochen, zwei Minuten vor zwölf, wir sind zwei Minuten vom Krieg entfernt. Das letzte Mal war die Lage so dramatisch im Jahr 1953.
Wir leben in einer globalisierten Welt, haben sie aber noch nicht völlig verstanden, haben nicht gelernt, wie wir alle darin gut leben können. Diese Erkenntnis beschäftigt mich schon länger. Wir bemerken die Gefahren, die auf uns lauern, oft zu spät. Und wenn wir sie doch erkennen, trauen wir uns nicht zu handeln. Wir haben auf vielen Ebenen Partnerschaft und Kooperation gepflegt. Und doch bleibt die Politik oft hinter den raschen Veränderungen in der Welt zurück.
Meine aktive politische Tätigkeit fiel in eine Zeit, als mein Land und die ganze Welt für kolossale Veränderungen reif waren. Wir haben uns den Herausforderungen gestellt. Wir haben manches falsch eingeschätzt und Fehler gemacht. Aber wir haben Veränderungen von historischem Ausmaß angestoßen, und das auf friedliche Weise. Ich denke, das gibt mir das Recht, auch über die Zukunft nachzudenken und meine Gedanken mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu teilen.
Ich hoffe, dass dieses Buch Sie zu eigenem Denken und Handeln anregt. Schließlich sind wir alle für die Zukunft der globalen Welt verantwortlich.
Erster Teil Unsere gemeinsame Sicherheit
Die Militarisierung der Weltpolitik
Die Weltpolitik entwickelt sich in eine äußerst gefährliche Richtung. Militaristische und destruktive Tendenzen nehmen zu. Der Abbau des Systems zur atomaren Rüstungsbegrenzung schreitet voran. Und die größte Bedrohung für unsere Sicherheit ist die Entscheidung der USA, den INF-Vertrag zur Vernichtung von Kurz- und Mittelstreckenraketen zu kündigen.
Der INF-Vertrag, der START-1-Vertrag zur Reduzierung nuklearer Trägersysteme, aber auch die Initiativen der Präsidenten der UdSSR und der USA zur Beseitigung taktischer Atomwaffen – sie haben es möglich gemacht, dass die Welt von Tausenden Atomwaffen befreit wurde, die sich im Kalten Krieg angesammelt hatten. Wir haben es geschafft, die Politik und das Denken zu entmilitarisieren.
Diese Abkommen wurden zu einem Symbol für das Ende des Kalten Krieges. Bei unserem ersten Treffen in Genf 1985 haben Ronald Reagan und ich jene Idee in Worte gefasst, die später zum INF-Vertrag führen sollte: »Niemals darf ein Atomkrieg entfesselt werden, denn es kann dabei keinen Sieger geben.« Zugleich revidierten unsere beiden Staaten ihre Militärdoktrinen, um die Abhängigkeit von Atomwaffen zu verringern.
Im Vergleich zum Höhepunkt des Kalten Krieges ist die Zahl der Atomwaffen in Russland und den USA bis heute um mehr als 80 Prozent geschrumpft – eine historische Errungenschaft.
Sie betraf nicht nur Atomwaffen. Dazu kam eine Konvention zur Beseitigung chemischer Waffen, und die Länder Ost- und Westeuropas einigten sich auf die radikale Reduzierung ihrer Streitkräfte und ihrer Rüstungsausgaben. Dies war die »Friedensdividende«, die vor allem die Europäer nach dem Ende des Kalten Krieges eingefahren haben.
Seit Mitte der neunziger Jahre setzte dann aber eine gegenläufige Tendenz ein: die schrittweise Remilitarisierung des Denkens und Handels, eine kontinuierliche Steigerung der Militärausgaben und ein Abbau der Rüstungsbeschränkungen.
Heute ist von den drei Hauptpfeilern der globalen strategischen Stabilität – dem ABM-Vertrag, dem INF-Vertrag und dem START-Vertrag – allein das Schicksal des Letzteren, von den Präsidenten Medwedew und Obama 2010 unterzeichnet, noch ungewiss. Nach Aussagen amerikanischer Regierungsvertreter könnte auch er bald Geschichte sein.
Die heutigen militärischen Aktivitäten ähneln zunehmend den Vorbereitungen für einen echten Krieg. Laut Dokumenten, die von der Trump-Administration veröffentlicht wurden, orientiert sich die US-Außenpolitik immer mehr an politischer, wirtschaftlicher und militärischer Rivalität überall auf der Welt. Das Ziel besteht darin, neue Atomwaffen für einen flexibleren Einsatz zu entwickeln. Was nichts anderes bedeutet, als die Schwelle für den Atomwaffeneinsatz stetig zu senken.
Vor diesem Hintergrund verkündete der russische Präsident Wladimir Putin vor der Föderalversammlung die Anschaffung mehrerer neuartiger Waffensysteme. Gleichzeitig erklärte er, Russland strebe kein neues Wettrüsten an, was ohne Zweifel die Stimmung in der Bevölkerung widerspiegelt. Schon oft in der Geschichte war unser Land gezwungen, in einem Rüstungswettlauf gegenüber der anderen Seite aufzuholen. Heute steht nicht nur Russland, sondern die ganze Welt vor einer neuen militärischen Herausforderung.
Die Vereinigten Staaten wollen die Weltpolitik dominieren, indem sie sich auf ihre militärische Überlegenheit stützen – dies ist der Eindruck, wenn man die aktuellen Ereignisse betrachtet.
Die USA wollen dabei die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat an den Rand drängen und durch eine militärische Allianz ersetzen, die nicht nur ihr eigenes Territorium erweitert, sondern auch zunehmend danach strebt, ihren »Verantwortungsbereich« auszudehnen – überall auf der Welt.
In den frühen neunziger Jahren hatten wir uns darauf geeinigt, dass das Gebiet der ehemaligen DDR einen militärpolitischen Sonderstatus erhalten sollte. Deutschland verpflichtete sich, dort keine zusätzliche militärische Infrastruktur, ausländische Truppen und Massenvernichtungswaffen zu stationieren. Darüber hinaus mussten die Deutschen die Zahl ihrer Streitkräfte fast halbieren. Deutschland hat diese wie auch andere Bestimmungen des Vertrages bis heute eingehalten.
Zugleich wurden im Rahmen der NATO und des damals noch bestehenden Warschauer Pakts die jeweiligen Militärdoktrinen überarbeitet. Es war geplant, jeweils die politische zulasten der militärischen Komponente zu stärken. Mitgliedsländer der NATO sowie des Warschauer Pakts einigten sich vertraglich auf den Abbau ihrer Truppenstärke.
Manche meiner Kritiker halten mir bis heute vor, ich hätte damals nicht darauf bestanden, vertraglich festzuhalten, dass die NATO sich zukünftig nicht nach Osteuropa ausdehnen dürfe. Eine solche Forderung wäre absurd, ja geradezu lächerlich gewesen, denn der Warschauer Pakt existierte ja noch. Man hätte uns sofort beschuldigt, ihn preisgegeben zu haben.
Vielmehr haben wir unter den damaligen Bedingungen das Maximum erreicht. Russland hatte das volle Recht zu verlangen, dass die Gegenseite nicht nur getreu den Buchstaben, sondern im Geiste der damaligen Vereinbarungen und Verpflichtungen handelt.
Doch das gegenseitige Vertrauen, das mit dem Ende des Kalten Krieges gewachsen war, wurde dann einige Jahre später schwer erschüttert – durch die Entscheidung der NATO, sich nach Osten auszudehnen. Und Russland konnte darauf keine Antwort finden.
Was auf dem Spiel steht
Der INF-Vertrag, der eine historische Bedeutung für den Frieden hatte, ist nun Geschichte – sein Scheitern geht auf das Konto der USA. Ebenso wie die Weigerung, den Vertrag über das Verbot von Nuklearversuchen zu ratifizieren, und der Rücktritt vom ABM-Vertrag über die Beschränkung von Raketenabwehrsystemen.
Die Kündigung des INF-Vertrags durch einen der beiden Partner bedarf einer Erklärung über außerordentliche Ereignisse, die dessen höchste Interessen gefährden. Wer eine so gravierende Entscheidung trifft, muss der Weltgemeinschaft erklären, was ihn dazu treibt, all das zu zerstören, was bisher aufgebaut wurde.
Was ist passiert, welche Bedrohung treibt die Vereinigten Staaten zu diesem Schritt – deren Militärausgaben um ein Vielfaches höher sind als jene der konkurrierenden Mächte?
Haben die USA den UN-Sicherheitsrat informiert, der dazu geschaffen wurde, um Konflikte zu lösen, die den Frieden bedrohen? Offenbar nicht. Stattdessen werden Russland angebliche Vertragsverstöße vorgeworfen, die selbst für Experten schwer nachzuvollziehen sind. Und all dies im Ton eines Ultimatums.
Als Argument verweisen die USA darauf, dass auch andere Länder, vor allem China, der Iran und Nordkorea, über Mittelstreckenraketen verfügen. Das ist nicht überzeugend. Tatsächlich kontrollieren die Vereinigten Staaten und Russland gemeinsam noch immer mehr als 90 Prozent der weltweit existierenden Atomwaffen. In diesem Sinne bleiben unsere beiden Länder Supermächte, das Atomwaffenarsenal anderer Länder ist zehn- bis fünfzehnmal kleiner.
Wenn der Prozess der Reduzierung von Atomwaffen fortgesetzt würde, müssten sich irgendwann zwangsläufig auch andere Länder anschließen, darunter Großbritannien, Frankreich und China. Diese drei Staaten haben wiederholt ihre jeweilige Bereitschaft bekräftigt. Aber wie kann man von ihnen Zurückhaltung verlangen, wenn eine der Supermächte die bestehenden Beschränkungen aufheben und ihr atomares Arsenal ausbauen will?
Es drängt sich der Eindruck auf, dass hinter der Entscheidung, vom Vertrag zurückzutreten, nicht die von den USA angeführten Gründe stehen, sondern etwas ganz anderes: das Streben nach militärischer Überlegenheit, ein dringender Wunsch, jegliche Beschränkungen bei der Aufrüstung abzuschütteln. »Wir haben viel mehr Geld als jedes andere Land«, erklärt Präsident Trump, »und wir werden unser Rüstungsarsenal erweitern, bis sie zur Besinnung kommen.« Erweitern – warum, wofür? Um der Welt seinen Willen aufzuzwingen?
Das ist eine Illusion. In der heutigen Welt kann kein einzelnes Land Hegemonie erlangen. In letzter Zeit wurde dies deutlich: Selbst die treuesten Verbündeten Washingtons sind nicht mehr bereit, vor dem großen Bruder strammzustehen.
Die Folge der gegenwärtigen destruktiven Wende können nur eine Destabilisierung und ein neues Wettrüsten sein. Die Weltlage wird immer chaotischer und unkontrollierbarer. Dies wiederum gefährdet die Sicherheit aller Staaten, auch die der USA.
Ihr Präsident erklärte, sein Land habe gehofft, einen neuen, »guten« Vertrag abzuschließen. Man sollte sich nicht täuschen lassen, auch nicht durch die Erklärung von Außenminister Mike Pompeo, man habe »keine Pläne, sofort neue Raketenwaffen einzusetzen«. Es bedeutet doch nur, dass die USA diese Raketen noch nicht besitzen.
Diese Beteuerungen haben auch die Europäer nicht überzeugt. Sie sind alarmiert, und das ist verständlich. Jeder erinnert sich an die frühen achtziger Jahre, als Hunderte von Raketen auf unserem Kontinent stationiert wurden, sowjetische SS-20 auf der einen, amerikanische Pershings und Marschflugkörper auf der anderen Seite. Und jeder versteht, dass ein neues Wettrüsten noch gefährlicher sein könnte.
Ich begrüße die Bemühungen der europäischen Länder, den INF-Vertrag zu retten. Die Europäische Union hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, über die Folgen des Rücktritts aus dem Vertrag für ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit ihrer Verbündeten und die der ganzen Welt nachzudenken. Bundesaußenminister Heiko Maas, der warnte, die Kündigung des INF-Vertrags habe »zahlreiche negative Folgen«, reiste deshalb nach Moskau und Washington, um zu vermitteln. Leider vergeblich. Umso dringlicher ist es, die Bemühungen fortzusetzen, auch nachdem der Rückzug der USA aus dem Vertrag und damit sein Scheitern praktisch vollzogen sind.
Zu viel steht jetzt auf dem Spiel.
Gegner des Vertrags erklären, die Welt habe sich seitdem entscheidend verändert, er sei schlicht veraltet. Das Erstere ist sicher wahr, das Letztere grundfalsch.
Denn trotz aller Veränderungen in der Welt – wir dürfen nicht auf jene Abkommen verzichten, die die Grundlage der globalen Sicherheit nach dem Ende des Kalten Krieges schufen. Vielmehr müssen wir unsere ganze Kraft darauf richten, das wichtigste Ziel zu erreichen: die endgültige Beseitigung aller Atomwaffen.
Gleiche Sicherheit für alle – die Charta von Paris
Im November 1990 kehrte ich aus Frankreich zurück, wo bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs Europas, der USA und Kanadas ein historisches Dokument unterzeichnet worden war: die »Charta von Paris« für ein neues Europa.
Im Flugzeug nach Moskau las ich sie noch einmal. Diese Charta war viel mehr als nur eine politische Erklärung – ein wahres Manifest, eine Verpflichtung gegenüber den Völkern nicht nur Europas, sondern der ganzen Welt.
Die Unterzeichner verkündeten darin: »Die Ära der Konfrontation und Spaltung in Europa ist vorbei.« Fortan würden Beziehungen »auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gegenseitiger Zusammenarbeit« gepflegt, man würde »die Demokratie als einziges Regierungssystem in unseren Ländern aufbauen, festigen und stärken«.
Die Länder Europas und Amerikas erklärten, dass sie in Zukunft gemeinsame Werte verfolgten: »Ein festes Bekenntnis zur Demokratie auf der Grundlage der Menschenrechte und Grundfreiheiten; Wohlstand durch wirtschaftliche Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gleiche Sicherheit für alle unsere Länder.«
Gleiche Sicherheit für alle, dies war die Grundvoraussetzung für alles andere. Die Charta war da unmissverständlich: »Mit dem Ende der Teilung Europas werden wir uns bemühen, unseren Sicherheitsbeziehungen eine neue Qualität zu verleihen, wobei die Wahlfreiheit in diesem Bereich uneingeschränkt gewahrt bleibt. Sicherheit ist unteilbar, und die Sicherheit jedes Teilnehmerstaats ist untrennbar mit der Sicherheit aller anderen verbunden.«
Am Ende heißt es:
»Wir beschließen, Mechanismen zur Verhütung und Lösung von Konflikten zwischen Teilnehmerstaaten zu schaffen. (…) Wir werden nicht nur nach wirksamen Wegen suchen, um mögliche Konflikte mit politischen Mitteln zu verhindern, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht auch geeignete Mechanismen zur friedlichen Beilegung etwaiger Streitigkeiten festlegen. Dementsprechend verpflichten wir uns, in diesem Bereich nach neuen Formen der Zusammenarbeit zu suchen.«
Wenn ich heute dieses Dokument betrachte, steht es für mich in einer Reihe mit den großen Abkommen, die wir bei unseren Treffen mit den US-Präsidenten Ronald Reagan in Reykjavik und George Bush in Malta erzielt haben. Es war der Schritt vom Kalten Krieg in eine friedliche Zukunft.
Europa spielte dabei eine besondere Rolle. Hier wurde im zwanzigsten Jahrhundert die Weltgeschichte entscheidend geprägt. Von hier aus verbreiteten sich jene Ideologien, die sich bald auf allen Kontinenten feindlich gegenüberstanden. Hier wurde auf dramatische Weise über Krieg und Frieden entschieden.
In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts erlebte Europa die Katastrophe zweier Weltkriege, den Tod vieler Millionen Menschen, die verheerenden Auswirkungen von totalitären Ideologien, von Willkür und Zerstörung von Recht und Moral.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts standen Europa und die ganze Welt vor weiteren kolossalen Herausforderungen. Die bei der Gründung der Vereinten Nationen proklamierten Ideale des Friedens und der Zusammenarbeit blieben ein fernes und für viele unerreichbares Ziel. Die Welt zerfiel in feindliche Lager. Und seit dem Aufkommen der Atomwaffen steht sogar die Existenz der Menschheit auf dem Spiel.
Die Generation der Politiker, der ich angehöre, wurde in der Nachkriegszeit geprägt. Einige von uns haben am Zweiten Weltkrieg als Soldaten teilgenommen, andere haben die schrecklichen Heimsuchungen als Kinder oder Heranwachsende erlebt. Der Zweite Weltkrieg hat tiefe Spuren in unserer Seele hinterlassen und uns gelehrt, den Frieden besonders zu schätzen.
Wir begannen unseren Weg in die Politik in den Jahren des Kalten Krieges und des beginnenden Wettrüstens, als teils aus objektiven Gründen, teils aufgrund der Fehler einzelner Staatsmänner, die historische Chance auf Frieden und Zusammenarbeit vertan worden war.
Politiker und Diplomaten waren in diesen Jahren vor allem darum bemüht, dass aus dem Kalten Krieg kein echter, »heißer« Krieg wurde. Das Wettrüsten konnten sie nicht verhindern.
Dafür war ein Durchbruch im Denken erforderlich. Und der kam tatsächlich zustande, nicht über Nacht, sondern als Ergebnis einer langen intellektuellen Suche auf beiden Seiten der damals noch geteilten Welt.
Das Ende des Kalten Krieges war das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen. Die Führer der Staaten, von denen das Schicksal der Welt abhing, zeigten damals Verantwortungsbewusstsein und politischen Willen. Und die gewaltigen Veränderungen, die allen Völkern Europas den Weg zu Freiheit und Demokratie ebneten, verliefen friedlich und gewaltfrei.
Freiheit – Worte und Taten
Einer der Grundsätze des neuen politischen Denkens lautete: Sicherheit kann niemals einseitig zum Nachteil anderer erreicht werden. Das war auch die Überzeugung der damaligen politischen Führung der Sowjetunion. Wir boten unseren westlichen Partnern Vereinbarungen an, die die aktuellen Konflikte lösen und dabei die Interessen beider Vertragsparteien berücksichtigen sollten.
Ein weiteres wichtiges Prinzip war die Wahlfreiheit, also das Selbstbestimmungsrecht. Das haben wir in der Sowjetunion den Völkern unseres großen, aus vielen Volksgruppen bestehenden Landes eingeräumt. Die Menschen konnten ihre Meinung frei äußern, ihre Politiker selbst wählen, politische Parteien und Vereinigungen gründen. Zugleich konnten wir den Völkern der Länder, die seit Jahrzehnten unsere Verbündeten waren, eben diese Wahlfreiheit und das Recht auf Selbstbestimmung nicht verweigern.
Wir haben unser Engagement für dieses Prinzip in der Praxis bewiesen. In der DDR und in den mittel- und osteuropäischen Ländern gingen die Menschen auf die Straße und forderten Freiheit, und kein Einziger von vielen Hunderttausend russischen Soldaten, die in diesen Ländern stationiert waren, verließ die Kaserne. Die Sowjetunion hinderte die Völker nicht daran, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. In Europa gab es eine Revolution, beispiellos und unblutig.
Ohne dabei die Rolle der Völker selbst gering zu schätzen, möchte ich hinzufügen: Diese friedliche Revolution und, ganz allgemein, ein neues, demokratisches Europa wären unmöglich gewesen ohne die tiefgreifenden Veränderungen, die in der Sowjetunion ihren Anfang nahmen, ohne Glasnost und Perestroika.
Und so hatten die Sowjetunion und ihr Nachfolger Russland das Recht zu erwarten, dass in diesem neuen Europa die Sicherheitsinteressen unseres Landes berücksichtigt werden. Wir betrachteten die Charta von Paris als den Beginn einer Entwicklung hin zu einer gemeinsamen, unteilbaren Sicherheit.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: