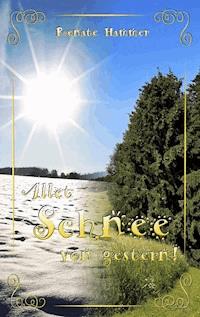
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Weißt du noch ..." fragt man sich so manches Mal, wenn man im letzten Drittel des Lebens, also kurz vor dem "finalen Fangschuss", angekommen ist. Erinnerungen werden wach, an die Kindertage, die Jugendzeit mit der ersten, wahnsinnig komplizierten Hürde des Lebens (genannt Pubertät), an die Eltern, die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens, die erste große Liebe, an das Eheleben, das Kinderkriegen und -erziehen etc. pp. ... Die Autorin zeichnet mit ihren Geschichten Erlebnisse auf, die für sie wichtig und prägnant waren. Geschichten, in denen sich so mancher Leser vielleicht wiedererkennt, oder ihm einiges bekannt vorkommt. Geschichten zum Schmunzeln, zum Nachdenklich werden, und auch zum Ein bisschen traurig werden. Wie im wirklichen Leben, wechseln sich Freud und Leid ab, reichen sich manchmal sozusagen die Hand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort ...
... fällt aus, ich fall gleich mit der Tür ins Haus!
Inhalt
„In Oppa seine Bude“
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“
„Alle Jahre wieder“
„Mein Vetter Heinz“
„Oh, mein Papa“
„Onkel Fritz und Tante Änne“
„Helmut P. “
„Deutsche Sprache - schwere Sprache“
„Der beste Weg zur Gesundheit ist der Weg in den Garten“
„I am the Winner“
„(Alb)Traumschiff ahoi“
„Muttertag“
„Salvatore - Freund von Mutter“
„Weh-weh-weh ... Punkt.de“ oder „Zurück zur Natur“
„Tiere sind die besseren Menschen“
„Der Schreibtisch von Tante Minna“
„Jugend ade“
„Stoff-Wechsel“
„In Oppa seine Bude“
Kindheitserinnerungen sind oftmals das schönste (und manchmal sogar einzige) Vergnügen älterer Menschen. Wenn das Gehirn nicht mehr so funktioniert, wie es eigentlich sollte, man vorne nichts Packendes mehr sieht, blickt man als alter Mensch gerne zurück. Kindheits- und Jugenderlebnisse erfahren ihre Auferstehung; in fröhlicher Freundesrunde oder beim Kaffeeklatsch zu zweit mit dem Sohnemann werden sie an ihn weitergegeben. (Ob er das nun hören will oder nicht; er muss in den sauren Apfel beißen und gute Miene zum bösen Spiel machen, denn er hört die alten Geschichten sicherlich nicht nur einmal. Häufige Wiederholungen der Erzählungen über Jugenderlebnisse der Alten sind vorprogrammiert, weil das Langzeitgedächtnis das einzige ist, das noch hervorragend funktioniert ...).
„Weißt du noch, damals ...“
So beginnen sie meistens, die Berichte über Kindheits- und Jugenderlebnisse.
Damals war alles anders, alles besser, zumindest in der Erinnerung der alten Menschen. Unangenehme Ereignisse wurden vom Selbstschutz-Mechanismus in den grauen Zellen ad acta gelegt. Das Gehirn breitet den Schleier des Vergessens über so manche Vergangenheit aus, die nicht mehr aufgerührt werden soll.
Meine Wenigkeit, als Nachkriegskind im Jahre 1947 geboren, erinnert sich schwach an beengtes Wohnen in zwei untergemieteten Zimmern. Unter der Fuchtel der Hauptmieterin, der man eine fünfköpfige Familie (bestehend aus zwei erwachsenen Personen nebst zwei halbwüchsigen Kindern und mir) wie ein faules Ei ins Nest gelegt hatte, ereigneten sich Dinge, die man sich heutzutage nicht mehr vorstellen kann. Wen wundert es da, dass man zu vergessen versucht, was einst sehr unschön verlaufen war? Wie die Rosinen aus einem Kuchen, pickt das alte Gedächtnis am liebsten die Erlebnisse heraus, über die man heute lachen kann und dies auch herzhaft tut.
Ich war sechs Jahre alt, als ich zum Spielen nach draußen geschickt wurde, damit Mama sich in der engen Wohnküche frei und ungehindert bewegen konnte. Für viereinhalb Personen ein Mittagessen zuzubereiten, war seinerzeit mit einem kleinen Abenteuer vergleichbar. Obwohl ich aufgrund meines zarten Alters und vom Körperbau her nur „eine halbe Portion“ war, bekam ich die gleiche Menge zu essen wie meine älteren Geschwister. Schließlich sollte ich möglichst schnell „groß und stark“ werden. Wozu, leuchtete mir seinerzeit noch nicht ein; die Räumlichkeiten waren schließlich damals schon viel zu eng ...
Da ein Haushalt seinerzeit noch nicht so gut und üppig ausgestattet war wie heutzutage, musste Mama bei der Vorbereitung und Herstellung einer warmen Mahlzeit oftmals Kreativität an den Tag legen. Für die Vorbereitung einer Grünkohl-Mahlzeit zum Beispiel benutzte sie die Allround-Zinkbadewanne. Schließlich musste die Unmenge dieses Wintergemüses, bevor sie in das Behältnis, das mein Bruder als „Hordentopf“ bezeichnete, umgelagert wurde, gründlich gewaschen werden; genauso wie ich, wenn ich vom aushäusigen Herumstromern zurückkehrte ...
Selbstredend wurde die Badewanne nach der Grünkohl-Wäsche genauso penibel ausgescheuert wie am Samstag nach der Beendigung des Familien-Reinigungsprogramms ...
Wenn ich Mama zu sehr genervt hatte (man mag es heute nicht mehr glauben, aber ich war ein quirliges Kind mit einem so gut wie niemals still stehenden Mundwerk), sagte sie: „Kind, tue mir einen Gefallen, besuche mal wieder den Opa in seiner Bude und fall dem auf den Wecker!“
Nur allzu gern erfüllte ich Mama jeweils diesen Wunsch. Opa war - genauso wie fast alle Männer in unserer Siedlung - beim Bochumer Verein beschäftigt. Als er Frührentner wurde, sich aber noch zu fit fühlte, um das Arbeiten gänzlich aufzugeben, ließ er sich seinem Hobby entsprechend als Schrankenwärter bei der werkseigenen Eisenbahn verdingen. Er nannte diese Umstrukturierung dem neuen Job entsprechend „ausrangieren“. (Böse Zungen behaupteten, dass Oma ihn aus dem Weg haben wollte, oder er ihr freiwillig aus demselben ging, weil sie es nicht gern sah, dass er „für längere Durststrecken“ stets einen Flachmann in der Westentasche bei sich trug. Die Füllung dieses Behältnisses bestand allerdings niemals aus Wasser, sondern aus wesentlich hochprozentigeren Flüssigkeiten ...)
Wenn ich mich dem Gebäude, in dem Opa seine immens wichtige Tätigkeit verrichtete, näherte, sah ich schon von weitem sein schneeweißes, gelocktes Haar, das er sich vom Wind zerzausen ließ. Stets winkte er mir zu; und er lächelte so breit, dass seine Augen, in denen der Schalk nur so blitzte, sich zu Schlitzen zusammenzogen.
Obwohl das Betreten des Werksgeländes, zu dem der Schienenstrang und auch das Wärterhaus gehörten, durch werksfremde Personen strengstens untersagt war, brach Opa alle diesbezüglichen Schranken und ließ mich zu sich hinauf kommen.
„Na, Mädelchen, willste mal wieder an der Kurbel drehen?“, fragte er jeweils. „Mein Reißmatismus in den Schultern und Armen ist heute wieder so schlimm, dass ich mir gar nicht zu helfen weiß. Ich glaube, ich schaff das mal wieder nicht allein. Aber einer muss es ja tun, sonst rumsen die Züge mit den Autos zusammen, und die Fußgänger kommen ebenfalls unter die Räder. Und dat wollen wir ja vermeiden, woll?“
Überglücklich drehte ich an der großen Kurbel, die die Schranken hinunter und nach Passieren der Waggons wieder herauf beförderte. Wieder herauf war wesentlich schwerer, sodass Opa mich trotz seiner geschummelten Zipperlein unterstützen musste.
„Ping ping ping“ ertönte ein gleichmäßiges Signal, das mich für die anstrengende Tätigkeit belohnte, denn für meine Ohren war es schöner als Musik. Schon von weitem hörte man die mit Eisen und Schrott beladenen Waggons der Werksbahn langsam herannahen. Wenn die Lok das Häuschen passierte, winkte der Lokführer Opa jeweils freundlich zu.
Oftmals musste ich mich allerdings ducken, um nicht entdeckt zu werden, denn man wusste ja nie, ob der Mann dort in der Lok nicht eventuell doch ein „übler Verräter“ oder „Kameradenschwein“ war und Opa wegen seiner illegal engagierten Aushilfe bei der Werksleitung verpfeifen würde!
„Weißte, Kindchen, die Menschen sind nicht alle nett; merke dir das fürs Leben. Man guckt allen nur vor den Kopp, nicht hinein. Manche lächeln dich vorne an, aber, Schwups, haste hinten ein Messer im Rücken. ... Aaaah, jetzt sehe ich den Kerl in der Lok. Es ist der dicke Otto. Vor dem musste dich nicht verstecken, der ist in Ordnung.“
Trotz Opas Entwarnung blieb ich vorsichtshalber in meinem Versteck. Die Vorstellung, den Heimweg mit einem Messer im Rücken antreten zu müssen, jagte mir eine dicke Gänsehaut über denselben. Mama würde sicherlich mit mir und Opa fürchterlich schimpfen ...
„Na, August, alles klar?“, rief Otto im Vorbeifahren. Unter wissendem Grinsen kniff er Opa ein Auge zu. Anscheinend wusste er genau, dass Opa nicht allein an der Kurbel gedreht hatte.
„So, Mädelchen, jetzt wollen wir uns nach der anstrengenden Maloche erstmal stärken“, sagte Opa, als wir gemeinsam die Schranken wieder in die Senkrechte befördert hatten. „Das dauert jetzt eine Weile, bis der Otto mit dem Zug wieder zurückkommt. Der muss ja den ganzen Krempel erstmal abladen lassen, woll?“
Flugs holte Opa die Blechbüchse hervor, in der Oma die reichlich mit Wurst und Käse belegten Stullen deponiert hatte. Opas Aufforderung, nun mal kräftig zuzulangen, kam ich nur zu gern nach, denn Omas Stullen waren eine Wucht in Tüten! Einen Schluck aus dem Flachmann verweigerte Opa mir allerdings.
„Dafür biste noch viiieeeel zu klein“, erklärte er.
Leicht errötend überreichte er mir ein Glas mit Limonade, die er „für alle Fälle“ stets heimlich in seinem Spind vorrätig hielt.
Als der Zug mit den entleerten Waggons zurückkam, kurbelten wir nochmals gemeinsam die Schranken hinunter und herauf. Noch einmal vernahmen meine Ohren das „Ping ping ping“. Wenn die eventuelle „Gefahr“ vorüber, der Lokführer außer Sichtweite war, schickte Opa mich zu meiner Familie zurück.
Niemals in meinem Leben werde ich die für mich abenteuerlichen Erlebnisse in Opas Wärterhäuschen vergessen.
Opa gibt es schon längst nicht mehr. Neunzehnjährig begleitete ich ihn mit meiner Familie, seinen Freunden und Werksbahn-Kollegen auf seinem letzten Weg auf dem Freigrafendamm.
Heute bin ich bereits älter als Opa damals war. Auch das Wärterhäuschen existiert nicht mehr. Die Werksbahnlinie dagegen gibt es noch immer. Wie es in der Neuzeit so üblich ist, wurde die seinerzeit von Hand zu bedienende Kurbel durch eine Automatik ersetzt. Der Schrankenwärter ist überflüssig geworden. Das melodische „Ping ping ping“ allerdings kann man, wenn man gute Ohren hat und der Wind günstig steht, bis zur viel befahrenen Autobahn, die nah an den Schienen vorbei führt, deutlich hören ...
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“
Diesen uralten, weisen Spruch sollte sich jeder Berufsanfänger hinter die Ohren schreiben, denn er ist bis heute aktuell geblieben. „Lehrjahre“ (besser gesagt hieße es Lernjahre) bedeutet nicht nur, den gewählten Beruf möglichst perfekt zu erlernen, sondern gleichzeitig auch schamlos ausgenutzt zu werden für Tätigkeiten, die mit der ins Auge gefassten Berufswahl absolut nichts zu tun haben!
Meine Wenigkeit hatte sich seinerzeit dazu entschlossen, die lebensnotwendigen „Piepen“ in einem Büro zu verdienen. Stundenlanges „sich die Beine in den Bauch stehen“ hinter einer Ladentheke, immerzu zu lächeln, auch wenn der zu bedienende Kunde ein Stinkstiefel war, der einem den letzten Nerv tötete, kurzum „Verkäuferin“ zu werden, schied von Anbeginn der Berufswahl aus. Obwohl ich (rein äußerlich betrachtet) mit recht stabilen Beinen ausgestattet bin, war es mir nicht möglich, acht lange Stunden in stehender Position zu verbringen.
„Sei froh, dass du den Krieg und seine Nachwehen nicht erleben musstest“, hatte Mama mir mit ernstem Gesicht erklärt. „Wir haben mit unseren Lebensmittelmarken viele Stunden lang in einer ellenlangen Schlange stehen müssen, um ein Brot zu erhaschen. Oftmals war das letzte Stück längst ausverkauft, wenn wir endlich dran waren!“
Ja, ich WAR froh, dass ich als Nachkriegskind geboren wurde (obwohl ich auch heute noch die unerschütterliche Meinung vertrete, dass es besser gewesen sei, mich überhaupt nicht mehr produziert zu haben; denn die ausgehungerten Menschen hatten ja seinerzeit „nichts zuzusetzen“. Woher Papa damals die Kraft für diese Schweiß und andere Flüssigkeit treibende Tätigkeit genommen hatte, ist mir bis heute schleierhaft. Von Mama, die mich als zusätzlichen Ballast in ihrem Bauch mitversorgen musste, ganz zu schweigen).
Nach einer abgebrochenen Schneiderlehre (zwischenzeitlich hatte ich den unüberlegten Geistesblitz, Modezeichnerin zu werden, die ihre Modelle nicht nur entwerfen, sondern auch selbst nähen können musste, nach sechs Wochen Staubwischen in der Nähmaschinenhalle wieder verworfen), gelang es meinen Eltern und mir, die vakante Lehrstelle im Büro eines namhaften Sporthauses zu ergattern. Die Tatsache, dass die dreijährige Ausbildung mit Verspätung angetreten wurde, störte meinen Lehrherrn und mich nicht. In den sechs Wochen hätte ich in der Firma und auch in der Berufsschule nichts Wesentliches verpasst, erklärte der Chef.
Meine Bürokauffrau-Lehre begann mit mehreren bitteren Enttäuschungen. Der in den Warenlagerraum nebst Werkstattkeller des Sporthauses integrierte Raum verfügte über das Format einer besseren Hundehütte, die mit der Anwesenheit der recht korpulenten Buchhalterin bereits zur Hälfte ausgefüllt war. In der anderen Hälfte tippte eine (gottlob) zierliche weibliche Person an einem kleineren Schreibtisch eifrig auf einer Reiseschreibmaschine die zu erledigende Post. Zwischen ihr und der buchführenden Matrone befand sich ein „Notschreibtisch“, an dem ein jüngerer weiblicher Bürolehrling (der mit mir, aber zum ordnungsgemäßen Termin die Lehre angetreten hatte) mit ernster Miene mehrere Berge von Kassenzetteln sortierte.
Während ich noch darüber sinnierte, wo wohl mein Platz in dieser überfüllten besseren Abstellkammer sei, wurde ich von der massigen Buchhalterin von oben bis unten gemustert. Zu meiner Erleichterung erschien anschließend ein freundliches Lächeln auf ihren runden, geröteten Wangen.
„Nur immer herein, Mädchen“, erklärte sie ermunternd. „Für dich halbe Portion werden wir schon noch ein Eckchen finden!“
Man fand das „Eckchen“, in dem ich den ersten, sehr langen Arbeitstag arbeits- und auch sonst tatenlos hinter mich brachte.
„Heute haben wir leider keine Beschäftigung für dich“, hatte die Bürovorsitzende erklärt. „Aber du wirst schon nicht über Langeweile klagen, keine Sorge. Wir finden schon was für dich. Leider müsst ihr beide euch den Schreibtisch teilen. Aber das wird schon irgendwie gehen. Zweimal in der Woche ist Berufsschule; danach braucht ihr ja nicht mehr zur Arbeit zu kommen.“
Verwundert über die Logik der in doppeltem Sinne gewichtigen Dame, enthielt ich mich eines Kommentars. Meines Wissens besuchten meine Lehrjahrs-Mitstreiterin und ich auch zur selben Zeit die Berufsschule ...
Die geräusch- und qualvollen (nebst sauerstoffarmen) Bürotage im Werkstattkeller schlichen dahin. Während nebenan lautstark gehämmert, gesägt, geklopft und geschliffen wurde, richtete ich oft neidvoll meine Blicke auf das Lehrmädchen im dritten Jahr, das den ganzen Arbeitstag lang an der Schreibmaschine verbringen durfte, während meine gleichaltrige Kollegin und ich die auf den massenhaft vorhandenen Kassenzetteln stehenden Beträge in ein großes Buch übertrugen. Ohne mich zu fragen, hatte man mich zum „Buchhaltungs-Lehrling“ auserkoren. Ausgerechnet mich, die schon in der Schule so gut wie kein Verständnis für Zahlen aufbringen konnte! Da ich aber ein stilles, gehorsames Mädchen war, brachte ich nicht den Mut dazu auf, mich gegen den Entscheid der Obrigkeit aufzulehnen.
Trat der Fall ein, dass der Chef in Begleitung seiner massigen Schäferhündin das Büro aufsuchte, durften wir „Lehrlinge“ über den Zeitraum seiner Anwesenheit das Büro verlassen. Immerhin hätte sonst die Möglichkeit bestanden, die vierbeinige Leibwächterin des Chefs zu verletzen oder gar mit einem falschen Fehltritt ins Jenseits zu befördern!
„Du hast ja grad nichts zu tun“, rief mir der Werkstattmann während eines Aufenthalts außerhalb des Büros zu. „Komm, du kannst mir helfen, die Skibeläge aufzutragen. Schnapp dir einen Pinsel, ich zeig dir, wie es geht.“
Innerlich meuternd, beugte ich mich dem Befehl des betagten Mannes. Die Tatsache, dass ich just an dem Tage mein bestes Kleid trug, blieb unbeachtet.
Die Folge des unfreiwilligen Werkstatteinsatzes blieb nicht aus. Mein Kleid war so gut wie ruiniert. Dies wiederum löste die Tatsache aus, dass Papa meinen Chef aufsuchte, um ihm entrüstet „die Flötentöne beizubringen über das, was ein Bürolehrling im ersten Lehrjahr zu tun und zu lassen hat.“
Papas Einsatz blieb erfolglos. Noch nie habe es jemandem geschadet, hin und wieder eine andere als die gewohnte Arbeit zu verrichten, hatte mein Chef ihm gelassen lächelnd erklärt. Schmollend und grollend hatte Papa den Rückzug angetreten.
Neben den sich häufenden Einsätzen in der Werkstatt, und als Unterstützung der überforderten Verkäuferinnen, die es in der „Stoßzeit“ nicht schafften, die ausgelegten Waren von den Theken in die Regale zurück zu räumen, wurde ich mit Fragen seitens der Kundschaft attackiert, die ich nicht zu beantworten in der Lage war.
„Frolleinchen, welche Baumwolle benutzt adidas für die Fertigung ihrer Polohemden? Ist sie naturbelassen oder mercerisiert?“
„Sind die Tennisschuhe von Rudolf Dassler besser, oder empfehlen Sie die von seinem Bruder Adolf?“
Gottogottogott!
Irgendwann hatte ich gelernt, dass die beiden Sportartikel-Hersteller zwar Brüder, aber sehr verfeindet waren. Ich erfuhr, dass der Adolf die Marke „adidas“ verwendete, sein Bruder das Pseudonym „Puma“ benutzte, aus welchem Grunde auch immer. Wie ein geschmeidiger Puma sah er nämlich beileibe nicht aus.
Während der Weltmeisterschaft im Eiskunstlaufen in der Nähe meiner Heimatstadt besuchten Berühmtheiten das Geschäft. Kilius/Bäumler, das seinerzeitige Traumpaar auf dem Eis, gaben meinem Chef die Ehre. Marika reichte ihm zwar recht überheblich, aber trotzdem die zarte Hand; Hans-Jürgen zeigte zusätzlich ein freundliches Lächeln. Ein Russe namens Oleg Protopopow, der ohne seine Partnerin erschien, drückte sogar mir, dem kleinen unscheinbaren Lehrmädchen, die Hand, die ich mir von Sekunde an bis zum nächsten Tag nicht mehr wusch. Auch den stahlharten Blick aus seinen stahlblauen Augen konnte ich lange Zeit nicht vergessen.
Frau Schleifstein, ihres Zeichens die Grand Dame im Verkaufsbereich (die mich augenscheinlich nicht leiden konnte, aus welchem Grunde auch immer) kanzelte mich unter überheblichem, äußerst dämlichem (im Sinne von Dame) Lächeln ab, indem sie erklärte: „Wenn es dir nicht passt, dass du hin und wieder im Verkauf helfen musst, so bist du in diesem Hause fehl am Platze. Wir sind hier eine große Familie, in der alles Hand in Hand erledigt wird. Jeder ist für den anderen da. Je früher du dir das einprägst, umso besser ist es für dich, mein Kind.“
Eigentlich wollte ich ihr erklären, dass ich nicht „ihr Kind“ sei und den Vorschlag unterbreiten, für mich einmal im Werkstattkeller einzuspringen, wenn ich ausnahmsweise im Büro zu tun habe, aber für eine solche Handlungsweise war ich zu gut erzogen. Sicherlich hätte sie sich tränenreich beim Chef über mich beschwert, was letztendlich zur Folge haben könnte, dass Papa wieder vergeblich im Sporthaus erschien. Anstatt meinen Groll auszusprechen, wünschte ich gedanklich der Dame, dass sie von der Pestilenz heimgesucht werde, und das möglichst bald.
Ich betätigte mich als Aushilfe putzend in der großen Privatwohnung des Chefs, kurbelte sommertags die große Markise vor dem Schaufenster heraus, erledigte private Einkäufe. Gottlob verlangte man nicht von mir, dass ich das Mittagessen für meine Chefs zubereitete. Länger als zwei Tage hätten sie es kaum überlebt, denn daheim war ich noch nicht zu derartigen Tätigkeiten herangezogen worden. Mama meinte, dazu sei ich noch zu jung; erst sei meine ältere Schwester an der Reihe.
An den „langen Samstagen“ entsorgte ich nach Ladenschluss unter Bewachung durch den Chef die „Geldbombe“ in den Nachttresor der Bank. Hätte jemand die Absicht verfolgt, illegal das Behältnis meinen Händen zu entreißen, wäre er gewiss erfolgreich gewesen, denn mein Lehrherr hielt einen im Fall eines Überfalls kaum mehr zu überbrückenden Abstand von meiner Wenigkeit.
Meine Schilderung über die nicht ungefährliche Tätigkeit rief abermals Papa auf den Plan. Er fragte meinen Lehrherrn, ob er schon mal etwas von der Verletzung der Aufsichtspflicht gehört habe. In Papas Augen (und sicherlich denen des Gesetzes) war es eine strafbare Handlung, ein schutzbefohlenes, minderjähriges Mädchen der Gefahr auszusetzen, überfallen und verletzt zu werden. Mein Chef rechtfertigte sich mit der Aussage, dass ich nicht allein gewesen sei, da er ja in Reichweite war und notfalls hätte eingreifen können. Wieder einmal trat Papa unzufrieden den Rückzug an. Ebenso tat er dies nach seiner Beschwerde über meinen Einsatz bei der jährlichen Inventur, von dem ich spätabends um zweiundzwanzig Uhr in der Dunkelheit daheim eintraf. Papa vertrat die Meinung, dass erstens ein Bürolehrling beim Zählen der Waren nichts zu suchen hatte, und zweitens der Lehrherr generell die Pflicht habe, für einen sicheren Heimweg seiner Schutzbefohlenen Sorge zu tragen. Und dies nicht erst kurz vor Mitternacht, sondern zur normalen Ladenschlusszeit. Die Beschwerde verlief im Sande.
Gemeinsam mit meiner Lehrjahrs-Genossin sortierte ich Aktenordner im heillos verstaubten Aktenkeller. Da dort auch die Kohlen lagerten, konnte ich mein Konfirmationskleid, das ich an dem Tage trug, in den Lumpensack entsorgen. Zu meinem Trost weinte Mama mit mir.
Da im Betrieb nicht die Möglichkeit vorhanden war, das korrekte Bedienen einer Schreibmaschine zu erlernen, erledigte ich dies privat und auf meine eigenen Kosten. Ich folterte meine Seele mit Stenographie, holte, meistenteils just an dem Tag mit meiner Sonntagskledage bekleidet, Skier vom Güterbahnhof Nord ab, weil außer mir „niemand greifbar“ war. Nebenher quälte ich mich neben kaufmännischem Rechnen und Religion in der Berufsschule mit „Warenkunde“ herum, die ich im Verlauf meines weiteren Lebens meiner Meinung nach nie wieder gebrauchen konnte. Papas wiederholte garstige Dispute mit dem Chef blieben weiterhin fruchtlos.
Zu Beginn des zweiten Lehrjahres bildete nicht allein die Aufstockung des Sporthauses um drei Etagen einen gigantischen Lichtblick in meinem Leben. Als viel gigantischer sah ich die Tatsache an, dass Frau Schleifstein auf dem gegenüberliegenden Gehsteig ausgerutscht, der Länge nach auf ihre Breitseite gestürzt war und sich dabei einen komplizierten Beinbruch zugezogen hatte.
Normalerweise lag mir Schadenfreude fern, aber der Eintritt der Ersatzkatastrophe für die Pestilenz gefiel mir dennoch. Die Dame hatte sich neben der Beschmutzung ihrer teuren Garderobe auch die gefärbte und stets gewissenhaft ondulierte Haarfrisur ruiniert. Aufgrund des Beinbruchs fiel sie monatelang aus.
„Ach, das ist doch kein Beinbruch“, erklärte der Chef lächelnd, hatte er doch umgehend eine Ersatzverkäuferin zur Hand. Die Dame Schleifstein wurde von einer jungen, lustigen, lebensfrohen Frau, die vor nicht allzu langer Zeit ihr Handwerk unter der strengen Aufsicht des Seniorchefs erlernt hatte, mehr als würdig vertreten. Sie brachte neben ihrer Fachkenntnis auch Lebensfreude, Heiterkeit und Lachen mit ins Sporthaus. Nach und nach sickerte die allgemeine Vermutung durch, dass alle Angestellten, die wochentags nun sehr freudig das Sporthaus belebten, „Frau Rosi“ unbedingt behalten wollten.
Nach Vollendung der Bauphase (und dem Ausscheiden des ältesten Bürolehrlings nach seiner bestandenen Prüfung) bezogen wir zu dritt das neue Büro, das auch mehr als dreimal so groß war wie der „Verschlag“ im Keller. Jede bekam einen eigenen, großen Schreibtisch. Die „Kellerasseln“, wie man uns scherzhaft nannte, konnten endlich aus dem Fenster schauen. Unter Tageslicht und Sonneneinstrahlung sortierte ich die Kassenzettel, suchte oftmals tage- und wochenlang in ihnen Fehler, wenn „die Buchhaltung nicht korrekt“ war. Die musste schließlich auf den Pfennig genau stimmen!
Der einzige Wermutstropfen für die schwergewichtige, buchführende Büro-Älteste war die Tatsache, dass sie sich vom Schreibtisch erheben und einige Schritte laufen musste, um an ihre Aktenordner zu gelangen.
„Ach, das macht gar nix“, erklärte sie schnaufend. „Ich wollte sowieso schon längst abnehmen. Im Keller ging das ja nicht.“
Im neuen Büro erhielt ich die ehrenvolle Aufgabe, die mit Bleistift eingetragenen Beträge auf den großen Blättern der seinerzeit aktuellen Durchschreibe-Buchhaltung „auszutinten“, weil ich die schönste Handschrift besaß!
Neben meiner buchhaltenden Lehrlingstätigkeit liebäugelte ich nach wie vor wehmütig mit der Schreibmaschine, die noch immer ausschließlich von meiner Lehrlingskollegin bedient wurde, bis eines Tages der Chef grollend und mit hochrotem Gesicht das Büro betrat. Seit er es sich angewöhnt hatte, seine Post nicht mehr handschriftlich vorzuschreiben, sondern dazu ein Diktaphon benutzte, kam die ungenügende Rechtschreibung meiner Kollegin zutage.
In mütterlichem Ton gelang es der Buchhalterin, den erzürnten Chef zu beschwichtigen. Nichtsdestotrotz erklärte er aber:
„Nein; ich bin das jetzt leid. Ständig müssen Briefe neu geschrieben werden. Was das allein schon an Papieraufwand kostet! Die Druckerei schenkt mir ja schließlich auch nichts!“
Strengen Blickes sah er meiner Lehrkollegin und mir in die Augen.
„Also, Mädels: Ich tausche euch jetzt aus! Die eine geht in die Buchhaltung, und die andere in die Korrespondenz! Einen Versuch ist es zumindest wert! Seid ihr damit einverstanden? Wenn nicht, versuchen wir es trotzdem.“
Ich war nicht nur einverstanden, sondern in meinem Inneren erklangen die Glocken von Jericho! Nie gekannte Glücksgefühle drohten mir die Luft abzuschnüren. Nur der Gedanke, dass meine Lehrlings-Kollegin „degradiert“ wurde und sicherlich nicht glücklich darüber war, verhinderte einen lauten Jubelschrei! Ich konnte endlich weg von den Zahlen, ich durfte an die Schreibmaschine! Halleluja!
Als ich unter starkem Herzklopfen meine erste Postmappe vom Unterzeichnen zurückholte, wurde ich im Verkaufsraum von Bravo-Rufen nebst lautem Applaus empfangen. Selbst die inzwischen wieder aushilfsweise tätige Dame Schleifstein beteiligte sich an der Huldigung meiner peinlich berührten Wenigkeit. Tief errötend und wortlos nahm ich die Mappe aus den Händen meines strahlend lächelnden Chefs entgegen, um die Post im Büro versandfertig zu machen. Innerlich bedrückt, öffnete ich die Tür zum Büro; eine betrübte (oder sogar neidische) Lehrlings-Kollegin erwartend, blickte ich stattdessen in ein befreit lächelndes Gesicht. Strahlend erklärte sie mir, dass sie glücklich darüber sei, endlich von der Qual der Postschreiberei befreit zu sein. Die Buchhaltung mache ihr so großen Spaß, dass sie bedauere, nicht viel früher von sich aus den Chef um eine Umbesetzung gebeten zu haben.
„Nun, es ist gut so, wie es jetzt ist“, hielt die Buchhalterin dagegen. „Was des einen Last ist, ist des anderen Lust. So ist das nun mal im Leben. In der Lehre müssen alle mal in jedes Fach hineinschnuppern. Nur dadurch stellt sich ja heraus, wo die Stärken und Schwächen der Personen liegen. Nun hat jede von euch beides gelernt, und das ist ja auch für die Abschlussprüfung notwendig, und jede weiß, was sie besser kann. ... Nun ja, dass ihr hier und da Arbeiten verrichten musstet, die mit dem Büro absolut nichts zu tun hatten, schadet, im Nachhinein betrachtet, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ihr habt gelernt, vorgesetzten Personen zu gehorchen, Rücksicht auf andere zu nehmen, Kollegen zu helfen und zu unterstützen, eigene Wünsche notfalls hinten an zu stellen. Und somit habt ihr auch etwas fürs Leben gelernt. Ob ihr das eine oder andere mal brauchen könnt, ist dabei unwichtig.“
Als Belohnung für meine stets fehlerfrei getippten Briefe und Bestellkarten erhielt ich zur Erledigung der täglichen Post die private Reiseschreibmaschine des Chefs, deren Tastatur einen „leichteren Anschlag“ hatte und demzufolge gelenkschonender war. Mit großen, erstaunten Augen erklärte die Buchhalterin anerkennend:
„Donnerwetter. Da hast du aber wirklich einen ganz dicken Stein im Brett beim Chef, denn der hat die Maschine bis jetzt nie aus der Hand gegeben. Weißt du, das ist die Königin unter den Reiseschreibmaschinen und war sehr teuer.“
Ich hatte viel gelernt, aber „fürs Leben gelernt“ hatte ich keinesfalls. Da ich in der Berufsschule dieselbe Klasse besuchte wie die Verkaufslehrlinge (eine Extraklasse für kaufmännische Bürolehrlinge gab es seinerzeit noch nicht), musste ich in der praktischen Lehrabschlussprüfung vorführen, wie man Tennisschläger bespannt und Skibeläge streicht. Letzteres gelang mir dank des Aushilfseinsatzes beim Werkstattmann recht gut; die mangelhafte Bespannung des Tennisschlägers allerdings brachte mir die passende Note ein, was zur Folge hatte, dass mein Kaufmannsgehilfenbrief nicht gut benotet wurde.
Nachdem der Chef nach Beendigung unserer Lehre verkündet hatte, nur eine von uns „übernehmen“ zu können, verließ ich freiwillig das Büro des Sporthauses, um anschließend als Stenotypistin eine Anstellung in einem großen Unternehmen in meinem Heimatort anzutreten. Der nur mit „befriedigend“ benotete Kaufmannsgehilfenbrief wurde dort in der Personalabteilung unbeachtet abgeheftet.
Die Abschiedstränen der Buchhalterin, die ja uns beide





























