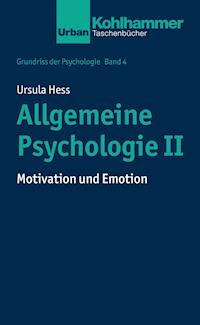
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Zwei zentrale Konzepte der Allgemeinen Psychologie sind Motivation und Emotion. Theorien der menschlichen Motivation beschäftigen sich mit der Frage, warum Menschen tun, was sie tun, Emotionstheorien dagegen mit der Frage, wie Emotionen ausgelöst werden und wie sie unser Handeln beeinflussen. Das Buch vermittelt Basiswissen über zentrale Theorien - so z. B. über Bedürfnis- und Kognitive Theorien der Motivation, Emotionstheorien nach Darwin und nach James sowie über Appraisaltheorien -, wichtige Forschungsergebnisse und neuere Entwicklungen. Illustrierende Beispiele und zusammenfassende Darstellungen helfen, die Materie in klarer, verständlicher Form zu vermitteln. Ein abschließendes Kapitel über kulturelle Unterschiede und Ähnlichkeiten stellt die Themenkomplexe in einen weiten Kontext.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundriss der Psychologie
Herausgegeben von Bernd Leplow und Maria von Salisch
Begründet von Herbert Selg und Dieter Ulich
Diese Taschenbuchreihe orientiert sich konsequent an den Erfordernissen des Bachelorstudiums, in dem die Grundlagen psychologischen Fachwissens gelegt werden. Jeder Band präsentiert sein Gebiet knapp, übersichtlich und verständlich!
H. E. Lück/S. Guski-Leinwand
Geschichte der Psychologie
Ursula Hess
Allgemeine Psychologie II
F. Eggert
Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie
K. Rentzsch/A. Schütz
Psychologische Diagnostik
J. Schiebener/M. Brand
Allgemeine Psychologie I
D. Ulich/P. Mayring
Psychologie der Emotionen
F. Rheinberg/R. Vollmeyer
Motivation
U. Ehlert/R. La Marca/E. A. Abbruzzese/U. Kübler
Biopsychologie
J. Kienbaum/B. Schuhrke
Entwicklungspsychologie der Kindheit
T. Faltermaier/P. Mayring/W. Saup/P. Strehmel
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters
H. M. Trautner
Allgemeine Entwicklungspsychologie
L. Laux
Persönlichkeitspsychologie
T. Greitemeyer
Sozialpsychologie
R. Guski
Wahrnehmung
F. J. Schermer
Lernen und Gedächtnis
H.-P. Nolting/P. Paulus
Pädagogische Psychologie
J. Felfe
Arbeits- und Organisationspsychologie, Bd. 1 und 2
L. v. Rosenstiel/W. Molt/B. Rüttinger
Organisationspsychologie
T. Faltermaier
Gesundheitspsychologie
S. Trepte/L. Reinecke
Medienpsychologie
D. Köhler
Rechtspsychologie
G. Felser
Konsumentenpsychologie
M. Vollrath
Ingenieurpsychologie
Ursula Hess
Allgemeine Psychologie II
Motivation und Emotion
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-021991-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-032353-7
epub: ISBN 978-3-17-032354-4
mobi: ISBN 978-3-17-032355-1
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Geleitwort
Teil 1:Motivation
1 Grundlagen
1.1 Gegenstandsbestimmung und Grundfragen
1.1.1 Quellen der Motivation
1.1.2 Wie misst man Motivation?
1.2 Historischer Abriss
1.2.1 Descartes‘ Willenstheorie
1.2.2 Instinkttheorien
1.2.3 Triebtheorien
2 Bedürfnistheorien
2.1 Einleitung
2.2 Physiologische Bedürfnisse
2.3 Psychologische Bedürfnisse
2.3.1 Psychologische Bedürfnisse (needs) nach Murray
2.3.2 Universelle psychologische Bedürfnisse nach Deci und Ryan
2.4 Soziale Bedürfnisse
2.4.1 Implizite und explizite Motive
2.4.2 Leistungsmotivation
2.4.3 Anschlussmotivation
2.4.4 Machtmotivation
3 Kognitive Theorien: Pläne und Ziele
3.1 Einleitung
3.2 Kontrolltheorie
3.3 Ziele
3.3.1 Zielsetzungstheorie (Goal Setting Theory, Locke & Latham, 1990; Locke & Latham, 1994)
3.3.2 Entscheidungstheorie (expected utility theory)
3.3.3 Prospekt-Theorie (Neue Erwartungstheorie)
3.3.4 Kritik an Zieltheorien
4 Kognitive Theorien und das Selbst
4.1 Einleitung
4.2 Selbstregulation
4.2.1 Ego-Depletion
4.2.2 Selbstregulation und Belohnungsaufschub
4.2.3 Die Heiß-/Kalt-Theorie
4.3 Regulationsfokustheorie
4.4 Selbstwert (Self-esteem)
4.5 Kognitive Dissonanz
4.5.1 Selbstkonsistenz
4.5.2 Selbstbestätigung
4.5.3 Kognitive Dissonanz als Motivator für Einstellungsänderungen
4.5.4 Einstellungsänderung durch einstellungskonträre Argumentation
4.5.5 Nachentscheidungsdissonanz
4.5.6 Rechtfertigung von Anstrengungen
4.6 Erlernte Hilflosigkeit
4.6.1 Gefühl der mangelnden Kontrolle
4.6.2 Pessimistischer versus optimistischer Attributionsstil
4.7 Reaktanz
4.7.1 Reaktanz und Hilflosigkeit
4.7.2 Modell der gelernten Hilflosigkeit und Reaktanz
5 Extrinsische und intrinsische Motivation
5.1 Einleitung
5.2 Die versteckten Kosten der Belohnung
5.3 Kognitive Evaluationstheorie
5.4 Selbstdeterminationstheorie
5.5 Organismische Integrationstheorie
5.6 Kausalitätsorientationstheorie
Teil 2:Emotionen
6 Grundlagen
6.1 Gegenstandsbestimmung
6.1.1 Emotionen und andere affektive Zustände
6.1.2 Emotionskomponenten
6.2 Historischer Abriss
7 Emotionsausdruck
7.1 Basisemotionen
7.2 Emotionaler (Gesichts-)Ausdruck
7.3 Was zeigen emotionale Gesichtsausdrücke wirklich?
7.3.1 Frühes 20. Jahrhundert
7.3.2 Behavioral Ecology Theory: Emotionen signalisieren Verhaltensabsichten
7.3.3 Emotionsausdruck aus Sicht von Appraisaltheorien
8 Klassische Emotionstheorien: Darwin und James
8.1 Einleitung
8.2 Evolutionäre Emotionstheorien: Charles Darwin
8.2.1 Darwins Prinzipien
8.2.2 Nachfolgetheorien
8.3 Physiologische Emotionstheorien: William James
8.3.1 Nachfolgetheorien
8.3.2 Die Fehlattribution von physiologischer Erregung
9 Kognitive Emotionstheorien: Appraisaltheorien
9.1 Grundlagen der Appraisaltheorien
9.2 Eine erste psychologische Appraisaltheorie: Magda Arnold
9.3 Lazarus’ Theorie der Stressemotionen
9.4 Moderne Appraisaltheorien
10 Affektive Neurowissenschaften
10.1 Einleitung
10.2 McLeans »Triurne Brain«
10.3 Somatische Marker
10.4 Die Rolle der Amygdala
10.5 Panksepps Affective Neuroscience
11 Sozialkonstruktivistische Theorien
12 Emotion im sozialen Kontext
12.1 Sozialisation
12.1.1 Emotionen empfinden
12.1.2 Emotionen ausdrücken
12.1.3 Emotionen erkennen
12.1.4 Emotionswissen erwerben und anwenden
12.2 Soziale Interaktion
12.2.1 Das soziale Mitteilen von Emotionen (emotional sharing)
12.2.2 Imitation und Emotionsansteckung
12.2.3 Emotionsregulation
13 Kulturelle Unterschiede und Ähnlichkeiten
13.1 Einleitung
13.2 Emotionsempfinden
13.2.1 Emotionsbegriffe
13.2.2 Beschreibung des Emotionsempfindens
13.3 Emotionsausdruck
13.3.1 Kulturelle Dialekte
13.3.2 Emotionsausdruck als Kontinuum über Spezies
13.4 Emotionsursache und Appraisal
13.5 Emotionsnormen und Regulation
Literatur
Stichwortverzeichnis
Geleitwort
Neue Studiengänge brauchen neue Bücher! Bachelor und Master sind nicht einfach verkürzte Diplom- oder Magisterausbildungen, sondern stellen etwas qualitativ Neues dar. So gibt es jetzt Module, die in sich abgeschlossen sind und aufeinander aufbauen. Sie sind jeweils mit Lehr- und Lernzielen versehen und spezifizieren sehr viel genauer als bisher, welche Themen und Methoden in ihnen zu behandeln sind. Aus diesen Angaben leiten sich Art, Umfang und Thematik der Modulprüfungen ab. Aus der Kombination verschiedener Module ergeben sich die Bachelor- und Masterstudiengänge, welche in der Psychologie konsekutiv sind, also aufeinander aufbauen. Die Bände der Reihe Grundriss der Psychologie konzentrieren sich auf das umgrenzte Lehrgebiet des Bachelorstudiums.
Da im Bachelorstudium die Grundlagen des psychologischen Fachwissens gelegt werden, ist es uns ein Anliegen, dass sich jeder Band der Reihe Grundriss der Psychologie ohne Rückgriff auf Wissen aus anderen Teilgebieten der Psychologie lesen lässt. Jeder Band der Grundrissreihe orientiert sich an einem der Module, welche die Deutsche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) im Jahr 2005 für die Neugestaltung der Psychologieausbildung vorgeschlagen hat. Damit steht den Studierenden ein breites Grundwissen zur Verfügung, welches die wichtigsten Gebiete aus dem vielfältigen Spektrum der Psychologie verlässlich abdeckt. Dies ermöglicht nicht nur den Übergang auf den darauf aufbauenden Masterstudiengang der Psychologie, sondern auch eine erste Berufstätigkeit im psychologisch-assistierenden Bereich.
So führt der Bachelorabschluss in Psychologie zu einem eigenen, berufsbezogenen Qualifikationsprofil. Aber auch Angehörige anderer Berufe können von einer ergänzenden Bachelorausbildung in Psychologie profitieren. Überall dort, wo menschliches Verhalten und Erleben Entscheidungsabläufe beeinflusst, hilft ein fundiertes Grundwissen in Psychologie. Die Bandbreite reicht vom Fachjournalismus über den Erziehungs- und Gesundheitsbereich, die Wirtschaft mit diversen Managementprofilen, die Architektur und die Ingenieurwissenschaften bis hin zu Führungspositionen in Militär und Polizei. Die wissenschaftliche Psychologie bietet insofern – bei ethisch vertretbarer Anwendung – ein Gerüst, über welches man auf die Gesellschaft positiv Einfluss nehmen kann. Daher können auch Studierende und Praktiker aus anderen als den klassischen psychologischen Tätigkeitsfeldern vom Wissen eines Bachelors in Psychologie profitieren. Weil die einzelnen Bände so gestaltet sind, dass sie psychologisches Grundlagenwissen voraussetzungsfrei vermitteln, sind sie also auch für Angehörige dieser Berufsgruppen geeignet.
Wir möchten den ausgeschiedenen Herausgebern für ihre inspirierende Arbeit an dieser Reihe danken und hoffen, auch weiterhin auf ihre Erfahrungen zurückgreifen und ihren wertvollen Rat in Anspruch nehmen zu können. Den Leserinnen und Lesern wünschen wir vielfältige Erkenntnisse und Erfolge mit den Bänden der Reihe Grundriss der Psychologie.
Maria von Salisch
Bernd Leplow
Teil 1: Motivation
1 Grundlagen
1.1 Gegenstandsbestimmung und Grundfragen
Warum spielen Kinder Fangen? Warum trainiert Anna jeden Morgen? Warum nimmt Lars die Treppen und nicht den Aufzug? Alle diese Personen strengen sich körperlich an, aber tun sie das aus den gleichen Gründen?
Motivationsforschung beschäftigt sich mit der Frage, warum Personen das tun, was sie gerade tun. Genauer geht es um die Frage nach den Prozessen, die Richtung und Intensität des Verhaltens bestimmen. Diese Frage lässt sich in weitere Unterfragen aufteilen:
1. Warum wird ein Verhalten angefangen?
2. Was bestimmt das Ziel des Verhaltens?
3. Wodurch wird das Verhalten aufrechterhalten?
4. Wodurch wird das Ziel verändert?
5. Warum hört das Verhalten auf?
Motivationspsychologie beschäftigt sich mit den inneren und äußeren Anreizen, die Individuen dazu veranlassen, ein bestimmtes Verhalten zu wählen und auszuführen. Eine weitere Frage ist, warum bestimmte Reize für manche Personen Verhalten veranlassen und für andere nicht, also die Frage nach den individuellen Unterschieden in der Motivation. Aus dieser Sicht definieren z. B. Thill und Vallerand (1993) Motivation folgendermaßen:
Definition
Motivation ist hypothetisches Konstrukt, das die internen und externen Kräfte beschreibt, die Verhalten auslösen und beenden, seine Richtung und Richtungsänderungen sowie die Intensität und Persistenz mit dem das Verhalten ausgeübt wird bestimmen.1
Generell werden Motivationen als adaptives Verhalten verstanden. Unterschiedliche Verhaltensweisen sind mit angenehmen oder unangenehmen Konsequenzen verbunden. Herbert Spencer (Spencer, 1899) postulierte, dass angenehme Konsequenzen mit Aktivitäten verbunden sind, die dem Überleben nutzen, und unangenehme mit Aktivitäten, die dem Überleben schaden. Wir alle können schnell Gegenbeispiele nennen, dennoch ist es vermutlich richtig zu sagen, dass eine Vielzahl von motivierten Akten eher adaptiv ist. Wichtig ist auch zu bedenken, dass die Überlebensnützlichkeit eines Verhaltens sich mit der Zeit ändern kann. So war unsere Vorliebe für kalorienreiche Nahrung und Energiekonservierung nützlicher zu Zeiten, als Kalorien sehr knapp waren.
Motivation lenkt die Aufmerksamkeit des Organismus. Zu jedem Zeitpunkt gibt es eine Vielzahl von möglichen Verhaltensweisen und relevanten Umweltreizen. Je nach Motivation wählen wir ein mögliches Verhalten. So können Sie z. B. dieses Buch lesen, weil Sie motiviert sind, für eine Klausur zu lernen, gleichzeitig fangen Sie langsam an, Hunger (physiologisches Bedürfnis) zu entwickeln und hören die Stimmen Ihrer Mitbewohner (Affiliationsmotiv). Plötzlich bekommen Sie einen Krampf im Fuß, springen auf und hüpfen hin und her. Schmerz ist ein motivierender Faktor, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht und sofortiges Handeln verlangt (Bolles & Fanselow, 1980). Wenn sich der Fuß wieder beruhigt hat, lesen Sie weiter – oder vielleicht unterhalten Sie sich doch mit Ihren Mitbewohnern oder bereiten sich etwas zu Essen zu. Dieses Beispiel zeigt auch, dass unterschiedliche Motivationen im Laufe der Zeit stärker und schwächer werden und so einen Verhaltensablauf bestimmen, wie in Abbildung 1.1 illustriert.
Abb. 1.1: Ein Beispiel für einen Verhaltensfluss (x, y, z) und die systematischen Veränderungen in der Stärke der Verhaltenstendenzen, die ihn hervorbringen (nach Atkinson, Bongort & Price, 1977).
1.1.1 Quellen der Motivation
Generell wird zwischen internen und externen Quellen der Motivation unterschieden. Externe Quellen sind Umweltanreize, die Richtung und Energie des Verhaltens bestimmen. Geld ist z. B. ein Anreiz, der Annäherungsverhalten auslöst. Wenn ich jemandem Geld für eine Tätigkeit anbiete, erhöhe ich die Chance, dass die Person diese Tätigkeit auch ausübt. Ein schlechter Geruch hingegen ist ein Beispiel für einen Umweltreiz, der Vermeidungsverhalten auslöst. Man bewegt sich von dem Geruch weg oder unterlässt Verhalten, dass ihn auslöst. Interne Quellen sind Bedürfnisse, Kognitionen und Emotionen. Bedürfnisse bezeichnen wesentliche Bedingungen für das Überleben und die angemessene Entwicklung eines Organismus. Biologische Bedürfnisse wie Hunger und Durst beschreiben einen physiologischen Mangel, der den Organismus motiviert, diesem abzuhelfen – im Falle von Hunger also nach Nahrung zu suchen. Psychologische Bedürfnisse wie z. B. Bedürfnisse nach Macht oder Affiliation behandeln psychologische Bedingungen, die für den Organismus wichtig sind, und zu deren Erreichen der Organismus Energie aufwendet.
Im Kontext der Motivationsforschung sind Erwartungen und Ziele wichtige Kognitionen, ebenso auch Kognitionen, die das Selbst betreffen (ideales Selbst, Soll-Selbst). So ist z. B. das Ziel, einen Universitätsabschluss zu machen, eine Kognition. Ziele werden oft aufgrund der persönlichen Erfahrungen des Individuums entwickelt. Es gibt aber auch evolutionär angelegte Ziele, wie z. B. das Ziel der Fortpflanzung. Evolutionäre Psychologie beschäftigt sich mit dieser Quelle der menschlichen Motivation. Auch Emotionen können motivieren. Einige Emotionstheorien (Teil II) sehen dies als einen zentralen Aspekt der Emotionen (z. B., Frijda, 1986; Weiner, 1986).
Ein Verhalten kann auch durch mehr als eine Motivation bestimmt sein. So kann ich zum Beispiel mehr Sport machen, um fit zu bleiben (ein Ziel) und dann einen bestimmten Sport wählen, der meinem Affiliationsbedürfnis entspricht.
Externe Ereignisse und interne Motivationsquellen interagieren in vielen Fällen. Wenn ich Hunger habe und ein Sandwich im Raum ist, dann bin ich motiviert, dieses zu essen. Wenn keines im Raum ist, bin ich motiviert, etwas Essbares zu suchen. Eine Person, die nach Macht strebt, wird sich auch nur dann entsprechend verhalten, wenn es in der Umwelt Gelegenheit gibt, Macht auszuüben.
In diesem Zusammenhang muss man zwischen Motiven und Anreizen unterscheiden. Motivation hat immer ein Objekt – ich kann nicht einfach motiviert sein, sondern ich bin motiviert, etwas Bestimmtes zu tun. Motivation zielt auf ein spezifisches Verhalten. Motivation veranlasst Verhalten auf etwas hin oder von etwas weg. Wenn ich also ein Sandwich esse, weil ich Hunger habe, dann wirkt mein Verhalten direkt auf das auslösende Motiv. Nachdem ich das Sandwich gegessen habe, habe ich keinen Hunger mehr. Ein Anreiz beschreibt hingegen einen Bestandteil der Situation, den das Individuum als positiv oder negativ erkennt und der einen spezifischen Aufforderungscharakter hat. So ist die Anwesenheit eines Sandwichs ein Anreiz für den Hungrigen, nicht aber für den Durstigen.
1.1.2 Wie misst man Motivation?
Motivation drückt sich im Verhalten aus, aber auch in den Kognitionen und Emotionen, die Quellen der Motivation sind. Deshalb kann Motivation über Verhaltenskomponenten gemessen werden, aber auch über Selbstbericht und über die physiologischen Veränderungen, die mit der motivationsbedingten körperlichen Aktivierung einhergehen. Vertreter unterschiedlicher Motivationsansätze bevorzugen dabei unterschiedliche Maße. Theorien, die besonders auf physiologische Bedürfnisse abheben (Instinkt- und Triebtheorien), bevorzugen Verhaltens- und physiologische Maße. Theorien, für die hingegen psychologische Bedürfnisse zentral sind, verwenden auch Selbstberichte. Gängige Verhaltensmaße sind:
1. Anstrengung: das Ausmaß der Anstrengung, die der Organismus zeigt
2. Latenz: der Zeitraum zwischen dem Auftreten des Anreizes und dem Verhalten
3. Persistenz: die Ausdauer, die der Organismus zeigt
4. Wahl: die Tatsache, dass der Organismus eine bestimmte von mehreren Verhaltensoptionen zeigt
5. Frequenz: wie häufig ein Organismus eine Verhaltensoption wählt
6. Richtung: Annährungs- und Vermeidungsverhalten
7. Emotionaler Ausdruck von Behagen oder Unbehagen
Der Grad der Aktivierung eines Individuums, aber auch spezifisch relevante Aspekte des motivierten Verhaltens lassen sich an einer Reihe von physiologischen Veränderungen ableiten. So gehen z. B. bestimmte kardiovaskuläre Veränderungen mit Herausforderung versus Bedrohung einher (Tomaka, Blascovich, Kelsey & Leitten, 1993). Katecholamine (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) werden im Rahmen von Kampf-oder-Flucht-Reaktionen freigesetzt und können im Blut nachgewiesen werden (Arun, 2004). Aufmerksamkeit auf bestimmte Reize wiederum kann durch elektrodermale Aktivität (Filion, Dawson, Schell & Hazlett, 1991) indiziert werden. Funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) zeigt die Aktivierung bestimmter Hirnregionen in Abhängigkeit von Bestrafung und Belohnung. So reagiert der Nucleus Accumbens als Teil des Belohnungssystems (Ikemoto & Panksepp, 1999) in Antizipation einer monetären Belohnung (Knutson, Adams, Fong & Hommer, 2001).
Selbstberichte umfassen Fragebögen zu bestimmten Motivationen (z. B. der Personality Research Form, PRF; Jackson, 1984), aber auch projektive Verfahren, wie z. B. der Thematic Apperception Test (TAT; Murray, 1943) oder die Picture-Story Exercise (PSE; McClelland, Koestner & Weinberger, 1989; Schultheiss, Liening & Schad, 2008). Diese werden zur Messung von Leistungs-, Macht- und Bindungsmotivation eingesetzt (Atkinson, 1958; Langan-Fox & Grant, 2006). Es zeigt sich dabei, dass implizite Maße wie der TAT oder PSE nur gering mit Fragebogenmaßen korrelieren (McClelland et al., 1989; Schultheiss, Yankova, Dirlikov & Schad, 2009). Dabei erfassen implizite Maße eher spontanes Verhalten, während Fragebogenverfahren eher kontrolliertes Verhalten erfassen.
Exkurs Thematischer Apperzeptionstest (TAT)
Abb. 1.2: Beispiel für ein TAT-Bild (THEMATIC APPERCEPTION TEST by Henry A. Murray, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, Copyright © 1943 by the President and Fellows of Harvard College, Copyright © renewed 1971 by Henry A. Murray.)
Es wird den Probanden eine Reihe von Bildern vorgelegt mit der Instruktion, zu jedem Bild eine Geschichte zu erzählen. Dabei soll jede Geschichte darauf eingehen, wie es zu dem gezeigten Ereignis gekommen ist, was im Moment passiert, was die Protagonisten fühlen und denken und was das Ergebnis war. Die Probanden werden instruiert, eine komplette Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende zu erzählen. Die Geschichten werden dann aufgezeichnet und kodiert, wobei es unterschiedliche Systeme gibt, die in Bezug auf Reliabilität variieren. Der TAT bestand im Original aus 32 Bildern. Murray (1943) schlug vor, davon 20 auszuwählen. In den meisten Forschungsanwendungen werden nur diejenigen Bilder eingesetzt, die für die jeweilige Fragestellung relevant sind.
1.2 Historischer Abriss
Historisch wichtig sind drei »universale« Motivationstheorien, d. h., Theorien, die jede Art motivierten Verhaltens erklären wollen: Descartes‘ Willenstheorie, Instinkttheorien (Darwin, James, McDougall) und Triebtheorien (Freud, Hull). Diese Theorien zeigten sich alle als problematisch und wurden im späteren Verlauf von sogenannten Minitheorien abgelöst. Diese versuchen nicht, die gesamte Spannbreite des motivierten Verhaltens zu erklären, sondern beschränken sich auf bestimmte Motive oder Prozesse, wie z. B. Leistungsmotivation (McClelland, Atkinson, Clark & Lowell, 1953) oder Kognitive Dissonanz (Festinger, 1957).
1.2.1 Descartes‘ Willenstheorie
Descartes sah den Willen als die ultimative motivationale Kraft. Danach entscheidet der Wille ob, wann und wie wir handeln. Körperliche Bedürfnisse, Leidenschaften, Freuden und Schmerzen sind dabei nur Aktionsimpulse, die den Willen anregen. Der Wille ist derjenige Teil des Geistes, der diese körperlichen Leidenschaften und Begierden im Sinne eines tugendhaften Lebensstils reguliert. Descartes‘ Theorie gibt allerdings wenig Hinweis darauf, wie der Wille dies tut. Willenstheorien wurden bis ins 20. Jahrhundert weiterentwickelt (Rand, 1964; Ruckmick, 1936). So war für Wilhelm Wundt (1832–1920), dem Begründer der experimentellen Psychologie, der Wille ein zentrales Thema. Willenshandlungen stellten demnach die gestaltende Wirksamkeit des handelnden Individuums dar und Prozesse wie Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Erinnerung, Gedanken wurden von ihnen geleitet. Die experimentelle Volitionsforschung wurde insbesondere in der Würzburger Schule von Ach und in der Löwener Schule von Michotte vorangetrieben. Diese Ansätze wurden allerdings nicht weitergeführt. So sah z. B. Kurt Lewin in der Intention eher ein Pseudobedürfnis.
Auch Forschung zur »Willenskraft« im Rahmen von Studien zum Belohnungsaufschub zeigten, dass die zugrundeliegenden Prozesse auch ohne diesen Begriff erklärt werden können. Mischel und Kollegen (siehe Mischel, 1996) gaben Kindern die Wahl, eine Süßigkeit entweder gleich zu essen oder noch eine Weile zu warten, um dann noch eine weitere Süßigkeit zu bekommen. Kindern gelang dies am besten, wenn sie sich während der Wartezeit ablenkten, indem sie etwas anderes machten und damit das Warten weniger unangenehm gestalteten. Wenn sie hingegen angehalten wurden, über die antizipierte Belohnung nachzudenken, fiel ihnen das Warten sehr viel schwerer. Dies entspricht allerdings nicht der Vorstellung von Willenskraft als der Fähigkeit zu tugendhafter Selbstverleugnung, wie sie Descartes beschreibt. Mischel schließt aus diesen Studien, dass es in diesem Kontext statt um Willenskraft eher um die Fähigkeit geht, eine unangenehme Situation (Warten) in eine weniger unangenehme Situation (z. B. Singen) umzuwandeln. Im Rahmen der Forschung zur Selbstregulation wird der Begriff ebenfalls wieder aufgegriffen (Kap. 5.2).
1.2.2 Instinkttheorien
Charles Darwins Evolutionstheorie brach mit der hergebrachten philosophischen Dichotomie zwischen Mensch und Tier. Damit konnte auch die Frage gestellt werden, was Tiere motiviert. Ein mentalistisches Konzept wie der Wille konnte diese Frage nicht beantworten. Nach Darwin (1859, 1872/1965) ist tierisches Verhalten ungelernt und automatisch. Um solche genetisch verankerten, adaptiven Verhaltensweisen erklären zu können, schlug er das Konzept des Instinkts vor. In Gegenwart eines angemessenen Anreizes veranlasse der angeborene Instinkt das Tier, eine bestimmte Handlung auszuführen, zu jagen, ein Nest zu bauen, etc.
William James (1890) beschrieb neben den physiologischen Instinkten, die Darwin schon beschrieben hatte, auch mentale Instinkte (z. B. Imitation, Spiel). Auch er nahm an, dass ein Hinweisreiz genügt, um einen Instinkt auszulösen, z. B. löse der Anblick einer Maus in einer Katze eine Reihe von Impulsen aus, die sie zu bestimmten Handlungen – rennen, jagen – veranlassen. Die dazu nötigen Reflexe sind nach James angeboren.
Nach William McDougall (1908) bestimmen Instinkte, wie Reize wahrgenommen werden, welche Emotionen sie auslösen und wie in Bezug auf Reize gehandelt wird. D. h., er schrieb den Instinkten assoziierte Emotionen zu (z. B. Fluchtinstinkt: Furcht). Nach McDougall erklären Instinkte das beobachtete menschliche zielgerichtete Verhalten; ohne Instinkte würden Menschen nicht handeln. McDougall nimmt dabei eine schwächere genetische Verankerung an, weshalb er auch von Neigungen (Propensities) spricht, in bestimmten Situationen mit bestimmten Emotionen und den assoziierten Handlungen zu reagieren.
Im Laufe der Zeit zeigten sich jedoch zunehmend Probleme mit dem Instinktansatz. Die Listen der Instinkte wurden rasch exzessiv (mit über 6 000 Instinkten). Zu jedem Verhalten wurde ein Instinkt beschrieben. Wenn Tiere vor einem Objekt flüchten, wird dies mit dem Fluchtinstinkt erklärt; wenn sie sich einem Objekt nähern, mit dem Neugierinstinkt; wenn sie sich um ihre Jungtiere kümmern, mit dem Parentalinstinkt und so weiter (Dunlap, 1919; Holt, 1931). Dieser Ansatz ist zirkulär, da ja allein aufgrund des Verhaltens auf seine Ursache – dem zugeordneten Instinkt geschlossen wird. Es gab also kein vom beobachteten Verhalten unabhängiges Kriterium für die Existenz eines Instinkts. Auch zeigte sich, dass genetisch identische Individuen durchaus unterschiedlich auf Reize reagieren können, und zwar in Abhängigkeit ihrer Lerngeschichte (Watson, 1924). Diese Bedenken führten dazu, dass in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Instinkttheorie in der Psychologie von der Triebtheorie abgelöst wurde. Es gab in der Ethologie allerdings weiterhin instinkttheoretische Ansätze, die versuchten, die oben genannten Probleme zu umgehen (Lorenz, 1937; Tinbergen, 1951).
1.2.3 Triebtheorien
Sigmund Freud
Eine erste Triebtheorie wurde von Freud (1915/1952) entwickelt. Es gibt eine Reihe von Ähnlichkeiten zwischen Instinkten und Trieben. Ein wichtiger Unterschied liegt allerdings darin, dass der motivierende Faktor bei Trieben nicht außerhalb des Organismus im Anreiz, sondern innerhalb des Organismus liegt. Nach Freud wird Verhalten von biologischen Bedürfnissen bestimmt. Bei Nichtbefriedigung dieser Bedürfnisse entsteht Spannung, die schädlich wirkt, wenn sie nicht abgebaut wird (dies wird meist mit einer Dampfkesselmetapher verdeutlicht). Der Trieb ist dann der motivationale Faktor, der zu einer Handlung führt, die das Bedürfnis befriedigt und damit die Spannung abbaut (Abb. 1.3). Freud ging zunächst (1915) von einer Vielzahl von Trieben aus, reduzierte diese aber später (1938/1995) auf zwei Urtriebe: Eros und Thanatos. Eros vereint dabei Sexual- und Selbsterhaltungstriebe, während Thanatos zerstörerische Triebe vereint. Aus dem Zusammenspiel der beiden Urtriebe ergeben sich dann die konkreten Antriebe des Alltags. Die genauere Steuerung dieses Prozesses läuft über Freuds Instanzenmodell (Es-Ich-Überich), auf das hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Abb. 1.3: Triebmodell nach Freud
Clark L. Hull
Hulls Triebtheorie (Hull, 1943, 1952) baut auf einem behavioristischen Ansatz auf. Seine Theorie ist dabei die einzige der »universalen« Theorien, die motiviertes Verhalten vorhersagen kann (anstatt es nur ex post facto zu erklären). Wie bei Freud sucht der Organismus eine Homöostase. Wenn es zu einem Deprivationszustand kommt (z. B. nicht genug Flüssigkeit), führt dieser zu einem physiologischen Bedürfnis (Durst). Wenn dieses Bedürfnis intensiv genug wird, wird ein Trieb ausgelöst und ein zur Wiederherstellung der Homöostase geeignetes Verhalten (Habit) ausgewählt. Es kommt dann zum Konsumationsverhalten (Trinken), was zu einer Reduktion des Triebes führt – der Kreis schließt sich damit.
Der Trieb ist dabei eine monotone Funktion der Länge des Deprivationszustandes und stellt die Energie für das Verhalten zur Verfügung. Habit bestimmt das gewählte Verhalten. Habit ist aus der Lerngeschichte abgeleitet. Wenn eine Ratte gelernt hat, dass der rechte Durchgang durch ein Labyrinth zu Futter führt, der Linke aber zu Wasser, dann wird sie den Rechten wählen, wenn sie nahrungsdepriviert ist, und den Linken, wenn sie flüssigkeitsdepriviert ist (Hull, 1933). Das resultierende Konsumationsverhalten reduziert den Trieb und verstärkt das Lernen. D. h., Verstärkung des Lernens findet durch eine Reduktion der durch die Deprivation entstandenen Spannung statt. Hull beschrieb sein Modell mit der Formel:
Das exzitatorische Potenzial E des Verhaltens R in der Situation S wird dabei durch das Produkt Triebstärke D mit der Habitstärke H der Reaktion in der gegebenen Situation bestimmt. Man kann also nach dieser Formel das Verhalten des Organismus vorhersagen, wenn man seinen Deprivationszustand und die Lerngeschichte kennt. Es zeigte sich allerdings, dass Verhalten auch durch einen externen Faktor bestimmt wird: die Stärke des Anreizes K. So zeigte z. B. Crespi (1942) in einer klassischen Studie, dass die Laufgeschwindigkeit von Ratten nicht nur von ihrem Deprivationszustand und der Habitstärke abhängt, sondern auch davon, wieviel Futter sie am Ende erwarten konnten. Hull (1952) erweiterte deshalb seine Formel um diesen Faktor (K):
Hulls Triebtheorie war extrem populär und initiierte eine Vielzahl von Studien. Allerdings kamen nach und nach einige Probleme zum Vorschein. Die drei fundamentalen Grundpostulate der Theorie waren: (1) Trieb entsteht durch körperliche Bedürfnisse, (2) Triebreduzierung ist verstärkend und produziert Lernen, (3) Trieb gibt dem Verhalten Energie. Insbesondere diese Grundpostulate konnten in dieser Form nicht aufrechterhalten werden. Es gibt auch Motivation, die nicht durch körperliche Deprivation mediiert wird. So verwies Klien (1954) auf Personen mit Anorexie, die motiviert sind, nicht zu essen, obwohl auch sie ein biologisches Bedürfnis nach Nahrung haben. Auch ist Triebreduktion nicht zum Lernen nötig, z. B. lernen hungrige Ratten auch, wenn sie nur mit nicht-nutritivem Saccharin belohnt werden (Sheffield & Roby, 1950). Zudem gibt es Verhalten, dessen Energie nicht durch einen Trieb bestimmt wird, z. B. kann ich auf einer Party sehr wohl den Wunsch haben zu trinken, ohne durstig zu sein.
Diese Probleme, aber auch eine Psychologie, die dem Individuum eine aktivere Rolle zuschrieb, und nicht zuletzt die kognitive Revolution in der Psychologie führten zum Niedergang der biologisch orientierten Triebtheorien. In der Folge beschäftigten sich Motivationsforscher mehr mit spezifischen Themen und Prozessen. Dabei standen oft bestimmte angewandte Probleme im Vordergrund. Fragen nach Motivation in spezifischen Kontexten, z. B. am Arbeitsplatz (z. B., Vroom, 1964) oder in der Schule (siehe Weiner, 1990) wurden vorherrschend. Diese Forschung ging dann aber langsam in den zugeordneten Disziplinen auf (Arbeitspsychologie, Pädagogische Psychologie, etc.), und Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden dann im Rahmen des Behaviorismus Fragen nach der Motivation eines Organismus zur Seite gestellt. Selbst das Nebraska Symposium on Motivation, das zwischen 1950 und 1970 die führende Publikation war und in dem die wichtigsten Namen der Motivationsforschung vertreten waren (Weiner, 1990), gab 1979 das Thema auf. Erst in den letzten 20 Jahren lebte das Thema wieder auf und ist nun auch wieder breit vertreten.
Zusammenfassung
Es gibt interne (Bedürfnisse, Kognitionen und Emotionen) und externe Quellen der Motivation. Es gibt biologische, psychologische und evolutionäre Quellen der Motivation. Ein Verhalten kann von mehr als einer Motivation bestimmt werden, entweder gleichzeitig oder in Sequenz.
Motivationen können anhand von Verhaltensbeobachtungen sowie mittels psychophysiologische Maße und Selbstbericht sowie projektiver Tests erfasst werden.
Es gibt drei »große« historische Motivationstheorien, die versuchen, die Gesamtheit des motivierten Verhaltens zu erklären. In Descartes‘ Willenstheorie motiviert der Wille alles Handeln. Instinkttheorien gehen davon aus, dass Verhalten automatisch und ungelernt ist und auf genetisch verankerten Instinkten beruht. Ein äußerer Reiz löst den entsprechenden Instinkt aus. Triebtheorien gehen davon aus, dass die Nichterfüllung biologischer Bedürfnisse einen Spannungszustand hervorruft. Nach Hull ist der Trieb vom Ausmaß der Deprivation abhängig und bestimmt die Energie, nicht aber die Richtung des Verhaltens. Die Art des Verhaltens wird vom Habit vorgegeben, der wiederum von der Lerngeschichte des Individuums bestimmt wird.
Weiterführende Literatur
Locke, E. A. & Latham, G. P. (2004). What Should We Do About Motivation Theory? Six Recommendations for the Twenty-First Century. The Academy of Management Review, 29(3), 388–403.
Weiner, B. (1972). Theories of motivation: From mechanism to cognition. Oxford, UK: Markham.
Fragen zur Selbstüberprüfung
• Welche Quellen der Motivation gibt es?
• Was ist der Unterschied zwischen Anreiz und Motiv?
• Welche Verfahren können zur Messung von Motiven eingesetzt werden?
• Warum konnten sich die »großen« Motivationstheorien nicht durchsetzen?
1 Freie Übersetzung der Autorin
2 Bedürfnistheorien
2.1 Einleitung
Bedürfnisse bezeichnen Prozesse, die für das Überleben, das Wachstum und das Wohlbefinden eines Organismus nötig sind. Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, kommt der Organismus zu Schaden. Ein Bedürfnis ist also die motivationale Kraft, die den Organismus dazu bringt zu handeln, bevor ein solcher Schaden eintritt. Es gibt physiologische Bedürfnisse, die die körperlichen Ressourcen des Organismus betreffen (Hunger, Durst, Sex), soziale Bedürfnisse, die die Beziehung zur sozialen Umwelt betreffen (Machtmotivation, Bindungsmotive, Leistungsmotivation), und psychologische Bedürfnisse nach Selbstbestimmung oder Kompetenz.
2.2 Physiologische Bedürfnisse
Hulls oben genanntes Triebmodell beschreibt die motivationale Kraft physiologischer Bedürfnisse. Das Modell geht davon aus, dass der Körper Homöostase anstrebt. Wenn es zu einem Mangelzustand kommt, bewirkt das Bedürfnis eine korrektive Handlung. Im vorherigen Abschnitt wurden die generellen Probleme dieses Ansatzes diskutiert. Das Homöostase-Modell beschreibt aber motiviertes Verhalten insbesondere für Durst recht gut (Fitzsimons, 1972). In Deprivationsstudien zeigte Warner (1928a, 1928b), dass die Bereitschaft einer Ratte, ein elektrisches Gitter zu überschreiten, unter Deprivation stark ansteigt. Im Falle von Hunger und Durst fällt die Bereitschaft allerdings rasch wieder (vermutlich wegen der durch die Deprivation verursachte Schwächung). Bei sexueller Deprivation hingegen bleibt sie auf einem Plateau. Dabei gab es auch deutliche Geschlechtsunterschiede, der Deprivationseffekt war bei männlichen Ratten nur von der Dauer abhängig, bei weiblichen aber auch von ihrem Hormonzyklus. Diese Daten sprechen durchaus für die Triebtheorie. Allerdings ist der Einfluss der Umwelt ebenfalls wichtig. Einer davon ist der Geschmack. In einem klassischen Übersichtsartikel präsentierte Pfaffmann (1960) Daten aus Studien, vornehmlich an Ratten, die eine deutliche Präferenz für süße Flüssigkeiten zeigen.
In Bezug auf das menschliche Verhalten gibt es zudem kulturelle Regeln und Normen, die auf die Nahrungsaufnahme einwirken. Beispiele dafür sind die Vorstellung, dass man 2 Liter Wasser am Tag trinken müsse (es gibt dafür keine wissenschaftlichen Belege), oder auch das Trinken bei sozialen Anlässen. Insgesamt ist das Hull’sche Modell also nur bedingt anwendbar. Hunger wird dabei noch stärker von Umwelteinflüssen gesteuert als Durst, so dass für dieses Bedürfnis das Hull’sche Modell noch weiter eingeschränkt werden muss. Dennoch steht natürlich auch Hunger in einem Zusammenhang zur tatsächlichen Deprivation des Organismus.
2.3 Psychologische Bedürfnisse
2.3.1 Psychologische Bedürfnisse (needs) nach Murray
Hulls Triebtheorie wurde zunächst auch auf psychologische Prozesse, wie z. B. Neugier (Berlyne, 1954), angewandt. Es zeigte sich allerdings, dass Deprivation keine nötige Bedingung für Neugier ist. Insgesamt eignet sich die Hull’sche Triebtheorie nicht zur Erklärung von nicht physiologisch bedingten Verhaltensweisen.
Im Gegensatz zu Hull, der Bedürfnisse als angeboren verstand, sah Murray (1938) psychologische Bedürfnisse im Wesentlichen als erworben. Er definiert psychologische Bedürfnisse so:
»A need is a construct (a convenient fiction or hypothetical concept) that stands for a force (the physico-chemical nature of which is unknown) in the brain region, a force that organizes perception, apperception, intellection, conation and action in such a way as to transform in a certain direction an existing, unsatisfying situation.« (pp. 123–124)
Diese Definition ist sehr breit und erlaubt eigentlich alles, was irgendwie motivierend wirkt, als Bedürfnis zu bezeichnen. Die Liste der von Murray vorgeschlagenen Bedürfnisse wurde deshalb auch recht lang (Tab. 2.1). Wichtig ist dabei die Person-Umwelt-Beziehung. Nach Murray hängt die Wahrnehmung einer Situation erheblich von der Stärke des relevanten Bedürfnisses ab. Dies war auch die Basis für die Entwicklung des Thematischen Auffassungstests (TAT), bei dem Probanden den Inhalt mehrdeutiger Bilder beschreiben sollen ( Exkurs TAT in Kap. 1.1). Die Grundannahme des TAT ist, dass die für die Interpretation bevorzugt gewählten Themen die Bedürfnisse des Probanden widerspiegeln. Mit einem geeigneten Auswertungsverfahren kann der Test dies auch für bestimmte Bedürfnisse leisten.
Tab. 2.1: Alphabetische Liste der Psychologischen Bedürfnisse (needs) nach Murray
Need forBedürfnis nach
Von den vielen von Murray vorgeschlagenen Bedürfnissen wurden im Weiteren vor allem den Bedürfnissen nach Macht, Leistung und sozialem Anschluss Aufmerksamkeit geschenkt. Neuere Forschung im Rahmen der Selbstdeterminierungstheorie hebt zudem die »universellen« Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit hervor (Deci & Ryan, 2000). Im Folgenden werden zunächst diese drei Bedürfnisse kurz beschrieben, danach wird auf Macht-, Leistungs- und Anschlussmotivation eingegangen.
2.3.2 Universelle psychologische Bedürfnisse nach Deci und Ryan
Für Deci und Ryan (2000) sind die Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit universell. In Ablehnung der Position Murrays und damit eher Hull folgend, sehen Deci und Ryan diese Bedürfnisse als angeboren an. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist essentiell für das psychologische Wachstum, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen. Dies steht im Gegensatz zu den von Murray beschriebenen Bedürfnissen wie Macht oder Erwerbsstreben, da es viele Personen gibt, die ohne eine Befriedigung dieser Bedürfnisse ein hohes Maß an Wohlbefinden und psychologischer Gesundheit zeigen. Die Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit können in unterschiedlicher Form verwirklicht werden, wobei es auch kulturelle Unterschiede geben kann. Z. B. spielt Autonomie eine andere Rolle in kollektivistischen Ländern, in denen die Rolle des Einzelnen als Mitglied einer Gruppe im Vordergrund steht, als in individualistischen Ländern, wo das Individuum im Vordergrund steht. Dennoch ist Autonomie in beiden Kontexten für das Wohlbefinden des Menschen wichtig (Chirkov, Ryan & Sheldon, 2011). Individuelle Unterschiede in der Stärke der Ausprägung der einzelnen Bedürfnisse sind Ergebnis der Lerngeschichte des Individuums und der Erfahrungen mit Bedürfnisbefriedigung und –frustration. Wie auch Murray betonen Deci und Ryan (2000) die Person-Umwelt-Beziehung. Personen sind aktiv, sie verfolgen Ziele, haben Interessen und Werte. Diese treffen auf den Aufforderungscharakter der Umwelt in Bezug auf mögliche Aktivitäten, Herausforderungen, Feedback, Wahlmöglichkeiten und Anreize sowie auch auf den sozio-kulturellen Kontext in Form von Regeln, kulturellen Werten und Zielen, sowie interpersonalen Gegebenheiten. Dabei können psychologische Bedürfnisse befriedigt, aber auch frustriert oder manchmal zeitweilig vernachlässigt werden. Wenn Bedürfnisse lange unbefriedigt bleiben, können einerseits pathologische Ersatzbedürfnisse auftreten, anderseits kann es auch zu Amotivation und Passivität kommen. Die Selbstdeterminationstheorie (SDT) beschreibt den Zusammenhang von Bedürfnisbefriedigung und einem Motivationskontinuum, das von intrinsischer Motivation auf der einen Seite zu Amotivation auf der anderen reicht. Diese Theorie wird in Kapitel 5 ausführlicher beschrieben.
Autonomie
Autonomie setzt sich aus drei subjektiven Komponenten zusammen: einer internalen Kontrollüberzeugung, dem Gefühl der Wahl des eigenen Handelns und dem Gefühl nach dem eigenen Willen zu handeln (Volition). Eine internale Kontrollüberzeugung liegt vor, wenn die Person ein positives oder negatives Ereignis als Konsequenz des eigenen Verhaltens wahrnimmt, sich selbst also als Ort der Kontrolle begreift (Rotter, 1975). Sie steht im Gegensatz zur externalen Kontrollüberzeugung, bei der das Individuum glaubt, nicht auf das von außen gesteuerte Geschehen einwirken zu können. Das Gefühl der Wahl des eigenen Handelns entsteht in Kontexten, in denen das Individuum Flexibilität in der Wahl der Aktionen hat. Es steht im Gegensatz zu Situationen, die nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten erlauben. Volition bezieht sich auf das freie Ausführen von eigenen Absichten durch Willenskraft und steht im Gegensatz zu äußerem Druck und Zwang. Dies schließt auch solchen Zwang ein, den eine Person auf sich selbst ausübt (Introjektion), wenn sie das Gefühl hat, etwas tun zu müssen, um den Wünschen oder Erwartungen Anderer gerecht zu werden (Deci, Ryan & Williams, 1996).
Individuen suchen Situationen, die autonomieunterstützend wirken und meiden solche, die kontrollierend sind. Autonomieunterstützend sind Kontexte, in denen Individuen darin unterstützt werden, ihre eigenen Ziele zu setzen, eigene zielführende Handlungen zu wählen und Probleme auf ihre Art zu lösen. Es ist wichtig, autonomieunterstützendes Verhalten von übertriebener Nachsicht und Laissez-faire zu unterschieden. Laissez-faire ist ein Stil, in dem das Individuum im Wesentlichen allein gelassen und seine Bedürfnisse vernachlässigt werden, da alles erlaubt wird und keine Grenzen gesetzt werden. Zu einem autonomieunterstützenden Stil gehören deshalb auch (konstruktives) Feedback über das Verhalten des Anderen und der Wille, dem Anderen zuzuhören sowie negative Emotionen zu akzeptieren. Im Gegensatz dazu zeichnet sich kontrollierendes Verhalten dadurch aus, dass spezifische Handlungsanweisungen gegeben werden, die keinen Raum zur eigenen Gestaltung lassen, und Druck auf die Person ausgeübt wird, entsprechend zu handeln.
Kompetenz
Das Bedürfnis nach Kompetenz ist charakterisiert durch die Suche nach einem Gefühl der Meisterschaft, nach optimalen Herausforderungen und nach dem Gefühl der Effektivität, der Originalität und der Kreativität.
Kinder lehnen oft Hilfe mit dem stolzen Hinweis ab, dass sie etwas schon können. Tatsächlich streben wir alle nach dem Gefühl, die sich uns stellenden Herausforderungen meistern zu können. Das Gefühl, unfähig zu sein oder hilflos einer Herausforderung gegenüberzustehen, ist dahingegen sehr negativ belastet. Voraussetzung für ein Kompetenzerleben ist, neben dem Gefühl





























