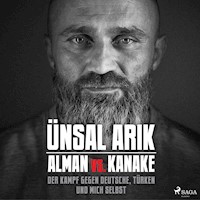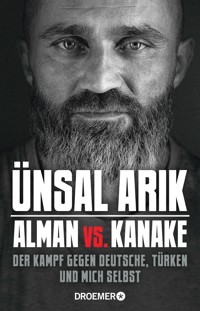
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Allein gegen alle und sich selbst: die mitreißende Autobiografie des deutsch-türkischen Profi-Boxers und vehementen Erdoğan-Kritikers Ünsal Arık. Als »Kanake« im Land der »Almans« lebt Ünsal Arık von Anfang an nach der Devise: ganz oder gar nicht. Er versucht sich als Fußballer, IT-Vertriebler und Versicherungsfachmann. Doch sein Glück findet Arık dabei nicht und fällt tief, rutscht sogar in die Obdachlosigkeit ab. Was ihn schließlich vor dem Untergang rettet, ist das Boxen. Er gewinnt reihenweise internationale Titel und begibt sich dabei auf seine bisher härteste Mission: das Engagement gegen die autoritäre Politik des türkischen Präsidenten Erdoğan. Nun erzählt Arık seine ganze Geschichte so, wie er durchs Leben geht. Ohne Kompromisse. - Die beeindruckende deutsch-türkische Lebensgeschichte von Box-Star Ünsal Arık - Vom Sportler zum politischen Botschafter: Arık ist einer der schärfsten Kritiker von Erdoğans Politik - Ein lebenslanger Kampf gegen Rassismus, Anfeindungen und Ausgrenzung Ünsal Arık wächst in der bayerischen Provinz auf und ist zerrissen zwischen türkischem Elternhaus und neuer deutscher Heimat. Trotz seiner großen Talente, egal ob auf dem Fußballplatz oder im Vertrieb, scheitern seine Lebensentwürfe immer wieder. Gefangen in einer Spirale aus Misserfolgen und privaten Rückschlägen, kommt Arık schließlich ganz unten an: Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Obdachlosigkeit. Es ist am Ende mehr Zufall als Plan, dass er mit dem Boxen anfängt und sich selbst rettet: Mit unermüdlichem Kampfgeist und Härte gegen sich selbst schafft er das Unglaubliche und wird mit 30 Jahren Profiboxer. Und nicht nur das, er erkämpft zahlreiche internationale Titel, darunter den IBF-Intercontinental im Supermittelgewicht. Ich habe vieles aufgegeben, um nicht meine Ziele aufzugeben. – Ünsal Arık Doch sein wichtigster Gegner steht nicht im Ring, sondern auf der politischen Bühne. Immer wieder setzt Arık politische Statements gegen die Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdoğan und wird dafür aufs Heftigste bedroht, auch und gerade von Türken in Deutschland. Doch Arık bleibt standfest und sagt: Nur mit gegenseitigem Respekt kann Integration in Deutschland gelingen. Und so beginnt sein bisher längster Kampf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ünsal Arık
In Zusammenarbeit mit Hendrik Heisterberg
Alman vs. Kanake
Der Kampf gegen Deutsche, Türken und mich selbst
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ünsal Arık wächst als »Türke« im Land der »Almans« auf und hat nur eine Devise: Ganz oder gar nicht. So versucht er sein Glück als Profifußballer, IT-Vertriebler und Versicherungsvertreter, unternimmt Höhenflüge, um umso tiefer abzustürzen. Was ihn schließlich vor dem Untergang rettet, ist das Boxen. Im Ring findet er zu sich selbst und erkämpft reihenweise internationale Titel. Das Profiboxen ist für Ünsal Arık von Anfang an Mittel zum Zweck. Sein Ziel ist es, Bekanntheit als Sportler zu erlangen, um in der Öffentlichkeit Gehör zu finden. Schockiert von der Politik des türkischen Präsidenten Erdoğan und dem hohen Ansehen, das er in der türkischen Community in Deutschland genießt, erhebt Arık die Stimme. Seine Botschaft: Nur mit gegenseitigem Respekt kann Integration in Deutschland gelingen. Und so beginnt Arıks bislang härtester Kampf.
Inhaltsübersicht
Prolog: Staredown – Ghana 2011
Staredown – Ghana 2011
Runde I: Mit harten Bandagen
Mit harten Bandagen
Zwischen den Runden
Runde II: In der Ecke
In der Ecke
Zwischen den Runden
Runde III: Clinch
Clinch
Zwischen den Runden
Runde IV: Finte
Finte
Zwischen den Runden
Runde V: Cut – der wunde Punkt
Cut – der wunde Punkt
Zwischen den Runden
Runde VI: Tiefschlag
Tiefschlag
Zwischen den Runden
Runde VII: Beinarbeit
Beinarbeit
Zwischen den Runden
Runde VIII: In den Seilen
In den Seilen
Zwischen den Runden
Runde IX: Wirkungstreffer
Wirkungstreffer
Zwischen den Runden
Runde X: Angezählt
Angezählt
Zwischen den Runden
Runde XI: Aufwärtshaken
Aufwärtshaken
Zwischen den Runden
Runde XII: Lucky Punch
Lucky Punch
Epilog
Vor der Urteilsverkündung
Bildteil
Dank
Prolog
Staredown – Ghana 2011
Der Kopf dröhnt, alles klebt vor Schweiß. Du kannst nur durch den Mund atmen, der Krach und der Gestank im Gedränge bringen dich halb um. Du folgst Lord, dem Guide, über den Basar, durch die Massen lächelnder Schwarzafrikaner in bunten Klamotten. Wirst gemustert. Angelacht. Angefasst. Dealer und Geldwechsler an den Ecken rufen dir nach, machen Klick- und Zischlaute mit dem Mund. Die wollen erst Aufmerksamkeit, dann Geld, so läuft es überall. Frauen kommen dir entgegen, balancieren riesige Pakete auf den Köpfen, Kinder an beiden Händen. Links und rechts der Straßen stehen Männer, alte und junge, die einfach nur rumhängen.
»Niemals allein aus dem Hotel gehen, zu gefährlich«, sagt Lord. »Passt auf euer Zeug auf!«
Ohne Guide wären mein Trainer Juri und ich komplett verloren in diesem Chaos aus Menschen und Marktständen. Drei, vier Jungs kommen angerannt und ballen die Fäuste. »Hey, Boxer! Boxer!« Jetzt erkennen mich schon irgendwelche Teenager in Accra auf der Straße. Nur wegen einem Bild in der Zeitung, als wäre ich Muhammad Ali oder sonst wer. Die haben meinen einzigen Profikampf nicht gesehen. Die checken nicht, dass Ghana meine letzte Chance ist. Wenn ich morgen verliere, ist meine Boxkarriere vorbei. Dann sind die 10000 von Hayri im Arsch, und ich gehe zum Jobcenter.
Lord führt uns in eine Seitengasse voller brauner Pfützen. Links und rechts türmen sich Müll und Pappkartons. Ein nacktes Kind kackt in ein Erdloch. Gleich daneben rupft eine Frau ein Huhn. Die Gasse wird zwischen den Wellblechhütten so eng, dass wir seitwärts gehen müssen. Weiter, immer weiter, zur nächsten größeren Straße, vorbei an abgefuckten Autos und überladenen Mopeds. Schwarze Männer, Frauen und Kinder hocken am Straßenrand im Dreck. Kein Plan, ob sie betteln oder auf irgendwas warten.
30 Minuten Fußmarsch, dann erreichen wir die Moschee, das erste schöne Gebäude heute, sauber, grün gestrichen, keine kaputten Fenster. Es geht eine Treppe hoch, wir hören den Ruf zum Freitagsgebet. Drinnen wieder Gedränge. Ich ziehe meine Schlappen aus und wasche mich, wie jeder gute Muslim.
Die Gläubigen hocken dicht an dicht auf ihren Teppichen. Es stinkt nach Schweiß und alten Männern. Man kann sich nicht zu Boden werfen, ohne an den Füßen des Vordermanns zu riechen. Die Luft steht. Ich schließe die Augen, versuche, mich auf das Gebet zu konzentrieren. Folge den Worten des Imams. »Allahu akbar.« Ich erhebe mich. Bitte Allah um Kraft für meinen Kampf.
Doch irgendwas irritiert mich. Irgendwas ist falsch, aber ich komme nicht drauf. Der Imam wechselt zu Englisch, dann spricht er eine andere Sprache. Was stimmt hier nicht?
Alle werfen sich nieder. Mein Blick fällt auf zwei Männer rechts neben mir, und ich weiß, was mich stört: Die folgen nicht dem Imam wie alle anderen. Die sind auch nicht zu den Worten »Allahu akbar« aufgestanden. Die beten anders, scheißen auf die Vorgaben, hocken da und legen die Hände aneinander. Was ist hier los?
Ich stehe auf, obwohl es verboten ist. Keiner merkt es, ich drehe mich einmal im Kreis. Da, noch einer. Und da, ein Scheißkreuz auf der Brust. Was haben Christen hier zu suchen? Das sind Ungläubige, die müssen in der Hölle brennen! Reiß dich zusammen. Fokus aufs Gebet, lass dir nichts anmerken! Ich knie nieder, aber es ist vorbei. Habe vergessen, wozu ich hergekommen bin, denke nicht mehr ans Boxen, steigere mich rein in meine Wut.
»Allahu akbar.«
Los, hoch mit dir, du Hund, denke ich, Allah ist groß! Was machst du ungläubiger Hurensohn in meiner Moschee? Das ist mein Islam, mein Glaube! Du verfickter Bastard wirst in der Hölle schmoren, draußen im Dreck, da kannst du beten, da gehörst du hin, nicht hierher.
So geht es ab in meinem kranken Hirn. Wieso beten hier Ungläubige? Warum stört das keinen? Das ist eine islamische Moschee! Da stehen Koranverse an den Wänden! Was haben diese respektlosen Hurensöhne hier verloren? Das Ende des Gebets bekomme ich gar nicht richtig mit. Mein Kopf rotiert. Ich wollte Klarheit, jetzt ist da nur noch Verwirrung.
Ich muss eigentlich zu meinen Leuten nach draußen, aber in mir brodelt es. Will das nicht einfach schlucken, will verstehen, was hier abläuft. Drängle mich durch nach vorn, muss das jetzt klären. Die Leute merken was, machen mir Platz, haben Schiss, dass es Ärger gibt. Als würde ich in einer Moschee zuschlagen! Dann stehe ich vor dem Imam, blicke in seine großen schwarzen Augen.
Wisst ihr hier nicht, wie Islam funktioniert, will ich sagen, hier läuft was falsch! Versuche es mit meinem katastrophalen Englisch: »Excuse me, why … the other peoples … they make so …«
Ich kann es nicht, finde keine Worte, das macht mich noch wütender, ich werde immer lauter. Keiner sagt was. Alle Köpfe in meine Richtung gedreht, die weißen Augen. Sie schauen mir zu, wie ich hilflos rumfuchtle, stottere, schreie und schimpfe. Allah, Kirche, Jesus … was soll das?
Schließlich nimmt der Imam meine Hand und nickt. Seine Hände sind so groß und rau, dass meine darin aussieht wie die eines kleinen Jungen. Warum sagt er nichts? Kein Standardtext, Allah, der Barmherzige, der Große, der alles sieht und verzeiht … und so weiter. Dieser Mann starrt mir in die Augen, dass es schon anfängt, mich zu nerven. Wie er immer näher kommt, bis sich unsere Nasen beinahe berühren, bis ich seinen Atem spüre, und er sagt immer noch kein Wort.
Dann sind wir zwei plötzlich allein. Ich weiß nicht, ob das Hypnose ist oder irgendein verfickter Trip. Kriege nichts mehr mit vom Lärm und vom Gestank. Da sind keine anderen Leute. Kein Stress, kein Druck. Nur noch wir beide. Bloß noch diese zwei großen dunklen Augen mit meinem Spiegelbild darin.
Wen sieht der Mann? Den Boxprofi kurz vorm K.o.? Den aggressiven Türken, den Deutschlandhasser? Den Vater ohne Sorgerecht? Den kriminellen, obdachlosen Junkie? Oder einen ganz anderen Ünsal, den noch keiner kennt? Ich weiß nicht, wie lange wir so dastehen. Vielleicht eine Minute, vielleicht zehn. Dann bewegen sich endlich seine Lippen. Von irgendwoher höre ich seine sanfte, aber feste Stimme.
»Brother.« Ganz leicht drückt er meine Hand. »Bread. Water. Peace.«
Er nickt mir zu, als wüsste er Bescheid über mich. Als hätte er mich komplett durchschaut, als würde er mich besser kennen als mein eigener Vater. Mir steckt noch was im Hals, aber ich kann nichts sagen. Es dauert noch mal eine gefühlte Ewigkeit, bis er mich einfach stehen lässt und geht. Seine Worte sacken. Brennen sich ein, bleiben in meinem Kopf. Brot, Wasser, Frieden. Mehr braucht es nicht, denke ich. Mehr brauchen wir nicht.
Als ich wieder klar im Kopf bin, habe ich die Moschee längst verlassen. Hier draußen sind nur Minuten vergangen, aber meine Welt hat sich gerade komplett gedreht. Alles ist neu. Das hier ist nicht das Ende. Das hier ist ein neuer Anfang.
Runde I
Mit harten Bandagen
Du stehst allein im Dunkeln, und sie sagen deinen Namen. Wenn deine Musik beginnt und du den schweren Gang zum Kampf antrittst, liegt der härteste Teil des Weges schon hinter dir. Die Scheiße mit dem Geld. Die schlaflosen Nächte. Die endlosen Stunden im Hotel, in denen du dir den Kopf zerbrichst, Selbstgespräche führst. Du stehst noch nicht mal im Ring und bist jetzt schon so fertig, dass du am liebsten wieder abhauen würdest. Dieser Kampf kann dein letzter sein. Es geht um alles.
Tausende Erdoğan-Fans warten nur darauf, dass du versagst, damit sie dir ihren ganzen Hass in die Kommentare rotzen können. »Du lächerlicher kleiner Alman warst schon immer ein beschissener Boxer, such dir mal einen richtigen Gegner! Aber dazu fehlt dir ja der Mut, weil er dich sofort vernichten würde. Große Fresse, nichts dahinter, geh arbeiten, du Hund.« So pissen sie dich an, jeden Tag.
Was, wenn sie recht haben? Was, wenn ich verliere?
Dann kann ich nicht mehr weitermachen. Dann bin ich am Arsch, dann verdiene ich kein Geld mehr, und die lachen mich aus. Zu Hause sitzt mein Vater, der kann dann keinem mehr ins Gesicht schauen. Ich weiß, wie die Türken ticken. Sie werden ihn ansprechen. Besonders die, die sonst nie mit ihm reden. »Na, hat dein Haustürkensohn endlich auf die Fresse bekommen? Richtig so.«
Seit zwei Wochen sind wir zurück aus Ghana, unsere Haut immer noch leicht gebräunt, nur mein Trainer Juri wirkt blass. Man sieht ihm seine Sorgen an. Es geht ums Ganze, für jeden von uns. Wir haben alles aufs Boxen gesetzt, jetzt müssen wir liefern. Und das werden wir. Vor einer Stunde habe ich einen in Koblenz umgehauen, K.o. in der zweiten Runde. Ohne Dusche ging es direkt weiter nach Köln, umziehen während der Fahrt in Dalibors altem 180er Benz. Noch einmal gewinnen, und ich darf in Regensburg um den GBA-Gürtel boxen.
Seit der Blamage in meinem ersten Profikampf habe ich mich monatelang mit öffentlichen Ansagen zurückgehalten, jetzt pokere ich wieder höher. Erzähle rum, dass ein Highlight kommt, dass ich zu Hause um einen Titel boxe, live bei Eurosport.
Mama ist hin und weg. Sie ruft alle Nachbarn an, als Erstes die, die sie nicht mag: »Mein Sohn boxt im Fernsehen um die deutsche Meisterschaft. In 14 Tagen. Wollte ich euch nur mitteilen.« Sie ist so stolz. Diesmal glaubt sie fest an mich. Wie viel haben wir dagegen früher wegen meiner Fußballkarriere gestritten? Egal wie gut ich gespielt habe, sie war nie überzeugt. Hat nie verstanden, wie Papa sich damals für mich reingehängt hat. Fürs Boxen ist sie Feuer und Flamme, dafür ist jetzt Papa skeptisch.
Der Kampf in Köln kostet wenig, vier Runden, nur 800 Euro. Dalibor, Juri und ich kratzen das Geld irgendwie zusammen. Dali bezahlt lieber einen Kampf als eine Autoreparatur. Nachvollziehbar. Mitten in einer Baustelle fängt der Kühler an zu kochen, wir sollten Wasser drüberkippen, aber es gibt keinen Seitenstreifen. Nach wenigen Minuten dampfen wir wie eine Shisha und bleiben liegen, niemand kann vorbei, wir müssen raus und schieben. Darüber können wir noch lachen.
Nach einer Stunde läuft der Wagen wieder, und wir schaffen es gerade noch rechtzeitig zum Wiegen. Sehen uns die Halle an, dann schlägt die Müdigkeit zu.
»Wie lange fahren wir zum Hotel?«, frage ich Dalibor.
»Jungs …« Er holt tief Luft. Ich kenne diesen Blick. »Jungs, wir haben kein Geld mehr für ein Hotel.«
Juri flucht auf Russisch, ich auf Türkisch.
»Und wo schlafen wir, Mann?«
Dalibor zeigt auf sein Auto. Typisch, mit so was erst kurz vorm Kampf rauszurücken, wenn du nicht mehr Nein sagen kannst. Bei ihm musst du immer mit Überraschungen rechnen.
Trotzdem bin ich nicht lange sauer. Dali ist mehr als ein Manager – er ist ein Magier. Afrika war seine Idee, ein Geniestreich. Ünsal Arık bringt drei Siege durch K.o. nach Hause, die Presse beißt an, plötzlich bin ich wieder im Gespräch. Diese kleinen Wunder verdienen Respekt, auch bei einem, der noch kein Topmanager ist. Der noch keine riesigen Summen beschaffen kann. Soll wegen so was alles scheitern?
Wir parken direkt vor der Halle, Abendessen fällt aus. Dalibor und Juri sitzen vorn, ich lege mich auf die Rückbank und versuche zu entspannen. Es wird dunkel. Es wird kalt. Dali lässt den Motor laufen, aber nicht zu lange, um Sprit zu sparen. Ein paarmal nicke ich ein, bis mich sein Schnarchen wieder weckt. So soll ich morgen boxen. Verliere ich, zerbricht alles, dann bin ich für meine Mutter wieder dieser Versagersohn, dann ist sie blamiert, dann geht gleich wieder das Geläster los.
Wir schlafen schlecht, wenn überhaupt. Morgens um sechs werden wir wach, alle schlapp, alle steif. Es riecht wie im Viehstall. Dalibor organisiert uns irgendwo Studentenfutter. Bis wir in die Halle können, müssen wir zehn Stunden totschlagen. Zeit – einer der härtesten Gegner überhaupt. Die Warterei killt mich, ich drehe halb durch. Nachmittags um fünf lässt mich der Supervisor endlich in die Kabine, ich mache mich warm, steige in den Ring, haue meinen Gegner in der ersten Runde k.o., und wir setzen uns direkt wieder ins Auto. Wer weiß, wie lange die Karre durchhält.
»Ich bin jetzt da!«
Samstagvormittag, halb elf, ungefähr 2004. Ich liege noch im Bett.
»Wo bist du?«
»Vor deiner Tür natürlich. Machst du mir auf, oder willst du mich ewig auf der Straße warten lassen?«
Was macht sie hier in Regensburg? Warum sagt sie nicht Bescheid, dass sie kommt? Ich stehe auf, werfe das Handy aufs Bett, ziehe mir eine Hose an. Zum Glück bin ich allein. Im Flur drücke ich den Knopf und öffne die Tür.
Energisch, kraftvoll, wie nur sie es kann, marschiert sie die Treppe rauf, eine schwere Tasche in der Hand. Sie küsst mich kurz und wuchtet die Tasche auf den Küchentisch.
»Ruf doch eher an«, sage ich. »Ich hätte dich vom Bahnhof abgeholt.«
»Ich bin nicht mit dem Zug da.«
Stolz hält sie mir Papas Autoschlüssel vors Gesicht, dann räumt sie Einkäufe und Selbstgekochtes in meinen leeren Kühlschrank. So ist meine Mutter, so war sie immer. Sie fragt gar nicht erst, steigt einfach in den Wagen und fährt die 45 Kilometer zu mir. Eine türkische Frau. Allein. Das ist eine Sensation. Autofahren ist Männersache, fertig, so habe ich es gelernt. Aber wenn irgendeine Türkin so was Verrücktes tut, dann ist es meine Mutter.
Mitte der 90er konnte keine türkische Frau in Parsberg Auto fahren. Eines Tages kam sie heim und legte ihren Führerschein auf den Tisch. Dafür hatte sie geübt und gespart, ohne dass wir es mitbekommen hatten. Kaum fuhr sie in Papas Passat durch den Ort, ging bei den türkischen Frauen das Gerede los: »Hast du gesehen? Die Frau vom Mustafa fährt Auto.« Und zu ihren Männern: »Warum darf ich keinen Führerschein machen? Bezahl mir den!« Ein paar Jahre später fuhren sie fast alle.
Meiner Mutter macht keiner was vor. Sie zieht radikal ihr Ding durch, ohne Kompromisse. Sie ist in einer Großfamilie in Kadirli aufgewachsen, einem Ort bei Adana in der Südtürkei, und war schon als Kind eine sehr dominante Person. Niemand konnte sich gegen sie durchsetzen. Niemand legte sich mit ihr an, sie schlug ihre großen Brüder und prügelte sich mit den Jungs aus dem Dorf. Mit acht konnte sie große Pferde reiten wie eine Erwachsene. Sie platzte vor Energie, hatte vor nichts Angst. Eine Naturgewalt. Und dieses türkische Mädchen vom Dorf, das jüngste von 13 Kindern, das sein halbes Leben auf dem Feld gearbeitet hat, sagt mit nicht einmal 20 Jahren: »Ich gehe nach Deutschland!«
Jetzt steht sie an meinem Elektroherd, kocht ihre Linsensuppe, für die ich sterben würde, und erzählt, was es in Parsberg Neues gibt.
Ich sehe Mama zu und sehe mich selbst. Ich bin eins zu eins ihre Kopie, habe ihr Temperament geerbt, ihren Kampfgeist und ihren Willen. Ich liebe sie, auch wenn ich ihr das niemals sage.
Ich wünschte, sie hätte mich genauso geliebt, aber Mamas Liebling war ich nie. Ein Freund aus der Nachbarschaft hat mir erzählt, was seine Mutter über mich sagt: »So viele Schläge wie der Ünsal habt ihr alle zusammen nicht kassiert.«
Das könnte stimmen. Wie in fast allen türkischen Familien war bei uns die Mutter die Grobe. Wenn du Scheiße gebaut hattest, kannte sie nur eine Erziehungsmaßnahme: Sie schlug zu, genauso wie sie wahrscheinlich selbst als Kind geschlagen wurde.
Du hast wieder mal einen Sechser und läufst mit Angstschweiß nach Hause, weil du weißt, was auf dich zukommt. Du redest nicht darüber, zeigst deine Arbeit nicht vor. Du traust dich nicht. Du weißt genau: Es gibt von ihr erst mal eine aufs Maul. Eine ordentliche osmanische Klatsche, wie man sagt. Eine richtig stramme Ohrfeige. Danach sitzt du zuerst mal nur da und lässt es brennen.
Oft nahm sie einen langen, dünnen Holzstab zum Teigrollen. Damit gab es dann fest eins auf den Hintern oder auf die Knie. Und meine Mutter hatte Kraft. Eine hammerharte Frau. Sie wusste genau, wo sie hinschlagen musste, damit es ordentlich wehtat. Niemals auf den Kopf, niemals ins Gesicht. Niemals diese Schläge, von denen du grün und blau wirst. Diese Art der Bestrafung hat bei uns Türken Tradition wie in anderen Kulturen der Rohrstock.
Mama rührt mit dem langen Holzlöffel in ihrer fantastischen Linsensuppe, und wir lachen über damals. Ich trage ihr die Schläge nicht nach. Sie wurde selbst so erzogen, wusste nicht, wie sie sich anders helfen sollte. Was hätte ich an ihrer Stelle mit mir angefangen? Welche andere Lösung hätte es für sie gegeben? Sie und mein Vater arbeiteten von früh bis spät, um Geld zu verdienen. Um uns Kindern ein besseres Leben zu bieten. Dann kamen sie von der harten Schichtarbeit nach Hause, bekamen Anrufe von der Schule, von der Polizei, der Sohn hat Mist gebaut, Mist gebaut, Mist gebaut. Sie wurden zu Recht wütend.
Du pubertierst, fängst an, dich zu wehren, zu provozieren: »Sagt mal, bin ich eigentlich adoptiert?«
Kein 14-Jähriger sollte so eine Frage stellen. Für einen Teenager ist allein der Gedanke, seine ganze Existenz infrage zu stellen, der reinste Hirnfick. Es gibt einen Riesenkrach, aber wenigstens klärt sich einiges auf.
Es war so: Als mein älterer Bruder Üstün zur Welt kam, freuten sich meine Eltern über ihn wie über ein Wunder. Sie waren sich vorher nicht sicher gewesen, ob sie überhaupt Kinder kriegen würden, und hatten mehrere Fehlgeburten erlebt. Dann kam ich, und es passierte etwas, woran niemand die Schuld trägt: Meine Mutter nahm mich nicht an. War mit der Situation überfordert.
Sie wurde depressiv. Hielt es mit dem neuen, schreienden Baby nicht aus und sah keine andere Lösung, als mich zu ihrem ältesten Bruder nach Adana zu geben. Da blieb ich neun Monate lang, ohne Mutter, ohne Vater. Mit knapp einem Jahr holten meine Eltern mich zurück nach Deutschland und setzten mich meinem 14 Monate älteren Bruder vor die Nase. Damit begann mein ständiger Kampf um Anerkennung. Um Aufmerksamkeit. Um irgendeine Art von Zuwendung von meiner Mutter. Notfalls auch in Form von Schlägen.
Du rebellierst, setzt immer noch eins obendrauf, spielst den Pascha. Draußen auf der Straße bin ich der King, was willst du? So viel Wut und Aggressivität bringst du von draußen mit nach Hause, dass man mit dir nicht mehr vernünftig reden kann. Schläge sind die einzige Sprache, die du noch verstehst.
Daran gibt es nichts schönzureden. Nach wie vor werden türkische Kinder von ihren Eltern geschlagen, weil die sich nicht anders zu helfen wissen. Weil sie es selbst nicht anders gelernt haben. Es ist Teil der strengen türkischen Kultur. Aber es ist kein Teil, auf den wir stolz sein können.
Deine Hände sind hart bandagiert, die Handschuhe fest verschnürt. Der Izmir-Marsch erklingt, die Hymne Atatürks, des türkischen Staatsgründers, des Vaters aller Türken. Der Chor setzt ein, du gehst los, die Hurensöhne fangen an zu pfeifen. Sie wollen Patrioten sein, aber dich pfeifen sie aus, obwohl du für ihr Mutterland boxt. Und sie pfeifen Atatürk aus. Sie rufen »Alman köpeği!«, deutscher Hund. Für diese Leute bist du kein Türke mehr, gehörst nicht mehr zu ihnen. Lass die ehrlosen Bastarde rufen. Würdige sie keines Blickes. Keiner von denen weiß, was du durchmachen musstest, um überhaupt bis hierher zu kommen. Die wissen nichts.
Vor dem Ring bleibst du stehen und sprichst dein Gebet. »Vergiss nicht die Namen der drei Propheten«, hat Papa wie immer gesagt. Sein altes Brillenband, oft gerissen, immer wieder neu geknotet, hängt um deinen Hals. Daran der erste Ring, den du Xenia geschenkt hast, und ein kleiner silberner Boxhandschuh, ein Geschenk von Mama. Wie immer hat Papa diese Gegenstände mit den 40 Gebeten aus dem Koran gesegnet, damit sie dir Glück bringen und dich vor dem Bösen beschützen.
Du steigst die Stufen hinauf, nimmst jede mit rechts zuerst. Ein Kämpfer braucht seine Rituale.
»Ey, du Hurensohn!«
»Du beleidigst meine Mutter?«
Ich überlege nicht lange, gehe zu dem Bastard hin und schlage ihm meine Faust ins Gesicht. Ich bin gerade mal elf oder zwölf. Meine erste Schlägerei. Meine erste Fahrt im Polizeiauto. Vor den Beamten scheißt mich mein Papa scheinheilig zusammen. Als sie weg sind, fragt er nach dem Grund.
»Du, Papa, der hat Mama Hure genannt!«
Er setzt sich hin und sagt: »Na gut, mein Sohn, dann war es zu Recht. Du hast deine Familie, deine Mutter, deinen Stolz und deine Ehre verteidigt. Wir leben für Stolz und Ehre. Hast du diese zwei Dinge nicht, bist du niemand, dann kannst du nicht leben.«
So läuft es bei uns zu Hause. Stolz heißt, die Familie zu beschützen. Die Familienehre geht bei uns über alles. Erst recht über deutsches Gesetz.
Unser Gesetz lautet: Wir sind keine Deutschen, wir sind Türken! Wir halten an unserer Kultur und an unserem Glauben fest. Das zeigen wir auch. Je türkischer, desto besser. Die Türkei ist zwar weit weg, wir sind in Deutschland und gehen mit deutschen Kindern zur Schule und zum Fußball – aber zu Hause sind wir immer in der Türkei. Es läuft türkisches Fernsehen, türkisches Radio, türkische Musik. Bei uns ist es so türkisch, dass mein Bruder und ich glauben, Mustafa Kemal Atatürk sei unser Großvater, weil im Wohnzimmer ein Foto von ihm hängt. Der Nationalstolz unserer Eltern ist unser Nationalstolz. Wir fühlen uns zu einhundert Prozent als Türken.
Jeden Tag laufen türkische Filme auf TRT. Historische Filme, die unser Geschichtsbild prägen: Wer war dieser Krieger? Wer war jener Feldherr? Wie hat es ein Türke geschafft, eine komplette christliche Armee zu besiegen? Wir sehen, wie es einer allein mit zehn Gegnern aufnimmt, und erinnern uns an die Sprüche der Erwachsenen: »Ein Türke ist so viel wert wie zehn Deutsche.« – »Ali Khan, der Ritter von 1830, der hat ja allein gegen 30 Mann gekämpft.« Solche Legenden und Mythen halten wir für Geschichte. Keiner erklärt es uns.
Unser Held ist Emrah, ein Schauspieler und Sänger, türkischer Superstar. In einem Film wird seine Schwester vergewaltigt, und er muss den Täter umbringen. Im nächsten sitzt sein Vater unschuldig im Knast, und Emrah bringt aus Rache den Verleumder um. Dafür geht er zwar ins Gefängnis, aber mit Stolz, erhobenen Hauptes. Im nächsten Teil kommt er frei und wird vom Dorf als Held gefeiert.
Diese Filme passen mit dem zusammen, was unsere Eltern und unsere türkischen Bekannten sagen. Es prägt sich tief ein. Wir gucken solche Filme täglich und denken: So läuft es. So funktioniert die Welt. So müssen wir uns verhalten. Niemand guckt deine Schwester an. Fasst der eine die Schwester von dem anderen an – Ehrenmord. Hat dein türkischer Freund eine Schwester, ist sie zugleich auch deine Schwester. Niemand guckt die Türkin an. Guckst du eine Türkin an, schlage ich dich. Sie ist tabu für mich, also ist sie auch tabu für alle anderen. Als Türke musst du automatisch die Ehre der anderen mitbeschützen. Darum geht es: Stolz und Ehre.
Der Gong ertönt, ich nenne die Namen der drei Propheten Mohammed, Ali und Ömer und bitte sie um ihre Kraft für den Kampf. Die erste Runde ist oft die schwerste. Du musst dich rantasten, willst zeigen, dass du der Boss im Ring bist. Willst Eindruck schinden. Verlierst du die ersten zwei, drei Runden, wird es schwierig, hintenraus noch was zu reißen. Dann musst du auf K.o. gehen. Und das ist reine Glückssache.
Du kommst in die Pubertät und fängst an, dich für Mädchen zu interessieren. Du bringst eine mit nach Hause, und sofort denken die Eltern ans Heiraten. Natürlich wollen sie eine türkische Schwiegertochter, eine Muslima. Alles andere wäre anscheinend eine Katastrophe. Also setzt sich mein Vater, ein sehr lieber und sanfter Mensch, mit uns zwei Jungs hin, und wir führen ein Gespräch.
»Üstün, Ünsal, ich erkläre euch mal was. Ihr kennt doch Murat, meinen Arbeitskollegen. Das ist der, der eine deutsche Frau geheiratet hat. Letztes Jahr habe ich ihn zusammen mit zwei anderen Freunden besucht. Wir kommen da an, setzen uns hin – und wisst ihr, was passiert? Es kommt kein Tee, es kommt kein Kaffee. Er sagt es seiner Frau, da sagt sie: ›Hol’s dir doch, wenn du’s brauchst! Es sind deine Gäste. Ich bin nebenan.‹ Er musste in die Küche. Er.« Papa schüttelt den Kopf. »›Deine Gäste.‹ Eine Türkin würde das niemals sagen! Solche Sachen gehen bei uns nicht. Wenn Gäste da sind, ist es die Aufgabe des Mannes, sie zu empfangen und zu unterhalten, und die Frau bringt Getränke und bereitet das Essen zu. Das ist einfach die Tradition, das ist die Kultur. Aber so ist das mit den Deutschen. Die werden uns Türken nie verstehen. Wenn ihr eine Deutsche nehmt, werdet ihr immer Probleme mit ihr haben. Wie wollt ihr eure Kinder erziehen? Werden sie Muslime oder Christen? Soll euer Sohn Hassan heißen oder Helmut? Nein, bloß keine Deutsche. Heiratet eine Muslima, am besten eine Türkin. Gleiche Kultur, gleicher Glaube. Ihr versteht sie, so wie sie euch versteht.«
Mein Vater ist nicht mal ein besonders strenger Türke. Aber er trichtert uns diese Geschichte noch tausend Mal ein.
Du bist also Teenager und sollst keine Deutsche haben. In deiner Stadt gibt es nur Deutsche und Türken, aber mit einer Türkin ausgehen, Eis essen oder so was – unmöglich. Türkische Mädchen anmachen, mit ihnen flirten – gibt es nicht.
Zu Hause klingelt das Telefon, ich höre Mama laut reden: »Was? Unser Ünsal? Deine Ayşe?« Sie lacht. Dann schreit sie ins Telefon: »Mein Sohn hat genug andere Schlampen, da braucht er deine nicht!« Ich gehe zu ihr hin, sie scheißt mich zusammen: »Was fällt dir ein? Warum machst du die Ayşe von den Yıldırıms an? Du weißt, dass wir die kennen! Was willst du von der?«
Meine Eltern leben zwar nicht ganz so traditionell, dass sie erst zum Kuzizdimek müssen, also bei diesen Yıldırıms in meinem Namen um die Hand ihrer Tochter bitten, bevor ich sie kennenlernen darf. Aber ich will diese Ayşe ja auch gar nicht heiraten. Ich will leben, Spaß haben. Keine Ahnung, ob ich mit dem Mädchen geflirtet habe oder nicht, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wer das überhaupt sein soll. Jetzt ist die Kleine für mich eh kein Thema mehr.
Also gut, suche ich mir ein türkisches Mädchen aus einer Familie, die wir nicht kennen. Sibel. Sie ist 16, so wie ich, und trägt Kopftuch, aber nur, weil ihre Eltern es wollen. Wir treffen uns heimlich. Es ist nicht die große Liebe, aber wir mögen uns. Erst machen wir nur rum, dann wollen wir mehr und haben Sex. Ein paar Mal. Für moderne Türken, zum Beispiel in Istanbul-Bebek, ist Sex vor der Ehe relativ normal. Die sammeln erst Erfahrungen mit verschiedenen Partnern, bevor sie heiraten. Sie amüsieren sich, halten Händchen und knutschen in der Öffentlichkeit.
Aber wir sind eben keine modernen Türken, und wir sind erst recht nicht in Istanbul-Bebek. Parsberg in der Oberpfalz ist mehr wie ein Viertel auf der anatolischen Seite, wo nur Zugezogene aus der Provinz leben. Wie in den aktuellen türkischen Seifenopern, in denen es immer nur um Stolz und Ehre geht. Sex vor der Ehe? Das machen nur Ungläubige! Das gibt es bei uns nicht! Tja, so kann man sich selbst belügen.
Die strenge türkische Tradition kombiniert mit dem islamischen Glauben, das ergibt eine explosive Mischung. Jeder weiß: Im Islam ist Sex vor der Ehe Sünde. Wie viele Ehrenmorde haben in Deutschland schon stattgefunden, weil ein Deutscher eine Türkin nur angemacht hat?
Nach einer Weile erzählt mir Sibel, dass wir uns nicht mehr treffen können, weil sie mit ihrem Cousin verheiratet wird. Sie wusste, dass es so kommt, es ist also keine große Überraschung. Wir sind auch nicht am Boden zerstört deswegen. Da ist nur diese eine Sache. Man kennt die Geschichten von der blutigen Bettwäsche, die man früher nach der Hochzeitsnacht rausgehängt hat, als Beweis, dass die Ehe vollzogen wurde. Dass die Braut Jungfrau war. Das machen heute zwar nur noch die allerletzten Bauern, aber stattdessen kommt garantiert irgendein Bastard aus der Familie an und fragt den Mann direkt: »Hat sie geblutet?«
Diese Idioten verbreiten immer noch das Märchen vom Jungfernhäutchen, das angeblich die Vagina verschließt, bis es beim ersten Sex reißt und die Frau blutet. Und wenn nicht? Aha, dann ist sie keine Jungfrau mehr! Dann hatte sie Sex vor der Ehe, also hat sie gesündigt! Ja, das ist alles Bullshit, aber woher sollen wir Kinder das wissen? Wir wissen nur, was uns erzählt wird. Ich begleite Sibel zu einem türkischen Arzt, der sie wieder »zunäht«, wie man so sagt. Damit sie im richtigen Moment hoffentlich blutet, wenn ihr Cousin sie zum zweiten Mal entjungfert. Dieser beschissene Hirnfick kostet ein paar Hundert Mark.
Ein Jahr später lerne ich Gülay kennen, ein wunderschönes türkisches Mädchen, sehr ehrenvoll, sagen ihre Eltern. Wir sind 17, voller Hormone und verliebt, die Eltern sind bei der Arbeit, und ich bin mit Gülay im Bett. Das geht wochenlang so, eigentlich eine normale Teenager-Lovestory – wenn wir keine Türken wären, wenn wir uns nicht permanent verstecken müssten. Das ist aber nicht der Grund, warum ich sie schließlich verlasse. Mit mir passiert etwas, das ich noch nicht verstehe. Ich liebe Gülay, aber ich suche etwas bei ihr, das sie mir nicht geben kann.
Dann wird es schlimm. Sie will die Trennung nicht akzeptieren, macht mir Vorwürfe, weil ich verliebt war und Sex mit ihr hatte, dabei hat sie mitgemacht, wollte es genauso. Doch sie sagt, ich hätte ihr Leben zerstört, weil sie nun keine Jungfrau mehr ist und ihre Ehre verloren hat.
Zum zweiten Mal begleite ich eine Frau zum Arzt, damit der sie »zunäht«, aber diesmal kommt alles raus. Es folgt tagelanger Telefonterror, bis schließlich sogar Gülays Vater bei uns aufkreuzt und von meinem Vater verlangt, ihn für mich um die Hand seiner Tochter zu bitten. Ich liebe meinen Papa dafür, dass er über so einen Schwachsinn gar nicht erst nachdenkt.
Gülay ist meine erste große Liebe, die Zeit mit ihr bleibt unvergesslich, aber das Ende traumatisiert uns beide. Sie wird mit dem Gefühl leben müssen, Stolz und Ehre verloren zu haben, ein Niemand zu sein, nicht mehr leben zu können. Wie es uns tagaus, tagein eingetrichtert wurde. Ich werde jahrelang keine Türkin mehr anschauen.
Als Nächste date ich ein deutsches Mädchen. Caro. Es ist die große Befreiung. Endlich kann ich mich draußen mit meiner Freundin sehen lassen, auf Partys gehen, alles ist möglich. Nach einer Weile stellt sie mich ihrer Mutter vor. Wir sitzen zusammen im Café, und die Mutter sagt: »Wenn ihr Sex habt, dann bitte mit Kondom.«
Noch nie bin ich so rot geworden. Ich habe mich auch noch nie so geschämt, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Ja, wir haben bestimmt irgendwann Sex, und natürlich benutzen wir dann ein Kondom – aber dass die Mutter mir erst mal sagt, wie ich ihre Tochter ficken soll, das ist eine komplett andere Welt!
Daheim erzähle ich es meiner Mutter: »Mama, die finden es normal, wenn ich Sex mit ihrer Tochter habe.«
Es kommen die üblichen Sätze: »Ich habe es dir immer gesagt. Die Deutschen haben keinen Stolz. Die haben keine Ehre. So sind die halt.«
Mit Caro geht es nicht lange, genau wie mit den Mädchen danach.
Es läuft immer gleich. Sie haben alle dieses gewisse Etwas, das mir irgendwie gefällt, das mich unwiderstehlich anzieht. Bestimmte Charakterzüge. Diese kühle Strenge, wenn sie sauer werden. Dieses blöde Daherreden, dieses Gemecker, wenn ihnen etwas nicht passt, wenn ich zu weit gehe, das liebe ich einfach. Und dann – von einer Minute auf die nächste – wird es mir zu viel. Es nervt mich. Dann suche ich mir was Neues, hinter ihren Rücken. Ich lüge, betrüge, breche Herzen, aber das berührt mich überhaupt nicht. Da bin ich knallhart.
Als ich 20 bin, macht mein bester Freund Erkan mir einen Job in Regensburg klar. Ich verkaufe Markenklamotten in einem angesagten Laden, wo den ganzen Tag Hip-Hop läuft und scharenweise heiße Bräute shoppen gehen. Eines Tages kommen zwei deutsche Frauen rein, eine von ihnen gefällt mir sofort, wir tauschen Blicke, ich spreche sie an, wir unterhalten uns länger als normal. In der nächsten Woche taucht sie allein auf. Als sie wieder geht, hat sie eine neue Hose und ich ihre Nummer.
Ich date Martina vier, fünf Mal, bevor etwas läuft. Irgendwas ist anders als bei meinen Bisherigen. Sie hat zwar auch diese Art, kann sauer werden und mir die kalte Schulter zeigen, aber da ist noch mehr. Sie interessiert sich wirklich für mich. Fühlt mit mir. Bei ihr spielt es keine Rolle, dass sie Deutsche ist und ich Türke. Da sind nur sie und ich, zwei Menschen, die sich verlieben, Zeit miteinander verbringen, Spaß haben. Einfach leben.
Nach ein paar Wochen nehme ich Martina mit zu mir nach Hause. Meine Eltern gucken zwar schief, schon wieder eine Deutsche, aber sie sind nett zu ihr. Sonst habe ich mich mit den Mädchen immer möglichst schnell wieder verdrückt – nicht mit Martina. Sie geht von Anfang an auf meine Eltern zu, interessiert sich für alles. Mein Vater erklärt es ihr geduldig mit seinem Kanakendeutsch. Martina darf zu meiner Mutter in die Küche, darf in ihre Töpfe gucken, die beiden reden mit Händen und Füßen, bringen sich gegenseitig Wörter bei, sie lachen sogar! Es ist phänomenal, das gab es noch nie. Was ist aus den Vorurteilen gegenüber deutschen Frauen geworden?
Abends wird es spät. Martina will sich verabschieden.
»Wohin musst du?«, will Papa von ihr wissen.
»Nach Bad Abbach, bei Regensburg.«
»Bad Abbach«, sagt Papa nachdenklich. Er kennt die Gegend gut. »Das sind fast 50 Kilometer, und es ist nach elf. Warum übernachtest du nicht hier? Nicht dass am Ende was passiert.«
Natürlich widerspreche ich nicht. Martina guckt mich an, und ich sage nur so was wie: »Ja, sicher ist sicher.« Papa ist schon klar, dass wir oben Sex haben werden, oder?
Nicht lange danach lädt Martina mich zu sich nach Hause ein. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ich die Familie einer deutschen Freundin zu Hause besuche. Ich sehe mir alles ganz genau an, die Möbel, die Fotos an der Wand – einige zeigen Martinas verstorbenen Vater –, die Gardinen, das Kaffeegeschirr. Ihre Mutter hat nie viel mit Türken zu tun gehabt. Sie stellt mir die typischen Alman-Fragen: »Wie heißt du? Wo arbeitest du? Was macht dein Vater beruflich?«
Was bei mir ankommt: Aber dein Vater liegt nicht dem Staat auf der Tasche, ne? Früher wäre ich halb ausgerastet, hätte mich einer wegen meiner Eltern so ins Kreuzverhör genommen. Aber wenn du verliebt bist, nimmst du so was locker und beantwortest alles brav.
Sie fragt: »Und? Gefällt’s dir bei uns in Deutschland?«
Darüber muss ich sogar lachen. Martinas Mutter schämt sich in Grund und Boden und entschuldigt sich tausendmal, als ich ihr erkläre, dass ich hier geboren wurde und dass mir Deutschland teilweise schon irgendwie ganz gut gefällt. Besonders seit Martina mich glücklich macht.
Unsere Beziehung läuft gut. Auch weil ich ein türkischer Mann bin und sie eine deutsche Frau. Was, wenn es umgekehrt wäre? Ein deutscher Schwiegersohn würde von einer türkischen Familie allerhöchstens dann akzeptiert, wenn er zum Islam konvertiert, sich beschneiden lässt, den Ramadan mitmacht, zum Freitagsgebet geht und so weiter. Er muss komplett türkisch leben, darf nicht bleiben, wie er ist. Oder es läuft so wie bei meinem Fußballkollegen Thorsten. Eine vielleicht 17-jährige Türkin aus Nürnberg verliebt sich in ihn. Natürlich ist ihre Familie strikt dagegen. Das Mädchen geht aufs Ganze und zieht zu dem Jungen nach Parsberg. Von da an haben die beiden keinen Frieden mehr. Einmal bin ich live dabei, wie die Parsberger Türken auf offener Straße auf die Frau losgehen: »Du dreckige Deutschenhure, sind deutsche Schwänze vielleicht besser?« Solche Sprüche. Um selber mitzumischen, bin ich noch zu jung, aber als Teenager finde ich es richtig so. Die hat keinen Stolz und keine Ehre mehr, also verdient sie es. Im Prinzip verdient Thorsten es auch. Er hat sie nicht anzufassen. Aber als die Parsberger Türken ihn aufs Extremste bedrohen und ihm richtig Psychoterror machen, tut er mir doch leid. Die beiden lieben sich, und man kann die Liebe nicht verhindern. Vielleicht schweißt der Druck sie sogar noch stärker zusammen. Sie geben nicht auf, ziehen es durch und heiraten. Am Ende muss es auch ihre Familie hinnehmen. Die verstoßen sie, betrachten sie als entehrt, aber sie haben verloren. Thorsten und seine Frau sind bis heute glücklich verheiratet und haben Kinder. Sie haben bewiesen, dass es funktionieren kann. Die erste Generation ist jetzt lange genug in Deutschland, um einzusehen, dass solche Beziehungen einfach ganz normal sind.
Früher, als wir noch Kinder waren, musste jede deutsche Frau zum Islam konvertieren, wenn sie in Deutschland in eine türkische Familie einheiraten wollte. Nicht beim Standesamt, sondern vor einem Imam, vor Allah. Sie musste Kopftuch tragen und die Gäste bedienen. Sie wurde um 180 Grad gedreht, bis sie so geformt war, wie es die Familie wollte. Bis von der Frau, in die der Mann sich verliebt hatte, kaum noch etwas übrig war. Was für eine Liebe soll das sein?
Jetzt sind wir erwachsen, und das Blatt hat sich gewendet. Mein Vater sagt: »Ich muss lieben, was ihr liebt. Ihr seid meine Kinder, und es ist euer Leben, eure Entscheidung.« Ich glaube, so sehen es mittlerweile alle, abgesehen von den letzten konservativen Dummköpfen, die immer noch den Ehrenmord fordern. Die meisten nehmen es hin, bevor man groß Ärger macht und sein Kind vielleicht ganz verliert. Man lästert auch nicht mehr über Familien, in die Deutsche eingeheiratet haben. In Parsberg gibt es sicher fünf oder sechs türkische Familien mit deutschen Schwiegersöhnen oder Schwiegertöchtern. Sogar bei denen, die damals Thorsten und seine Frau bedroht haben. Im Laufe der Jahre haben sie aus ihren Erfahrungen gelernt. Innerlich wurmt es einige natürlich, aber auch die wollen ihre Kinder glücklich sehen.
Meine Eltern lieben meine deutsche Freundin wie ihre eigene Tochter. Papa fragt regelmäßig, wann Martina mal wieder zum Essen kommt. Mama lernt Deutsch, um sich mit ihr unterhalten zu können. Irgendwann höre ich die sensationelle Frage: »Die Martina ist ein super Mädel, warum heiratest du sie nicht? Die ist sauber, ordentlich, die respektiert unsere Kultur, die passt zu uns, heirate sie doch!« Diese Sätze von früher – »Die Deutschen haben keine Ehre, keinen Stolz!« – höre ich gar nicht mehr. Stattdessen bringt meine Mutter Martina ein Geschenk aus der Türkei mit: das vergoldete Auge der Fatima als Anhänger, der sie beschützen soll.
Aber vor dem, was ich Martina antue, kann sie nichts und niemand beschützen. Ich kann das Flirten nicht lassen, feste Freundin hin oder her. Sie ist zu Recht eifersüchtig. Wenn wir streiten, dann deswegen. Und wenn meine Eltern es mitbekommen, halten sie zu ihr. Die Frau ist die Nummer eins, und ich bin das Arschloch, das ich bin. Obwohl ich Martina liebe, betrüge ich sie schließlich doch, wie ich es bei allen Frauen mache. Die andere kann ihr nicht das Wasser reichen, trotzdem werde ich schwach.
Im Haus meiner Eltern in Parsberg beichte ich Martina den Seitensprung. Sie macht mir eine Szene, und es passiert, was mir immer passiert. Was mich sonst so an ihr anzieht, stößt mich jetzt ab, es wird mir zu viel, und ich werde laut: »Halt die Fresse, jetzt reicht’s endlich!«
Sofort kommt mein Vater hoch, er scheißt mich zusammen wie früher. »Schreist du sie noch einmal an, dann fliegst du raus!«
Egal was ich bisher angestellt habe – das hat er mir noch nie angedroht. Ich sehe meinen Fehler ein, bitte Martina um Entschuldigung, ziehe alle Register. Am Ende verzeiht sie mir, und wir bleiben noch mal ein Jahr zusammen.
Dann baue ich denselben Mist wieder. Nach fünf Jahren Beziehung macht sie endgültig Schluss, und ich bin am Boden. Habe alles zerstört. Warum? Wird das immer so weitergehen? Werde ich ständig nach etwas Neuem suchen? Was läuft falsch bei mir?
Ich sitze mit Mama am Küchentisch in meiner Regensburger Singlewohnung in der Schattenhofergasse. Sie hat gleich Linsensuppe für die ganze Woche gekocht, wie früher, als ich noch in Parsberg gewohnt habe. Als könnte ich nicht selbst für mich sorgen, jetzt, wo Martina mich verlassen hat. Meine Eltern haben alles Mögliche versucht, Papa hat sogar bei ihr zu Hause angerufen, um sie vielleicht doch noch umzustimmen, damit wir wieder zusammenkommen. Mama liegt mir in den Ohren deswegen, schimpft mich aus, macht mich runter: »Was denkst du dir?! Wie kannst du das versauen?«
Es tut weh, gleichzeitig genieße ich es. In diesem Moment ist sie zu 100 Prozent bei mir. Um sie zu besänftigen, esse ich noch einen Teller Suppe, obwohl ich satt bin. Ich sollte aufpassen. Seit ich nicht mehr Fußball spiele, werde ich langsam fett.
Du hast vergessen, was du dir vorgenommen hast. Falls du dir etwas vorgenommen hast. Er gibt dir einen weichen Jab, schaut, wie weit du ihn heranlässt. Dann schlägt er hart, will dich testen.
Dein erster Schlag. In die Luft.
Er ist schnell, ahnt deine Angriffe, bevor sie kommen. Holt aus, trifft. Dieser erste Schlag von ihm bleibt in deinem Kopf, schüchtert dich ein. Er darf nicht sehen, dass du beeindruckt bist.
Du führst Selbstgespräche: Ich muss punkten, brauche einen Treffer. Du schlägst zu, er blockt dich, als könnte er voraussehen, was du tust. Als könnte er deine Angst riechen.
Oktober 2011. Vor nur einem Monat, einen Schritt vom Abgrund entfernt, habe ich in einer Moschee in Ghana den Weg hierher eingeschlagen – zum Titelkampf um den GBA-Gürtel. Ich boxe zu Hause in Regensburg, ohne Reisestress, ohne Hotelkosten, bin Lokalmatador und motivierter als je zuvor, die Sache mit dem Profiboxen durchzuziehen. Eurosport überträgt live. Zum ersten Mal ist meine Mutter bei einem Kampf dabei. Sie spricht kaum Deutsch und kennt hier keinen Schwanz, aber läuft rum wie die Queen und hockt sich gleich in die erste Reihe auf einen VIP-Platz. Ich will ihr den Sieg schenken, will ein deutscher Meister mit türkischem Namen sein.
Wir reden kurz. »Mama«, sage ich, »ich hab Schiss zu verlieren.«
»Was, verlieren?« Sie lacht. »Als hättest du noch nie eine Schlägerei gehabt!«
Ein Boxkampf ist keine Schlägerei, aber so sieht sie es.
Die erste Runde boxe ich sehr nervös. Es ist ein Abtasten, viel passiert nicht. In die zweite starte ich dank Juri besser. Er hat einen Schwachpunkt gefunden, ein-, zweimal trifft mein Leberhaken, im Publikum wird es laut. Sie feiern, rufen meinen Namen. Mein Gegner geht auf Abstand. Vielleicht sitzen da draußen sein Vater, seine Mutter oder seine Frau, spüren jeden meiner Schläge. Mein Papa weiß, wie das ist, er könnte es nicht ertragen, darum ist er gar nicht erst mitgekommen. Mein Gegner greift an, ich fange mir auch eine. Wir schenken uns nichts.
Anfang der dritten Runde fällt mein Blick auf meine wütende Mutter. Sie ist mit Fleisch und Blut dabei, als würde sie gleich mit ihrer Handtasche auf den Typen losgehen, der da ihrem Sohn wehtut. Ich höre sie lautstark schimpfen. Dieses Draufgängertum, diese Unbeugsamkeit, diese eiserne Härte hat sie mir vererbt, genau für diesen einen Moment.
Ein paar feuern mich an, ich höre Mamas Stimme: »Jetzt schlag zu! Schlag richtig zu!«
Der Gedanke an sie pusht mich radikal hoch, weckt meinen Instinkt. Ihr Blut rauscht durch meine Adern, ich fühle ihre Kraft und ihren unbeugsamen Willen. Ich blocke und setze die erste Rechte. Diese Faust ist meine Waffe Nummer eins. Auf sie ist Verlass, sie schlägt zu, wie sie es mein ganzes Leben lang getan hat. Ich funktioniere nur noch. Bin wie losgelöst. Alles, was ich denke, ist: Ganz oder gar nicht. Kein Mitleid. Kein Erbarmen. Er oder ich.
In der dritten Runde siege ich durch technischen K.o., werde mit nur sechs Profikämpfen deutscher GBA-Meister. In der Boxwelt kein großer Titel, aber für mich der Durchbruch, mit über 30 Jahren. Vorher war ich im Sport ein Niemand, ein Türke ohne Schulabschluss, Ex-Fußballer, Ex-Amateurboxer. Bald werden sie mich für die Wahl zum Regensburger Sportler des Jahres nominieren.
Mein Sieg beschert mir sehr gemischte Gefühle. Ich bekomme meinen ersten Gürtel, aber ich verliere meinen Trainer. Juri Steiner verabschiedet sich nach dem Kampf. Ihn zu verlieren, ist wie eine Niederlage. Ich liebe ihn sehr, er ist wie ein Bruder für mich, ein toller Mensch, dem ich viel verdanke. Einen Trainer wie ihn werde ich nie wieder finden.