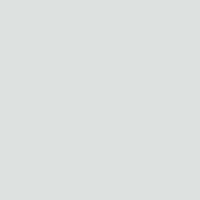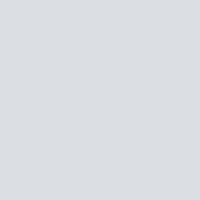15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
»Wir sind, was wir vergessen haben.« Erst verlegte sie ihre Brille, dann vergaß sie ein paar PIN-Nummern, schließlich fand Jörn Klares Mutter ihre Küche nicht mehr. Am Ende stand die Diagnose Demenz. Die Besuche im Heim werfen Fragen auf: Sind Erlebnisse nur dann etwas wert, wenn wir uns daran erinnern? Kann man seine Würde oder gar »sich selbst« verlieren? Und liegt in den Begegnungen im Hier und Jetzt nicht auch ein Trost? Bereits heute leben in Deutschland 1,3 Millionen Menschen, die von Demenz betroffen sind, 2050 werden es doppelt so viele sein. Jenseits der Klischees von grauen Heimen und überfordertem Personal sucht Jörn Klare nach anderen, weniger bedrückenden Sichtweisen auf diese immense gesellschaftliche Herausforderung. Ausgehend von den bewegenden Besuchen bei seiner Mutter, macht er sich auf den Weg zu Experten und Praktikern, zu Ärzten und Juristen, Philosophen und Altenpflegern. Mit ihnen spricht er über das Leben, den Tod und das, was dazwischen liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Ähnliche
Erst verlegte sie ihre Brille, dann vergaß sie ein paar PIN-Nummern, schließlich fand Jörn Klares Mutter ihre Küche nicht mehr. Am Ende stand die Diagnose Demenz. Die Besuche bei der Mutter werfen Fragen auf: Sind Erlebnisse nur dann etwas wert, wenn wir uns daran erinnern? Kann man seine Würde oder gar »sich selbst« verlieren? Und liegt in den Begegnungen im Hier und Jetzt nicht auch ein Trost?
Bereits heute leben in Deutschland über eine Million Menschen, die von Demenz betroffen sind, 2050 werden es mehr als doppelt so viele sein. Jenseits der Klischees von grauen Heimen und überfordertem Personal sucht Jörn Klare nach anderen, weniger bedrückenden Sichtweisen auf diese immense gesellschaftliche Herausforderung. Ausgehend von den bewegenden Besuchen bei seiner Mutter, macht er sich auf den Weg zu Experten und Praktikern, zu Ärzten und Juristen, Philosophen und Altenpflegern. Mit ihnen spricht er über das Leben, den Tod und das, was dazwischen liegt.
Jörn Klare, geboren 1965, schreibt Reportagen und Features, unter anderem für den Deutschlandfunk und Die Zeit. 2008 und 2012 wurde er mit dem Robert-Geisendörfer-Preis der EKD ausgezeichnet. Im Suhrkamp Verlag erschien zuletzt sein viel diskutiertes Buch Was bin ich wert? Eine Preisermittlung (st 4262).
Jörn Klare
Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand
Vom Wert des Lebens mit Demenz
Suhrkamp
Umschlagfoto: Ian Logan/Getty Images
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Büro Überland, Schober & Höntzsch
eISBN 978-3-518-78660-4
www.suhrkamp.de
Für Jan und Mago
Inhalt
Was dazwischenliegt
Erinnerungen I
Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand
Erinnerungen II
Das Urteil
»Jeder Fall ist anders.« –Der Psychiater Hans-Georg Nehen
Erinnerungen III
Ein böser Traum
»Nichts haben wir im Griff.« –Der Alternswissenschaftler Andreas Kruse
Erinnerungen IV
Dünnes Eis
»Wir brauchen eine offene Debatte.« –Der Pflegewissenschaftler Hartmut Remmers
Erinnerungen V
Meine Mutter will nicht zur Tour de France
»Dem Tod bei der Arbeit zusehen« –Der Psychiater Hans Lauter
Erinnerungen VI
Sie weiß nicht, wer ich bin
»Alle werden dement«, und was man vielleicht dagegen tun kann –Der Psychiater Hans Förstl
Erinnerungen VII
Ärger im Heim
»Glückliche Menschen mit Demenz« –Der Sozialarbeiter Markus Kübler
Erinnerungen VIII
Wird alles, was wahrgenommen worden ist, umsonst wahrgenommen worden sein?
»Wir sind, was wir erinnern.« –Der Psychologe Rüdiger Pohl
Erinnerungen IX
Sie will nicht meckern
»Lernen, abhängig zu sein« –Der Theologe und Altenpfleger Christian Müller-Hergel
Erinnerungen X
Hat meine Mutter sich verloren?
»Wir sind die Geschichten, die wir über uns zu erzählen vermögen.« –Der Soziologe Heinz Abels
Erinnerungen XI
Ein glücklicher Tag
»Wir sind, was wir vergessen haben.« Oder: Die Frage nach der Würde der Menschen mit Demenz –Der Philosoph und Psychiater Thomas Fuchs
Erinnerungen XII
Alltage
»Kein Schirm für alle« – Der Philosoph Michael Quante
Erinnerungen XIII
Meine Mutter klatscht nicht mehr
Über Ökonomie und die »Würde im Dunkeln« –Der Jurist Bernd von Maydell
Erinnerungen XIV
Ich wünsche mir ein Würdometer
Erinnerungen XV
Das Leben schaffen
»Sinn bedeutet, in ›Beziehung treten‹.« –Die Alternswissenschaftlerin Marion Bär
Erinnerungen XVI
Weihnachten
Erinnerungen XVII
Alles ist jetzt
Erinnerungen XVIII
Dank
Literatur
Es kommen härtere Tage.
Die auf Abruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.
Ingeborg Bachmann
Kein Gestern haben und kein Morgen.
Die Zeit vergessen,
dem Leben verzeihen,
in Frieden sein.
Oscar Wilde
Was dazwischenliegt
Im Fernseher läuft ein Spiel der Fußballweltmeisterschaft der Frauen. Nachdem meine Mutter das fünfzehn Minuten lang angestarrt hat, sagt sie: »Männer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.«
Meine Mutter ist fünfundsiebzig Jahre alt und befindet sich im Stadium einer fortgeschrittenen Demenz. Das ist traurig, bitter und beängstigend. Es ist allerdings nicht nur traurig, bitter und beängstigend. Immer wieder gibt es berührende, überraschende und auch erhellende Momente. Manchmal sind sie auch schlichtweg komisch. Ich lerne viel von meiner Mutter, und die Besuche im Altenheim sind zwar manchmal schwierig, ganz bestimmt aber sind sie eher schön als schrecklich.
Am Anfang war das etwas anders. Für meine Mutter, für unsere Familie und für mich. Die Demenz hat uns auf einen Weg gezwungen, dessen Ende zum Glück noch nicht erreicht ist. Ein Weg, der viele Fragen aufwirft, von denen ich einige gerne noch länger verdrängt hätte. Fragen nach der Bedeutung des Gedächtnisses, der Identität und den möglichen Verlusten, Fragen nach der Würde eines Menschen mit Demenz, Fragen nach Leben und Tod und dem, was dazwischenliegt.
Wo es möglich war, habe ich Rat bei Fachleuten und Experten gesucht. Einige Antworten blieben offen, einige habe ich selbst gefunden, einige werden unweigerlich noch kommen.
Um diesen Weg, um diese Fragen und auch um den Wert eines Lebens mit Demenz geht es in diesem Buch. Und natürlich geht es um meine Mutter.
Erinnerungen I
»Welche Erinnerungen hast du noch an deine Großeltern?«
»Großeltern … ich bin im Hause meiner Großeltern aufgewachsen. Ich bin da sogar geboren, am zweiten Ostertag 1936. Ich bin eine Hausgeburt.«
Sie lacht.
»Ich konnte mir gar nicht vorstellen, nur mit meinen Eltern zusammen zu sein. Ich war einmal unten, einmal oben.«
Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Berlin. An der Wand vor mir hängen Fotos aus meinem Leben. Auch wenn ich die Bilder von der Familie, von Freunden und Reisen nur selten bewusst wahrnehme, fühlt es sich gut an, sie in meiner Nähe zu haben. Mit jedem Foto sind Erinnerungen verbunden, die mir lieb und wichtig sind. Erinnerungen, die mich ausmachen. In diesem Zimmer fühle ich mich zu Hause.
»Was heißt ›unten‹, was heißt ›oben‹?«
»Unten in der Mauerstraße wohnten wir. Oben wohnten meine Großeltern.«
Ich höre mir eine Tonaufnahme aus dem Herbst 2002 an. Wort für Wort schreibe ich auf, was damals gesagt wurde.
»Die Mauerstraße?«
»Die Mauerstraße 5 in Hohenlimburg. Das ist das Haus, in dem ich geboren bin, in dem ich bis zu meiner Heirat gelebt und gewohnt habe. Das Haus meiner Großeltern. Wir hatten da eine Wohnung, meine Großeltern hatten eine … und dann waren noch drei Wohnungen vermietet.«
Die Stimme meiner Mutter. Ich bin es, der die Fragen stellt. Hin und wieder hört man im Hintergrund ein drei Monate altes Baby brabbeln, quäken oder schreien. Das ist meine Tochter Mascha. Wenn sie schreit, macht meine Mutter eine Pause und kümmert sich um ihre Enkelin. Diese Aufnahme ist für Mascha, ein Geschenk für später, für den Fall, dass Mascha sich irgendwann fragt, was vor ihr war. So wie ich selbst gerne einmal die Stimme meines Großvaters gehört hätte, der zwanzig Jahre vor meiner Geburt im Zweiten Weltkrieg verschwand und nie wieder auftauchte.
Maschas drei andere Großeltern haben solche Gespräche bereits hinter sich. Jetzt geht es um die Erinnerungen meiner Mutter. Ich protokolliere weiter.
»Wie kamen deine Großeltern zu dem Haus?«
»Die hatten sich das vom Munde abgespart, wie das früher so üblich war. Mein Großvater war Drahtzieher. Da wurde immer erzählt, ›sonntags gab es einen Stuten‹. Das war ein Weißbrot, der kostete fünfzig Pfennig. Aber den gab es nur sonntags, das war das Besondere. Dann hatten wir selber Hühner und Kaninchen. Die wurden Weihnachten und Ostern geschlachtet. Und wenn man Glück hatte, gab es vielleicht auch zwischendurch mal ein Suppenhuhn. Das war alles ziemlich bescheiden.«
Mascha brabbelt. Meine Mutter macht eine kurze Pause.
»Und dann kann ich mich noch gut erinnern, wie wir mit der Hausgemeinschaft ›Mauerstraße 5‹ Weihnachten feierten. »Erst feierten die Familien bei uns im Haus für sich mit ihren Kindern den Heiligen Abend. Dann ging man von einer Wohnung zur anderen. Und das nannten die ›Bäume prämieren‹.«
Sie kichert.
»Wer hat den schönsten Weihnachtsbaum? Jeder gab eine Flasche Bier aus. Die Frauen tranken höchstens mal einen selbst aufgesetzten Johannisbeerlikör oder selbst gemachten Eierlikör. Da musste ich immer Weingeist aus der Apotheke holen, und dann gab es Weihnachten immer die gute Bärenmarke dazu.«
Mascha brabbelt.
»Als dann die Bäume prämiert wurden, hatten die Männer alle ziemlich einen im Schoß. Das war der Heilige Abend in der Mauerstraße. Eine Zeremonie, die sich immer wiederholt hat. Für mich als Kind war das eine wunderbare Sache, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann.«
Ihre Stimme klingt fröhlich und ein wenig aufgekratzt. Erinnerte Geschichten und erlebte Geschichte aus über siebzig Jahren. Keine spektakulären Abenteuer, sondern Kindheit, Jugend, Arbeit, Heirat, Kinder, eine Trennung nach fast vierzig Jahren Ehe, der Versuch, etwas Neues zu beginnen …
Meine Mutter erzählt gern. Sie freut sich über das Interesse an ihrem Leben, ihren Erinnerungen. Damals ahnte ich noch nicht, was mir diese Aufnahme später bedeuten würde. Dieses »Später« ist jetzt.
Als meine Mutter ihre Küche nicht mehr fand
Ein paar verpasste Termine, Wochentage, die verwechselt wurden, vergessene PIN-Nummern, eine verlegte Handtasche, im Kühlschrank immer häufiger Lebensmittel mit längst abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, das Brillenetui, das regelmäßig tagelang und irgendwann für immer verschwand. So fing es an. Das war vor gut drei Jahren.
Meine Mutter, die damals zweiundsiebzig Jahre alt war und mit ihrem Lebensgefährten Egon in Essen lebte, reagierte zunehmend irritiert, verunsichert und manchmal fast panisch. Ich reagierte genervt. Auch ich habe schon mal Termine vergessen, Dinge verlegt oder verloren. PIN-Nummern kann ich mir sowieso nicht merken. Und ich hatte zu jener Zeit, wie eigentlich immer, genug zu tun mit meiner Arbeit, meiner eigenen Familie, meinem Leben in Berlin. Selbst wenn ich versuchte, geduldig zu sein oder zumindest so zu wirken, ärgerte es mich, dass ich mich mit solchen Problemen meiner Mutter beschäftigen musste.
War ein wenig Vergesslichkeit nicht völlig normal in ihrem Alter? Konnte sie sich die Dinge nicht einfach aufschreiben? War es tatsächlich nötig, mich damit behelligen? Erst viel später wurde mir klar, dass meine Mutter gespürt haben muss, dass dies der schleichende Anfang von etwas Neuem war, und dass sie bei meinem Bruder und mir Halt und Orientierung suchte.
Hin und wieder rief Egon mich an, bat darum, meiner Mutter am Telefon zu erklären, dass das komfortable Einfamilienhaus direkt am Essener Grugapark, in dem die beiden seit mehr als zehn Jahren lebten, ihr Zuhause sei. Meine Mutter wollte auch mir das kaum glauben. Sie wirkte verzweifelt darüber, dass selbst ihr Sohn sie nicht verstand. Manchmal rief sie mich auch aus diesem Haus an und erzählte, dass sie sich in einem Hotel befinde, dass dort viele fremde Leute seien, dass es ihr aber gut gehe.
Es kam vor, dass ich über solche »komischen Geschichten« lachen musste. Ich wollte das Problem verdrängen, was mir, im Nachhinein betrachtet, überraschend gut gelang. Doch vage, denke ich jetzt, muss ich den Schrecken, der da auf meine Mutter und auch auf mich zukam, schon geahnt haben.
Dann fand sich meine Mutter außerhalb des Hauses nicht mehr zurecht, verlief sich auf dem vertrauten Weg zum nur wenige hundert Meter entfernten Lebensmittelgeschäft. So erzählte es mir Egon. Er selbst war über achtzig Jahre alt, schwer herzkrank und auf meine Mutter angewiesen. Die hatte sich in den letzten beiden Jahren zunehmend mit der Frage beschäftigt, wo und wie sie nach seinem Tod, der immer wieder befürchtet werden musste, leben würde.
Indem sie sich nach vierzig Jahren von meinem Vater trennte, hatte sie ein neues Leben gewonnen, aber auch eine konkrete Heimat verloren, die durch den überschaubaren Rahmen im kleinen Hohenlimburg geprägt war. Ohne Partner dorthin zurückzukehren, konnte sie sich nicht vorstellen. Berlin war ihr, trotz der Liebe zu ihren Enkelinnen, fremd. Zu der Stadt Münster fehlte ihr, abgesehen von der Bindung zu meinem dort lebenden, vielbeschäftigten Bruder, der Bezug, und ob die über Egon geknüpften sozialen Beziehungen in Essen auch ohne ihn tragfähig sein würden, war unklar. Abgesehen davon war auch ihre finanzielle Situation nicht ganz geklärt. Obwohl mein vier Jahre älterer Bruder und ich zusicherten, sie zu unterstützen, machte sich meine zweiundsiebzigjährige Mutter offensichtlich große Sorgen um ihre Zukunft.
Nachdem sie sich ein paarmal verlaufen hatte, verließ sie das Haus immer seltener und irgendwann gar nicht mehr allein. Die Einkäufe übernahm die Haushaltshilfe. Das Mittagessen wurde fertig angeliefert.
Als ich sie, derart vorgewarnt, im Herbst 2009 wieder einmal besuchte, hatte ich mich mit meinem Bruder darüber verständigt, dass »das Problem ihrer Verwirrungen« gründlich medizinisch geklärt werden müsse. Bis dahin war meine Mutter das nur sehr zögerlich und unentschieden angegangen. Ab und an hatte sie sich irgendwelche Tabletten verschreiben lassen, ohne sich jedoch um eine gründliche Diagnose zu bemühen. Sie hatte Angst. Das war unverkennbar. Die ganze Familie hatte Angst vor der Wahrheit. Wir wollten uns nicht eingestehen, was nicht mehr zu übersehen war.
Bei diesem Abendessen am 19. Oktober 2009 musste ich mich dem Drama meiner Mutter stellen. Sie hatte schon den ganzen Nachmittag nervös und unruhig gewirkt, was wir – Egon, meine Mutter, meine damals siebenjährige Tochter Mascha und ich – mehr oder minder erfolgreich überspielten. Nach dem Essen, das meine Mutter selbst zubereitet hatte, nahm sie ein paar Teller, stand auf, ging ein paar Schritte … und war verloren.
Sie wusste nicht weiter, wusste nicht, wo sie hin sollte. Meine Mutter fand die fünf Meter und zwei Türen entfernte Küche nicht mehr. Ein Weg, den sie in den letzten Jahren Tausende Male gegangen war. Sie stand mitten im Zimmer, und vor ihr und vor uns allen öffnete sich ein Abgrund. Ich war fassungslos. Eine gefühlte Ewigkeit. Dann ging ich zu ihr, nahm ihr das Geschirr aus der Hand und zeigte ihr den Weg. Schweigend räumten wir die Küche gemeinsam auf.
In der Nacht schreckte meine Mutter mehrmals auf, irrte orientierungslos und um Hilfe rufend durch das Haus. Immer wieder brachte ich sie zurück ins Bett, setzte mich neben sie, sprach auf sie ein, versuchte, sie zu beruhigen. Egon kam dazu, auch Mascha. Es war für uns alle wie ein bedrückender Albtraum. In seinem Zentrum meine Mutter.
Ein Gutes hatte diese Nacht dann doch. Es war nun für alle offensichtlich, dass meine Mutter Hilfe brauchte. Dringend. Der Bann aus Schweigen, Stolz und Bequemlichkeit war gebrochen. Später wurde mir im Gespräch mit Egon klar, dass sich meine Mutter bislang wohl noch irgendwie mühsam zusammengerissen hatte, bis jemand kam, bei dem sie sich fallen lassen konnte. Es schien, als hätte sie auf mich gewartet, um diese Hilfe von mir einzufordern.
Spätestens nach der zweiten Nacht war ich damit überfordert. Ich sprach mit Egon, telefonierte mit meinem Bruder, meiner Schwiegermutter, einer pensionierten Ärztin, und auch mit meinem Vater, von dem sich meine Mutter zehn Jahre zuvor getrennt hatte. Ich brachte meine Mutter in die Memory-Clinic des Essener Elisabeth-Krankenhauses, erklärte das Problem einem jungen Arzt und offenbarte meine Hilflosigkeit. Er verstand die Situation, weil sie ihm vertraut war. Er schlug vor, meine Mutter für eine umfassende Diagnose eine Woche lang aufzunehmen.
Nachdem ich mich mit meinem Bruder besprochen und zugestimmt hatte, musste der Arzt mich gleich auch noch trösten. Meiner Mutter gegenüber hatte ich das Gefühl, sie ab- und auszuliefern. Sie sollte in einem Mehrbettzimmer schlafen, wirkte verstört und flehte mich an, sie nicht allein zurückzulassen. Der Abschied war schrecklich. Und doch war ich auch erleichtert.
Die nächste Nacht konnte ich wieder nicht schlafen. Dabei ging es nicht nur um meine Mutter, sondern auch um mich, mein Leben, meine Frau und meine Töchter. Wir hatten langfristig eine Reise auf die Kanaren geplant. Einen Tag nachdem ich meine Mutter in die Klinik gebracht hatte, wollten wir losfliegen. Ich sagte meiner Frau, dass ich nicht mitreisen könne. Sie verstand das, und doch spürte ich, dass sie darüber traurig war. Mein Bruder riet mir zu fliegen, er sei vor Ort und könne sich um alles kümmern. Ich spürte, dass es eine Art Grundsatzfrage war zwischen den Gefühlen für und der Loyalität gegenüber meiner Mutter auf der einen Seite und meiner eigenen Familie, meinem eigenen Leben auf der anderen. Ich war hin- und hergerissen. Am frühen Morgen entschied ich mich zu reisen und schaffte es gerade noch zum Flughafen.
Erinnerungen II
»Was hast du von der Politik in der Zeit mitgekriegt?«
»Ich weiß, dass da immer … Das ist mir erst vor einiger Zeit eingefallen, dass ich immer im Ohr hatte ›Germany Calling. Germany Calling‹. Das war der Rundfunksender, den man nicht hören durfte. ›Radio London‹ oder so. Wir konnten doch kein Englisch. Ich war ja im Krieg noch ein Kind. Das durfte man aber nicht hören. Meine Mutter war mutig und hat das immer angemacht. Das dauerte immer, bis der Sender eingestellt war, und dann lauschten wir. Die sprachen natürlich Deutsch: ›Ihr werdet den Krieg verlieren! Ihr müsst aufgeben!‹ Und so weiter.«
Mascha brabbelt ein bisschen verärgert. Meine Mutter wiegt sie.
»Och, och, Mäuschen.«
Nach einer kleinen Pause.
»Ich war da ja erst acht oder neun Jahre, aber eigentlich habe ich viel mehr mitgekriegt, als die glaubten. Auch dass meine Mutter immer sagte: ›Den Krieg, den werden wir verlieren.‹ Dann sagten die immer alle: ›Sei still, sei still! Das darfst du doch nicht laut sagen!‹ Einmal gab es da bei uns auch einen großer Tumult. Papa hatte im besoffenen Kopf was über Hitler gesagt, und da hat ihm einer gedroht. Und da hatten die alle ganz große Angst. Ich weiß auch jetzt noch, wie der hieß, der ihm gedroht hat.«
»Wie hat der gedroht?«
»Ja, so: ›Besoffener Mund spricht Herzensgrund. Du bist gegen den Führer!‹ Das ist dann aber noch mal gut gegangen. Entweder haben die den be… das weiß ich nicht. Oder die haben den überredet, das nicht anzuzeigen. Oder er hat von sich aus gedacht, das ist eine Lappalie.«
»Was hätte da passieren können?«
»Ja, da wurde gesagt: ›Da kommst du ins KZ!‹ Ich weiß nicht, ob du dafür schon ins KZ kamst, wenn du so zersetzende Sachen sagtest. Vielleicht.«
»Wann war das?«
»Das war vielleicht 43 oder 44. Ich war ja, 45, als der Krieg ausging, neun Jahre alt.«
Das Urteil
In den Aufzeichnungen der Memory-Clinic, in der meine Mutter untersucht wurde, ist von einer »ängstlichen Patientin« die Rede, die »orientierungslos« sei, die »Pflegekraft für ihre Schwiegertochter hält«, sich »bevormundet« fühle, mit »dem Feuermelder redet«, »viel Chaos« anrichte und die Behandlung einer Mitpatientin untersage, weil »dies ihr Mann sei«. Das Protokoll eines weiteren Albtraums.
Weiterhin finde ich in den Unterlagen eine schlecht gezeichnete Uhr. Der »Uhrentest«, bei dem eine Uhr mit allen nötigen Zahlen und Zeigern gezeichnet werden soll, ist ein klassisches Instrument bei der Demenzdiagnose.
Genau wie der Mini-Mental-Status-Test. Dabei werden zuerst die aktuelle Zeit und der aktuelle Ort abgefragt. Der Patient lernt drei Begriffe wie zum Beispiel »Auto«, »Blume« und »Kerze« auswendig, bevor er ein paar Rechenaufgaben löst oder ein Wort wie »Radio« rückwärts buchstabiert, um anschließend wieder die drei gelernten Begriffe zu erinnern. Schließlich sind noch ein paar relativ leichte sprachliche Aufgaben zu lösen, bevor am Ende eine einfache geometrische Zeichnung kopiert werden muss. Für jede gelöste Einzelaufgabe gibt es Punkte, die anschließend addiert werden. Meine Mutter wurde außerdem gebeten, einen vollständigen Satz zu schreiben. »Heute vor fünfzig Jahren habe ich zum ersten Mal geheiratet«, steht auf dem Zettel. Ich schaue auf das Datum. Es stimmt auf den Tag genau.
Dann befinden sich in der Akte noch eine Menge Seiten mit vielen Zahlen zu Blutwerten und Hirnwasser sowie der Befund einer Computertomografie des Schädels mit zahlreichen, mir völlig fremden Fachbegriffen, aber auch verständlichen Aussagen wie »Hirnvolumenminderung« und »degenerative Veränderungen«.
Die Diagnose liest sich wie ein Urteil. Von »Defiziten im Kurzzeitgedächtnis« ist die Rede, von »einer schwergradig gestörten, räumlichen konstruktiven Kompetenz« sowie »depressiven Episoden« und »Angststörungen«. Schließlich heißt es: »Im Rahmen der Demenzdiagnostik konnten wir eine Demenz vom Mischtyp diagnostizieren. […] In der Pflege braucht die Patientin Strukturgabe, viel Anleitung und Beaufsichtigung.« Die Ärzte empfehlen eine ganze Reihe von Medikamenten gegen Depression, Angst, Unruhe und Demenz.
Als ich aus dem Urlaub zurückkam, hatten mein Bruder und ich die wesentlichen Entscheidungen in zahlreichen Telefongesprächen bereits getroffen. Meine Mutter und ihr Lebensgefährte Egon würden in ein Heim ziehen. Ob das auch wirklich ihrem Wunsch entsprach, war eine Frage, der niemand wirklich auf den Grund gehen wollte. Es war offensichtlich, dass sie ihren Alltag nicht mehr allein bewältigen konnten, zumal keiner ihrer Angehörigen in Essen lebte. Deswegen kam auch das Heim in ihrer Nachbarschaft, das sich die beiden schon mal angeschaut hatten, nicht infrage. Ganz abgesehen davon, dass es zu diesem Zeitpunkt dort keine freien Plätze gab. Egons Tochter hatte aber in ihrem Wohnort Warendorf eine Einrichtung mit zwei freien Zimmern gefunden. Da mein Bruder Jan im nahe gelegenen Münster wohnt, waren wir einverstanden. Zudem gab das Heim an, auf die Behandlung von Menschen mit Demenz spezialisiert zu sein. Das war uns wichtig. Wir waren froh, dass es einen »sicheren« Ort für unsere Mutter gab.
Jan und ich sortierten die Möbel, die Kleidung und persönlichen Dinge vor, die meine Mutter mitnehmen sollte. Die endgültigen Entscheidungen wollten wir ihr überlassen. Doch sie war, wohl auch wegen der »beruhigenden« Medikamente, mit solchen Fragen weitgehend überfordert. Sie schien nicht ganz fassen zu können, was gerade passierte. Vielleicht war es besser so, redete ich, der selbst weit davon entfernt war, wirklich alles fassen zu können, was gerade passierte, mir ein. So mussten wir, die Söhne – von wenigen Rückfragen abgesehen –, festlegen, was sie nicht mehr brauchte, was verschenkt oder weggeworfen werden sollte. Innerhalb eines halben Tages lösten wir so ein Zuhause auf, in dem sie zehn Jahre gelebt hatte. Das ging erschreckend schnell, vielleicht zu schnell. Aber was ist in solchen Fällen der Maßstab? Ich wusste es nicht und weiß es auch heute nicht.
Mein Bruder und ich nahmen die Verantwortung an. Wir beklagten nicht das vermeintlich ungerechte Schicksal unserer Mutter, wir schrien unsere Wut über dieses Schicksal nicht lauthals in die Welt hinaus, wir rannten nicht weg, wir stritten nicht. Wir funktionierten.
Was wir erlebten, war und ist kein exklusives Drama. So was passiert in Deutschland jeden Tag wohl mindestens einige Dutzend Mal. Der Abgrund, den wir spürten, wurde durch diese Erkenntnis allerdings nicht kleiner. Wir wussten nicht, was auf unsere Mutter und auf uns zukommen würde. Wir wussten nur, dass sich das alles nicht wirklich gut anfühlte. Es war einer der traurigsten Tage meines Lebens.
Als ich mit meiner Mutter und meinem Bruder für einen Moment ruhig zusammenstand, bat ich sie, im Zweifelsfall doch bitte zuerst ihn und erst dann mich zu vergessen. Wir lachten. Auch meine Mutter. Ein gequältes Lachen, aber immerhin ein Lachen.
Es war schon dunkel, als wir in Warendorf ankamen. Ein modernes Haus in einem neu angelegten Park. Meine Mutter und Egon bekamen jeweils ein eigenes großes Zimmer mit Bad und Blick in den Garten. Wir luden die Möbel aus, richteten schon mal alles grob ein. Ich lernte einen netten Pfleger kennen, dem ich den Arztbrief und die Medikamente für die nächsten Tage übergab. Wir tauschten Informationen aus über Gewohnheiten und Vorlieben meiner Mutter und den Alltag und die Angebote des Heimes. Das klang erst mal gut. Der Mann wirkte kompetent und verständnisvoll. Ich vertraute ihm, auch weil mir kaum etwas anderes übrig blieb und weil ich hoffte, dass es meiner Mutter dort besser gehen würde als zuvor. Außerdem war ich mittlerweile mit den Nerven fertig und konnte meine Fassade nur noch mit großer Mühe aufrechterhalten.
Bei all dem vernünftigen Funktionieren hatte ich das Gefühl, in einen Film geraten zu sein, der sich fremd und falsch anfühlte. Es gab kein positives Szenario, an dem ich mich orientieren konnte. Allerdings fehlte mir auch die Fantasie für eine Erzählung von zwei Söhnen, die ihre an Demenz leidende Mutter in ein Heim bringen, und alles ist gut.
Sie selbst war am Ende des Tages vor allem erschöpft, zeigte sich aber gewillt, das Beste aus der Situation und der neuen Perspektive zu machen. In der Essener Klinik hatte sie den Wunsch geäußert, einen Ort zu finden, an dem sie bleiben konnte. Dieses Heim sollte es sein. Ich fuhr wieder nach Berlin, hoffte, dass alles gut werden würde, und ich freute mich darauf, mich wieder um mein eigenes Leben kümmern zu können. Erst ein paar Tage später kam die Melancholie, dann die Trauer. Ich dachte an meine Mutter und spürte die wachsende Kluft. Ein Bild setzte sich fest: Ich stehe am Ufer, meine Mutter treibt in einem kleinen Boot davon. Ich rufe ihr noch etwas zu und weiß nicht, ob sie mich versteht. Sie ist hilflos und allein.
Die Klarheit, welche die Diagnose mit sich brachte, hatte schon bald nichts Befreiendes mehr. Lange war sie vor allem ein Schock, den ich nicht mit meinem Verständnis vom Leben verknüpfen konnte. Dement bedeutet »ohne Geist«. Das Gehirn meiner Mutter schrumpft unaufhaltsam. Ihre Erinnerungen, ihr Empfinden für Zeit und Raum, ihre reflektierte Selbstwahrnehmung und auch ihre Eigenständigkeit gehen zum Teil langsam, zum Teil erschreckend schnell verloren. Bei der Vorstellung kreisen in meinem Kopf Schlagwörter wie »Sterben bei lebendigem Leib« und »Abschied vom Ich«.
Stimmt das?
Kann man Demenz, den Zustand »ohne Geist«, überhaupt verstehen? Ich meine jenseits von dem, was da im Gehirn schiefläuft? Ist das, was verloren geht, nicht das, was einen Menschen ausmacht? Sind Erlebnisse nicht nur dann etwas wert, wenn wir uns daran erinnern? Wie kann man erfassen, was es bedeutet, wenn sich ein Gedächtnis auflöst, wenn sich nach und nach alle Erinnerungen verabschieden? Und was bleibt übrig? Ist die Person, die jetzt noch meine Mutter ist, irgendwann nicht mehr diese Person? Ist es möglich, »sich selbst zu verlieren«? Und … was ist ein solches Leben wert?
Ich weiß es nicht. Ich würde es aber gern verstehen, dann könnte ich darin vielleicht einen Sinn erkennen oder zumindest hineininterpretieren. Es geht dabei nicht um Mitgefühl. Es geht um die Hoffnung, die Demenzerfahrung in ein Weltbild integrieren zu können, das mir ein Mindestmaß an Halt und Orientierung gewährt. Im Moment erlebe ich die Demenz vor allem immer wieder als einen Krater in meiner Lebensanschauung, als Angriff auf mein Selbstverständnis. Als Katastrophe.
»Jeder Fall ist anders.«Der Psychiater Hans-Georg Nehen
Ich habe einen Termin bei Professor Hans-Georg Nehen, dem Leiter der Essener Memory-Clinic, in der meine Mutter zum ersten Mal untersucht wurde. Inzwischen weiß ich, dass es viele Formen von Demenz gibt. Die bekannteste und häufigste wurde nach dem Nervenarzt Alois Alzheimer benannt, der am 25. November 1901 mit der damals einundfünfzigjährigen Auguste Deter einen der mittlerweile berühmtesten Dialoge der Medizingeschichte führte:
»Wie heißen Sie?
»Auguste.«
»Familienname?«
»Auguste.«
»Wie heißt Ihr Mann?«
»Ich glaube Auguste.«
»Ihr Mann?«
»Ach so.«
»Wie alt sind Sie?«
»Einundfünfzig.«
»Wo wohnen Sie?«
»Ach, Sie waren doch schon bei uns.«
»Sind Sie verheiratet?«
»Ach, ich bin doch so verwirrt.«
»Wo sind Sie hier?«
»Hier und überall, hier und jetzt, Sie dürfen mir nichts übel nehmen.«
»Wo sind Sie hier?«
»Da werden wir noch wohnen.«
»Wo ist Ihr Bett?«
»Wo soll es sein?«
Später äußerte Deter nach Alzheimers Aufzeichnungen mehrfach den Satz: »Ich habe mich sozusagen selbst verloren.«
Deter war unter anderem aufgrund zunehmender Verwirrtheit zu Alzheimer in die Frankfurter »Anstalt für Irre und Epileptiker« gebracht worden. Es war nicht das erste Mal, dass der damals achtunddreißigjährige Alzheimer einem Patienten oder einer Patientin mit solchen Symptomen begegnete. Doch noch niemand war so jung gewesen wie Deter. Alzheimer nannte das Phänomen »Die Krankheit des Vergessens«. Nach dem Tod Deters im Jahr 1906 obduzierte er ihr Gehirn, wo er mit einem im Vergleich zu heutigen Möglichkeiten bescheidenen Mikroskop »hirsegroße Herdchen« aus abgestorbenen Nervenzellen und Eiweißablagerungen – sogenannten Plaques – entdeckte. Seine damaligen Wissenschaftlerkollegen interessierte das allerdings alles nur am Rande.
Schließlich war die Demenz ja auch keinesfalls eine neue Erscheinung. Schon 2400 vor Christus beschrieb der ägyptische Wesir Ptahhotep das Alter so: »Kindliche Schwäche zeigt sich erneut. Wer ihretwegen tagein, tagaus dahindöst, ist infantil … der Mund ist schweigsam, er kann nicht reden. Das Herz [nach altägyptischer Vorstellung der Sitz des Geistes; J. K.] lässt nach. Es kann sich nicht mehr an das Gestern erinnern.« Auch Shakespeares achtzigjähriger Lear war wohl nachlesbar dement.
Eine gängige Definition beschreibt das Phänomen heute als »alltagsrelevante Abnahme von Gedächtnis und anderen kognitiven Funktionen im Vergleich mit dem ursprünglichen Funktionsniveau des Patienten, die länger als sechs Monate besteht«. Nur in seltenen Fällen kommt es dabei über die verstandesmäßigen Einschränkungen hinaus auch zu Veränderungen der Persönlichkeit.
Seit Mitte der siebziger Jahre ist »Alzheimer« die am häufigsten diagnostizierte Form von Demenz. Zeitweise galt sie gar als »Modekrankheit«. Umstritten ist allerdings, ob es sich dabei tatsächlich um eine spezifische »Krankheit« oder nicht doch eher um eine Art forciertes, im Grunde aber normales Altern handelt, wie es die Experten Peter J. Whitehouse und Daniel George in ihrem 2009 in Deutschland erschienenen Buch Mythos Alzheimer ausführlich darlegen. Fakt ist, dass die Alzheimer-Demenz als Krankheit weder klar definiert noch hundertprozentig sicher zu diagnostizieren ist. Und unbestritten ist außerdem, dass in den Gehirnen Verstorbener immer wieder auch Veränderungen gefunden wurden, die eindeutig auf eine Alzheimer-Demenz hinwiesen, ohne dass die Betroffenen zu Lebzeiten entsprechende Symptome zeigten.
2011 machte die Wissenschaftsautorin Cornelia Stolze in ihrem Buch Vergiss Alzheimer! darauf aufmerksam, dass viele Ursachen für Gedächtnisstörungen wie Medikamentennebenwirkungen, Infarkte im Gehirn, Depressionen, Alkoholismus oder Austrocknung zu wenig beachtet würden. Hinter diesen »Nachlässigkeiten« vermutet Stolze unter anderem auch wirtschaftliche Interessen der an der Forschung beteiligten Pharmakonzerne und Mediziner. Das sind interessante Berichte, und es erscheint mir tatsächlich sinnvoll, vorsichtig mit dem Begriff »Alzheimer« umzugehen. Leider ändert das jedoch nichts am tatsächlichen Zustand meiner Mutter.
Insgesamt kennt die Medizin zwanzig bis dreißig weitere Formen von Demenz, etwa die Demenz mit Lewy-Körperchen, die frontotemporale Demenz oder die Pickkrankheit. Neben »Alzheimer« tritt die auf Gefäßveränderungen basierende vaskuläre Demenz, eine Art Arteriosklerose im Gehirn, umgangssprachlich »Verkalkung« genannt, am häufigsten auf. Oft wird sie zusammen mit »Alzheimer« als eine Art Mischtyp diagnostiziert. So wie bei meiner Mutter.
Betroffen ist das wohl komplexeste Organ, das die Natur hervorgebracht hat: das menschliche Gehirn. Bei einem Neugeborenen wiegt es ungefähr ein Pfund, im erwachsenen Zustand etwa dreimal so viel. Bereits ein Fötus im Mutterleib bildet in jeder Minute bis zu 250000 Nervenzellen. Während nach der Geburt wohl kaum noch weitere dieser Neuronen entstehen, beginnt nun die große Zeit der Verknüpfungen. Wissenschaftler schätzen, dass in den ersten Lebensjahren pro Sekunde und Quadratzentimeter der Gehirnoberfläche an die 30000 solcher Verbindungen hergestellt werden. So verfügt ein Hirn schließlich über bis zu hundert Milliarden Nervenzellen mit jeweils Tausenden Verknüpfungen untereinander. Die versorgenden Blutgefäße kommen dabei auf eine Gesamtlänge von achtzig bis hundert Kilometern. Ein unvorstellbares Netz, in dem all unsere Erinnerungen stecken.
Grundsätzlich unterscheidet man dabei zwischen dem Kurz- und dem Langzeitgedächtnis. Unablässig erreichen unser Gehirn im Wachzustand neu gesehene, gehörte, geschmeckte, gerochene oder gefühlte Eindrücke, die je nach Art der Information entweder gleich im Langzeitgedächtnis landen oder aber im Kurzeitgedächtnis für ein paar Sekunden oder auch Minuten zwischengelagert werden, bis entschieden ist, ob sie längerfristig abgespeichert werden sollen. Man kann sich dieses Kurzzeitgedächtnis als einen Arbeitsspeicher mit begrenzter Kapazität vorstellen, der im angeregten Wachzustand ständig überzulaufen droht. Während permanent neue Informationen eintreffen, muss unablässig die gleiche Menge an »alten«, vermeintlich unwichtigen Informationen abfließen. Das heißt, sie werden sofort wieder vergessen.
Werden Informationen längerfristig abgespeichert, verändert sich das Gehirn physisch – weshalb man gleich versuchen sollte, den gern genutzten Vergleich mit der Festplatte eines Computers zu vergessen. Im Gegensatz zu einer Festplatte, die durch einen Speichervorgang physikalisch nicht verändert wird, kommt es im Gehirn bei der Abspeicherung einer bestimmten Information über eine chemoelektrische Reizweiterleitung zu einer jeweils speziellen Verknüpfung einzelner Nervenzellen. Dabei gilt: Je komplexer die Information, desto größer der beteiligte Zellverband.
Auf diese Weise verändert sich die Struktur unseres Gehirns mit jeder neu aufgenommenen Erfahrung. Informationen, die schon irgendwie bekannt sind, werden mit den vorliegenden Erinnerungen in Beziehung gesetzt. Das heißt, bereits bestehende Verbindungsmuster von Nervenzellen werden verstärkt und gegebenenfalls leicht verändert. Während sich Informationen, die immer wieder bestätigt und abgespeichert werden, in einem immer stabiler werdenden und somit beständigeren Netz von Verknüpfungen ausdrücken, verblassen die Verbindungsspuren jener Informationen, die nicht bestätigt werden. Das ist nebenbei auch der Grund, weshalb uns die Werbeindustrie so gern denselben Werbespot im Fernsehen innerhalb kurzer Zeit immer und immer wieder vorsetzt.
Dazu kommt, dass auch Gefühle, die mit der Information verbunden sind, für eine grundsätzlich stabilere Abspeicherung sorgen. Wer also eine bestimmte Vokabel lernen möchte, sollte sie sich öfters anschauen oder vorsagen. Wem es gelingt, dabei Freude zu empfinden, hat dann gleich noch größere Chancen, seinen Kaffee im nächsten Urlaub mal ohne Wörterbuch bestellen zu können.
Ausgelöst, also wieder hervorgerufen werden Erinnerungen, wenn ein entsprechender Reiz das Gehirn erreicht, zum Beispiel: ein Foto mit dem Gesicht der eigenen Mutter. Zu diesem Bild entsteht ein spezielles, überaus komplexes Verbindungsmuster von Nervenzellen, genau so, als ob ich es zum ersten Mal sehen würde. Dieses Muster wird dann mit ähnlichen, bereits vorhandenen Mustern verglichen. Und weil zum Bild meiner Mutter ja schon viele entsprechende Muster vorliegen, entsteht eine Verbindung zu den gespeicherten Gedächtnisinhalten. Mein Bewusstsein erkennt: »Ah! Meine Mutter!« Erinnerungen werden wach, das heißt gespeicherte Erlebnisse, Gefühle und Abstraktionen werden aktiviert. Einem Menschen mit Demenz gelingt das in vielen Fällen nicht mehr.
– Bei der Alzheimer-Demenz sterben die Gehirnzellen zunehmend ab.
Sagt Hans-Georg Nehen. Wir sitzen in seinem hellen Büro in der modernen Memory-Clinic.
– Auch die Verbindungen der Zellen untereinander werden zerstört.
Nehen ist ein eher zarter Mann, Anfang sechzig, mit einem feinen, freundlichen Lächeln. Vor gut zwanzig Jahren gründete der Arzt für Innere Medizin, Rheumatologie und Klinische Geriatrie die damals einzigartige Spezialeinrichtung. Sie ist mit zahlreichen Fachärzten und jährlich 800 bis 1000 Patienten eines der führenden Kompetenzzentren Deutschlands.
– Die Synapsen, das sind die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, können nicht mehr miteinander agieren. Und mit den Verknüpfungen lösen sich die erinnerten Informationen auf.
Die ersten Anzeichen einer Demenz, die meist das Kurzeitgedächtnis betreffen, werden in der Regel erst bemerkt, wenn bereits etwa sechzig Prozent der Nervenzellen nicht mehr funktionieren. Die Veränderungen im Gehirn beginnen aber schon Jahrzehnte, bevor die Symptome auftreten, was nichts anderes bedeutet, als dass in meinem siebenundvierzig Jahre alten Kopf der Prozess, der mir später eine Demenz beschert, schon längst begonnen haben könnte. Ganz abgesehen davon, dass im menschlichen Gehirn schon bei Fünfundzwanzigjährigen ein vollkommen normaler Schrumpfungsprozess beginnt, der sich in der zweiten Lebenshälfte beschleunigt, wenn sich pro Jahrzehnt etwa fünf Prozent unserer Nervenzellen verabschieden.
– Und wie stellt man fest, ob jemand eine Demenz hat?