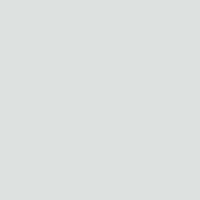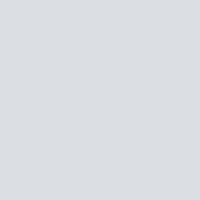16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie wichtig? Jörn Klare geht dem sehr persönlich und ganz wörtlich nach. Von seiner Berliner Haustür aus wandert er an den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebiets. Ein Weg über gut 600 Kilometer, erst durch Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wilde Wiesen heißen, begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. Schließlich erreicht er die kleine Stadt, die einst sein Leben war. Jörn Klares Weg führt zum Ziel. Seine Wanderung durch ein Deutschland, das man kaum kennt, liefert die Grundlage für eine persönliche und großartig geschriebene Auseinandersetzung mit der Frage: Wohin gehöre ich in einer Welt, die sich immer schneller wandelt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Was genau ist Heimat? Was bedeutet sie? Und warum ist sie wichtig?
Jörn Klare geht dem sehr persönlich und ganz wörtlich nach. Von seiner Berliner Haustür aus wandert er an den Ort seiner Kindheit und Jugend am Rand des Ruhrgebiets. Ein Weg über gut sechshundert Kilometer. Erst durch Ostdeutschland, das ihm immer noch fremd ist, dann durch Westdeutschland, das ihm oft nicht mehr vertraut ist. An Orten, die Alte Hölle, Elend oder Wildewiese heißen, begegnet er Menschen, die ihre Heimat lieben, an ihr leiden und für sie kämpfen. Schließlich erreicht er die kleine Stadt, die einst sein Leben war. Ein besonderes Buch, das jeden dazu bewegt, sich neu zu verorten. Ein Porträt von Deutschland, das man so kaum kennt.
Der Autor
Jörn Klare, geboren 1965, schreibt Bücher, Theaterstücke sowie Reportagen und Features, unter anderem für den Deutschlandfunk und Die Zeit. Jörn Klare lebt mit seiner Familie in Berlin.
Jörn Klare
Nach Hause gehen
Eine Heimatsuche
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1320-7
© by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagabbildung: Cees van Nile/Corbis
Karte Vorsatz/Nachsatz: © Peter Palm, Berlin
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für K. K.
Nie habe ich so viel nachgedacht, nie war ich mir meines Daseins, meines Lebens so bewusst, nie war ich sozusagen mehr ich selbst als auf den Reisen, die ich allein und zu Fuß gemacht habe.
Jean-Jacques Rousseau
Dieser Geruch, der mir plötzlich in die Nase steigt und in meinem Kopf ein Feuerwerk auslöst, aus dem ein erstes Bild entsteht. Es ist unscharf, zeigt ein lächelndes Gesicht, ein Haus, einen Garten, andere Menschen …, immer mehr Bilder tauchen auf. Szenen in warmem und auch kaltem Licht, sie entspringen meiner Kindheit und reihen sich zu einem Film, der sprunghaft läuft, bis alles ineinanderfließt. Es dauert keinen Augenblick, und eine Welle strömt durch meinen Körper, und ich fühle mich mit dem, was um mich ist, verbunden. Dabei war mir dieser Geruch nicht einmal bewusst. Er kommt von der Lenne, die ein Stück weiter unten im Tal Richtung Ruhr fließt, und mischt sich mit dem Aroma der sauerländischen Wälder, aus denen ich gerade herabgestiegen bin. Natürlich ist es mehr als das. Und natürlich ist es komplizierter. Doch was ich in meiner Nase spüre, ist eindeutig und unverkennbar: Heimat.
Nach einunddreißig Tagen Wanderung stehe ich unterhalb der Burg von Altena, die ich von Ausflügen während meiner Schulzeit kenne. Das Tal ist eng, die Sonne schon verschwunden. Um mich herum stehen junge und alte Männer, die sich wie Kinder auf die nächsten Tage freuen. Sie schmücken ihre kleine Straße mit Girlanden und Transparenten in Grün und Weiß, klettern dafür auf Leitern, halten diese fest, reichen Hammer oder Zange, schlagen Nägel ein, knipsen Drähte ab. Die meisten aber geben Ratschläge, scherzen und trinken Bier dabei. Noch drei Mal schlafen, dann beginnt ihr Schützenfest. Auch mir reichen sie ein kaltes Bier. Es tut gut, mein Tag war lang, er soll hier enden. Diese Nacht in Altena ist die letzte vor Hohenlimburg, meinem Ziel. Fünfzehn oder zwanzig Kilometer noch, dann bin ich, wo einst mein Zuhause war. Ich müsste nur flussabwärts der Lenne folgen, will morgen aber »über den Berg« gehen. Wegen der Erinnerungen. Sie sind gemischt wie der Geruch in meiner Nase.
Die Schützenbrüder zeigen auf meinen Rucksack, meinen Wanderstab und fragen, woher ich komme. Sie lachen, als ich sage »aus Berlin« und wiederholt bejahe, dass ich den ganzen Weg zu Fuß gegangen bin. Sechshundert Kilometer mit ein paar Umwegen. Schon reicht einer mir ein neues Bier. Er fragt, warum die Mühen? Wegen der Heimat, antworte ich, der Frage, was und wo das ist. Er nickt, stößt seine Flasche an meine und erzählt, dass sie hier weit über zweitausend Schützenbrüder sind, dass sie ihr Fest aus sehr alten, komplizierten Gründen nur alle drei Jahre feiern und dass die Zeit dazwischen sehr, sehr lang ist. Als er sagt, dass ihre Bürgerwehr im Jahr 1429 gegründet wurde, stoße ich nun als Zeichen des Respekts meine Flasche gegen seine. Dann trinken wir und schweigen. Er freut sich auf das Fest, ich freue mich, hier neben ihm zu stehen. So wohl habe ich mich lange nicht gefühlt.
Vor einer Weile wollten meine Frau und ich in Berlin eine Wohnung kaufen. Wir leben dort seit vielen Jahren in einer schönen, großen Mietwohnung. Aber irgendwann werden unsere Töchter, die am Anfang und am Ende der Pubertät stehen, ja vielleicht mal ausziehen. Was meine Frau und ich zu kaufen suchten, könnte ruhig kleiner, sollte aber hell und nicht zu laut sein. Ein paar Zimmer, in denen man leben und vielleicht sogar alt werden kann. Es war die Zeit vor meinem fünfzigsten Geburtstag. Wir radelten an einem Frühsommernachmittag durch einen der schöneren Bezirke Berlins, um zu schauen, was hinter den Angeboten steckte, die wir im Internet gelesen hatten. Einige Wohnungen waren schön, andere hässlich, und alle schienen uns viel zu teuer. Die Makler hatten es eilig. Sie wussten, dass sie die schönen und auch die hässlichen Wohnungen in kurzer Zeit für viel zu viel Geld loswerden würden. Irgendjemand würde schon unterschreiben, ohne allzu lange nachzudenken. Ich schaute aus verschiedenen Fenstern, die vielleicht uns gehören könnten, auf verschiedene Nachbarn, die vielleicht unsere sein könnten. Ich bekam das wachsende Gefühl, im falschen Film zu sein. Was, fragte ich mich, stimmt hier nicht? In der dritten oder vierten Wohnung wusste ich es, die Erkenntnis überraschte und verwirrte mich: Ich bin kein Berliner.
An diesem Tag musste ich mir eingestehen, dass ich mich in der Stadt, in der ich seit bald dreißig Jahren lebe, noch immer nicht so heimisch fühle, dass ich bereit bin, ihr meine finanzielle Unabhängigkeit zu opfern und mich fest an sie zu binden. Wobei: Berlin ist schon okay und mir zumindest lieber als Hamburg, Frankfurt oder München. Noch immer ist es in Berlin etwas weniger spießig als anderswo, eine Stadt, in der man sich neu erfinden kann und immer wieder neu behaupten muss. Manchmal ist mir das zu viel. Auch nach knapp dreißig Jahren fehlt mir ein Gefühl von entspannter Selbstverständlichkeit und Aufgehobensein. Ein Gefühl von … Heimat eben. So bat ich meine Frau, unsere Wohnungspläne noch einmal zu überdenken. Sie war einverstanden, und ich fühlte mich befreit. Doch es blieb die Frage, wo und was für mich denn Heimat ist – oder Heimat sein könnte. Je länger ich mich das fragte, umso stärker kamen die Erinnerungen an einen fernen Ort im Westen: Hohenlimburg. Das überraschte und erschreckte mich.
In Altena kommt jetzt der Sohn des Mannes neben mir auf uns zu. Er hat Down-Syndrom und ist wie die allermeisten Menschen mit dieser genetischen Besonderheit ein reizender Kerl. Für mich ist er aber auch eine Herausforderung, was an seinem Trainingsanzug liegt. Dieser ist blau-weiß und mit dem Wappen eines Fußballclubs versehen, den ich aus langer Tradition nicht schätzen kann. Da greift ein altes Muster und, da hier der Nase nach meine Heimat schon beginnt, werde ich nervös. Ich spüre den Drang, Position zu beziehen, zu zeigen, dass ich mein Gegenüber ernst nehme und mich selbst auch. Indianer rammen in Filmen für so etwas einen Speer in die Erde, Hunde heben einfach nur ein Bein. Auch ich bin ein territoriales Wesen.
»Was hat der Junge angestellt?«, frage ich den Vater, nachdem sein Sohn schon wieder weiter ist.
»Wieso?«
»Weil er so einen Anzug tragen muss.«
Stille. Er schaut verwirrt, sagt spontan, dass der Anzug eine Belohnung gewesen sei. Danach sieht er mich prüfend an.
»Du bist schwarz-gelb, oder?«
»Was sonst?«
Er stöhnt, dann grinst er leicht gequält, und ich grinse auch. Er kennt das Spiel. Unsere Flaschen stoßen wieder aneinander, wir trinken. Ein guter Mann, ein möglicher Freund.
Die Heimatfrage ließ mich nicht mehr los, und mir wurde klar, dass ich sie in Berlin nicht durch Gespräche, mit Büchern oder gar dem Internet beantworten kann. Es ging darum, ein Gefühl zu klären. Da helfen weder Theorie noch Algorithmus. Ich hatte gelesen, dass die Bepflanzung von Blumenkästen als armselige Rückbesinnung auf die bäuerlichen Wurzeln gesehen werden kann, und fühlte mich ertappt, auch wenn weder ich noch mein Vater, noch meine Großväter jemals Bauern waren.1 Wenn ich allerdings nur weit genug zurückblicke, würde sich wohl schon einer finden. Doch nicht Ahnenforschung, sondern Heimat war mein Ziel.
Zu Fuß sollte die Reise gehen, weil mir die guten Gedanken in meinem Leben ganz selten nur im Sitzen oder Liegen kommen. Und ich wollte endlich auch mal Teil der Landschaft sein, die so oft im Auto oder Zug an mir vorüberzog. Ich sagte meiner Frau, dass ich für meine Antwort »nach Hause gehen« will. Sie meinte, ich sollte doch in Hohenlimburg starten. Wir lachten, aber es war auch ernst gemeint. Sie ist eine tolle Frau. Sie lässt mich gehen, wartet nicht und ist trotzdem da, wenn ich zurück von einer Reise komme.
Hohenlimburg liegt zwischen dem Sauerland und dem Ruhrgebiet, hat knapp 30 000 Einwohner und gehört mittlerweile zu Hagen. Eine Kleinstadt, die man nicht toll finden muss und auch nicht interessant, aber ich bin dort geboren, genauso wie schon meine Eltern und Großeltern. Einundzwanzig Jahre lebte ich dort in dem Haus, das mein Vater gebaut hat, habe dort Abitur gemacht, hatte dort meinen ersten Liebes- und Lebenskummer und in dem Zusammenhang auch meinen ersten Vollrausch. Trotzdem wollte ich nach meinem Zivildienst möglichst schnell weg ins »richtige Leben« oder zumindest hinaus in »die Welt«. Ich wollte meine Heimat loswerden, was mir erst mal auch gelang.
Mein Ziel hieß Berlin, bzw. West-Berlin, weil 1986 ja noch die Mauer stand. Dort hatte ich einen Studienplatz für Psychologie und Theaterwissenschaften. Die Großstadt war eine Verheißung, die für mich Kleinstadtkind voll eintrat. Zumal der Wedding, in dem ich mein erstes WG-Zimmer fand, damals tatsächlich noch ein bisschen wild war. Und natürlich war alles sehr, sehr anders als in Hohenlimburg. Ich habe auch keine Zweifel, dass das Ganzberlin von heute immer noch eine ganz andere Welt als Hohenlimburg ist. Was das »richtige Leben« betrifft, bin ich mir schon lange nicht mehr sicher.
In dem kleinen Hotel in Altena gibt es eine Kneipe mit klassischem Holztresen und abgewetztem Parkettboden. Tische und Stühle, überhaupt das ganze Mobiliar bis hin zum Wandschmuck wirken, wie auch die Gäste, zusammengewürfelt und schon etwas älter. Ich bekomme ein Zimmer unter dem Dach, dusche, lege mich aufs Bett, genieße die Entspannung, die Ruhe, das schlichte Nichtbewegen nach einem langen Wandertag. Doch je mehr der Körper ruht, desto schneller rasen die Gedanken. Wenn ich wandere, ist es umgekehrt. Jetzt aber: Erinnerungen an die letzten Tage und Wochen, an viele Wälder, vor allem aber an Menschen. Ein Kleinverleger in Brandenburg, eine polnische Saisonarbeiterin, eine tapfere Wirtin, ein alter Knecht irgendwo in Sachsen-Anhalt, ein geflohener Afghane, ein Wanderfreund im Harz, eine alter Nazi in Hessen, eine Ortsheimatpflegerin, ein Schützenbruder, ein Mönch im Sauerland … Und immer wieder die Frage nach der Heimat, was das ist, was sie für mich bedeutet. Viele Antworten habe ich bekommen und noch keine eigene gefunden. Noch bin ich ja auch nicht in Hohenlimburg. Andererseits habe ich mich in den letzten Tagen und Wochen auch gefragt, ob mein Hohenlimburger Heimatgefühl nicht eine Art Phantomschmerz ist. Seitdem ich von dort fortgegangen bin, ist meine Mutter gestorben, und mein Vater lebt in einem Heim in Münster. Die alten Freunde habe ich so lange nicht gesehen, dass ich nicht sagen kann, ob sie überhaupt noch Freunde sind. Ich fürchte, das, was ich gern »geschätzte Heimat« nenne, zu überschätzen.
Ich gehe runter in die Kneipe – Fußball gucken, die herrlichste Zeittotschlägerei der Welt, heute aber noch viel mehr. Pokalendspiel, Dortmund ist dabei, und ich bin angespannt. Am Tresen ist noch ein Platz mit bester Aussicht auf den Bildschirm frei. Das ist meiner, bis hinter mir am Tisch einer »Mach mal Platz, Großer!« ruft, da ich ihm und anderen die Sicht aufs Spiel versperre. Als ich mich zu ihnen an den Tisch setze, rücken sie zusammen. Aus einer Ecke rufen ein paar Schalke-Fans ab und an bemühte Witze in den Raum, das gehört dazu, damit muss man leben können. Schlimmer ist, dass Dortmund keine Chance hat. In der Nachbesprechung des 1 : 3 bemühe ich mich um die Rolle des guten Verlierers, was nicht gelingt. Ich muss hier raus und gehe runter an die Lenne.
Mein letzter Morgen in Berlin beginnt mit Zweifeln, noch bevor die Sonne aufgegangen ist. Dass in meinem Gemüt die Frage nach der Heimat pocht, ist mir auch ein wenig peinlich, weil ich mich für einen aufgeklärten Menschen halte. Sind solche Fragen nicht längst schon überholt? Wozu denn Heimat, wenn ich Sinn, Familie und Arbeit in meinem Leben sehe und habe?
Mit den ersten Sonnenstrahlen kommt meine jüngste Tochter an mein Bett, sie ist ein wenig traurig, aber auch gewohnt, dass ich hin und wieder allein fortreise. Am Frühstückstisch erklärt mir meine andere, zwanzigjährige Tochter die Zusammenhänge zwischen den Türstehern und Drogendealern in den Clubs, die mehr oder minder vor unserer Haustür liegen. So gehe ich die ersten Schritte meiner Wanderung vorbei an ebenjenen Türstehern, die ich als solche erkenne, und jenen, die wohl Dealer sind. Auf dem Boden liegen wie so oft Partymüll und leere Flaschen, einige davon in Scherben. Am alten Wachturm auf dem ehemaligen Grenzstreifen glänzen neue Graffiti. Eine kleine Gruppe blasser Spanier wankt von einem nahen Club herüber. Mit dunklen Brillen kämpfen sie gegen das Licht der Sonne. »It’s all cool!«, sagt einer zu einer jungen schönen Frau, die ihn nicht zu hören scheint. Ich frage mich, warum er Englisch spricht. Ein anderer lässt eine Sektflasche fallen und pinkelt dann an einen Baum. Mein Kiez wirkt wie ihre Beute. Ich bin empört und erinnere mich doch vage, dass ich mich, als ich in ihrem Alter war und durch Europa reiste, wohl ähnlich schlecht benahm. Ich fühle mich alt.
Gestern saß ich am Ufer der nahen Spree. Es war ein sonniger Sonntagmorgen, ein Ausflugsdampfer nach dem anderen pflügte durch das Wasser, beflissene Touristenführer informierten weithin hörbar über die Reste alter Grenzanlagen. Wer wie ich dabei am Ufer saß, wurde zur Kulisse degradiert. Ein Mann, den ich nicht sehen konnte, brüllte etwas zu den Schiffen hin. Es brauchte einen Moment, bis ich ihn verstand. »Sieg Heil«, tatsächlich brüllte er immer wieder »Sieg Heil«. Später dann auch noch »Heil Hitler!«. Es klang verzweifelt.
Vor dem Standesamt ein paar hundert Meter weiter und schon in Kreuzberg eine Hochzeitsgesellschaft. Der Bräutigam im Smoking, die Braut in einem knappen, roten Rock. Die wenigsten männlichen Gäste tragen einen Anzug, die wenigsten weiblichen Gäste ein elegantes Kleid. Auf einem Tisch stehen ein paar Flaschen Sekt und Plastikbecher.
»Hier wird verdrängt!«, informiert ein Zettel an einem Haus, vor dem Männer ein Gerüst für eine Renovierung aufbauen. Daneben stinkt ein Dixi-Klo. Ich komme an der frisch umzäunten Brachfläche zwischen Straße und Spree vorbei, auf der vor Monaten noch mittellose Berlinbesucher lagerten. Manche nannten das den ersten »Slum« Berlins. Die Menschen sind längst vertrieben. Bald wird wohl auch hier was neues Schickes stehen, das sich keiner leisten kann, der jetzt noch in der Gegend wohnt. Und viele von denen, die jetzt hier wohnen, haben bereits andere verdrängt.
Weiter entlang an den alten Kinderläden meiner Töchter, einer Eckkneipe, die mit einem eigenen Klimaschutz-Zertifikat wirbt, und einem Späti, in dem es rund um die Uhr achtzig Bier- und vierzig Chips-Sorten zu kaufen gibt. Der Italiener, bei dem ich gern gegessen habe, ist verschwunden. Die Apotheke, den Bio- und den Buchladen, von denen ich nach zwanzig Jahren im Kiez zumindest die Besitzerinnen kenne, gibt es zum Glück noch. Zwischen den Büchern in dem kleinen Schaufenster liegt eine schöne Postkarte mit dem Bild eines gestickten »Home is where your bookstore is«. In der Straße gab es mal eine ganze Reihe Geschäfte mit Dingen, die man im Alltag braucht, mittlerweile präsentieren die neusten Szenecafés ihr Angebot nur noch in Englisch. So sieht die Gegend aus, in der ich seit vielen Jahren wohne und die ich nicht Heimat nennen kann.
An der Pizzabude stehen sechs Polizisten, die mit müden Gesichtern auf ein frühes Mittagessen warten. Sie tragen Straßenkampfmontur, am Himmel kreist ein Hubschrauber. Es ist der Tag vor dem Ersten Mai, an dem nach Kreuzberger Tradition mit Krawall zu rechnen ist. Als die 1987 ihren Anfang nahm, lief ich durch Zufall mitten hinein. Es war die Zeit vor einer in Kreuzberg höchst unpopulären Volkszählung. Damals begegnete man selbst einfachsten Datensammlern noch konsequent mit Misstrauen, auch ich engagierte mich, ging auf Demos und bekam auch mal unbegründet Prügel von der Polizei, über die ich aufrichtig erschrak. Allerdings war ich auch ein wenig stolz darauf. So etwas gehörte hier zum Lebensstil.
In der Nacht vor einem großen Fest zum Tag der Arbeit mitten in Kreuzberg hatte die Polizei ein Büro der Volkszählungsgegner aufgebrochen und durchsucht. So war die Stimmung schon angespannt und verspannte sich noch weiter, als am Rand des bunten Familienfestes Autonome einen abgestellten Streifenwagen auf die Seite kippten. Mehr und mehr Polizisten in Kampfmontur tauchten auf. Erst flogen Gegenstände in die eine, dann Tränengasgranaten in die andere Richtung. Einige von ihnen landeten in der friedlich feiernden Menge, die den Ärger kaum bemerkt hatte. Als das Fest mit einem Schlagstockeinsatz aufgelöst werden sollte, eskalierte die Situation. Die Menschen leisteten wütend Widerstand, und die Polizei zog sich irgendwann am Abend von allem überfordert komplett zurück. Brennende Straßenblockaden sorgten dafür, dass das bis zum Morgengrauen auch so blieb. Geschäfte wurden aufgebrochen und geplündert. Der größte Laden war ein Bolle-Supermarkt am Görlitzer Bahnhof, der noch in jener Nacht von einem Pyromanen abgefackelt wurde. Vorher schleppten ganze Familienverbände palettenweise Klopapier und Hundefutter an sekt- und siegestrunken Feiernden vorbei in ihre Vorratsschränke. Den archaischen Sound dieser bizarren Szenerie lieferten Hunderte Menschen, die mit Pflastersteinen gegen die gusseisernen Streben der Hochbahn schlugen. Mitten in diesem durchaus auch bösen Rausch der Anarchie stand ich, ein junger Mann aus Hohenlimburg, der bis dahin nicht die Phantasie gehabt hatte, sich auch nur im Ansatz vorzustellen, was hier geschah.
Die Lenne ist auch in Altena kein großer Fluss. Zwanzig Meter sind es bis zum anderen Ufer. Vermutlich könnte man hinüber waten. Wenn wir früher mal aus Übermut in ihrem Wasser badeten, juckte später unsere Haut von den Abwässern der Stahlwerke. Ich gehe flussaufwärts. Die Straße ist gesperrt, ich erkenne das halb aufgebaute riesige Schützenzelt, von dem die Männer am Nachmittag erzählt haben. Als ich auf ein kleines Feuer in einer Eisenschale zusteuere, stottert mich ein junger Mann auf Polnisch an. Ich stottere auf Deutsch zurück. Das geht ein wenig hin und her, bis wir beide merken, dass keiner von uns Pole ist. Franky stellt sich vor, er hat heute Geburtstag und hat Polnisch gesprochen, weil er mich für einen polnischen Schützenzeltaufbauer hielt. Er ist nicht mehr ganz nüchtern. Das kleine Feuer gehört zu seiner Party. Und auch wenn ich kein Pole bin, soll ich jetzt mitkommen.
Als ich vor bald dreißig Jahren mit einem Kleinwagen, in dem ich eine Matratze, eine Bücherkiste und zwei Koffer transportierte, in Berlin ankam, parkte ich zum Ausladen auf dem Bürgersteig. Eine ältere Frau sprach mich freundlich auf das Nummernschild aus Hagen an. Sie hatte Verwandte dort. Eine jüngere Frau kam dazu, sie war sauer, dass das Auto ihren Weg versperrte. Wohl um mich zu verteidigen, sagte die ältere: »Aber er kommt doch aus Hagen!« Die Antwort lautete: »Mir egal, aus was für einem Dorf der kommt!« Für mich war das eine interessante Lektion in Sachen »Großstadt«, weil ich Hagen, damals immerhin achtmal so groß wie Hohenlimburg, bis zu genau diesem Zeitpunkt als eine solche gesehen hatte.
Neu in Berlin, antwortete ich anfangs ungern auf die Frage, woher ich komme. Ich wollte nicht von der Kleinstadt erzählen, die kurz zuvor noch meine Welt gewesen war, nicht vom Sauerland, nicht vom ruhigen Rand des Ruhrgebiets. Ich wollte nicht der Provinzler sein, der ich war und sicher auch noch bin. Ich wollte Berliner sein oder es zumindest werden. Allerdings war meine Vorstellung davon nicht ganz klar. Cool, lässig, abgeklärt – auf jeden Fall das Gegenteil von meinem Leben in Hohenlimburg. Mit der Zeit setzte eine Wandlung ein, ich lernte andere Westfalen kennen, Sauerländer auch, ich spürte eine Nähe und fing an, ihre Mentalität zu schätzen, schon weil sie meiner ähnlich ist. Auch sie sind ein bisschen langsamer in manchen Dingen, dafür aber auch weniger leicht aus der Spur zu bringen, sie sind schwerer zu begeistern, aber auch weniger leicht zu beeindrucken, sie frieren nicht so schnell und machen weniger heiße Luft, was nicht ausschließt, dass sie heftig explodieren können, wenn sie »die Faxen dicke haben«. So begann ich zu erkennen, was Hohenlimburg für mich war, und ich lernte, es zu schätzen und wohl auch schon zu verklären, denn dort wieder leben wollte ich nicht. Später fand ich dazu einen Satz bei Kafka: »Man muss in die Ferne gehen, um die Heimat, die man verlassen hat, zu finden.«2
Am ersten Tag meiner Wanderung komme ich, noch in Berlin, zu einer alten Haustür, sie führt über einen Hinterhof zu einer kleinen, feuchten Wohnung im Erdgeschoss, in der ich mit einem guten Freund ein paar Jahre lebte. Am Klingelkasten nur unbekannte Namen. Daneben mit Edding geschrieben: »Now all your love is wasted and who the hell was I?« Ende der Achtziger war die Gegend ein ranziger Kiez mit vielen Kampfkötern. Wo früher Prostituierte auf Kunden warteten, bieten heute Cafés ausgefallene vegane Snacks an. Wieder wundere ich mich, dass Inneneinrichtung aus Sperrmüll so geschmackvoll sein kann. Aber vielleicht haben sie ihre Möbel ja auch ganz woanders her. Der soziale Nenner der Gegend lautet diversen Aufklebern nach: »No place for Nazis!« bzw. »No hay lugar para Nazis!« Was, frage ich mich im Vorbeigehen, ist mit den rechtsextremen Spackos, die weder Englisch noch Spanisch verstehen? Ziehen sie verwirrt ab, oder machen sie verärgert erst recht auf dicke Hose?
Über dem Coiffeur Fantasy hängen an der nächsten Ecke trotzig ein paar schlappe Deutschlandfähnchen. Ein Anblick, der mich bis heute irritiert. Daran hat auch der Event-Patriotismus eines fußballsiegestrunkenen Sommermärchens nichts ändern können. Mein Nationalgefühl ist zu diffizil für selbstberauschte Fahnenschwenkerei. Bewusstsein ja, Stolz nein. Natürlich sind da Kleist, Büchner und all die anderen, deren Sprache auch die meine ist, natürlich sind da Leistungen und Errungenschaften, auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber das Bewusstsein, dass etwas wie Auschwitz möglich war, verbietet es, so denke ich, von Stolz zu sprechen. So hat Heimat für mich auch kaum etwas mit Nation zu tun, obwohl ich schon wegen der Sprache eigentlich nicht woanders leben möchte.
Ein Naturkostladen neben einer Hertha-Fußball-Pinte. Einen halben Liter Schultheiß gibt es für knapp drei Euro, ein paar Meter weiter verlangt ein Wirt für die gleiche Menge Rioja das Sechsfache. Hier tobt kein Kulturkampf, es wird ganz sachlich nur verdrängt. »Und dann ging der Stadt die Luft aus«, kommentiert ein Banner im Schaufenster einer offensichtlich schon länger geschlossenen Kneipe, die einmal Freies Neukölln hieß. »Der Moloch war jetzt hell erleuchtet«, lese ich noch, bevor nach »die alten dicken Raucher waren« plötzlich Schluss ist. Ich versuche mir den restlichen Text zusammenzureimen, als mich ein Mann mit langen, leicht fettigen Haaren und geklebter Brille auf meinen Rucksack anspricht. Wo ich hinwolle, fragt er. Ich sage »nach Hause«, woraufhin er schnaubt. Dann kramt er ein altes Handy aus der Tasche und zeigt mir, nach einigen hektischen Wischbewegungen, ein Foto mit dem ganzen Text: »die alten dicken Raucher waren wegverschwunden und nicht nur zur Weihnachtszeit duftete alles nach Konsum. Das Stadtleben – gestaltet von Bewohnern und Besuchern – war jetzt endlich Kapital. Sie dankten allen Gästen und Nachbarn und machten das Licht aus. Schön war’s hier.« Als ich noch dabei bin, die Botschaft auszuloten, sagt der Mann, den ich auf Ende fünfzig schätze, »die Mieten«, und nach einem nächsten Schnauben, »die steigen hier wie nirgendwo sonst in dieser Stadt«. Und er, will ich wissen, wie kommt er damit klar? Ist das oder war das hier mal seine Heimat? Das Schnauben, das seine letzte Antwort sein soll, ist etwas tiefer als die ersten beiden, dann schlurft er davon und lässt mich einfach stehen.
Ich gehe den Hermannplatz entlang. Der Taxi-Halteplatz, an dem ich vor mehr als zwanzig Jahren vor allem nachts auf Kunden wartete. Fahrten, die mich auch in die entlegensten Ecken der Stadt führten, Fahrgäste aller Art und jeglichen Temperaments. Die Prostituierte, die von ihrem Zuhälter verdroschen worden war, das völlig verliebte Hochzeitspaar, die jungen Eltern mit ihrem Säugling direkt aus der Entbindungsstation, der Dealer, der seine Clubs abfuhr, der alte Mann, der allein von der Beerdigung seiner Frau kam, die er vor mehr als fünfzig Jahren geheiratet hatte. So lernte ich einiges kennen von Berlin. Im Ganzen begreifen oder gar verstehen kann ich diese Stadt jedoch bis heute nicht.
An Frankys Geburtstagsparty-Feuer in der Eisenschale bekomme ich sofort ein Bier. Er selbst gießt mit großem Schwung aus einem offenen Fass Spiritus in die Flammen. Einmal, zweimal, dreimal. Die meisten seiner gut zehn Gäste und sehr bald auch ich brüllen, er solle doch »verdammt noch mal sofort damit aufhören!«. Doch das stört ihn nicht. Im Gegenteil. Im flackernden Licht kann ich ihn besser sehen: Ich schätze ihn auf Anfang dreißig, er ist schlank, sein Haar ist strubbelig, seine Kleidung eng anliegend und schwarz, sein Gürtel voller Nieten. Ein Lenne-Punk – auweia! Weil das Feuer nicht vom Spiritus allein leben kann, wird einer zum Holzholen geschickt. Er verschwindet in der Dunkelheit, aus der alsbald krachende Geräusche zu uns dringen. Wenig später kommt Frankys Freund mit einem Stück Gartenzaun zurück, das kleingetreten in der Eisenschale landet. Ich bin beeindruckt, bekomme ein neues Bier und später noch eins und noch eins … auch eine Wurst und noch eine und ein Schweinenackensteak. Aus einem kleinen wird ein großer Abend, und ich bin mittendrin.
Im Volkspark Hasenheide steht Turnvater Jahn sehr aufrecht auf einem Sockel. Sein Blick ist stolz und stur, in seinem Rücken feilscht ein Rocker mit einem der vielen Dealer um den Preis für Drogen. Friedrich Ludwig Jahn hatte hier 1811 als Lehrer eines nahen Gymnasiums den ersten öffentlichen Turnplatz Deutschlands eröffnet, obwohl es Deutschland zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gab. Als Erfinder von Reck und Barren, die mir manche Schulsportstunde verleideten, war er mir nicht sonderlich sympathisch. Vor kurzem las ich aber von seinen Vaterländischen Wanderungen. Diese hielt er, wie er 1810 in Deutsches Volksthum schrieb, für
»[…] nothwendig, denn sie erweitern des Menschen Blick, ohne ihn dem Vaterlande zu entführen. Kennenlernen muß sich das Volk, als Volk; sonst stirbt es sich ab. […] Wandern, Zusammenwandern, erweckt schlummernde Tugenden […] und die edle Betriebsamkeit, das auswärts gesehen Gute in die Heimath zu verpflanzen.«3
Es ging ihm dabei um eine nationale Identität als Grundlage der angestrebten gemeinsamen Heimat. Ich musste bei diesen Zeilen an meine Wanderroute denken, die mich zwangsläufig durch mir unbekannte Gegenden, insbesondere im Osten Deutschlands, führen würde, durch viele Heimaten mir fremder Menschen und Mentalitäten.
Über dem Tempelhofer Feld tanzen große Lenkdrachen. Der stillgelegte Flughafen ist ein Versprechen auf die Weite Brandenburgs. Ich wünsche, Berlin läge schon hinter mir. Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Volksbefragung, bei der es darum ging, ob das ein paar hundert Hektar große Gelände an den Rändern bebaut werden sollte. Mit der Mehrheit stimmte ich dagegen. Ein Trotzreflex, weil mal etwas bleiben sollte, wie es ist, und weil mir das Vertrauen fehlte in die Berlin-Regierenden, denen nicht noch ein Flughafen anvertraut werden sollte.
Unter meinen Füßen kein Asphalt mehr, sondern etwas weniger harte Wiese. Ich kreuze die Wege von Joggern, Skatern und Touristen und lege mich ins Gras. Die Sonne strahlt, der satte, blaue Himmel lässt auf den Sommer hoffen, mein Blick folgt einzelnen Wolken von West nach Ost. Heimat, geht mir durch den Kopf, der geschützte und vertraute Ort der Kindheit, eine überschaubare Welt mit klaren Verhältnissen, in der ich einen sicheren Platz hatte. Ein Grundgefühl, das mit der Pubertät ins Wanken kam, weil sie abenteuerliche Fragen brachte, auf die ich naturgemäß nicht vorbereitet war. Es ging um den Sinn des Lebens und meinen Platz oder zumindest Weg in der Welt. Erste Antworten führten zu neuen Fragen, es entstanden Umdrehungen in diesem Lebens-Fragen-und-Antwort-Spiel, die am Ende meiner Zeit in Hohenlimburg immer schneller wurden und in den ersten Jahren in Berlin bisher nie mehr erreichte Spitzenwerte erzielten. Ich wollte das so, auch wenn es bisweilen schmerzhaft war. Mit der Zeit entstanden ein Gerüst, ein Kompass und schließlich ein Gespür, das mir meist hilft, meinen Weg zu finden.
Ein frischer Wind treibt mir Tropfen ins Gesicht. Ich öffne die Augen, sehe dunkle Wolken, eile runter von dem Feld und komme in das kleinbürgerliche Tempelhof, wo die Piefigkeit der alten Mauerstadt noch gut zu spüren ist. West-Berlin war in großen Teilen wesentlich provinzieller und spießiger, als es in all den Rückschauen heute wirkt. Doch wenn man frisch aus Hohenlimburg kam, fiel das nicht auf. Ich konzentrierte mich auf die Kneipen und Discos, die wir damals noch nicht Clubs nannten, und empfand das ganze Kultur- und Nachtleben als eine große Offenbarung. Die Stadt war eine Spielwiese, deren Angebote ich genoss.
Dazu bot West-Berlin, von der Mauer einmal abgesehen, viele konkrete Begegnungen mit den Spuren der jüngeren deutschen Geschichte. Es gab zahlreiche, der Bombardierung Berlins geschuldete Brachflächen, und der Potsdamer Platz war nichts anderes als ein großer Sandhaufen. In vielen ganz normalen Fassaden konnte man noch mit leichtem Gruseln Einschusslöcher aus dem Häuserkampf der letzten Kriegstage entdecken. Vor allem aber musste ich mich vor niemandem rechtfertigen, und was andere sagten, hatte nur eine Bedeutung, wenn ich es wollte. Eine Freiheit, die ich so nicht gekannt hatte.
In Steglitz und dann Zehlendorf wächst mit der Zahl der Villen die Zahl der Alarmanlagen, die Zahl der »Warnungen vor dem Hunde«, die Höhe der Zäune. Hier ist die Stadt mir einerlei. Ich bin froh, als ich an ihre Grenze komme.
Mein Blick verliert sich in Frankys Feuer. Ich kann mich nicht sattsehen an dem brennenden Holz, das erst zu Glut und dann zu Asche wird, während neue Flammen an anderer Stelle neues Holz zu ihrer Beute machen. Ein faszinierendes Schauspiel. Fing damit nicht alles an? Der Mensch lernt, das Feuer zu beherrschen, wird sesshaft und macht sich einen Ort vertraut. Ist die Basis von Heimat nicht eine archaische Gemeinschaft von Menschen, die um ein Feuer sitzt, das sie wärmt und schützt?
Neben mir steht ein junger, schlanker Mann. Er stammt aus Guinea, einer Militärdiktatur, die zu den ärmsten Ländern der Welt zählt. Sein Weg führte ihn vor eineinhalb Jahren durch den Senegal, Mauretanien, Algerien, Marokko, in einem kleinen Flüchtlingsboot über das Mittelmeer nach Spanien und schließlich hierher, nach Altena. Ich frage nach Einzelheiten seiner Flucht, er winkt ab, weil er alles vergessen hat, vergessen musste, um, wie er sagt, seine »Seele zu schützen«. Es gäbe da, er zeigt auf seine Schläfe, »zu viele böse Bilder«. Er hat Asyl beantragt und spricht schon leidlich Deutsch. In seiner alten Heimat hat er studiert, in Deutschland will er weiter lernen. Er mag Altena, die Leute sind nett zu ihm, vor allem Franky, der gerade aufs Neue Spiritus ins Feuer gießt, sei ein guter Mann. Dass immer mehr Asylbewerber kommen, macht ihm Sorgen. Natürlich hat er mitbekommen, dass Menschen wie er in Deutschland nicht nur willkommen sind. Ich frage ihn, ob er Heimweh hat, und er versteht die Frage nicht. Ich versuche, es zu erklären, was nicht viel hilft. Nein, nein, sagt er immer wieder, er wolle nicht zurück in das Land, aus dem er fliehen musste, um zu überleben. Altena soll seine Heimat werden.
»Heimweh« ist ein Schweizer Wort. Ende des 17. Jahrhunderts wurde die »unbefriedigte Sehnsucht nach der Heimat« erstmals als Morbus Helveticus beschrieben und bezog sich konkret auf die Leiden Schweizer Soldaten, die im Ausland dienten. Die »Krankheit« soll zu Entkräftung, Fieber und auch Stillstand des Herzens geführt haben. Das Singen von Heimatliedern war unter Androhung der Todesstrafe verboten.
Ein Kreuz aus Holz an einer Straßenecke in Kleinmachnow. Darauf der Name Karl-Heinz Kube und der Satz »Auf dem Weg in die Freiheit erschossen«. Ein Mauertoter, gestorben am 16. Dezember 1966. Da war Kube, ein Elektrokarren-Fahrer, siebzehn Jahre alt. Die Stasi notierte akribisch, dass er sich gegen Spenden für das kommunistische Vietnam aussprach und andere davon abhielt, in die FDJ einzutreten. Lieber hörte er die Musik einer »Gammler-Truppe« namens Beatles. Er stand kurz vor der Einweisung in eine Art Jugendgefängnis und wollte raus aus seinem Heimatland. Am Abend des 16. Dezembers 1966 durchschnitt er mit einem Freund einen Grenzzaun, überwand die erste Mauer, Stolperfallen sowie eine Sperre aus Stacheldraht. Die beiden hatten den Todesstreifen schon fast durchquert und nur noch einen hohen Eisenzaun zwischen sich und West-Berlin, als Soldaten einer Grenzpatrouille auf sie schossen. Kube und sein Freund retteten sich in einen Graben, versuchten zurück auf DDR-Gebiet zu kriechen und gerieten in das Schussfeld einer zweiten Patrouille. Zwei von vierzig Kugeln trafen tödlich in Kubes Kopf und Brust. Sein Freund landete im Gefängnis, die vier Grenzsoldaten bekamen Medaillen und eine kleine Feier mit kaltem Buffet. Kube verstehe ich als jemanden, dem seine Heimat zu eng geworden ist, der ahnte oder wusste, dass es noch ein anderes mögliches und gar besseres Leben für ihn geben könnte. Seine Sehnsucht und seinen Mut bezahlte er mit seinem Leben. Meine Wanderung, denke ich zum ersten Mal, ist ein Privileg.
So etwas Exotisches wie Ost-Verwandtschaft gab es in meiner Familie nicht, und was östlich der dreihundert Kilometer entfernten innerdeutschen Grenze lag, gehörte nicht zur Welt meiner Kindheit und Jugend. Für mich war die DDR ein fremdes Land, das ich, wenn überhaupt, nur aus den Nachrichten kannte. Die Bilder zeigten alte graue Männer aus Regierung und Politbüro, organisierten Jubel, auf Sieg getrimmte Sportler und Frauen mit Frisuren, die ich hässlich fand. Die Strebsamkeit, die dahinterstecken musste, schien mir viel deutscher, als ich es sein wollte. Und ich fand Kati Witt auch nie erotisch. So waren die Bürger der DDR für mich keine »Brüder und Schwestern«, sondern fremde Menschen, die sogar noch ein bisschen fremder waren als Engländer, Franzosen oder Italiener. Mit den deutschen »Brüdern« verband mich vielleicht eine gemeinsame Sprache, die Geschichte gemeinsamer geistiger Kultur, aber keine – für mich damals viel konkretere – Marken- und Erlebniswelt. Denn wichtig waren in meiner Jugend Antworten auf die Fragen: Levi’s oder Wrangler? Adidas oder Puma? Pepsi oder Coca-Cola? Die Aufregung, als in Hagen die erste McDonald’s-Filiale eröffnete. Der von ein paar Durchgeknallten in einem alten Hohenlimburger Kinoschuppen eröffnete Rockpalast, der Extrabreit, Abwärts, Fehlfarben und andere Bands der Neuen Deutschen Welle tatsächlich bis nach Hohenlimburg brachte, der uns Kleinstadt-Jungs Filme wie Easy Rider zeigte und ahnen ließ, was an Ausbruch und Revolte möglich war. Das hat mich geprägt. Mit den Menschen meiner Generation aus Ostdeutschland fehlten und fehlen solche gemeinsamen Erinnerungen und Bezugspunkte. Wir haben sozusagen nie zusammen Bonanza geschaut. Ganz anders ist es, nebenbei bemerkt und zum Glück, bei meiner 2002 geborenen Tochter, deren Grundschule in einem Berliner Ost-Bezirk lag. Ob nun ein Kind in Friedrichshain oder Kreuzberg aufwuchs, ob die Eltern aus der ehemaligen DDR oder der alten BRD stammen, ist für sie ganz und gar egal.
Erlebbar wurde die Mauer für mich erst, als ich 1986 nach West-Berlin kam. Hin und wieder tauchte sie, meist überraschend, am Ende einer Straße auf, die damit zur Sackgasse wurde. Der nackte Beton, die Grenzsoldaten in ihren grau-grünen Uniformen, die man bei ihren Beobachtungen beobachten konnte, wirkten vor allem bizarr. In Ostberlin war ich nur selten, und wenn, dann um ein Theater zu besuchen. Iphigenie auf Tauris in der Schumannstraße, kurz hinter dem Grenzübergang am Bahnhof Friedrichstraße. Erinnerungen an peinliche Kontrollen im Neonlicht, der sehr spezifische Geruch ostdeutscher Reinigungsmittel, kurze Gespräche mit Grenzbeamten, die sich wie Verhöre anfühlten und mir das Gefühl aufzwangen, hier nicht nur falsch und unerwünscht, sondern auch an irgendetwas schuld zu sein. Danach Spaziergänge wie durch eine andere Welt, die der, in der ich sonst lebte, Jahrzehnte hinterherzuhinken schien. Tatsächlich fühlte ich mich, wenn ich am Ende eines solchen Tages in der West-Berliner U-Bahn saß, befreit.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.