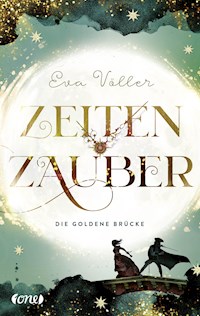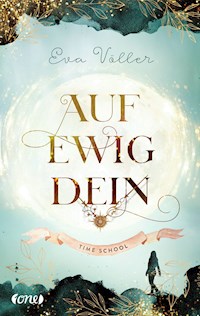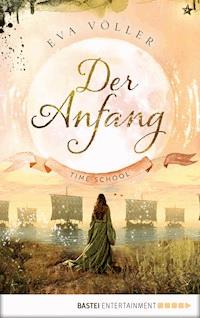11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalinspektor Carl Bruns
- Sprache: Deutsch
Aufwühlend, packend, herausragend: Die historische Krimi-Reihe von Bestseller-Autorin Eva Völler aus dem Essen der Nachkriegszeit geht weiter! Ein besonders heikler Fall landet 1949 auf dem Schreibtisch von Kriminalinspektor Carl Bruns: In Essen wurde der angesehene Richter Dr. Vahrendonk Opfer eines Giftmords. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Tote zu Hause ein wahrer Tyrann war und seine junge Ehefrau misshandelte, als er von ihrer Affäre erfuhr. Ist sie die gesuchte Mörderin? Plötzlich tauchen als Anklageschriften formulierte Vorwürfe auf, die Vahrendonk schwer belasten: Während der Nazizeit soll er aufs Grausamste seine Macht missbraucht haben. Durch die Urteile des Richters hat ein Vater seine Tochter verloren, ein Sohn seinen Vater, ein jüdischer Anwalt seine ganze Familie. Sie alle haben ein Motiv für den Mord. Doch für wen geht Vergeltung über alles? Ein Spannungsroman der Extraklasse Eva Völler ist die Bestseller-Autorin der »Ruhrpott-Saga«. Mit ihren historischen Kriminalromanen beweist sie erneut, dass sie mitreißende Geschichten erzählen kann, in denen auch die Liebe nicht zu kurz kommt. Ihre Krimi-Reihe erforscht authentisch und anschaulich die Verstrickungen von Polizei und Justiz in Nazi-Verbrechen und deren Aufarbeitung in der Nachkriegszeit. »Die Autorin verquickt auf hervorragende Weise eine Mordermittlung aus dem Ruhrgebiet im Jahr 1948 mit der Aufklärung eines Massakers an Zwangsarbeitern in Essen kurz vor dem Zusammenbruch des Naziregimes. […] Ein fantastisches Buch!« Westfälische Nachrichten über Helle Tage, dunkle Schuld Die Krimi-Reihe um Kriminalinspektor Carl Bruns ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Helle Tage, dunkle Schuld (1948) - Alte Taten, neuer Zorn (1949)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eva Völler
Alte Taten, neuer Zorn
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein besonders heikler Fall landet 1949 auf dem Schreibtisch von Kriminalinspektor Carl Bruns: In Essen wurde der angesehene Richter Dr. Vahrendonk Opfer eines Giftmords. Erste Ermittlungen ergeben, dass der Tote zu Hause ein wahrer Tyrann war und seine junge Ehefrau misshandelte, als er von ihrer Affäre erfuhr. Ist sie die gesuchte Mörderin? Plötzlich tauchen als Anklageschriften formulierte Vorwürfe auf, die Vahrendonk bezichtigen, während der Nazizeit aufs Grausamste seine Macht missbraucht zu haben. Durch die Urteile des Richters hat ein Vater seine Tochter verloren, ein Sohn seinen Vater, ein jüdischer Anwalt seine ganze Familie. Sie alle haben ein Motiv für den Mord. Doch für wen geht Vergeltung über alles?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Epilog
Nachwort
Der Dolch des Mörders war unter der Robe des Juristen verborgen.
(Aus der Urteilsbegründung des Nürnberger Juristenprozesses im Jahr 1947)
Prolog
Für Sie, Herr Doktor Vahrendonk«, sagte der uniformierte Wachmann, als er dem Richter die Pappschachtel überreichte. »Mit den besten Empfehlungen Ihrer Kollegen.«
Vahrendonk klappte die Schachtel auf. Keine Karte, wie er etwas irritiert feststellte, aber der Inhalt sprach für sich: Mandelhörnchen, sein Lieblingsgebäck. Eine nette Aufmerksamkeit, die er seinen Kollegen nicht unbedingt zugetraut hatte. Die meisten zeigten ihm gewohnheitsmäßig die kalte Schulter. Doch offenbar gab es sogar unter denen noch so was wie Anstand, schließlich war es ein runder Geburtstag. Er sog den Duft ein, der aus der Schachtel stieg. Es roch köstlich.
»Wer hat Ihnen die Schachtel gegeben?«, wollte Vahrendonk wissen.
»Die wurde eben von einem Boten angeliefert, wahrscheinlich direkt aus der Bäckerei«, sagte der Wachmann. »Der meinte, dass es für Sie zum fünfzigsten Geburtstag ist. Von den Kollegen.« Er hielt inne und fügte dann höflich hinzu: »Von mir übrigens auch noch herzlichen Glückwunsch zum Runden. Andere wären da längst zu Hause und würden feiern.«
»Bei mir steht die Arbeit an erster Stelle«, erwiderte der Richter. Er machte dem Wachmann die Tür vor der Nase zu und ging zurück zu seinem Schreibtisch. Das erste Hörnchen verschlang er mit wenigen Bissen, er war nach der vielen Arbeit ganz ausgehungert. Seit dem Mittagessen hatte er nichts zu sich genommen, und auch das hatte nur aus einem von daheim mitgebrachten Butterbrot bestanden. Eine Kantine gab es in den kläglichen Resten des einst so prachtvollen Gerichtsgebäudes nicht. Sogar vier Jahre nach Kriegsende war der gesamte Essener Justizbetrieb immer noch ein einziges Provisorium. Von Bomben durchlöcherte Wände, ausgebrannte Sitzungssäle, verrußte Arbeitsräume – es war ein Jammerspiel sondergleichen.
Man hätte längst einen Neubau hochziehen können, beim Polizeipräsidium schräg gegenüber war es viel schneller gegangen, denen hatte man voriges Jahr einen nagelneuen Seitenflügel hingestellt. Dagegen steckte man beim Gerichtsgebäude noch in den Planungen fest. Es hieß, dass es kommendes Jahr endlich losgehen sollte. Aber hatten sie das nicht letztes Jahr auch schon gesagt? Wem sollte man da noch glauben? Den Tommys jedenfalls nicht, und denen, die nach ihrer Pfeife tanzten, noch viel weniger. Die hängten ihr Mäntelchen doch alle nach dem Wind. Spielten das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel, wie es ihnen beliebte.
Das zweite Hörnchen aß der Richter mit Bedacht, hielt dann aber inne. Eine eiserne Faust presste seinen Brustkorb zusammen. Mit einem Mal bekam er keine Luft mehr, egal wie hastig er atmete. Und es tat weh! Es war, als würde er innerlich verbrennen.
Der Richter riss den Telefonhörer von der Gabel und wählte die Nummer des Wachdienstes, doch als endlich abgehoben wurde, brachte er nur noch ein Röcheln hervor. Bereits von den Krämpfen des Erstickens geschüttelt, rappelte er sich vom Stuhl hoch. Mit letzter Kraft schleppte er sich zur Tür und öffnete sie, aber es gab keine Rettung mehr. Und auch keine tröstlichen oder mitfühlenden letzten Worte. Die Etage war menschenleer. Wie so oft war er der letzte Richter im Gebäude, alle anderen machten gern zeitig Feierabend oder nahmen die Akten zur Bearbeitung mit nach Hause.
Unter qualvollen Zuckungen brach er zusammen und blieb zusammengekrümmt auf der Türschwelle liegen, halb auf dem Flur, halb im Zimmer. Während seine Wahrnehmungen nach und nach erloschen, zog in schlaglichtartigen Bildern sein Leben an ihm vorüber. Es blieben so viele Fragen offen. Nur eines wusste er mit absoluter Sicherheit: Seine Zeit war abgelaufen.
Kapitel 1
Carl zückte sein abgegriffenes Notizbuch und kritzelte ein paar Fakten auf eine freie Seite. Julius Vahrendonk, Vorsitzender Richter am Landgericht Essen, dem ersten Anschein nach vergiftet. Blitzlichtgewitter erhellte das karge Arbeitszimmer, in dem nicht viel mehr stand als ein Schreibtisch, ein Schrank und ein Regal voller Akten und Gesetzesbücher. Der Polizeifotograf knipste den Toten aus allen möglichen Blickwinkeln, während der Bestatter im Hintergrund bereits auf seinen Einsatz wartete.
»War wohl ein hohes Tier hier am Gericht, oder?«, erkundigte sich Carls junger Kollege Harry mit leiser Stimme.
»Scheint so«, gab Carl zurück, ebenfalls in gedämpftem Ton.
Vor ihnen hatten sich schon erstaunlich viele Schaulustige eingefunden, und es kamen immer noch weitere dazu. Mittlerweile waren es über ein Dutzend, die sich grüppchenweise im Gang versammelt hatten, lauter distinguiert wirkende Herren. Die meisten kannte Carl vom Sehen. Den Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Den Vizepräsidenten des Landgerichts. Dann war da noch ein höherer Beamter aus der Stadtverwaltung und ein anderer aus der Chefetage des Polizeipräsidiums.
Bei den übrigen handelte es sich um Kollegen des Verstorbenen, Richter und Staatsanwälte am Landgericht Essen; einigen war Carl schon bei früheren Anlässen persönlich begegnet. Als Kriminalbeamter wurde er regelmäßig als Zeuge zu Strafprozessen geladen.
Ein junger Wachtmeister hatte den Toten gefunden. Der Schreck war ihm noch anzumerken, er war blass um die Nase, und seine Stimme zitterte, während er Carls Fragen beantwortete.
»Als ich ihm die Schachtel brachte, wirkte er noch ganz munter. Hab ihm noch zum fünfzigsten Geburtstag gratuliert. Ungefähr zehn Minuten später hat er mich auf der Hausleitung angerufen.«
»Was hat er gesagt?«, fragte Carl.
»Nichts. Ich konnte nur ein Stöhnen hören.«
»Woher wollen Sie dann wissen, dass er es war?«
»Weil außer ihm keiner mehr da war. Er geht oft als Letzter. Ging als Letzter«, korrigierte der Wachmann sich.
»Was geschah dann?«
»Ich bin raufgegangen, um nachzusehen. Und da lag er hier in der Tür. Mausetot. Zuerst dachte ich: Schlaganfall. Oder Herzinfarkt. Hat man ja oft bei älteren Männern.«
Der Wachmann war Anfang zwanzig. Für jemanden in diesem Alter war jeder über vierzig dem Greisentum gefährlich nahe.
»Dann hab ich gesehen, dass er Schaum vorm Mund hat«, fuhr der Wachmann fort. »Und der Geruch war auch komisch.« Mit entwaffnender Offenheit fügte er hinzu: »Da dachte ich so bei mir: Heinrich, nimm dir besser keins von diesen Hörnchen, auch wenn der arme Mann sie jetzt nicht mehr essen kann!«
Carl stellte die entscheidende Frage. »Von wem stammt die Schachtel?«
»Ein Bote kam damit an.«
»Zu Ihnen in die Wachstube?«
»Nein, ich stand ja unten beim Eingang, hab da gerade eine geraucht. Hab den Mann gefragt, wo er hinwill. Und da sagte er: zu Richter Vahrendonk. Er hätte ein Geschenk zum fünfzigsten Geburtstag, von den Kollegen.«
»Was war das für ein Bote? Postbote? Gerichtsbote?«
Der Wachmann zuckte die Achseln. »Nein, einfach nur ein Bote. Hab den vorher noch nie hier gesehen. Ich dachte, der wäre ein Lieferant von der Bäckerei.«
»Hatte er irgendwas Schriftliches dabei? Eine Glückwunschkarte oder einen Lieferschein?«
»Nein, nur die mündliche Nachricht, dass es ein Geburtstagsgeschenk für Richter Vahrendonk ist, zum Fünfzigsten, von den Kollegen«, wiederholte der Wachmann.
»Was hat er sonst noch gesagt?«
»Nichts. Bloß dass ich es sofort überbringen soll. Dann ist er wieder gegangen.«
»Wie sah er aus?«
Der Wachmann dachte nach. »Ganz normal.«
»Alter?«
»Weiß nicht. So wie ich vielleicht. Oder jünger? Könnte aber auch älter gewesen sein.«
»In meinem Alter?«
»Nein, so alt auf keinen Fall.«
Carl, der kürzlich neununddreißig geworden war, seufzte im Stillen. Nicht wegen seines fortgeschrittenen Alters, sondern weil der Wachmann als Zeuge ein Reinfall war – ein Eindruck, der sich bei den nächsten Antworten noch verfestigte. Demnach war der Bote von unbestimmter Körpergröße und wahrscheinlich braunhaarig. Möglicherweise aber auch blond, das habe man nicht genau erkennen können, weil er eine Schirmmütze getragen hatte. Vielleicht aber auch eine Kappe oder einen Hut. Ob er einen Bart oder Schnurrbart gehabt hatte? Schwer zu sagen, so genau hatte der Wachmann nicht hingeschaut, und an die Stimme könne er sich auch nicht erinnern. Und ob er jetzt endlich heimgehen dürfe, seine Mutter warte sicher schon mit dem Essen.
Carl insistierte nicht weiter, es hatte keinen Zweck. Er würde den Mann in ein paar Tagen noch einmal befragen. Vielleicht kehrten die Erinnerungen zurück, sobald sich die Aufregung gelegt hatte.
Kaum hatte der Wachmann das Feld geräumt, kam einer der im Gang versammelten Herren näher, seines Zeichens Oberstaatsanwalt am Essener Landgericht. Es handelte sich um einen massigen Mann in den Fünfzigern, den Carl noch als ausgesprochenen Hungerhaken in Erinnerung hatte. Vor weniger als zweieinhalb Jahren, im Winter 1946/1947, war er so dünn gewesen, dass er fast in seiner Robe ertrank. Inzwischen wog er sicher an die fünfundzwanzig Kilo mehr. Nach der Währungsumstellung im vergangenen Jahr war die Nahrungsmittelversorgung wieder in Gang gekommen, und manche stopften sich mit Essen voll, als gäbe es kein Morgen.
»Guten Tag, Herr Inspektor.«
»Herr Oberstaatsanwalt.« Carl schüttelte ihm die Hand und deutete dann auf Harry. »Mein neuer Kollege, Kriminalassistent Harry Bloom.«
»Angenehm«, sagte Harry.
»Ebenfalls.« Der Oberstaatsanwalt wirkte ein wenig irritiert. Ihm war anzusehen, was er dachte: Für einen einfachen Kriminalassistenten war dieser junge Schnösel außerordentlich gut angezogen.
Auch bei den Kollegen im Polizeipräsidium wurde lebhaft darüber spekuliert, was von Harry zu halten war. Von seinem armseligen Polizistengehalt konnte er sich seine vornehme Aufmachung jedenfalls nicht leisten. Der gewöhnliche Essener Kripobeamte kleidete sich in billige, oft heruntergekommene Anzüge ohne jede Fasson. Das galt auch für Carl; sein gesamtes Zeug war abgetragen und fadenscheinig. Er war schon froh, wenn er jeden Tag ein frisches Hemd anziehen konnte.
Harry Bloom hingegen trug täglich wechselnde, passgenau sitzende Sakkos, dazu Manschettenknöpfe aus fein ziseliertem Silber, perfekt gebundene Krawatten und elegante, auf Hochglanz polierte Schuhe. In der Abteilung wusste niemand, woher er das Geld für solche modischen Finessen nahm, doch es war nicht von der Hand zu weisen, dass er welches besitzen musste. Unter den Kollegen wurde gemunkelt, er habe geerbt. Anfangs hatte man sich im Büro über den geschniegelten Neuling lustig gemacht, ihm sogar hier und da spaßeshalber hinterhergepfiffen, aber weil es ihn nicht im Mindesten zu stören schien, hatte die Aufmerksamkeit nachgelassen. Mittlerweile war man übereingekommen, dass er eindeutig ein netter Kerl war, mit dem es sich gut zusammenarbeiten ließ, auch wenn er ein wenig aus dem Rahmen fiel. Er hatte diese besondere Art zu lächeln, was automatisch zu besserer Laune beitrug.
Selbst der Oberstaatsanwalt war nicht immun gegen Harrys Charme. »Sind Sie schon lange bei der Essener Kripo?«, erkundigte er sich.
»Seit drei Monaten.«
»Sie sind nicht von hier, oder? Woher kommen Sie?«
»Aus Westberlin«, sagte Harry.
»Waren Sie da auch schon bei der Polizei?«
»Ja, aber nicht als Ermittler, sondern als Übersetzer für die Amerikaner.«
Viel mehr hatte auch Carl bisher nicht über Harrys berufliche Vergangenheit erfahren, und über sein Privatleben hüllte sein junger Kollege sich erst recht in Schweigen. Neugierige Fragen beantwortete er regelmäßig mit freundlichen Floskeln.
»Was hat Sie in den Kohlenpott getrieben?«, fragte der Oberstaatsanwalt.
»Man hört viel Gutes über das Ruhrgebiet«, meinte Harry vage. »Hier findet der wirkliche Wiederaufbau des Landes statt.«
Der Oberstaatsanwalt verlor das Interesse und konzentrierte sich wieder auf den aktuellen Fall. »Ein natürlicher Tod ist anscheinend ausgeschlossen, oder?«, wandte er sich an Carl. Ein Hauch von Resignation schwang in seiner Stimme mit, fast so als hegte er die Hoffnung, es möge anders sein.
»Momentan sieht es für mich eher nach einer Vergiftung aus«, bestätigte Carl. »Kannten Sie den Richter?«
»Natürlich. Hier bei Gericht war Julius Vahrendonk eine feste Größe. Unlängst hat er sein zwanzigjähriges Dienstjubiläum begangen. Seine Chancen, eines Tages Landgerichtspräsident zu werden, standen nicht schlecht.«
Carl schrieb einige unleserliche Kürzel in sein Notizbuch. »Gibt es Konkurrenten, die sich ebenfalls Hoffnung auf so einen Karrieresprung machen?«
»Konkurrenten hat jeder. Auch bei Gericht.«
»Ich will es mal anders formulieren: Könnte der nächste Landgerichtspräsident nicht auch aus den Reihen der Staatsanwaltschaft kommen?«
»Damit meinen Sie wohl mich«, konstatierte der Oberstaatsanwalt trocken.
Carl widersprach nicht. »Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie schon länger im Dienst als Richter Vahrendonk.«
»Sie machen Ihre Hausaufgaben, was?«
»Das gehört zu meiner Arbeit.«
»Nun denn«, meinte der Oberstaatsanwalt im Plauderton. »Ich will nicht ausschließen, dass ich wirklich irgendwann Gerichtspräsident werde. Aber ganz sicher würde ich dafür niemanden um die Ecke bringen. Oder wollten Sie das etwa andeuten?«
»Wo denken Sie hin?«, gab Carl verbindlich zurück. »Könnte es denn unter den übrigen Kollegen jemanden geben, der so weit gehen würde?«
Die eben noch leutselige Miene des Oberstaatsanwalts wurde kühl. »Ist das eine ernsthafte Frage? In welche Richtung soll das hier gehen?«
»Ich stehe mit den Ermittlungen noch am Anfang und muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Konkurrenzkampf kann ein mächtiges Motiv sein.«
»Das ist absurd. Zumindest in diesem Fall. Unser derzeitiger Präsident hat noch viele gute Jahre vor sich, der Posten steht also gar nicht zur Disposition. Außerdem gibt es noch einen Vize, der auch schon lange dabei ist. Vahrendonk war Kammervorsitzender, also ziemlich weit oben auf der Leiter. Ich wüsste niemanden, der ihm das streitig machen wollte.«
»Es gibt auch andere Arten von Konkurrenz. Jede Menge Möglichkeiten, sich bei der Arbeit gegenseitig auf die Füße zu treten. Ist Ihnen da irgendwas zu Ohren gekommen? Querelen mit Untergebenen, Streit unter Kollegen?«
»Soll das jetzt ein Verhör werden, Herr Inspektor?« Der Oberstaatsanwalt wartete die Antwort gar nicht erst ab. »Suchen Sie die Nadel im richtigen Heuhaufen, Bruns. Wo das ist, muss ich Ihnen nicht extra sagen, Sie sind lange genug dabei.« Mit diesem Rüffel ließ der Oberstaatsanwalt ihn stehen und gesellte sich zu einer Gruppe von Juristen, die ein paar Schritte weiter leise miteinander palaverten, allesamt in mittleren Jahren und gediegen gekleidet. Zwei Strafrichter und zwei Staatsanwälte, Carl kannte sie aus diversen Verhandlungen.
Forschend betrachtete er die Gesichter der Männer, suchte nach Anzeichen echter Anteilnahme oder gar aufrichtiger Trauer, doch davon war nichts zu sehen. Allenfalls wirkten sie betroffen, vielleicht sogar besorgt. Sie hatten ihren Feierabend sausen lassen und waren hierhergeeilt, kaum dass sie von Vahrendonks Tod Wind bekommen hatten. Warum? Wollten sie sich mit eigenen Augen davon überzeugen, wie er gestorben war? Hofften sie, hier irgendetwas Bestimmtes in Erfahrung zu bringen? Oder hatte die schiere Sensationslust sie hergetrieben?
Dieselbe Frage stellte sich bei den übrigen Amtsträgern, die sich auf dem Gang versammelt hatten. Einer von ihnen steuerte gerade auf Carl und Harry zu – es war der persönliche Referent des Polizeichefs, einige Jahre jünger und deutlich schlanker als der Oberstaatsanwalt. Und ebenfalls Jurist, die gab es auch in der höheren Verwaltung zuhauf. Nach einer knappen Begrüßung kam er ohne Umschweife zur Sache.
»Dieser Fall hat oberste Priorität«, sagte er, mit ernster Miene seine schwere Hornbrille zurechtrückend. »Der Chef legt äußersten Wert darauf, dass Sie mit Hochdruck ermitteln. Ihre anderen Fälle können Sie delegieren. Das ist eine amtliche Weisung. Wir wollen Ergebnisse sehen, und zwar schnell. Richten Sie sich auf Überstunden ein.«
»Kein Problem, die mache ich sowieso ständig«, sagte Carl. »Momentan auch wieder.«
Der Referent musterte ihn scharf, offenbar in der – zutreffenden – Annahme, Carls Antwort könne sarkastisch gemeint sein.
»Oh, und noch was: Alle Berichte und Protokolle gehen in Abschrift an mich. Ich will, dass jedes Blatt Papier auf meinem Schreibtisch landet. Haben wir uns verstanden?«
»Klar«, sagte Carl höflich.
»Finden Sie den Schweinehund, der das getan hat!«, sagte der Referent. Er war bereits im Weggehen begriffen und sprach über die Schulter, so laut, dass alle Umstehenden es hören konnten. Allerdings verpuffte die Wirkung ein wenig, weil Carl sich bereits abgewandt hatte und wieder in seine Notizen vertieft war.
»Was meinte der Oberstaatsanwalt vorhin mit dem richtigen Heuhaufen?«, wollte Harry von Carl wissen.
»Das Privatleben des Opfers«, antwortete Carl. »Seine Familie.«
»Gehen wir da jetzt hin?«
»Später. Erst wenn wir hier fertig sind. Und das kann noch dauern.«
Tatsächlich dauerte es noch über eine Stunde. Carl und Harry teilten sich die Arbeit. Nicht jedem passte es in den Kram, von der Polizei nach seinem persönlichen Verhältnis zu Richter Vahrendonk befragt zu werden, doch die meisten Anwesenden waren Juristen und kannten das Prozedere bei Mordermittlungen: Wer sich ungebeten an einem Tatort einfand, musste sein Erscheinen begründen können. Hier und da ernteten Carl und Harry ein Augenrollen oder entnervt hochgezogene Brauen, aber offener Widerspruch erhob sich nicht.
Wie Carl schon vermutet hatte, fielen die Erklärungen eher mau aus. »Warum ich hier bin? Das liegt doch auf der Hand!«, sagte etwa der Stellvertreter des Oberbürgermeisters. »Es ist im öffentlichen Interesse. Herr Doktor Vahrendonk war eine hochgestellte und wichtige Persönlichkeit.«
»Er war ein langjähriger Berufskollege und wurde an seinem Arbeitsplatz ermordet«, hörte Carl vom Nächsten. »Da will man doch sofort Genaueres wissen! Wir arbeiten ja schließlich ebenfalls hier!«
Das war in der Tat ein schlagendes Argument. Carl ergänzte seine Notizen.
Der Bestatter und seine Gehilfen hüllten den Toten in ein Laken und trugen ihn weg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sollte der Leichnam zur Gerichtsmedizin gebracht und schnellstmöglich obduziert werden.
Nach und nach leerte sich der Gang vor dem Amtszimmer des Richters. Schließlich hatte auch der letzte der Anwesenden seine Erklärungen zu Protokoll gegeben und sich verabschiedet.
Nur ein Mann wartete noch schweigend im Hintergrund. Carl schätzte ihn auf Ende vierzig, auch wenn die verhärmten Züge und das schüttere, grau gesträhnte Haar ihn älter wirken ließen. Seine Nase stand wie ein höckeriger Zinken im Gesicht, vermutlich bei einem Unfall oder einer Schlägerei gebrochen und anschließend schief zusammengewachsen. Seine Kleidung war um einiges schlichter als die der anderen Besucher. Er trug einen schäbigen Trenchcoat, bei dem ein Knopf fehlte, dazu eine ausgebeulte Hose und ausgetretene Schuhe von undefinierbarer Farbe.
»Brinkmann«, stellte er sich Carl und Harry vor. »Josef Brinkmann von der NRZ. Können Sie schon etwas zum Stand der Ermittlungen sagen?«
»Nein«, erwiderte Carl kurz angebunden. Die Presse hatte ihm bei diesem Fall gerade noch gefehlt! Im vergangenen Jahr hatte er eigene Erfahrungen mit der Journaille gemacht, auf die er gerne hätte verzichten können. Das eine oder andere Blatt hatte ihn zwar als eine Art Nazijäger in den Himmel gelobt, aber nicht in allen Artikeln war er gut weggekommen. Der Tod von zwei altgedienten Kollegen war nichts, dessen man sich rühmen konnte, nicht mal dann, wenn sie bei SS-Verbrechen mitgemacht und jede Menge Blut an den Händen kleben hatten. Das, was in der Öffentlichkeit hängen geblieben war, beschränkte sich darauf, was für ein Sauhaufen die Essener Polizei doch sei.
Im Präsidium wurde Carl deswegen immer noch schief angesehen. Hinter seinem Rücken tuschelte man über den Nestbeschmutzer, der den Ruf der Kripo ruiniert hatte – er hatte die Mauer des einvernehmlichen Schweigens niedergerissen und ein Stück der grauenhaften Vergangenheit ans Licht geholt.
Die meisten Essener Reporter waren ihm seitdem bekannt; fast alle hatten ihn interviewen wollen, und wenn er sich geweigert hatte, war trotzdem irgendwas über ihn und den Fall erschienen.
Von diesem Josef Brinkmann hatte er allerdings noch nie gehört, der musste neu sein.
Auf dem Weg nach draußen blieb er Carl und Harry dicht auf den Fersen. Offenbar einer von der hartnäckigen Sorte.
»Vermuten Sie den Täter in den Kreisen der Justiz?«, wollte er wissen. »Oder sieht es eher nach einem privat motivierten Mord aus?«
Carl hatte nicht vor, Brinkmanns Fragen zu beantworten. Draußen ging er schneller, um den Mann abzuhängen. Harry hielt mühelos mit ihm Schritt und blieb an seiner Seite.
Doch der Reporter folgte ihnen auf dem Fuße, am Ende rannte er fast. Keuchend trabte er neben Carl her. »Kommen Sie, haben Sie ein Herz! Ich bin seit drei Monaten bei der NRZ und brauche endlich einen richtigen Aufmacher! Ich war in Gefangenschaft, Mann! Geben Sie mir eine Chance!« Es klang so aufrichtig verzweifelt, dass Carl Mitleid bekam und sein Tempo ein bisschen verlangsamte. Sie waren sowieso fast da. Vom Gerichtsgebäude bis zum Haupteingang des Polizeipräsidiums war es nicht weit, nur schräg über die Straße und ein Stück ums Gebäude herum.
»Wir haben mit den Ermittlungen eben erst begonnen und können daher nichts zu dem Fall sagen«, meinte er mit bemühter Höflichkeit.
»Also gibt es noch keinen bestimmten Verdacht?«
»Nein.«
»Keine Vermutung zum Täter?«
»Nicht die geringste.«
»Könnte es mit Vahrendonks richterlicher Tätigkeit unter den Nazis zusammenhängen? Oder eher mit dem, was man sich über seine Frau erzählt?«
Carl blieb abrupt stehen. Harry, der es zu spät merkte, stoppte erst ein Stück weiter und kam zurück.
»Was wissen Sie denn über Vahrendonks richterliche Tätigkeit während der Nazizeit?«, wollte Carl von Brinkmann wissen.
»Nicht besonders viel. Nur das, was ich vorhin so nebenher im Gang aufgeschnappt habe.« Brinkmann war immer noch außer Puste vom raschen Laufen. Er drückte sich die Hand in die Seite und schnaufte ein paarmal. »Da hieß es, er sei eine Zeit lang beim Sondergericht für Erbgesundheit gewesen.«
Carl musste gegen eine Aufwallung von Übelkeit ankämpfen, so wie immer, wenn er bestimmte Begriffe hörte. Erbgesundheit war so ein Wort. Es stand für die Reinhaltung der arischen Herrenrasse. Für die Ausmerzung lebensunwerten Lebens. Für all die unmenschliche Grausamkeit, mit der die Nazis ein ganzes Land in eine Hölle aus Blut und Asche geführt hatten.
»Was haben Sie sonst noch von den Unterhaltungen im Gang mitgekriegt?«, fragte Carl. »Was war da mit seiner Frau?«
»Sybille. Die soll nur ungefähr halb so alt sein wie er und ein Auge auf einen anderen geworfen haben.«
»Auf wen?«
»Auf jemanden namens Albrecht. Keine Ahnung, wer der Kerl ist.«
»Von wem genau haben Sie das gehört?«
»Da stand eine Gruppe Juristen, die Namen kenne ich nicht. Sie haben sich drüber unterhalten. Ganz leise. Aber ich habe sehr gute Ohren. Einer von denen war so ein Dicker, mit dem hatten Sie als Erstes gesprochen. Jemand aus der Gruppe sagte zu ihm, dass es dem Kollegen Albrecht bestimmt nicht gut zu Gesicht stehen würde, wenn sein Verhältnis mit Vahrendonks Frau Sybille publik würde. Zumal die Frau nur halb so alt sei wie ihr verblichener Gatte und die Ehe das reinste Debakel. Worauf der Dicke meinte, dass das ein offenes Geheimnis sei, auf dem man nicht noch herumreiten müsse, denn das würde nur das Ansehen des Toten und der Justiz beschädigen.«
Sieh einer an, dachte Carl. Es gab anscheinend schmutzige Wäsche im Privatleben des Toten, sogar der Oberstaatsanwalt hatte davon gehört. Damit stand fest, dass an der Sache was dran war. Genug für einen Verdacht gegen die Ehefrau. Vielleicht auch gegen besagten Albrecht. Bei dem es sich nur um Doktor Burkhard Albrecht handeln konnte, einen der Staatsanwälte am Landgericht Essen. Carl kannte ihn von diversen Strafsachen, in denen er ermittelt hatte. Ein hochnäsiger Bursche.
Brinkmann holte tief Luft. »Mehr habe ich momentan nicht zu bieten. Doch wenn Sie wollen, kann ich mich mal umhören. Dabei finde ich bestimmt noch das eine oder andere raus.«
»Tun Sie das. Aber kommen Sie dabei bloß nicht auf die Idee, im Namen der Ermittlungsbehörden aufzutreten.«
»Was glauben Sie denn von mir?«, gab Brinkmann zurück. Seine Entrüstung war ein bisschen zu dick aufgetragen. Als Reporter konnte er zweifellos einiges einstecken. »Ich recherchiere mit meinen eigenen Methoden. Ganz offen und ehrlich.« Er hielt inne. »Wir könnten uns ja über unsere Erkenntnisse austauschen«, schlug er dann vor.
Diese absurde Idee quittierte Carl nur mit einem kurzen Schnauben. Nichtsdestotrotz notierte er sich die Anschrift des Reporters. Als Zeuge konnte der Mann noch von Nutzen sein.
»Schönen Abend noch!«, rief Brinkmann ihnen nach, als Carl und Harry das Polizeipräsidium betraten.
»Der hat’s bestimmt nicht leicht«, meinte Harry drinnen. »Nach der Gefangenschaft zurück in den Beruf, und das in seinem Alter – ist sicher hart.«
»Andere haben es auch schwer«, sagte Carl lapidar. Es gab Hunderttausende von Kriegsheimkehrern, und längst nicht alle hatten in Lohn und Brot zurückgefunden. Viele von ihnen waren berufsunfähig, weil sie verstümmelt oder erblindet oder einfach nur seelisch zu kaputt waren. Andere hatten zwar Arbeit, kamen aber privat nicht mehr auf die Beine. So wie sein Nachbar Kurt Böhm, ein Witwer, der mit seiner kleinen Tochter Bärbel im selben Mietshaus wohnte wie Carl. Böhm hatte im Krieg eine Hand verloren und danach obendrein ein Jahr in französischer Gefangenschaft zugebracht, doch sein früherer Arbeitgeber hatte ihn nicht fallen lassen, sondern als Pförtner wiedereingestellt. Trotzdem war Kurt Böhms Leben eine einzige Katastrophe. Er war ein Säufer und Spieler und vernachlässigte das Kind.
»Entschuldigung«, platzte Harry heraus. Er wirkte peinlich berührt. »Ich wollte keine alten Wunden aufreißen.«
Es dauerte einen Moment, bis Carl begriff, worauf Harry anspielte.
»An mich selber hab ich gerade überhaupt nicht gedacht«, brummte er, und in diesem Fall stimmte es sogar.
»Aber jetzt denken Sie dran, oder?«, erkundigte Harry sich reumütig. »Tut mir leid.«
Carl hatte keine Lust, das Thema zu vertiefen. Er hatte seinen Beruf geliebt, und als die Nazis ihm den weggenommen hatten, war für ihn eine Welt zusammengebrochen. Mit den harten Jahren danach, als Bergmann unter Tage, hatte er sich arrangiert, auch mit dem Scheitern seiner Ehe. Aber wie widerlicher Abschaum behandelt zu werden, nur weil sein Großvater Jude gewesen war – das würde er nie vergessen. Und erst recht nicht den Selbstmord seines Vaters nach den blindwütigen Pogromen im November 1938.
Es war spät, Carl und Harry waren allein im Büro. Der neue Mordfall war gegen halb sechs hereingekommen, da hätten sie schon längst zu Hause sein können – wenn sie rechtzeitig Feierabend gemacht hätten. Dann wäre jemand vom Spätdienst dran gewesen. Doch die waren alle in anderen Fällen unterwegs, also hatte Carl einspringen müssen, weil er noch am Schreibtisch gesessen hatte. Ebenso wie Harry, der es sich aus irgendwelchen Gründen zur Devise erkoren hatte, genauso lange im Büro zu bleiben wie Carl, egal wie viele unbezahlte Überstunden er sich damit aufhalste. Anscheinend hatte er kein Privatleben. Oder falls doch, war es ihm nicht so wichtig.
»Gehen wir jetzt zu der Familie des Toten, oder wollen Sie das auf morgen verschieben?«, erkundigte Harry sich.
»Ich habe vor, noch hinzufahren, aber das kann ich auch ohne Sie machen, da müssen Sie nicht unbedingt mit.«
»Würde ich aber gerne.«
»Na schön. Schauen Sie doch mal, ob ein Wagen da ist.«
Während Harry sich draußen im polizeilichen Fuhrpark umtat, spitzte Carl seinen stumpf gewordenen Bleistift und fluchte dabei über das vorsintflutliche Gerät. Die Kurbel war so ausgeleiert, dass sie ständig aus dem Gewinde sprang. Ganz zu schweigen von der schartigen Klinge, unter der andauernd die empfindliche Bleispitze abbrach. Ein beständiges Ärgernis, vor allem für Carl, der nie ohne frisch gespitzten Bleistift und Notizbuch zu seinen Einsätzen ging.
Neue Stifte waren Mangelware, genauso wie Papier und frische Tinte, von Farbbändern für die Schreibmaschine gar nicht zu reden. Manche Dinge gab es trotz Währungsreform und Wirtschaftsaufschwung immer noch nicht in ausreichender Menge, vor allem nicht bei der notorisch unterfinanzierten Polizei.
Aber dafür schien es mit dem Auto ausnahmsweise zu klappen. Draußen hupte es. Harry hatte einen passenden Wagen gefunden.
Im vergangenen Jahr war endlich das Angebot an Streifenwagen aufgestockt worden. Einige davon waren sogar mit Funk ausgestattet, das Allerneueste auf dem Gebiet moderner Einsatzleitung. Doch die waren immer schnell weg. Übrig blieben die alten Vorkriegsrostlauben oder bestenfalls die zusätzlich angeschafften, offenen Knatterkisten der Marke Volkswagen, bei denen die Seitenbereiche mit Stoff bespannt waren. Ob aus Gründen der Sparsamkeit oder wegen des immer noch anhaltenden Metallmangels – jedenfalls war es ein skurriler Anblick. Keiner fuhr gern damit, schon gar nicht bei schlechtem Wetter.
Das von Harry organisierte Auto hatte zum Glück ein Dach, was bei der zunehmenden Abendkühle eindeutig von Vorteil war.
Die Fahrt dauerte nicht lange, es waren nur ein paar Kilometer. Vahrendonk hatte in Bredeney gewohnt. Sein Haus befand sich in einer ruhigen Seitenstraße. Das Bombeninferno des Luftkriegs schien an dieser Villengegend spurlos vorübergegangen zu sein. Falls es hier irgendwo Schäden gegeben hatte, waren sie längst beseitigt. Noble Wohnhäuser standen inmitten blühender, sorgsam gepflegter Gärten, umgeben von schmiedeeisernen Zäunen und altem Baumbestand. Hier lebte die Hautevolee von Essen in friedvoller Abgeschiedenheit.
Mit der üblichen Zwangseinquartierung von Displaced Persons mussten die Bonzen dieser Gegend sich nicht herumschlagen – sie hielten sich die Inspektoren vom Wohnungsamt regelmäßig vom Hals, indem sie scharenweise Bedienstete bei sich unterbrachten, und sei es nur auf dem Papier.
Im Vergleich zu den Nachbargebäuden wirkte Vahrendonks Haus nicht übermäßig feudal, aber imposant genug, um einen Eindruck von Wohlstand zu vermitteln. Auf Carls Läuten hin öffnete eine ältere Frau mit streng zurückgekämmtem grauem Haar. Ihr unauffälliges Auftreten spiegelte sich in ihrer schlichten Kleidung wider – sie trug ein einfach geschnittenes dunkles Tageskleid und flache, schon leicht abgewetzte Hausschuhe.
»Guten Abend, wen darf ich melden?«, erkundigte sie sich höflich, woraus Carl den naheliegenden Schluss zog, dass sie zum Personal gehörte. Sie mochte Ende fünfzig, Anfang sechzig sein, eine farblose, blasse Person ohne hervorstechende Eigenschaften. Abgesehen von der tiefen Erschöpfung, die sich auf ihrem schmalen Gesicht zeigte. Anscheinend hatte sie einen langen, anstrengenden Tag hinter sich.
»Inspektor Bruns, Kripo Essen. Das ist mein Kollege, Kriminalassistent Bloom.«
Sie nickte, als hätte sie bereits damit gerechnet, dass jemand von der Polizei auftauchen würde. Ihre nächsten Worte bestätigten Carls Vermutung.
»Frau Vahrendonk weiß schon Bescheid«, sagte sie leise. »Herr Doktor Albrecht hat ihr die Nachricht überbracht. Er ist jetzt bei ihr.«
»Darf ich Ihren Namen erfahren?«, fragte Carl.
»Mertens. Isolde Mertens. Ich bin die Haushälterin.«
Sie führte Carl und Harry durch das großzügige Vestibül zu einer doppelflügeligen Tür, die sie nach kurzem Anklopfen öffnete. Von drinnen war klassische Musik zu hören. Händel, wie Carl nach wenigen Takten erkannte. Sein Großvater hatte eine umfangreiche Plattensammlung mit klassischer Musik besessen, Carl hatte die Stücke immer noch im Ohr.
»Die Polizei ist da«, sagte Isolde Mertens.
»Soll reinkommen«, übertönte eine Männerstimme die Musik.
Carl erfasste beim Betreten des Salons mit raschem Rundblick das Mobiliar aus schwerer Eiche, die Perserteppiche und die Samtportieren. Ein Kronleuchter verbreitete ein angenehm mildes Licht. Die Musik stammte von einem Plattenspieler, der auf einem speziell dafür angefertigten Tisch in der Ecke stand. In den Fächern darunter befanden sich Dutzende von Schallplatten.
Auf einem Sofa saß eine junge Frau mit schulterlangem, rötlichem Haar. Ihre Gesichtszüge waren von außergewöhnlichem Liebreiz. Carl fühlte sich an ein altes Gemälde erinnert, das er mal in einer Zeitung gesehen hatte. Er dachte kurz nach, dann fiel ihm der Name des Malers wieder ein. Botticelli.
Die Frau trug ein himmelblaues Seidenkleid in der Farbe ihrer Augen, die stumpf ins Leere blickten. Ihr Make-up war makellos; falls sie geweint hatte, sah man es ihr nicht an. Dennoch wirkte sie nicht gefasst, sondern seltsam geistesabwesend, fast apathisch. Die Hände hielt sie verkrampft ineinander verschlungen auf dem Schoß, die Füße hatte sie unter sich gezogen. Das Unterteil des Kleides bauschte sich um ihre Beine wie eine umgedrehte, zerknitterte Blume. Vor dem Sofa lag einer ihrer Schuhe, eine zierliche, mit Strass bestickte Pantolette. Wie bei Aschenbrödel, das vom Ball kam.
Neben ihr saß Burkhard Albrecht. Er war ein gut aussehender, salopp gekleideter Mann in den Dreißigern. Das Tweedsakko hatte er ausgezogen und über die Sofalehne gelegt, die Ärmel seines Hemds hochgekrempelt. Er hatte dunkles, volles Haar und ebenmäßige Gesichtszüge. Sein Kinn wies eine Kerbe auf, was ihm eine vage Ähnlichkeit mit Cary Grant verlieh. Spontan dachte Carl, dass diese beiden Menschen da auf dem Sofa ein beeindruckend attraktives Paar abgaben.
»Guten Abend«, sagte Carl. »Ich bin Inspektor Bruns, Kripo Essen. Und mein Kollege heißt …«
»Ja, ich hab’s gehört«, unterbrach ihn der Mann. Er erhob sich vom Sofa und stellte die Musik ab. Harrys Anblick schien ihn kurz zu irritieren, die übliche Reaktion auf diesen ungewöhnlich gut gekleideten Kriminalassistenten, aber sofort darauf war seine Miene wieder so unbewegt wie zuvor. Er verschränkte die Arme, als wollte er klarstellen, dass ihm nicht der Sinn nach einem Händedruck stand. »Am besten kommen Sie gleich zur Sache.«
Der unfreundliche Empfang störte Carl nicht weiter. Die Kripo wurde selten zuvorkommend begrüßt.
»Frau Vahrendonk?«, sprach Carl mit sanfter Stimme die Frau auf dem Sofa an. »Sie sind doch Frau Vahrendonk, oder? Sybille Vahrendonk, die Gattin von Herrn Doktor Julius Vahrendonk?«
Es dauerte mehrere Sekunden, bis sie ihren trüben Blick auf ihn richtete. »Ja«, murmelte sie. »Ich weiß es schon. Mein Mann … Er ist tot.«
»Mein Beileid«, sagte Carl der Form halber, doch sie reagierte gar nicht darauf.
»Sie hat ein Beruhigungsmittel eingenommen«, erklärte Albrecht. »Ich habe aber bereits mit ihr gesprochen. Sie hat nicht den Hauch einer Ahnung, wer es getan haben könnte. Und falls Sie sich fragen, wieso ich hier bin – ich bin ein Freund der Familie. Wir kennen uns schon lange.«
»Privat oder beruflich?«
»Beides. Ich wohne in der Nachbarschaft, im Haus meiner Eltern. Das befindet sich am Ende der Straße, nur ein paar Schritte von hier. Ich bin gleich rübergekommen. Julius war wie ein Vater für mich.«
»Und was verbindet Sie beruflich?«, hakte Carl nach. »Hat er nicht eine Zivilkammer geleitet? Als Staatsanwalt sind Sie doch nur mit Strafsachen befasst, oder nicht?«
»Im Referendariat hatte ich Julius als Ausbilder. Er war früher eine Zeit lang Strafrichter.«
»Hier in Essen?«, wollte Carl wissen.
»Ja, sicher«, kam es ungeduldig zurück. »Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie endlich zur Sache!“«
Carl ließ sich nicht aus der Reserve locken. »Wie haben Sie von seinem Tod erfahren?«
Albrecht zuckte die Achseln. »Per Telefon.«
»Wer hat Sie angerufen? Und wann war das genau?« Carl zückte demonstrativ Notizbuch und Bleistift, um keinen Zweifel daran aufkommen zu lassen, dass er Wert auf eine korrekte Antwort legte.
Albrecht verzog sichtlich verärgert das Gesicht, rückte aber mit der erwünschten Auskunft heraus. »Der Oberstaatsanwalt rief mich vom Gericht aus an, das war um Viertel nach sechs. Ich bin direkt hergekommen und hab es Sybille gesagt. Sie sehen ja, wie fertig sie ist.«
»Wenn er Ihnen so nahestand – wieso sind Sie nicht sofort zum Tatort geeilt, so wie viele andere seiner Kollegen?«
»Weil …« Albrecht brach ab, seine Wangen röteten sich leicht.
»Weil Sie sich zuerst um Frau Vahrendonk kümmern wollten?«, fragte Carl.
»Ganz recht«, blaffte Albrecht. »Es lag buchstäblich näher. Nur ein paar Schritte von meinem eigenen Zuhause entfernt, das sagte ich ja bereits. Ich fand’s angebrachter, die Witwe meines guten Freundes Julius über dessen Tod zu informieren, statt sensationslüstern am Schauplatz eines Verbrechens herumzulungern. War’s das jetzt?«
»Nein.« Carl wandte sich ungerührt an Sybille Vahrendonk, die immer noch reglos auf dem Sofa saß. »Frau Vahrendonk, ich muss Sie das fragen: Unterhalten Sie eine außereheliche Beziehung zu Staatsanwalt Albrecht?«
Seine Frage versetzte sie ersichtlich in Panik. Sie schrak auf, ihre Augen flackerten, und in ihrem Gesicht arbeitete es. Ruckartig schwang sie ihre Beine unter dem Saum ihres Kleides hervor und erhob sich. Auf bloßen Füßen stolperte sie zu Albrecht und umklammerte seinen Arm. »Burkhard, bitte, kann ich noch was haben?«, flehte sie. »Ich brauch noch was!«
»Später«, sagte Albrecht unerwartet sanft. Er legte eine Hand auf ihre. Dann maß er Carl mit eisigem Blick. Seine nächsten Worte klangen unverhohlen drohend. »Ich verbitte mir diese unerhörten Unterstellungen! Auch im Namen von Sybille! Was immer auch für Gerüchte da über sie und mich in Umlauf sind – es sind alles Lügen! Haltlose, gemeine Verleumdungen! Durch nichts zu beweisen! Wagen Sie es nur noch einmal, unseren Ruf auf diese Weise in den Schmutz zu ziehen, und ich werde Maßnahmen ergreifen, die Sie die Stelle kosten! Und jetzt fordere ich Sie auf, das Haus zu verlassen, Herr Inspektor! Sofort!«
»Gewiss«, sagte Carl in verbindlichem Ton. Fürs Erste hatte er erfahren, was er wissen wollte. Und natürlich würde er wiederkommen, im Idealfall mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss.
Als er zusammen mit Harry den Salon verließ, wurde hinter ihnen zuerst die Tür zugeschlagen und dann die Musik voll aufgedreht.
»Der war anscheinend nicht gut auf uns zu sprechen«, stellte Harry trocken fest. »Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?«
»Weswegen?«
»Wegen der Maßnahmen, die er Ihnen angedroht hat.«
»Mir wurde schon Schlimmeres angedroht.«
»Auch von Staatsanwälten? Könnte er in seiner amtlichen Eigenschaft irgendwas gegen Sie lostreten?«
»Selbst wenn – er hätte schlechte Karten. Er hat eine Affäre mit der Witwe des Mordopfers.«
»Ja, die sahen beide aus wie frisch ertappt«, stimmte Harry zu. »Denen stand das schlechte Gewissen förmlich auf die Stirn geschrieben. Das war ein richtig guter Tipp von diesem Brinkmann, oder?«
»Allerdings. Aber eine Bestätigung in Form einer echten Zeugenaussage kann nicht schaden.« Carl hielt nach Isolde Mertens Ausschau. Sie stand neben der Haustür und wartete darauf, den späten Besuch hinauszulassen, ganz die zuvorkommende Hausangestellte.
»Auf ein Wort«, sagte Carl zu ihr, bevor er ohne Umschweife mit der Befragung begann. »Wie lange arbeiten Sie schon hier?«
»Seit gut vier Jahren. Ich bin zusammen mit Sybille … mit Frau Vahrendonk ins Haus gekommen.«
»Heißt das, dass Sie schon vorher für Frau Vahrendonk tätig waren?«
Isolde Mertens nickte. »Schon seit über zwanzig Jahren.«
»Sie ist doch bestimmt noch keine dreißig.«
»Siebenundzwanzig. Früher war ich ihr Kindermädchen und danach Zugehfrau bei ihren Eltern. Waren feine Leute, sehr großzügig. Hab praktisch zur Familie gehört.«
Carl hörte den schwachen Akzent heraus. »Sie stammen nicht von hier, oder?«
»Nein, aus Schlesien. Sybilles Familie auch. Wir sind alle zusammen in den Westen gegangen, als die Russen kamen. Die Eltern sind auf der Flucht umgekommen. Sybille und ich haben uns zusammen durchgeschlagen, sie als Stenotypistin und ich in der Fabrik.« Ein Schatten glitt über ihr Gesicht, ihre Gedanken schienen für einen Moment abzuirren, ehe sie fortfuhr. »Sybille hat eine Beschäftigung bei Gericht gefunden, dort ist sie Herrn Doktor Vahrendonk begegnet. Er hat sie vom Fleck weg geheiratet. Keine drei Wochen nachdem sie sich kennengelernt hatten.«
»Also Liebe auf den ersten Blick?«
Auf Carls Frage hin hob Isolde Mertens die Schultern, was sich unschwer so deuten ließ, dass Amors Pfeil wohl nur den Richter getroffen hatte. »Herr Doktor Vahrendonk war verwitwet«, erklärte sie. »Seine erste Frau ist vor zehn Jahren gestorben.«
»Und die Ehe mit seiner neuen Frau verlief nicht gerade rosig, was?«
»Darüber möchte ich mir kein Urteil erlauben.«
»Sie hat ein Verhältnis mit Staatsanwalt Albrecht«, sagte Carl. Er ließ es absichtlich wie eine unumstößliche Feststellung klingen. Mit Erfolg: Isolde Mertens unternahm keinen Versuch, es abzustreiten, im Gegenteil.
»Das müssen Sie verstehen«, sagte sie. Es klang eindringlich, fast beschwörend. »Das mit den beiden … es ist Liebe! Richtige Liebe! Sie ist doch noch so jung! Und der Richter war …« Sie verstummte.
»Er war was?«
»Ich will nichts Schlechtes über ihn sagen. Über Tote soll man nicht herziehen.«
»In diesem Fall gilt das nicht. Er wurde ermordet, und ich suche nach möglichen Motiven für diese Tat. Also?«
»Er war kein guter Mensch«, sagte Isolde Mertens schlicht.
»Wie soll ich das verstehen?«
»Er hat Sybille misshandelt.«
»Hat er sie geschlagen?«
»Nein, das nicht. Er hat sie … kontrolliert. Sie auf eine bösartige Weise kleingemacht. So getan, als würde er nur ihr Bestes wollen, aber in Wahrheit hat er ihr jede Freiheit geraubt. Und er hat … Er hat sie abhängig gemacht. Hat ihr Tabletten aufgezwungen, bis sie am Ende drum gebettelt hat, mehr davon zu kriegen. Und er hat sie ihr beschafft, immer wieder und wieder. Das tat er, um sie gefügig zu halten. Damit sie alles tat, was er wollte. Wie eine Sklavin.«
»Mit anderen Worten: Sie hatte gute Gründe, ihn sich vom Hals zu schaffen«, führte Carl aus.
Isolde Mertens wirkte erschrocken. »Nein! Auf keinen Fall! So was täte sie nie! Und Herr Doktor Albrecht auch nicht! Er liebt sie sehr und will ihr helfen, und sie liebt ihn ebenfalls – sie sind füreinander bestimmt! Aber mit dem Tod von Herrn Doktor Vahrendonk haben die zwei nichts zu tun! Bitte, das müssen Sie mir glauben!« Die Haushälterin hielt inne und schien mit sich zu ringen, ehe sie entschlossen fortfuhr: »Andere hatten viel bessere Gründe, ihm Böses zu wollen.«
»Wer?«
»Zum Beispiel all die Menschen, die unter seinen Urteilen gelitten haben. Es gab sogar Todesurteile! Herr Doktor Vahrendonk war unter den Nazis Richter am Sondergericht.« Es klang, als würde sie mehr darüber wissen, doch Carl kam nicht dazu, ihr weitere Fragen zu stellen. Die Tür zum Salon ging auf, und Burkhard Albrecht erschien auf der Bildfläche. Als er Carl und Harry im Vestibül stehen sah, erstarrte er. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, in seinen Augen funkelte heller Zorn. Doch diesmal gab er sich nicht die Blöße, aus der Haut zu fahren. Der Jurist in ihm hatte die Kontrolle übernommen, seine Stimme ließ nichts von seinen Emotionen ahnen.
»Frau Vahrendonk lässt Sie höflich bitten, augenblicklich das Haus zu verlassen«, sagte er in ruhigem Ton. »Sofern Sie noch Fragen haben, wird sie diese auf entsprechende Vorladung hin auf dem Präsidium beantworten. Sie wissen hoffentlich, dass niemand gesetzlich verpflichtet ist, sich zu Hause ausfragen zu lassen. Dasselbe gilt für Frau Vahrendonks Angestellte, Frau Mertens.«
»Selbstverständlich«, erwiderte Carl, der sich mindestens genauso gut beherrschen konnte wie Albrecht, auch wenn er sauer über die Unterbrechung war. »Wir sprechen uns noch.« Mit einem knappen Kopfnicken räumte er das Feld, Harry im Schlepptau.
»Scheint so, als wären wir noch nicht am krausen Bäumchen«, meinte Harry, als sie draußen waren. »Da liegt wohl noch Arbeit vor uns.«
»Sicher. Aber nicht mehr heute.« Carl hielt inne und sah Harry fragend an. »Woher kennen Sie den Spruch?«
»Ach, da gibt’s doch in Rüttenscheid diese Kneipe in der Klarastraße. Hinterm krausen Bäumchen heißt die. Neulich war ich da mal einen trinken, und die Wirtin erzählte mir, was es mit dem Namen auf sich hat. Dass es eine hiesige Redensart ist. Man ist noch nicht am krausen Bäumchen, wenn man sein Ziel noch nicht erreicht hat. Aber das wissen Sie sicher schon, oder? Sie sind ja aus Essen.«
Carl kannte nicht nur die Redensart, sondern auch die Kneipe. Ebenso die Wirtin. Sie hieß Frieda und war die Schwester seiner Verlobten. Carl überlegte kurz, es Harry zu erzählen, nahm dann aber davon Abstand. Er mochte den Jungen, trotzdem wollte er es nicht zu privat werden lassen, und freundschaftlich erst recht nicht. Damit war er schon einmal reingefallen, das reichte ihm völlig. Man fuhr besser damit, wenn man die Kollegen nicht zu nah an sich heranließ.
Beim Wagen trennten sich ihre Wege. Harry erklärte, zu Fuß heimgehen zu wollen, es sei nicht weit von hier. Carl, der vorher kaum einen Gedanken daran verschwendet hatte, wo Harry wohnte, verspürte einen Anflug von Neugier. Ob sein junger Kollege ähnlich gehoben logierte, wie er sich kleidete? Und falls ja, woher hatte er so viel Geld? Aber schon im nächsten Moment war es ihm völlig gleichgültig, denn er hatte noch was vor.
Kapitel 2
Exitus«, sagte Doktor Emmerich. Er bemühte sich um einen sachlichen Ton, aber Anne hörte die bittere Resignation in seiner Stimme. Sie hatten bis zuletzt um das Leben des Patienten gekämpft. Ein junger Polizist, gerade dreißig geworden. Familienvater mit Frau und zwei kleinen Kindern. Getötet in Ausübung seines Dienstes, so würde es in ebenso banalen wie endgültigen Worten später in den amtlichen Unterlagen stehen.
Der medizinische Bericht würde sich noch kälter lesen. Lauter lateinische Ausdrücke, die beschrieben, was den Mann das Leben gekostet hatte: drei gebrochene Rippen, von denen eine die Lunge durchstoßen hatte. Schwellungen des Gehirns, weil er mit dem Kopf aufgeschlagen war.
Doktor Emmerich sah auf die Uhr an der Wand hinter dem OP-Tisch. »Zeitpunkt des Todes: zweiundzwanzig Uhr.«
Anne stellte das Narkosegerät ab und nahm die Äthermaske vom Gesicht des Patienten. Sie entfernte die Drainageschläuche und sammelte die Instrumente zum Desinfizieren ein. Blutige Tupfer und Kompressen kamen zum späteren Auskochen in den Wäschesack. Schürzen und Handschuhe mussten separat in einer speziellen Lösung eingeweicht werden, das gummierte Material war hitzeempfindlich.
Sie zog sich die Haube vom Haar und folgte Doktor Emmerich in den Vorraum. Er stand mit gesenktem Kopf am Waschbecken und schrubbte sich die Hände. Auch sein Gesicht und die Brille hatten Blutspritzer abbekommen, die er mit einem nassen Lappen abrieb. Anne drehte das Wasser am daneben befindlichen Becken auf und wusch sich ebenfalls Hände und Gesicht. Nur noch den Schwesternkittel gegen die Alltagskleidung tauschen, und sie konnte Feierabend machen.
Die Nachtschwester war schon da und reinigte den OP, damit der Raum für weitere Eingriffe zur Verfügung stand. Das Essener Polizeikrankenhaus war eine kleine Klinik. Nicht jeden Tag kamen Notfälle wie dieser herein, rechnen musste man allerdings immer damit.
Anne blickte ihren Chef von der Seite an. »Sie haben alles nur Erdenkliche getan, er hatte keine Chance.« Sie kannte Doktor Emmerich und wusste genau, dass er gerade im Geiste jeden Handgriff noch mal durchging. Jeden Schnitt, jede Naht, die komplette zeitliche Abfolge. Wieder und wieder, als ließe sich noch irgendwas dran ändern.
»Ich weiß«, sagte er erschöpft. »Aber wie soll ich es seiner Witwe erklären? Er ist schon öfter vom Pferd gefallen, und nie ist was Schlimmes passiert.«
Der Verstorbene hatte zu einer berittenen Abteilung gehört, die in derselben Liegenschaft wie das Krankenhaus untergebracht war. Nach dem Sturz war er sofort eingeliefert worden, die Begleitumstände hätten gar nicht günstiger sein können. Trotzdem hatte es ihm nichts geholfen.
»Manchmal kann man nicht gegen das Schicksal an«, sagte Anne. Es klang wie eine hohle Phrase, doch sie wusste, wovon sie redete. Das Schicksal hatte ihr schon oft Knüppel zwischen die Beine geworfen. Die vielen Bombenangriffe, der Hunger, der ganze verdammte Krieg … und nicht zuletzt Arnold, ihr tückischer, mörderischer Schwager. Die schlimmste nur denkbare Heimsuchung. Aber sie hatte überlebt und neu angefangen. Gemeinsam mit Carl.
Er wollte sie gleich abholen, vielleicht wartete er schon draußen auf sie. Sofern ihm nicht irgendwas wegen der Arbeit dazwischengekommen war, was man vorher nie genau wissen konnte.
Anne verabschiedete sich von Doktor Emmerich und beeilte sich mit dem Umziehen.
Sie war schon auf dem Weg nach draußen, als sie zurückgerufen wurde – ein Patient im Drogendelirium musste fixiert werden. Doktor Emmerich und Schwester Gesine wurden nicht allein mit dem Mann fertig. Anne packte mit an, und erst zu dritt und mit roher Gewalt schafften sie es, den auskeilenden, brüllenden Patienten zu bändigen, damit Doktor Emmerich ihm eine Beruhigungsspritze verabreichen konnte. Als endlich die Wirkung einsetzte, sackte der Mann in sich zusammen und starrte blicklos unter gesenkten Lidern an die Decke.
Anne rieb sich die Wange, wo sie ein Fausthieb getroffen hatte. Die Stelle tat ziemlich weh, morgen würde sie dort einen hässlichen blauen Fleck haben. Sie war wütend, aber zugleich verspürte sie Mitleid. Jedoch nicht mit dem drogensüchtigen Mann, sondern mit dessen Frau. Die hatte ihn einliefern lassen, nachdem er zu Hause alles kurz und klein geschlagen hatte. Nach dem letzten Entzug war er monatelang sauber geblieben, aber dann erneut rückfällig geworden. Irgendwie war es ihm gelungen, wieder an Pervitin zu kommen, das in Kombination mit zu viel Alkohol zu diesem Gewaltausbruch geführt hatte.
Ursache seiner Sucht war eine Schmerzmittelbehandlung wegen einer im Krieg erlittenen Schussverletzung. Allein in der britischen Besatzungszone gab es unzählige ehemalige Soldaten, die auf diese Weise abhängig geworden waren, darunter auch Polizisten aus Waffenbataillonen, so wie der Mann von vorhin. Nicht zuletzt deshalb hielt sich Annes Mitgefühl in Grenzen: Die von den Nazis in die Ostgebiete entsandten Polizeibataillone hatten unsägliche Gräueltaten verübt, hatten Hunderttausende unschuldige Menschen massakriert, und kaum einer der daran beteiligten Männer war bisher zur Verantwortung gezogen worden. Sie hatten nach dem Krieg ihren Dienst bei der Polizei fortgesetzt, als wäre nichts geschehen. Gut möglich, dass der Patient einer von denen war.
Carl erwartete sie draußen am Fuß der Eingangstreppe. Er schloss sie in die Arme und küsste sie leidenschaftlich, so wie immer, wenn er sie von der Arbeit abholte. In diesem Moment fiel die ganze Anspannung von ihr ab. Sie spürte das Kratzen seiner Bartstoppeln auf ihrer Haut, den festen Druck seiner Hände in ihrem Rücken, die vertrauten Konturen seines Körpers dicht an ihrem. Himmel, wie sehr sie ihn liebte!
Als er sich nach einer wundervollen Ewigkeit von ihr löste und in ihr Gesicht blickte, erstarrte er.
»Wer war das?«, entfuhr es ihm.
Sie lächelte ein wenig kläglich. »Niemand, den du verhaften musst. Ein tobsüchtiger Patient hat um sich geschlagen. Da hab ich halt was abgekriegt. Lässt sich manchmal nicht vermeiden.«
Vorsichtig berührte er die Schwellung unter ihrem Auge.
»Wenn wir verheiratet sind, musst du nicht mehr arbeiten«, erklärte er dann in entschiedenem Ton.
Es war das erste Mal, dass er dieses Thema anschnitt. Anne verzog das Gesicht. »Ernsthaft? Ich hatte gehofft, dass du keiner von diesen Männern bist.«
»Von welchen Männern?«
»Die es richtig und wichtig finden, dass ihre Frauen nicht arbeiten gehen. Sondern stattdessen daheim herumsitzen und sich für den Herrn des Hauses hübsch machen. Wenn sie nicht gerade kochen und backen oder bügeln.«
»Das habe ich doch gar nicht gesagt«, verteidigte Carl sich. Er wirkte verlegen. »Ich wollte einfach nur … Ich meinte bloß, wenn du nicht mehr arbeiten willst, musst du es nicht. Es wäre allein deine Entscheidung.«
Anne griff nach seiner Hand. »Ich weiß. Und es gibt wirklich Tage, da habe ich keine Lust mehr. Aber solche Tage hat jeder mal, du doch auch, oder?«
Er öffnete den Mund zu einer Antwort, klappte ihn aber dann wieder zu. Zweifellos hatte er entgegnen wollen, dass man das nicht vergleichen könne, da sie ja schließlich eine Frau sei.
»Ich bin gern Krankenschwester«, stellte sie klar. »Und ich höre ganz sicher nicht auf zu arbeiten, nur weil ich mal einen schlechten Tag hatte. Wenn wir heiraten, wird sich daran nichts ändern.« Sie hätte hinzufügen können, dass sie auf das Geld, das sie heimbrachte, nicht verzichten wollte, auch nicht als seine Ehefrau. Allein mit seinem Gehalt würden sie kaum über die Runden kommen. Die Bezahlung bei der Kriminalpolizei war ausgesprochen dürftig. Allerdings wäre Anne nicht im Traum auf die Idee gekommen, mit so einer Bemerkung seinen Stolz zu verletzen. Carl schuftete sich tagein, tagaus ab, machte ständig Überstunden, verbiss sich in manche seiner Fälle wie ein Kampfhund, der unter keinen Umständen von der einmal gefassten Beute abließ. Aber nie hörte Anne ihn über die viele Arbeit klagen. Er war mit Leib und Seele Kriminalist, es war für ihn nicht nur ein Beruf, sondern zugleich auch Berufung.
»Ich bin mit dem Auto da«, sagte Carl. Seine Stimme hatte einen hoffnungsvollen Unterton. Anne kicherte, und dann fingen sie beide an zu lachen, jedoch nicht ohne einen Hauch von Verzweiflung. Wenn er sie nach der Spätschicht mit dem Wagen abholte, konnten sie einen Abstecher in den Wald machen und da irgendwo an einer einsamen Stelle parken, um sich zu lieben. Eine Behelfslösung, die ihnen beiden auf die Nerven ging.
Sie hätten schon seit einem Monat verheiratet sein und offiziell das Bett teilen können, doch der Termin auf dem Standesamt war geplatzt – kurz vorher war bei der Enttrümmerung eines benachbarten Ruinengrundstücks der Blindgänger einer gewaltigen Fliegerbombe entdeckt worden, was eine umfangreiche Entschärfungs- und Räumungsaktion zur Folge gehabt hatte. Alle für die fragliche Woche angesetzten Trauungen waren gestrichen worden. Inzwischen war die Bombe weg, aber auf einen neuen Termin warteten sie immer noch.
Ihre erste intime Zusammenkunft hatte in Carls Bude in der Rosastraße stattgefunden, doch beim zweiten Mal war wie aus dem Nichts seine Hauswirtin im Flur aufgetaucht und hatte ihren amourösen Plänen einen Riegel vorgeschoben. Keine Fisimatenten unter ihrem Dach, so lautete Frau Schultes ehernes Prinzip. Sie war nicht mal verärgert gewesen, es hatte sogar fast entschuldigend geklungen. Aber gleichzeitig auch durch und durch kompromisslos. Ohne Ehering keine Liebesnacht.
An jenem Abend im vergangenen Sommer waren Anne und Carl mangels anderweitiger Möglichkeiten in den Wald gegangen, was sich seither mehr oder weniger regelmäßig wiederholte. Natürlich nur an wärmeren Tagen. Den Winter über hatten sie sich auf die wenigen Male beschränken müssen, an denen Carl einen Wagen zur Verfügung gehabt hatte.
Auch an diesem späten Abend fuhren sie in den Wald. Der Wagen holperte über die Unebenheiten des Feldwegs, der zwischen den Bäumen in die tiefschwarze Dunkelheit führte. Carl parkte das Auto auf einer kleinen Lichtung am Wegrand. Anne hatte bereits angefangen, sich auszuziehen. Das letzte Mal war schon wieder viel zu lange her. Auch Carl streifte sich hastig die Kleidung ab. Im schwachen Licht der Innenbeleuchtung des Wagens schauten sie einander an. Sein Blick hielt den ihren gefangen, der Ausdruck in seinen Augen war eindringlich, fast hypnotisch. Sie sah darin die Liebe, die er ihr entgegenbrachte, ebenso wie sein Verlangen, das von Mal zu Mal größer zu werden schien. Seine Hände auf ihrem Körper waren warm, und aus der Hitze, die sie auf ihrer Haut erzeugten, erwuchs ein Feuer, in dem sie verglühen wollte. Für den Liebesakt mussten sie sich verrenken und verbiegen, es war eine artistische Herausforderung, ständig war entweder der Schalthebel oder das Lenkrad im Weg, doch gemessen an ihrer Begierde war das nicht von Belang. Anne schrie vor Lust auf, als er endlich in sie eindrang, und eine ganze Weile hörte sie nichts mehr außer den Geräuschen ihrer Vereinigung, das Keuchen und Stöhnen, vermischt mit dem Hämmern ihres Herzschlags, der ihr in den Ohren dröhnte. Als sie zum Höhepunkt kam, schrie sie abermals auf, es war ein Moment völliger Loslösung, alle Fesseln und Zwänge des Lebens schienen innerhalb eines einzigen Atemzugs von ihr abzufallen.
»Ein Gutes hat es ja, hier im Wald«, murmelte sie hinterher, ihre Wange an seiner. »Keiner hört uns.«
Carl rieb sich ächzend die Hüfte, und Anne kletterte kichernd von ihm herunter. Er angelte nach seinen Sachen, die verstreut im Fußraum lagen. »Ein Bett wäre trotzdem nicht schlecht. Dann könnten wir jetzt einfach schlafen. Gott, was bin ich müde!«
Dasselbe galt für Anne. Schon während der anschließenden Fahrt nach Rüttenscheid nickte sie mehrmals ein. Als Carl in der Klarastraße anhielt, ging es auf Mitternacht zu. Noch ein verstohlener Kuss, dann stieg Anne aus dem Wagen. Wie immer wartete Carl vorm Haus, bis sie drinnen war und die Tür hinter sich zugezogen hatte. Die Schrecken des letzten Sommers hatten ihre Spuren hinterlassen, es war wie ein heimlicher Zwang, stets auf der Hut zu bleiben. Der Tod hatte an ihre Tür geklopft, und sie waren ihm nur knapp entronnen. Zu knapp, um es je vergessen zu können.
Im Treppenhaus miefte es nach Kohl und Plumpsklo. Auf halber Treppe zwischen dem ersten und zweiten Stock befand sich ein Lokus, den sich sämtliche Mieter des Hauses teilen mussten. Nur in der Eigentümerwohnung im ersten Obergeschoss, in der Anne mit ihren beiden Schwestern und ihrem kleinen Neffen lebte, gab es ein separates Klosett, sogar mit Wasserspülung. Außerdem ein Badezimmer mit Wanne und Durchlauferhitzer – ein Luxus sondergleichen, für den sie nur dankbar sein konnten. Dennoch – oder vielleicht sogar deswegen – fühlte Anne sich an manchen Tagen immer noch fremd und deplatziert in dieser Wohnung, die ihnen (genauer: ihrem siebenjährigen Neffen Emil) im Wege der Erbschaft zugefallen war. Vorher hatte sie Emils Großmutter gehört. Der Mutter von Arnold, dem Massenmörder.
Anne sah nach dem Betreten der Wohnung routinemäßig nach dem Rechten, so wie immer, wenn sie nach einer Spätschicht heimkam. Der Gasherd war aus, die Fenster alle zu. Die Tür zum Wohnzimmer war geschlossen, von drinnen drang kein Laut heraus; Frau Lindemann, die im vergangenen Jahr vom Wohnungsamt bei ihnen einquartiert worden war, ging immer früh zu Bett.
Im Jugendzimmer schliefen Emil und Annes jüngste Schwester Lotti. Mittlerweile hatte der Kleine ein eigenes Bett, aber er kroch immer noch oft zu Lotti unter die Decke. Auch in dieser Nacht lagen die beiden zusammen im Bett, dicht aneinandergekuschelt und die blonden Lockenköpfe einträchtig im selben Kopfkissen vergraben.
Im größeren Schlafzimmer, das sich Anne mit ihrer Schwester Frieda teilte, war das Doppelbett leer, offenbar war Frieda noch unterwegs. Ihre nächtlichen Exkursionen waren seltener geworden, seit sie als Gastwirtin die Kneipe führte, aber ganz aufgehört hatten sie nie. Heute war Dienstag, da war Ruhetag, eine gute Gelegenheit zum Ausgehen.
In dieser Nacht war Frieda jedoch zu Hause; als Anne das Badezimmer betrat, fand sie ihre Schwester in der Wanne vor, neben ihr auf der Ablage zwei brennende Kerzen und ein halb volles Glas Rotwein. Sie saß zurückgelehnt da, nur Kopf und Schultern ragten aus dem Wasser. Die Spitzen ihres hellen Haars trieben auf der Oberfläche. Träge wandte sie Anne den Kopf zu. Im Kerzenlicht wirkten ihre sonst so klaren blauen Augen eigentümlich dunkel, fast violett.
»Guten Abend, Schwesterherz.«
»Frieda.« Anne nickte ihr zu.
»Gut siehst du aus. Frisch und munter. Hat Carl dich abgeholt?«
Anne spürte, wie sie unter dem wissenden Blick ihrer Schwester errötete. Sie schnappte sich ihren Kulturbeutel und ging damit in die Küche, wo sie sich am Spülstein wusch und die Zähne putzte. Ihr war zu dieser späten Stunde nicht danach, sich mit Frieda zu unterhalten, sie wollte bloß noch ins Bett. In der letzten Zeit war ihre Schwester häufig schlecht gelaunt. Wahrscheinlich steckte wieder irgendein Kerl dahinter, es wäre nicht der erste, der ihr die Stimmung vermieste.
Vor dem Einschlafen ging Anne wie schon so oft die Frage durch den Kopf, wie das Zusammenleben mit Carl in dieser Wohnung wohl funktionieren würde. Dass sie nach der Heirat zu ihm in sein muffiges und viel zu kleines Mansardenkämmerchen zog, hatte nie zur Debatte gestanden. Hier bei ihr war mehr als genug Platz für eine weitere Person; monatelang hatten sie nur mit Mühe zusätzliche Zwangsbelegungen durch das Wohnungsamt verhindern können, immer mit Hinweis darauf, dass der Hochzeitstermin schon feststand und Carl bald hier einzog. Frieda würde ihren Platz im Schlafzimmer räumen und rüber zu Frau Lindemann ins Wohnzimmer ziehen, dort konnte problemlos ein zweites Bett aufgestellt werden. Sie hatten das alles schon besprochen. Allerdings nur einmal und auch bloß ganz kurz, außerdem war es schon eine Weile her. Da hatte Frieda noch bessere Laune gehabt.
Ob die näher rückende Umquartierung die Ursache für ihre anhaltende Missstimmung war? Die Aussicht, sich mit einem Mann das Bad teilen zu müssen, jeden Tag mit ihm beim Essen in der Küche am selben Tisch zu sitzen?
Vielleicht hätte Frieda sich eher damit anfreunden können, wenn es nicht ausgerechnet Carl gewesen wäre. Der Mann, der ihr dunkelstes Geheimnis kannte. Der wusste, dass sie ihre Schwiegermutter umgebracht hatte und dass sie nur deshalb jetzt hier in dieser Wohnung leben konnten.
Natürlich hatte Frieda es nicht aus diesem Grund getan, es war im Affekt geschehen, von Adelheids Testament hatten sie alle erst hinterher erfahren. Aber es blieb dabei: Den ganzen Komfort hatten sie einem Verbrechen zu verdanken. Obendrein einem Verbrechen, das Carl als zuständiger Ermittler vertuscht hatte. Es war Anne nicht verborgen geblieben, wie sehr ihn das erschüttert hatte. Seit damals hatte er nie wieder darüber gesprochen, aber sie ahnte, dass es ihm immer noch zusetzte. Sein gesamtes Selbstbild als unbestechlicher und gewissenhafter Kriminalbeamter war aus den Fugen geraten. Er hatte seine Liebe zu ihr über seine Pflicht gestellt, den Zusammenhalt ihrer Familie über das Gesetz. Damit mussten sie alle fertigwerden, auch Frieda. Sie würde sich der neuen Situation stellen müssen, sich mit Carls täglicher Gegenwart abfinden. Er kam ja sowieso schon oft her, zum gemeinsamen Essen in die Wohnung oder auf ein Feierabendbier ins Krause Bäumchen, es würde also keinen großen Unterschied machen. Alles würde irgendwie klappen, ganz bestimmt. Diesen hoffnungsvollen Gedanken nahm Anne mit in den Schlaf.
Frieda blieb noch eine Weile in der Wanne sitzen, sie wollte warten, bis Anne eingeschlafen war und keine lästigen Fragen stellen konnte. Über kurz oder lang würde es dazu kommen, so viel stand fest. Aber bis dahin wollte Frieda sich erst mal selbst richtig klar über die Lage werden. In Ruhe überlegen, wie es weitergehen sollte. Niemandem war geholfen, wenn sie die Dinge übers Knie brach.
Als sie sicher war, dass Anne schlief, stieg sie aus der Wanne und trocknete sich ab. Sie rubbelte sich das Haar so gut es ging trocken, bevor sie es auskämmte, auf Lockenwickler drehte und dann vorsichtig ihr Nachthemd über den Kopf streifte. Sorgfältig cremte sie anschließend ihr Gesicht ein. Ihre Haut war makellos und faltenfrei, und das sollte möglichst lange so bleiben. Mit sechsundzwanzig musste sie sich darüber noch keine großen Gedanken machen, aber Vorkehrungen konnten nicht schaden, wenn sie in zehn Jahren eine Haut haben wollte wie Anne, deren Teint auch mit sechsunddreißig nichts zu wünschen übrig ließ. Das abendliche Eincremen hatten sie von der Mutter übernommen, auch Lotti tat es schon, und dabei war sie gerade mal sechzehn. Frieda ließ es so gut wie nie ausfallen, nicht mal nach einer durchzechten Nacht.