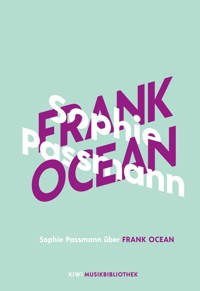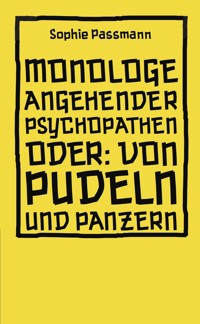Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacheles!
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Beweis erbracht: Unbestechlichen Feminismus gibt es auch in lustig. Sogar in sehr lustig! Großartig!« Anne Will. Sophie Passmann ist Feministin und so gar nicht einverstanden mit der Plattitüde, der alte weiße Mann sei an allem schuld. Sie will wissen, was hinter diesem Klischeebild steckt und fragt nach: Ab wann ist man ein alter weißer Mann? Und kann man vielleicht verhindern, einer zu werden? Sophie Passmann gehört zu einer neuen Generation junger Feministinnen; das sind Frauen, die stolz, laut und selbstbestimmt sind. Sie wollen Vorstandschefinnen werden oder Hausfrauen, Kinder kriegen oder Karriere machen oder beides. Und sie haben ein Feindbild, den alten weißen Mann. Dabei wurde nie genau geklärt, was der alte weiße Mann genau ist. Eines ist klar: Er hat Macht und er will diese Macht auf keinen Fall verlieren. Doch Sophie Passmann will Gewissheit statt billiger Punch-lines, deswegen trifft sie mächtige Männer, um mit ihnen darüber zu sprechen: »Sind Sie ein alter weißer Mann und wenn ja – warum?« Die Texte, die daraus entstanden sind, gehören zu den klügsten und gleichzeitig lustigsten, die man hierzulande finden kann. Sophie Passmann war im Gespräch mit: Christoph Amend, Micky Beisenherz, Kai Diekmann, Robert Habeck, Carl Jakob Haupt, Kevin Kühnert, Rainer Langhans, Sascha Lobo, Papa Passmann, Ulf Poschardt, Tim Raue, Marcel Reif, Peter Tauber, Jörg Thadeusz, Claus von Wagner
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:5 Std. 17 min
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sophie Passmann
Alte weiße Männer
Ein Schlichtungsversuch
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Sophie Passmann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Sophie Passmann
Sophie Passmann ist 25 Jahre alt und für ihr Alter schon ganz schön viel da. Ihre Jugend verbrachte sie deutschlandweit mit Auftritten bei Poetry Slams, später trat sie als Comedian und Autorin auf. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und Philosophie ging sie als Radiomoderatorin zu 1LIVE, außerdem ist sie im Ensemble des Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann. Ihre Texte und Kolumnen erschienen u.a. im ZEITMagazin. Ihr Hauptwohnsitz ist das Internet, auf Instagram und Twitter spricht sie über alles, was in ihrem Leben eine Rolle spielt: tinder, Gin Tonic, die Europäische Union, vegane Pizza oder der Nahostkonflikt. Sie scheint das ganz gut zu machen, denn in beiden Netzwerken hat sie mittlerweile rund 90.000 Follower. Sie trinkt sehr gerne Riesling und kann kein bisschen Klavier spielen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Sophie Passmann gehört zu einer neuen Generation junger Feministinnen; das sind Frauen, die stolz, laut und selbstbestimmt sind. Sie wollen Vorstandschefinnen werden oder Hausfrauen, Kinder kriegen oder Karriere machen oder beides. Und sie haben ein Feindbild, den alten weißen Mann. Dabei wurde nie genau geklärt, was der alte weiße Mann genau ist. Eines ist klar: Er hat Macht und er will diese Macht auf keinen Fall verlieren. Doch Sophie Passmann will Gewissheit statt billiger Punchlines, deswegen trifft sie mächtige Männer, um mit ihnen darüber zu sprechen: »Sind Sie ein alter weißer Mann und wenn ja – warum?« Die Texte, die daraus entstanden sind, gehören zu den klügsten und gleichzeitig lustigsten, die man hierzulande finden kann.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Vorwort
Privilegien und Pokémon Go! Ein Vormittag mit Sascha Lobo
Die Digitalisierung ist schuld, sagt der Mann aus der Printbranche – Im Büro von Christoph Amend
Der reflektierte Mann und das Meer – an der Spree mit Robert Habeck
BILD dir deinen Feminismus – Suppe essen mit Kai Diekmann
Saubere Autos und rauchende Feministen – die Sternschanze mit Micky Beisenherz
Die Bedürfnispyramide von Berlin-Mitte – sehr viel Schorle mit Carl Jakob Haupt
Stillgruppen und Studentenverbindungen – im Steakhaus mit Papa Passmann
Durchsichtige Strumpfhosen und vegane Butter – Picknick mit Claus von Wagner
Den Männern mehr abverlangen – Eis essen mit Peter Tauber
Schöner Streit und böse Witze – am Wannsee mit Jörg Thadeusz
Endlich intellektuell abgeholt werden – im Elfenbeinturm mit Ulf Poschardt
Feminismus: fast so schlimm wie der BVB? – am Zürichsee mit Marcel Reif
Den Sexismus kaputt reflektieren – Frühstück mit Kevin Kühnert
Soja-Hack und Opfer-Feminismus – Lunch mit Rainer Langhans
Kein Sexismus in Kreuzberg – im Restaurant von Tim Raue
Schlusswort
Dank
»You hear straight white man and you say ›That’s reverse sexism!‹ No, it’s not. You wrote the rules. Read them.«
– Hannah Gadsby in Nanette
Vorwort
Einen ganzen Sommer habe ich damit verbracht, mich mit mächtigen Männern zu treffen. Ich habe in Chefetagen auf Gesprächstermine gewartet, mich in voll verglasten Büros über die Frauenquote gestritten, wurde ins Steakhaus eingeladen, habe Wein ausgeschenkt, mir Falafel-Portionen geteilt und saß am Zürichsee, wo ich einen Monatslohn für eine Flasche Wasser bezahlt habe. Ich habe Männer getroffen, die in gesellschaftlichen Eliten Macht innehaben, Männer, die kulturellen, politischen und finanziellen Einfluss ausüben. Diesen Männern wird ohnehin zugehört, sie haben nicht darauf gewartet, dass eine Feministin aus dem Internet sie endlich um ein Interview bittet, damit sie auch mal ihre Meinung sagen können. Aber bei der Suche nach dem Feindbild »alter weißer Mann« können eben nur sie weiterhelfen. Außerdem – und davon bin ich so fest überzeugt wie von wenig anderem – bringen Gespräche einen immer weiter, egal, wie abstrus die Meinung des Gegenübers auch wirken mag, egal, wie wenig der Feminismus von Männern in Machtpositionen lernen kann.
Diese Reise ist der Versuch einer Annäherung an Männlichkeit im 21.Jahrhundert, die sich zum ersten Mal mit dem Umstand konfrontiert sieht, nicht mehr das Monopol auf die Erzählung der Menschheit auszuüben. Diese Männlichkeit kann sich, je nachdem, wie fragil beziehungsweise charakterstark ihr Inhaber ist, vom modernen Feminismus bedroht fühlen. Das Gefühl der Bedrohung ist real. Ich erkenne das an, weder aus Mitgefühl noch aus Sorge um den modernen Mann. Keine Lesart des modernen Feminismus auf der ganzen Welt wird Männer jemals davor schützen, sich bedroht zu fühlen. Männer, die einigermaßen wachen Auges durch die Welt schreiten, werden anerkennen, dass ihr bisher schier uneingeschränkter Zugang zu Teilhabe und Mitsprache in Gremien, Parlamenten, Institutionen und Ämtern ihnen nie wirklich zweifelsfrei zustand. Die anderen scheinen den Feminismus in ihren Bestrebungen für etwas Lächerliches zu halten, sie betrachten den Wandel nicht als logische Konsequenz der aktuellen Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, sondern als lästige Option, über die sie sich nur lang genug lustig machen müssen, damit sie verschwindet.
Nicht jeder Mann, der alt und auch weiß ist, gehört automatisch zum Feindbild »alter weißer Mann«. Das Gefühl der Überlegenheit gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien macht für mich eher dieses Feindbild aus. Ich erkenne einen alten weißen Mann, wenn ich mich mit ihm unterhalte[1], ich weiß aber nicht, an welchem Punkt ein Mann sich dafür entscheidet, den Wandel als Bedrohung zu betrachten; ob es überhaupt ein freiwilliger Akt ist, eine grundsätzliche Geisteshaltung, ein Blick auf die Welt, eine Schlüsselerfahrung. Ich wollte herausfinden, wann ein mächtiger Mann zu einem alten weißen Mann wird und – viel wichtiger – ob man es verhindern kann.
Ich wollte nicht herausfinden, wie ich mich und den Feminismus bei Männern beliebt mache. Beliebtheit ist mir völlig egal. Jede Frau, die Feminismus ernsthaft betreibt, muss sich von der Idee verabschieden, sich damit bei einem Großteil der Männer beliebt zu machen. Feminismus ist, wenn er radikal im eigentlichen Sinne des Wortes betrieben wird, unbequem, anstrengend, omnipräsent und lästig. Es ist der Job von Feminist*innen, zu nerven, wir tun das nicht aus Langeweile oder Themenarmut, es ist eine Überlebensstrategie. Die Machtfrage wird nie höflich gestellt, denn es ist menschlich, dass diejenigen, die die Macht innehaben, sie nur ungern teilen wollen. Dieses Buch ist also nicht der Versuch, die Geschlechterungerechtigkeit wegzulächeln oder Sexismus mit einem Glas Wein in der Sonne zu beenden. Es ist ein Gesprächsangebot. Denn das kommunikative Grundrauschen in sozialen Netzwerken, das wir heute aufrechterhalten, ist zwar aus vielen Gründen wertvoll und bedeutend, aber höchstens die Illusion eines echten Dialogs. Natürlich haben wir ein Überangebot an männlichen Meinungen in der Gesellschaft. Deswegen habe ich nicht einfach aufgeschrieben, was die mächtigen Männer des Landes zum Feminismus zu sagen haben. Ich habe sie zum Gespräch gebeten. Das war teilweise anstrengend und auslaugend, aber immer interessant.
Emma Goldmann, eine der einflussreichsten Feministinnen und Anarchistinnen der Moderne, hat mal gesagt: »Abschließende Ergebnisse sind etwas für Götter und Regierungen, nicht für den menschlichen Intellekt.« In diesem Sinne würde ich auch nach 100 Sommern nicht beantworten können, wie alte weiße Männer wirklich zu dem werden, was sie sind. Aber ich mache mich und meinen Feminismus handlungsfähiger und klüger. Und da ich die Befürchtung habe, dass der Feminismus noch viele Jahrzehnte nötig sein wird, ist das doch ein guter Anfang.
Es ging in diesen Gesprächen um Besonnenheit und darum, sich durch die Meinung des Gegenübers nicht gleich angegriffen zu fühlen. Darum, abzuwägen, wann es sich lohnt, die eigenen Argumente zu bemühen, wen man überzeugen kann, und darum – das war mit Sicherheit die anstrengendste Übung –, sich zu fragen, ob das Gegenüber nicht auch einen ganz klugen Gedanken formuliert, der einen weiterbringt. Es geht um Gespräche, die geführt werden können, ohne die eigene Radikalität und den eigenen argumentativen Stolz dadurch bedroht zu sehen.
In gewisser Weise sind diese Gespräche, die ich geführt habe, nur stellvertretend für eine Menge anderer Gespräche, die man auch führen könnte. Sie zeichnen eine simple Methode nach, die sich nicht nur auf Männer und Frauen, Feminist*innen und alte weiße Männer anwenden lässt. Theoretisch können alle mit allen ins Gespräch kommen, die eigenen Standpunkte vergleichen und meinetwegen am Ende weiterhin darauf beharren. Die Welt wird dadurch nicht zwangsweise einfacher, aber aus jeder Chiffre wird dann plötzlich ein Mensch. Das erschwert ungerechte Urteile und schlechte Witze, zwei Dinge, von denen wir heute mehr als genug haben. In Zeiten, in denen wir am liebsten unter uns bleiben, das eigene Meinungskonstrukt an manchen Tagen so angreifbar erscheint, dass bereits ein Gegenargument wie ein Angriff wirkt, ist eine Unterhaltung bereits ein radikaler Akt. Man erkennt damit die eigene Fehlbarkeit an und gibt der Meinung des Gegenübers eine Daseinsberechtigung. In einer Zeit, in der wir uns dafür entschieden haben, Konflikte still streitend auszutragen, ist jedes Gespräch automatisch ein Schlichtungsversuch.
Privilegien und Pokémon Go!
Ein Vormittag mit Sascha Lobo
Das Café, in dem ich Sascha Lobo treffe, ist exakt so unhip, wie es für ein Café in Berlin überhaupt möglich ist. Auf den schweren Eichentischen liegen dicke Speisekarten aus weichem Kunstleder, die es normalerweise nur in schwäbischen Ausflugslokalen gibt. Es gibt Fleischgerichte, und der Beilagensalat wird immer mit »Speck und Croutons« serviert, Familien sitzen auf der Veranda in der Sonne, die dazugehörigen Kinder trinken Apfelsaftschorle aus für ihre Kinderhändchen viel zu großen Gläsern. Wir sind im Prenzlauer Berg.
Es gibt in Berlin Kneipen, die ironisch »urig« sind, so, dass es zwar Schnitzel und Weißbier gibt, aber immer mit einem Augenzwinkern, damit die Medienschaffenden sich nicht abgeschreckt fühlen. Dieses Café hingegen ist echt urig. Sascha Lobo wird sich über das Level von Urigkeit des Treffpunkts keine Gedanken gemacht haben, zumindest nicht bewusst. Er wird das Café aus reinem Pragmatismus ausgewählt haben, wahrscheinlich lag es auf seinem Weg. Sascha Lobo interessiert sich nicht für die Außenwirkung eines Treffpunkts, mutmaße ich. Er hat so viel zu tun, da bleibt schlicht keine Kapazität für Coolness. Sein Job ist es, Menschen das Internet zu erklären, und da das Internet eine unendlich komplizierte Sache ist, ist Lobos Terminkalender entsprechend voll. Angefangen hat er als Blogger, und er war das schon zu Zeiten, in denen Blogging noch nichts mit neureichen Fashion-Mädchen zu tun hatte, die für einen durchschnittlichen Monatslohn Handtaschen in die Kamera halten. Lobo hat auf das Internet und seine Potenziale gesetzt, als Journalist*innen diese »Netzleute« noch für schlecht angezogene Freaks hielten. Heute ruht er sich auf den Lorbeeren seines Pionierdaseins aus, schreibt eine Kolumne für Spiegel Online, wird gerne als Internet-Intellektueller in Talk-Runden eingeladen und hält Vorträge, die er sich vermutlich frech gut bezahlen lässt, wenn ich seine Randbemerkungen richtig interpretiert habe. Am Ende des Tages ist Sascha Lobo aber vor allem auch dieser Typ mit dem roten Irokesen, der auf Bühnen schlaue Sachen über Digitalisierung sagt. Wo genau er das tut, ist gar nicht so leicht herauszufinden, ab und zu taucht mal ein Foto von ihm bei einem Neujahrsempfang oder einem internationalen Kongress auf. Ich würde Sascha Lobo allerdings auch zutrauen, völlig abgeklärt zu Heckler & Koch zu gehen, eine fünfstellige Summe für einen Vortrag einzukassieren und dann 45 Minuten lang allen Vorstandschefs zu erklären, wieso sie, explizit sie, wie sie da sitzen in ihren Nadelstreifenanzügen, mehr Unrecht und Terror zu verantworten haben als der Islamische Staat. Ich verliere mich gerne in solchen Vorstellungen, weil ich das aufregender finde als das naheliegende Szenario, in dem Sascha Lobo jede Woche zweimal im Mietwagen zu irgendwelchen Think Tanks fährt, um da mit jungen Overperformern über visionäre Netzpolitik zu sprechen.
Für Menschen, die viel Zeit im Internet verbringen, ist Lobo so etwas wie ein altväterlicher Vordenker, zu dem man aufblickt, den man manchmal vielleicht etwas absolutistisch und arrogant findet in seiner Art, die Welt zu erklären, dem man aber trotzdem aufmerksam zuhört, wenn er es tut. Bei der re:publica, einem Festival für Netzkultur, ist Lobos Vortrag, der stilistisch irgendwo zwischen intellektueller Abrechnung und Ansprache ans Volk liegt, jedes Jahr aufs Neue die wichtigste Veranstaltung der gesamten vier Tage. Die Leute pilgern zu Sascha Lobo, als wäre er das Mekka des Internets.
Wer sich mit Sascha Lobo unterhält, betritt eine Welt voller radikaler Besonnenheit, in der es keine definitorische Schlampigkeit geben darf. Jedes Wort ist überlegt und klug, zumindest wirkt er in seinem typischen Lobo-Modus, jedes Wort genau abzuwägen, ständig leicht angestrengt. Sein Wort ist kein Gesetz, wird aber oft retweetet.
Das Café betritt er in einem Kapuzenpullover von 2004, ich musste das gar nicht schätzen, denn der Aufdruck, der sich aus Altersschwäche schon ablöst, macht Werbung für irgendein Netz-Event aus genau diesem Jahr. Sascha Lobo trägt solche Pullover nicht aus Nostalgie oder Sparsamkeit, er kann es sich einfach leisten, überhaupt keinen Wert auf neue Pullover zu legen. Ich vergesse in der ersten Sekunde unseres Gesprächs alles, was ich irgendwann mal über kluge Interviewtechnik gelernt habe, und steige sofort ein mit einer viel zu persönlichen und extrem verschreckenden Frage: »Sascha, bist du ein alter weißer Mann?«
Lobo holt tief Luft und trinkt einen großen Schluck Ingwertee, so, als müsse er Kraft schöpfen für eine anstrengende Erläuterung. »Also, ich habe einen Migrationshintergrund, einen etwas untervermarkteten: Mein Vater ist Argentinier. Aber ich fühle mich sehr deutsch, sehe sehr deutsch aus, und ich werde sehr weiß behandelt von der Gesellschaft.« Und genau deswegen kauft man Lobo wohl für Vorträge ein: ein Satz, gleich zwei Metaebenen von Hautfarbe. Da hat er einmal das Gefühl von Herkunft, das Aussehen, das Herkunft mit sich bringt, und die Erkenntnis, dass Herkunft definitiv eine Rolle spielt in Deutschland.
»Es gibt eine innere Zuschreibung von alt, nach der bin ich nicht alt, da habe ich es in den letzten zehn Jahren grade erst geschafft, erwachsen zu werden. Und es gibt eine äußere Zuschreibung. Die fängt zwischen 45 und 55 Jahren an, ab dann gehört man zu den alten weißen Männern, spätestens ab 55, würde ich sagen.« Na gut. Lobo hat noch maximal dreizehn gute Jahre vor sich. Und dann? Kriegt er an seinem 55.Geburtstag ohne Aufforderung Bundfaltenhosen und einen Aufsichtsratsplatz in einem börsennotierten Unternehmen geschenkt? Lobo schüttelt den Kopf. »Der alte weiße Mann ist eher ein Typus Mensch. Nicht jeder Mann, der alt und weiß ist, gehört automatisch dazu. Die Essenz von diesem Typus ist, dass sich alles um ihn herum dreht. Er ist der Mittelpunkt der Welt. Der klassische alte weiße Mann hat große gesellschaftliche Macht, die er nicht nur wahrnimmt, sondern auch für selbstverständlich hält.« Nur wer mächtig ist, kann also dieses negative, leicht ekelhafte Abziehbild eines männlichen Klischees werden? Für die Definition wäre das natürlich ultra praktisch: Alter weißer Mann erst ab mindestens 80000€ im Jahr und erst ab Golf-Handicap 18.
»Der alte weiße Mann ist nicht nur alt und weiß, sondern auch ein wohlhabender, tendenziell eher gebildeter und einflussreicher Mann. Das kann dann aber auch mal nur eine Lebensphase sein. Manche haben nur zwischendurch die Chance, solche Männer zu sein, um die sich alles dreht. Und wieder andere sind gar keine alten weißen Männer, weil sie einen niedrigen sozialen Status haben.«
Ich, als junge, wilde, feministische Frau gehe sehr großzügig mit dem Prädikat alter weißer Mann um. So beeindruckend ich Lobos trennscharfe Definition finde, so sehr beißt sie sich mit meiner Methode, jeden Mann als »alt und weiß« zu bezeichnen, der mich ekelhaft angeht, sich breitmacht, mich als Frau nicht ernst nimmt oder unangenehm auffällt. Es erscheint mir fast ungerecht, dass ein Bauarbeiter, der mir auf offener Straße erzählt, dass ich »ganz nette Titten« hätte,[2] nach Lobos Definition kein alter weißer Mann sein kann, nur weil er eben nicht unbedingt einflussreich und mit Sicherheit nicht reich ist. Lobo schüttelt wohlwollend den Kopf, als hätte ich einen Denkfehler gemacht, der mir noch nicht auffällt, ihm aber natürlich schon. »Es gibt auch Arschlöcher – wie den Bauarbeiter –, die keine alten weißen Männer sind. Und nicht jeder, der ein Arschloch ist, ist automatisch gleich ein alter weißer Mann.«
Lobo antwortet auf meine Fragen mit Präzision und Aufrichtigkeit. Für einen kurzen Moment bin ich mir sicher, dass wir beide die Sache mit dem Sexismus noch an diesem Nachmittag lösen können. Nach manchen meiner Fragen schweigt er kurz nachdenklich und antwortet dann aber im staatsmännischen Tonfall. In diesen Momenten bin ich sehr froh, dass Lobo in meinem Team spielt und nicht für die Sexisten argumentiert. Ich erzähle, wie der alte weiße Mann für mich die Überschrift eines Feindbildes geworden ist, das ich mir nicht erklären kann. Als der Begriff »Feindbild« fällt, wird Sascha Lobo plötzlich ein wenig angriffslustig. Er verabschiedet sich kurz von seiner kontrollierten Art zu sprechen, diesem Überbetonen aller Konsonanten, als würde er morgens im Radio die Staus vortragen, er spricht jetzt auch etwas lauter und nachdrücklicher als nötig. Zum ersten Mal während unseres Gesprächs reicht es ihm offensichtlich nicht, analytisch zu erklären. Der alte weiße Mann als Feindbild, das hat ihn emotional berührt.
»Dieser alte weiße Mann gehört zu der am wenigsten diskriminierten Gruppe in der westlichen Zivilgesellschaft, es gibt keine Tür, die ihm verschlossen bleibt. Es gibt immer Türen, die bleiben dir verschlossen, wenn du eine Frau bist, wenn du jung bist oder schwarz bist. Aber als weißer alter intelligenter reicher Mann sind alle Türen, die ab Werk geöffnet sein können, auf. Man kann immer noch Pech haben, man kann immer noch echt arm dran sein, aber die Werkeinstellung für dich ist die beste, wenn du ein Mann bist. Wenn man solch einen Startvorteil hat, ist es ganz schwer zu abstrahieren, dass deine Leistung nicht nur deine Leistung ist, sondern auch deinem Status geschuldet ist, den du nicht selbst verschuldet hast. Weil die Leute das spüren, haben viele alte weiße Männer den Wunsch, ständig zu betonen, wie irre gut sie sind, um den Anteil, den sie selbst verschuldet haben, möglichst groß zu halten. Der alte weiße Mann hat das Bedürfnis, seine eigenen Leistungen dramatisch zu übertreiben, weil er irgendwie schon ahnt, dass er es leichter hatte als andere.«
Ich muss an die ständige und vor allem ständig gleich anstrengende Diskussion über eine mögliche Frauenquote denken. Immer, wenn so eine Quote für Aufsichtsräte und Führungsetagen diskutiert wird, wird auch von irgendeiner Seite angemerkt, dass eine Frau dann ja nie wissen könne, ob sie wegen ihrer Kompetenz eingestellt wurde oder nur, weil der Proporz zufällig nach einer Frau verlangt hatte. Das lässt vermeintlich jede Frau in einem Chefsessel in der ewigen unterschwelligen Unsicherheit zurück, ob sie vielleicht gar nicht gut genug ist für ihren Job. Ähnlich muss es dem alten weißen Mann gehen: Eigentlich kann er sich nicht sicher sein, ob er wirklich seiner Kompetenz wegen in der Chefetage sitzt oder nur, weil er ein alter weißer Mann ist und somit seine Werkseinstellung maximal gut ist. Nur, dass es im ersten Fall erst eine Gesetzesänderung braucht, im zweiten Falle brauchen wir einfach weiterhin Sexismus. In einer perfekten Welt müsste dann ja tatsächlich jeder alte weiße Mann in jeder Machtposition ständig sich und anderen gegenüber verdeutlichen, dass er nicht nur wegen seiner Fähigkeiten in ebendieser Machtposition ist, sondern auch, weil er es viel, viel leichter hatte als andere. Das würde nicht mal mein Ego zulassen. Es ist doch viel gemütlicher für diese Männer, die eigenen Errungenschaften in den Vorder- und die eigenen Startvorteile in den Hintergrund zu rücken. Vielleicht hat es also zumindest einen Vorteil, eine Frau in der Arbeitswelt zu sein. Zwar gibt es immer Jobs, die ich nicht bekomme[3], weil ich eine Frau bin, aber alle Jobs, die ich bekomme, auf die kann ich dann besonders stolz sein: Seht her, das alles habe ich trotz meiner Brüste geschafft.
Ein alter weißer Mann hat das alles wegen der Umstände erreicht. Stelle ich mir ja wirklich belastend vor, dass ich am Wochenende in meinem Zweithaus im Tessin sitze und meinen Reichtum und Einfluss nicht genießen kann ohne den miesen Hintergedanken, dass ich das alles vor allem meinem Dasein als Mann zu verdanken habe. Verdrängung klingt bequemer und einfacher; wäre ich Mann, ich würde es ganz ehrlich nicht anders machen.
Was ist denn mit Lobo selbst? Wenn Alter-weißer-Mann-Sein nur eine Lebensphase sein kann, wäre es ja auch möglich, dass all die Vorträge, die messeartigen Ansprachen auf der re:publica, die Talkshow-Auftritte, die am nächsten Tag dann bei Facebook viral gehen, auch nur oder zumindest zum Teil mit ihm, als zwar innerlich halb-argentinisch und jung, äußerlich aber sehr weißem und auch fast altem Mann zu tun haben? Lobo lächelt bei der Frage, er hat sich von seinem sanften Ausbruch erholt und flüstert in einem Gemütszustand vor sich hin, den Kritiker vermutlich als Arroganz bezeichnen würden, ich aber gerne maximale Souveränität nennen möchte: »Wenn man mich fragen würde, ich bin der Allerletzte, der meine Leistung gering schätzt. Aber mindestens 50 Prozent von dem, was ich heute mache, kann und bin, der Erfolg, der ökonomische und der Status, ist Glück und Mechanismen zu verdanken, für die ich nichts kann. Mir kommt es drauf an, realistisch einzuschätzen, was ich geschafft habe und was mir zugefallen ist.«
Mir fällt kaum ein Mann ein, der mehr männliches Selbstbewusstsein an den Tag legt und gleichzeitig so meilenweit davon entfernt ist, ein alter weißer Mann zu sein. Sascha Lobo vertritt den seltenen Typus Mann, der erfolgreich und einflussreich ist und keine Angst davor hat zuzugeben, dass das nicht einzig und allein auf sein Genie zurückzuführen ist. In meinem kurzen Leben als Frau in der Berufswelt habe ich schnell gelernt, dass erfolgreiche feministische Männer meine Komplizen sind, denn sie wissen, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht, und sind bereit, einen Schritt zur Seite zu gehen für junge, aufmüpfige Frauen, die auch mal im Chefsessel sitzen wollen. Männer wie Sascha Lobo lassen das zu, weil sie völliges Vertrauen in sich und ihr Können haben. Seine Ellbogen auf dem Tisch faltet er die Hände vor seinem Kinn, er schaut angestrengt, als wäre unsere Unterhaltung ein Schachspiel: »Es gibt eine spezifische Abwehrstrategie des alten weißen Mannes, das ist die Gönnerhaftigkeit. Das ist dieses ›Das, was du erreichst, tust du gewissermaßen von meinen Gnaden‹. Und das ist eines der größten Probleme in dieser Gemengelage. Wenn alte weiße Männer zu oft oder zu betont den roten Teppich für Frauen ausrollen, ist das auch wieder eine Form von Paternalismus.«
Ich spüre, wie ein sechzigjähriger Investmentbanker in mir wach wird, der denkt: »Jetzt können wir Männer wirklich GAR nichts mehr richtig machen. Unterstützen wir Frauen nicht, sind wir Sexisten, unterstützen wir Frauen, sind wir Paternalisten!«
Lobo lächelt: »Diese Gönnerhaftigkeit ist eine, die noch giftiger sein kann als klare Ablehnung, denn sie ist eine Möglichkeit, unabhängig von den Umständen, sich von Anfang an über den anderen Menschen zu stellen. Deswegen muss man aufpassen, dass man nicht auf solche Argumentationen reinfällt. Dann lässt sich als Mann nämlich leicht sagen: Weil ich in meiner unendlichen Weisheit und Güte geholfen habe, sind Frauen da, wo sie heute sind!«
Jetzt verstehe ich Lobos Denkerpose. Wenn ein Mann es wirklich ernst meint mit dem Feminismus, dann ist das eine ständige intellektuelle Anstrengung in alle Richtungen. Es ist immer noch nicht so schlimm wie als Frau unterdrückt zu werden, aber spaßig klingt es auch nicht. Gleichberechtigung ist für alle Beteiligten mühsam. Wie lässt sich das auflösen? Wie können Männer fördern, ohne gönnerhaft zu sein, und wie viel dürfen Frauen einfordern, ohne faul zu wirken?
»Ganz ohne weibliches Selbstbewusstsein wird es auf keinen Fall gehen«, Lobo grinst mich an. Ich bin für ihn eine dieser jungen Frauen, die mit fast bedenklich großem Selbstbewusstsein durch die Gegend laufen.
»Die öffentliche Debatte im Nachkriegsdeutschland wird zu 92,73 Prozent von Männern unter sich ausgemacht – das ist ein Schätzwert –, und das ändert sich nur, wenn ausreichend viele Menschen merken, dass das falsch ist, wenn alte weiße Männer ein bisschen Raum geben und wenn dieser Raum nicht von neuen Pimmeln, sondern von Frauen gefüllt wird.«
Vor unserem Interview habe ich ihm erzählt, dass ich für eine öffentlich-rechtliche Talkshow als Gast angefragt wurde und in Schockstarre abgesagt habe, weil ich zu dem Thema der Folge wirklich gar nichts zu sagen gehabt hätte. Daraufhin hat Lobo laut gelacht und gesagt: »Du hast genauso viel zu dem Thema zu sagen wie Jan Fleischhauer zu den meisten Themen zu sagen hat, und der sitzt auch ständig in jeder Talkshow.« Scheinbar bin selbst ich, die junge Frau mit dem belächelnswerten Selbstbewusstsein, zu zögerlich, wenn es darum geht, ohne Scham Couchsessel im Fernsehen zu besetzen. Und das, obwohl ich die Erste bin, die ungefragt und meistens auch etwas penetrant die unzufriedenstellende Frauenquote in Talkrunden kommentiert. Dann bin ich wohl auch Teil des Problems.[4]
»Alte weiße Männer waren immer schon gut darin, frei werdende Räume mit einer großen Selbstverständlichkeit zu besetzen. Ich glaube, dass diese Selbstverständlichkeit ›Ich gehöre auf die Bühne/ Meine Meinung ist wichtig und ausschlaggebend‹ auch in Frauenköpfen stattfinden muss. Das Selbstbewusstsein, etwas beizutragen, zu der öffentlichen Debatte.«
Sascha Lobo ist ein gutes Beispiel dafür, dass männlicher Feminismus eine Frage des Selbstbewusstseins ist. Er hat keine Angst, dass Frauen ihm etwas wegnehmen, er hat auch keine Angst zuzugeben, dass Teile seines Erfolges mit seinem Dasein als Mann und nicht mit seinem Können zu tun haben. Er stellt sein Können mit dieser Feststellung nämlich nicht automatisch infrage. Würden Frauen auf einmal 50 Prozent aller Aufträge in seiner Branche bekommen und 50 Prozent aller Auftritte in Talkshows, wäre Sascha Lobo immer noch Sascha Lobo. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schmälert die Angst vor Gleichberechtigung. Je mehr du kannst, desto weniger bist du auf deine Privilegien angewiesen.
Als wir uns verabschieden, wischt Lobo auf seinem Smartphone rum. Auf dem Display erscheint der Startbildschirm von Pokémon Go!. Bis gerade eben war ich überzeugt davon, dass es die App schon gar nicht mehr gibt. Sascha Lobo scheint hauptberuflich netzpolitische Visionen zu verkaufen, in seiner Freizeit allerdings benutzt er Spiele-Apps von vor drei Jahren. Ich schaue auf sein Handy und frage überrascht: »Ach, du spielst noch Pokémon Go!?« Und mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte ich gerade gefragt, ob er auch ab und zu atme, antwortet Lobo knapp und barsch: »Natürlich.« Er sagt das so bestimmt, dass ich für eine Sekunde überlege, ob das Spiel vielleicht doch noch der heiße Scheiß ist und nur ich nichts davon weiß. Da war er kurz, der Mechanismus, den Lobo dem alten weißen Mann zuschreibt. Die Welt dreht sich um ihn und die Tatsache, dass er Pokémon Go! spielt, ist von seiner Umwelt bitte nicht auch nur ansatzweise infrage zu stellen. Sascha Lobo ist kein alter weißer Mann, er kann ihn nur sehr gut imitieren, wenn er möchte. Solange er weiter Kapuzenpullover von 2004 trägt und in seiner Freizeit Pikachus fängt, ist er gefeit davor, jemals ein alter weißer Mann zu werden.
Die Digitalisierung ist schuld, sagt der Mann aus der Printbranche
Im Büro von Christoph Amend
Die Redaktion des ZEITMagazins riecht nach gutem Kaffee, an den Wänden hängen schöne Fotografien, auf den Gängen begegne ich Menschen, die in Eile und gut angezogen sind. Alle wirken hier so, als wären sie diese Woche mindestens schon auf einer spannenden Kunstausstellung oder einer hippen Party mit exklusiver Gästeliste gewesen. Ich treffe heute den Chefredakteur Christoph Amend, der hat diese Woche bestimmt beides schon geschafft.
Menschen lesen das ZEITMagazin aus einem bestimmten Grund: Sie wollen zu der Gruppe Menschen gehören, die das ZEITMagazin lesen. Es gibt überfordernd hochkulturelle Fotostrecken, liebevolle Interviews und Geschichten, die abwechselnd fast albern hedonistisch und dann wieder so tief und schön und welterklärend sind, dass man den Macher*innen sofort die Verantwortung für dieses Land anvertrauen möchte. Das ZEITMagazin war es auch, das die #metoo-Debatte endgültig von Hollywood nach Deutschland holte, indem es die Ergebnisse der aufwendigen Dieter-Wedel-Recherchen in mehreren Interviews und Reportagen veröffentlichte. In der Woche nach der großen, ersten Enthüllungsstory dazu war Amend – natürlich – bei hart aber fair zu Gast und hat mit schier unendlicher Besonnenheit über die Recherche und die wirklich immer gleich anstrengenden »Wieso-melden-die-Frauen-sich-denn-erst-jetzt-Vorwürfe« gesprochen. Als seine Zusage kam, mit mir sprechen zu wollen, wusste ich, dass mein Buch damit automatisch klüger werden würde.
Amends Büro besteht aus Büchern, Briefen und einem guten Ausblick über Berlin. Neben der schwarzen Ledercouch stapeln sich Bildbände von Fotograf*innen, Biografien von Schauspielerinnen und Bücher über Design-Hotels. Er bietet mir den einzigen Stuhl an, der frei von Druckerzeugnissen ist. Christoph Amend sitzt mir gegenüber auf dem Sofa, über ihm an der Wand eine gerahmte Fotografie von Willy Brandt. Freundlich und ruhig schaut er mich an, als wäre dieses Gespräch der wichtigste Termin seines Tages, als hätte er nicht noch die Entstehung eines wöchentlichen Magazins zu überblicken. Ich kann nur mutmaßen, woher diese Gelassenheit kommt, vielleicht Routine, vielleicht hat Christoph Amend genug Ferienhäuser irgendwo in der Sonne, an die er denkt, wenn es ihm zu blöd wird, vielleicht aber ist er auch einfach nur einer dieser wenigen aufrichtig freundlichen und beruhigten Menschen, die gar keine Pose, gar keinen Plan B brauchen, weil ihr Plan A für die Welt schon völlig ausreichend ist.
So oder so, ich werde Amend kaum aus der Fassung bringen, wenn ich ihn frage, ob er ein alter weißer Mann ist. Ein amüsiertes Grinsen in seinem Gesicht. »Ich bin wahrscheinlich ein mittelalter weißer Mann. Was alt bedeutet, kommt immer auch auf die Perspektive des Betrachters oder der Betrachterin an. Als ich in deinem Alter, mit vierundzwanzig, auf über Vierzigjährige geblickt habe, wirkten die in meinen Augen oft richtig alt. Andererseits bin ich heute für einen Sechzigjährigen immer noch ein halbwegs junger Mensch. Wenn man über Alterswahrnehmung redet, finde ich das immer so interessant, wie viele auf die Welt schauen und ganz selbstverständlich denken: Mein Blick ist objektiv. Was natürlich nicht stimmt.«
Es gibt ältere Menschen, die nutzen das Konzept der relativen Alterswahrnehmung dazu, leicht triumphierend, als hätten sie die Grundregeln der Physik ausgehebelt, von sich zu behaupten, jung geblieben zu sein, was sich bei ihnen im Alltag dann meistens nur durch das Trinken von bunten Cocktails und der übertriebenen Pflege des eigenen Facebook-Profils äußert. Diese Art von zur Schau gestellter falscher Jugend führt bei den echten Jungen dann meistens zu einer Emotion irgendwo zwischen großem Spaß und peinlicher Berührung. »Nein, ich fühle mich genau wie 44 Jahre«, sagt Amend, er sagt das entschlossen und ohne eine Sekunde zu überlegen. Da spricht einer, der weiß, wie unschick Midlife-Crisis ist, da ruht jemand bis auf den Tag genau im eigenen Alter.
Es gibt Männer, die können das nicht, dieses Ruhen, die haben im Gespräch mit jungen Menschen dann den Drang, kokett vorzurechnen, wie alt ich war, als sie Abitur gemacht haben oder wie lange sie schon ihren Führerschein hatten, als ich Auto fahren gelernt habe. Die Rechnung ist rein mathematisch sehr banal und der Überraschungseffekt auch eher überschaubar, ich war nämlich ausnahmslos sehr jung, als sie Abitur gemacht haben und Auto fahren kann ich bis heute nicht. Trotzdem erwarten diese Männer als Reaktion auf ihre Einfallslosigkeit meist eine Art Lachanfall oder zumindest staunende Sprachlosigkeit, die ich allein schon aufgrund meiner unbeeindruckten Grundhaltung der Welt gegenüber nicht leisten kann. Ich bin froh, dass Amend uns beiden diese ganze Chose durch seine Coolness erspart.
Fairerweise muss man aber auch sagen, dass es vermutlich für kaum einen anderen Mann in seinem Alter leichter ist, nicht mit seinem Alter zu hadern. Denn Amend bewegt sich ja in der Medien- und Kulturbranche, beides Gebiete, in denen Männer nicht alt werden, sondern höchstens trinkfester, und graue Schläfen nicht zu Kontrollverlust, sondern zum Kauf eines Kaschmir-Rollkragenpullovers führen. Wäre das Wort nicht so klebrig-popkulturell, würde es nicht so sehr nach Oktoberfest und ABBA! klingen, könnte man fast sagen, dass Christoph Amend ein bisschen Kult ist in seiner zurückhaltenden Omnipräsenz im Kulturbetrieb. Sein Gesicht, samt runder Hornbrille und rotblondem Haar, ist mittlerweile das stilisierte Logo seines eigenen Newsletters, den er jeden Abend um Punkt 17 Uhr verschickt. Christoph Amends Gesicht ist das Logo für Christoph Amends Newsletter, diesem Mann kann also selbst im hohen Alter nichts mehr passieren. Vielleicht müsste Christoph Niemann, der das Logo entworfen hat, in ein paar Jahren die Schläfen grau einfärben, aber diese Art von Midlife-Crisis ist ja recht ressourcenschonend, im Vergleich zum Kauf eines Porsches, zum Beispiel.[5]
Er lehnt sich entspannt zurück, trinkt abwechselnd Espresso und stilles Wasser und gibt mir alles, was er weiß:
»Mit dem Label alter weißer Mann ist in den meisten Fällen etablierter weißer Mann gemeint. Das Feindbild, das Klischee-Bild, meint das Establishment, und zwar das männliche Establishment. Da kann man 35 Jahre alt sein oder auch 65. Aber alter weißer Mann ist natürlich eingängiger.«
Es ist ein bisschen ironisch, wenn der Chefredakteur des ZEITM