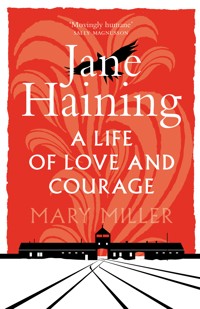Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sie sind gierig nach romantischen Gefühlen, aber gefangen in Zeiten pornografischer Abgeklärtheit. Sie haben keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen, und sorgen sich um ihr Gewicht und wie sie in weißen Bikinis aussehen. Sie treffen ständig schlechte Entscheidungen und sind sich selbst ihr schlimmster Feind. Die orientierungslosen jungen Frauen in "Always Happy Hour" verbringen ihre besten Jahre in Shopping Malls, Drogerien, Karaoke-Bars und Fast-Food-Restaurants, wo sie zu viel Alkohol trinken und komplizierte Gespräche über Essen führen. So damit beschäftigt, irgendwelchen Männern zu gefallen, merken sie gar nicht, wie egal ihnen diese Männer eigentlich sind. Mary Miller beschreibt eine atemlose Gegenwart, die keine Zukunft kennt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Sie sind gierig nach romantischen Gefühlen, aber gefangen in Zeiten pornografischer Abgeklärtheit. Sie haben keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen, und sorgen sich um ihr Gewicht und wie sie in weißen Bikinis aussehen. Sie treffen ständig schlechte Entscheidungen und sind sich selbst ihr schlimmster Feind. Die orientierungslosen jungen Frauen in »Always Happy Hour« verbringen ihre besten Jahre in Shopping Malls, Drogerien, Karaoke-Bars und Fast-Food-Restaurants, wo sie zu viel Alkohol trinken und komplizierte Gespräche über Essen führen. So damit beschäftigt, irgendwelchen Männern zu gefallen, merken sie gar nicht, wie egal ihnen diese Männer eigentlich sind. Mary Miller beschreibt eine atemlose Gegenwart, die keine Zukunft kennt.
Mary Miller
Always Happy Hour
Erzählungen
Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs
Hanser Berlin
Für meine Exfreunde
Der Parkplatz nach dem Kino ist die aufgebrochene Welt.
Mark Leidner, Die Liebe in Zeiten dieser Krankheit hier, wie auch immer sie heißen mag
Anleitung
Er hat ihr ein Blatt Papier mit mehreren Zeichnungen hingelegt. Er muss ziemlich lange dafür gebraucht haben — wahrscheinlich ist er deshalb spät losgekommen. Dabei wollte sie nur den Code zum Wäscheraum wissen und wo der Briefkastenschlüssel liegt.
Sie legt sich zu seinen Katzen aufs Bett und sieht sich die Zeichnungen an. Ganz oben ist ein Banner, so eins in der Art, wie es Flugzeuge hinterherziehen, vielleicht mit einer Werbung für das Two-for-one-Angebot einer Strandbar darauf. Im Falle meines vorzeitigen Todes. Darunter hat er einen Grabstein gezeichnet: Alles war schön und nichts tat weh. Neben den Grabstein eine einzelne Blume und ein paar Grasbüschel. Außerdem gibt es verschiedene Kästchen mit den Überschriften GATOS, KAFFEE, PAR AVION und BASURA und eins mit nur einem Fragezeichen. In dem PAR-AVION-Kästchen steht: Der Briefkastenschlüssel hängt neben dem Schlagring. Die Abteilung GATOS nimmt den größten Teil der linken Seite ein. Er hat eine Skizze vom Katzenklo mit der klumpenden Streu darin gezeichnet und schreibt, sie soll es mindestens zweimal am Tag saubermachen, damit die Katzen keinen Koller kriegen. BASURA … auf dem Parkplatz.
Hält er sie für unfähig, den Müll rauszubringen und ein paar Katzen zu füttern?
Sie steht vom Bett auf, geht in die Küche und trinkt den letzten Kaffee, den er gemacht hat, und weil er kalt ist, gibt sie Eiswürfel, Milch und Zucker hinein. Sie rührt ihn mit einem sauberen Löffel um und legt den Löffel in die Spüle. Alles war schön und nichts tat weh, denkt sie, während sie in Socken dasteht.
Sie öffnet die Küchenschränke und betrachtet die Sachen, die immer in seinen Küchenschränken stehen und die hundertmal interessanter sind als die Sachen bei ihr zu Hause. Es ist noch jede Menge von den Schokoriegeln da, die seine Tante aus Neuseeland mitgebracht hat, mit Fröschen auf dem Papier. Außerdem Tic Tacs, mehrere Flaschen Olivenöl und Gewürze aus dem italienischen Spezialitätenladen. Auf dem Kühlschrank vier Schachteln Kellogg’s. Sie wird einfach Cornflakes und Schokoriegel essen und sich Sandwiches aus dem Little Deli holen. Sie wird auf seinem Heimtrainer strampeln und sich dabei The Office und Girls ansehen. Sie vermisst schon jetzt ihre Wohnung mit den ganzen Büchern und dem Balkon, auf dem sie rauchen kann, unbeobachtet von alten Damen und den Katzen, die sie von der Fensterbank aus anstarren.
Sie trinkt den Kaffee aus und stellt die Tasse neben den Löffel ins Spülbecken. Trotz der Anweisungen im Kästchen KAFFEE (YouToube: Chemex, Filter überm Spülbecken) wird sie hier bei ihm keinen mehr trinken. Er kennt so viele Arten, ihn zuzubereiten, und sie kommen ihr alle unnötig kompliziert und zeitraubend vor.
Sie zieht die Schuhe wieder an und verabschiedet sich von den Katzen. Sie mag diese Katzen nur, weil es sich durch ihre Anwesenheit mehr nach Familie anfühlt. Nachts schleichen sie durch die Wohnung und suchen irgendwas zum Umwerfen, frühmorgens wecken sie sie, weil sie Hunger haben. Wenn sie im Bett liest, schlagen sie ihre Krallen in die Buchseiten und warten ihre Reaktion ab.
Auf der Fahrt zur Arbeit denkt sie an all das, von dem sie weiß, dass es ihm wehgetan hat: der Tod seines Cousins, Knochenbrüche oder das eine Mal, als er eine Handvoll Tabletten geschluckt und zu viel Wodka getrunken hat, weil er jung und im Ausland war. Sie erinnert sich an das, was ihr wehgetan hat, und denkt dann über Schönheit nach und darüber, wie selten sie diese selbst in schönen Dingen wahrnimmt. Sie fragt sich, ob Menschen, die in ihrem Leben viel Schmerz erfahren haben, Schönheit besser erkennen können. Sie fragt sich, wie ein paar aneinandergereihte Wörter so bedeutungsvoll wirken können, obwohl sie sie gar nicht glaubt.
In der Mittagspause textet sie ihrem Freund und fragt, ob das von ihm ist.
Das ist aus Schlachthof 5, antwortet er.
War ja klar. Das ist so die Art Spruch, wie ihn sich Hipster auf die Arme tätowieren lassen — Das Herz ist ein einsamer Jäger, Nicht alle Wandernden sind verloren, Alles war schön und nichts tat weh.
Sie ist enttäuscht, andererseits hätte sie auch selbst darauf kommen können.
Ein paar Stunden später steht sie wieder vor seiner Wohnung. Als sie die Tür aufschließt, kommt seine Nachbarin heraus und drückt ihr ein paar Coupons in die Hand.
»Danke«, sagt sie. »Super.«
Die Frau wirkt enttäuscht; sie ist nicht so überschwänglich, nicht so begeistert, wie sie sein sollte. »Die sind gratis«, sagt die Frau, »das beste Barbecue in der ganzen Stadt.«
Sie bedankt sich noch einmal und sagt, dass sie die Coupons auf jeden Fall einlösen wird.
»Wenn nicht, geben Sie sie mir einfach zurück.«
»Doch, die löse ich auf jeden Fall ein«, sagt sie ein zweites Mal, macht die Tür zu und schließt ab. Sie zieht die Rollos runter und schaltet überall Licht an.
Die Coupons wirft sie in den Müll. Sie mag keine Barbecues und schon gar nicht, dass immer alle davon reden, wo es das beste Barbecue in der Stadt gibt. Sie hat noch nie bei Franklin’s in der Schlange gestanden, umgeben von Leuten, die in Gartenstühlen aus Pappbechern trinken, und ist auch noch nie auf der Suche nach etwas Authentischem meilenweit zu irgendeiner dubiosen Bude mitten in der Pampa gefahren.
Sie macht das Katzenklo sauber, füttert die Katzen und sieht sich die Zeichnungen noch einmal genau an — wenn sie das richtig versteht, füttert ihr Freund sie viermal am Tag, ein stetiger Futterstrom in ihren gemeinsamen Napf. Morgen wird sie es besser machen. Ganz unten auf dem Blatt sind Herzchen, sechs Stück, und drei Hab dich lieb … Sie denkt über den Unterschied zwischen Hab dich lieb und Ich liebe dich nach. Hab dich lieb, das sagt sie zu ihrer Freundin, wenn sie am Telefon abrupt auflegen oder eine Verabredung absagen muss. Sie vermutet, dass er in diesem Fall Hab dich lieb geschrieben hat, weil es besser aussah, denn so etwas hat ihr Freund immer im Blick — alles ist wohl erwogen und sorgsam durchdacht. Sie hat vor langer Zeit beschlossen, dass sie kein umsichtiger Mensch sein will, ihr Leben nicht damit verbringen will, sich dauernd Gedanken zu machen, was andere von ihr halten. Natürlich macht sie sich Gedanken, sie macht sich ständig Gedanken, und ihre Nachlässigkeit führt nur dazu, dass sie andere dauernd vor den Kopf stößt, sie mit ihrem Verhalten auf die Probe stellt und erwartet, dafür von ihnen geliebt zu werden.
Sie zieht eine Feder an einem Stab über den Boden und beobachtet die Katzen: Sie starren zurück, ohne zu blinzeln oder wegzusehen. Sie kitzelt den Kater mit der Feder am Kopf und dann an der Nase, er langt ein paarmal mit der Pfote danach und gibt dann auf. Sie kniet sich auf den Boden und lockt sie mit dem Finger, so wie ihr Freund. Sie kommen zu ihr und stupsen sie mit der Stirn an, dann legt sie sich mit ihnen aufs Bett und spürt ihre kitzelnden Härchen im Gesicht. Sie streichen um sie herum und schnurren, immer lauter und lauter, und sie fragt sich, ob sie sie wohl in ihrem Wagen mit zu sich nehmen könnte. Katzen mögen keine Ortsveränderung, hat ihr Freund gesagt. Dann schreien sie und kacken alles voll.
Sie hat keine Haustiere, hatte noch nie welche, und ihrem Freund tat sie leid, als sie ihm das erzählte. Dass ihre Familie arm war und dass sie im Garten hinterm Haus Frösche, Schlangen und Schildkröten gesammelt hat, die sie in Einmachgläsern und Schuhkartons sterben ließ, hat sie ihm nicht erzählt. Einmal hat sie ein halbes Dutzend Frösche in ein Puppenhaus gesperrt, das ihre Mutter ihr auf einem Garagenflohmarkt gekauft hatte, und sie durch die kleinen Fenster hindurch beobachtet. Natürlich weiß er, dass ihre Familie arm war. Wenn man arm aufgewachsen ist, kann man das nie ganz abstreifen, selbst wenn man später alles tut, um nicht mehr arm zu sein. Sie liest gern von Lottogewinnern, die kopflos alles verschleudern, bis sie das ganze Geld wieder los sind, nur um zurück auf vertrautes Terrain zu gelangen.
Sie betrachtet ihren offenen Koffer auf dem Boden, ihre Handtasche, den Rucksack und die Tennisschuhe. Ihr MacBook Pro, erst ein paar Monate alt. Wenn sie sonst ohne ihn in seiner Wohnung war, hat sie auf ihn gewartet und wusste, er würde jeden Moment kommen, und dann würden sie Sex haben, sich irgendeinen Film ansehen und gegenseitig den Rücken kratzen. Sie würden reden und lachen.
Sie geht zu seinem Schrank, nimmt den Ledermantel heraus, für den er siebenhundert Dollar hingeblättert hat, und probiert ihn an. Der Reißverschluss geht kaum zu. Ihr Freund ist nicht sehr groß. Sie steckt die Hände in die Taschen: leer. Sie fragt ihn immer, wie viel irgendwas kostet, wie viel er bezahlt hat, und er hasst das. Sie weiß, dass er es hasst, aber deshalb will sie es nur umso mehr wissen.
Im Falle meines ungewöhnlich frühen Todes, denkt sie — nein, nicht ungewöhnlich — unwahrscheinlich.
Sie nimmt den Kater hoch, ebenfalls kleiner als sein weibliches Gegenstück. Diesen mag sie am wenigsten, hat sie beschlossen. Er zappelt, lässt sich dann aber von ihr in die Küche tragen. Sie setzt ihn ab, nimmt das Päckchen mit den Leckerlis vom Küchenschrank und schüttelt es. Darin ist besonderes Trockenfutter, das genauso aussieht wie das normale Futter. Sie schüttet etwas davon auf den Boden und sagt, Leckerlis, feine Leckerlis, und die Katze kommt ebenfalls in die Küche geschlichen.
Als sie alles aufgefressen haben und weggehuscht sind, öffnet sie den Kühlschrank, nimmt eine Packung Frischkäse heraus und sieht nach dem Haltbarkeitsdatum. Es ist vor vier Monaten abgelaufen, aber die Milch ist noch gut und die Eier auch. Sie macht sich mit seinem Uncle Val’s Gin einen Drink, nimmt ihn mit ins Bad und stellt ihn neben das Waschbecken, während sie aufs Klo geht. Die Katze setzt sich in die Tür und sieht ihr zu. Obwohl sie und ihr Freund fast jede Nacht zusammen verbringen, gab es noch nie irgendein Anzeichen dafür, dass er auf Toilette mehr als gepinkelt hätte. Wirklich sehr merkwürdig, das Ganze. Sie lauscht jetzt immer schon, stellt den Fernseher leiser. Geht direkt nach ihm ins Bad, um zu prüfen, ob man etwas riecht. Nichts — nie die geringste Spur.
Die Katze kommt ins Bad, vorsichtig, dann stößt sie den Rasierer vom Badewannenrand. Die Klinge löst sich, sie schreit auf, und die Katze flieht unters Bett. Sie sucht die Rasierklinge, findet sie aber nicht; bestimmt hat die Katze sie verschluckt, denkt sie und fühlt sich ganz elend, weil ihrem Freund klar war, dass sie eine genaue Anleitung brauchte. Er wusste, dass sie es irgendwie versauen würde.
Sie versucht, die Katze unterm Bett hervorzulocken. Als sie eine Ecke der Matratze hochhebt, zieht sie sich in einen sicheren Bereich zurück, während ihnen der Kater zusieht. Sie geht von einer Ecke zur anderen, hebt überall die Matratze an und sucht die Rasierklinge, findet sie aber nirgends. Sie legt sich wieder aufs Bett und nimmt einen Schluck von ihrem Drink. Wenn ihr Freund sich zu Hause einen Cocktail macht, trinkt er ihn nie aus. Er lässt ihn immer irgendwo stehen, und dann ist er zu wässrig, und er kippt ihn weg. Sie will wissen, ob sie das auch kann: ein Test. Wenn sie den hier nicht austrinkt, hat sie gewonnen. Außer den Katzen liegt unter dem Bett nur ein Revolver. Geladen und entsichert, hat ihr Freund gesagt; sie soll die Finger davonlassen, es sei denn, sie wäre darauf vorbereitet, ihn zu benutzen. Er hat ihr gezeigt, wie man die Trommel öffnet und die Patronen rausnimmt, aber sie hat es sofort wieder vergessen. Das ist wie beim Erste-Hilfe-Kurs, egal, wie oft sie den schon belegt hat, sie wäre nicht in der Lage, jemandem das Leben zu retten.
Ihr Freund ruft an; noch hundert Meilen bis zum fantastischen, wunderschönen San Francisco, sagt er.
»Willst du, dass wir irgendwann nach Kalifornien ziehen?«, fragt sie.
»Kalifornien wird uns zu Füßen liegen, Baby«, sagt er. »Wir haben das schönste Haus mit den größten Fenstern, die aufs Meer rausgehen. Ich bring dir jeden Morgen frischgebackenes Brot, dann lass ich dich in Ruhe.«
»Wann lässt du dir dein Tattoo stechen?«, fragt sie.
»Morgen«, sagt er.
Bevor er gefahren ist, ist er alle seine Tattoos mit ihr durchgegangen, hat ihr erzählt, was sie bedeuten und warum er sie sich hat stechen lassen. Eins ist ein menschliches Herz, in dem SOFA steht. Da stand nicht immer SOFA — früher waren es mal die Initialen eines Mädchens, deshalb hatte er nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt jede Menge literarischer Anspielungen. In jungen Jahren hat er sich ein Gertrude-Stein-Gedicht auf den Rücken tätowieren lassen, aber das ist jetzt von einem Bullen und einem Bären überdeckt, die miteinander kämpfen: Es sieht aus, als würde der Bulle gewinnen, aber er meinte, keiner von beiden würde je gewinnen; sie sind dazu verdammt, auf immer und ewig zu kämpfen. Es gibt Bezüge zu Proust, Nabokov und L. Frank Baum. Und dann hat er noch etliche kleine Tattoos, die sie an ihre Collegeblöcke aus Highschool-Zeiten erinnern, die Ränder voller Sterne und vierblättriger Kleeblätter.
Er mag es, dass ihre Haut weiß und unberührt ist.
»Es ist einsam hier ohne dich«, sagt sie. »Ich hab Die Straße mitgebracht, aber das musst du mir vorlesen.« Seit Wochen liest er ihr daraus vor. Sosehr sie es mag, sie kann selbst nie mehr als eine Seite auf einmal lesen, weil es so einlullend und so schön ist, dass es sie in eine Art Trance versetzt. Nur wenn er es ihr vorliest, ist sie in der Lage, die Wörter in Bilder und die Bilder in Bedeutung zu übersetzen. Sie öffnet das Buch an der Stelle, wo sie zuletzt waren: Als er über das Gras ging, wurde ihm schwummrig, und er musste stehen bleiben. Er fragte sich, ob es daher kam, dass er an dem Benzin gerochen hatte. Wie geht das, dass solche simplen Sätze zusammen etwas ergeben, das sie nicht versteht?
Sie telefonieren noch zehn Minuten weiter, und die ganze Zeit überlegt sie, ob sie ihm sagen soll, dass seine Katze wahrscheinlich eine Rasierklinge gefressen hat und sterben wird. Als sich seine Stimme verändert — er will bald auflegen —, sagt sie es ihm. »Die Klinge ist abgesprungen«, sagt sie, »und ich finde sie nicht mehr. Ich glaub, sie hat sie verschluckt.«
»Katzen verschlucken keine Rasierklingen«, sagt er, aber sie ist sich da nicht so sicher. Sie weiß nicht, was Katzen tun oder nicht tun. Sie weichen zum Beispiel nicht aus, wenn sie seine Kugelhantel in ihre Richtung schwingt, und einmal hat sie den Kater damit am Kopf erwischt, und es hat so laut pock gemacht, dass ihr Freund es nebenan noch gehört hat.
Sie sagen, Ich liebe dich und Tschüss — Ich liebe dich, Ich dich auch, Tschüss —, dann ist es wieder still. Sie hat Angst, dass ihr Freund bei einem Autounfall stirbt oder betrunken die Treppe runterfällt und sich das Genick bricht. Dass sie ihn nie wiedersieht. Sie schaltet den Fernseher ein, zappt herum und denkt dabei an diesen Traum, den er neulich hatte, als er sie mitten in der Nacht geweckt hat, um ihr davon zu erzählen: Wir saßen zusammen in einem Boot, und auf einmal kam ein schlimmer Sturm auf, hat er gesagt. Ich hab die Ruder verloren, deshalb hab ich mit den Armen gepaddelt. Dann haben Piranhas sie mir abgefressen, sie runtergekaut bis auf den Knochen, aber ich bin immer weiter gepaddelt. Ich bin gepaddelt und gepaddelt und hab versucht, uns an Land zu bringen. Und so endete der Traum: ihr Freund, der mit seinen Skelettarmen wie wild paddelt, um sie beide zu retten. Der Traum war Ausdruck seiner Sorgen, das weiß sie, so wie fast alle Träume. Er macht sich Sorgen, dass seine Liebe irgendwann einmal aufgebraucht sein könnte. Er liebt sie so sehr, dass es ihm Angst macht, weil so etwas nicht ewig gutgehen kann — vielleicht sollten sie sich beide jemanden suchen, den sie weniger lieben können. Oder vielleicht ist sie auch einfach nicht die, die er in ihr gesehen hat, oder die, von der er sich gewünscht hätte, dass sie es wäre. Sie hat ihn enttäuscht. Sie hat sich selbst enttäuscht, indem sie ihn enttäuscht hat, und sie wird ihn auch in Zukunft enttäuschen, weil sie enttäuscht ist, dass er enttäuscht ist, und so weiter. Alles ist gut, hat sie zu ihm gesagt, ihm das Haar zurückgestrichen und seine Hand genommen. Wir sind glücklich, hat sie ihm versichert. Hier gibt es keine Stürme.
Das Haus an der Main Street
Mittwochs ist in der Stadt ein Bauernmarkt. Meine Mitbewohnerin Melinda fährt die drei Blocks zum Town Square Park mit dem Rad und kommt mit einer Tüte voll Hirschsalami oder einem ganzen Huhn zurück. Sie ist klein, nicht mal eins sechzig, und hat die winzigsten Schuhe und Slips, die ich je gesehen habe, aber sie isst unglaubliche Mengen. An anderen Tagen bringt sie Ziegenfleisch, eine Taube oder ein Eichhörnchen mit heim. Genau wie ich ist sie zum Promovieren in der Stadt, aber sie kommt aus New York City und findet bis auf die ausgefallenen Fleischsorten und die Nähe zu New Orleans alles hier scheiße. Ich habe ihr erzählt, dass meine Brüder früher immer Waschbären gejagt, aber nicht gegessen, sondern stattdessen an Schwarze verschenkt haben. Sie meinte, das wäre rassistisch, dabei ist es doch bloß die Wahrheit, das haben sie wirklich gemacht, und ich weiß echt nicht, was daran rassistisch sein soll. Vielleicht hätte ich einfach den Mund halten und nichts davon erzählen sollen.
Oft kann ich nicht anders, als ihr ihre schlimmsten Vermutungen über uns zu bestätigen, denn sie sagt immer, es ist viel zu schwül hier, es gibt keine brauchbaren Männer, die man daten könnte, und die Leute rufen ihr irgendwas nach, wenn sie joggen geht oder Rad fährt, was ich alles genauso hasse wie sie, nur gibt sie mir immer das Gefühl, es wäre meine Schuld. Und warum gibt’s hier keine verfickten Gehwege?, fragt sie mich, als hätte ich persönlich beschlossen, dass in dieser Stadt keine gebraucht werden.
Heute hat Melinda ein Huhn mitgebracht. Die mag sie am liebsten, sie kocht das ganze Ding in einem Topf. Ich stehe in der Küche und sehe es an. Der Topf ist randvoll, und der fette Vogel schwimmt hüpfend an der Oberfläche. Ich esse kaum noch Fleisch im Moment, so eklig finde ich die blutigen, tropfenden Tüten, die sie die Treppen hochträgt, und die kahlgerupften blassrosa Kadaver. Während ihr Huhn kocht, vögelt sie mit einem Doktoranden aus dem dritten Jahr, der mit seinen religiösen Überzeugungen ringt. Er ist groß und blond, also eigentlich mein Typ, aber er ist Baptist, ordentlich gekleidet und allseits beliebt, also doch nicht mein Typ.
Das Wasser kocht über, alles ist voll Hühnerfett. Melinda macht nie den Herd sauber. Sie hat ganz allgemein was gegen Putzen, soweit ich das beurteilen kann, und weil die Sauerei nicht von mir ist, mache ich sie auch nicht weg.
Ich bin angespannt, wenn sie im Haus ist, und diese Anspannung werde ich nur los, indem ich mit ihr spreche. Sie erzählt mir, wie viele Klimmzüge sie schafft oder wie das Training für ihren nächsten Marathon läuft. Ich frage sie nach ihren Gedichten, die sich um Äpfel und Bäume drehen und tatsächlich nie mehr als Äpfel und Bäume sind. Das größte Problem, das ich mit ihr habe, ist wohl, dass sie sich anscheinend vor gar nichts fürchtet.
Ich nehme mir ein Bier aus dem Kühlschrank, setze mich an den Küchentresen und sehe zum Fenster raus, in das sie eine Weinflasche geklemmt hat, damit es offen bleibt. Eine liegt schon draußen auf dem Flachdach, und ich könnte ohne Weiteres rausklettern und sie aufheben, aber sie liegt da schon so lange, dass sie einfach zur Kulisse gehört. Den besten Küchenplatz gab es in meiner vorherigen Wohnung, eine Fensternische, in der ich mir vorkam, als wäre ich irgendwo versteckt, wo mich niemand finden konnte. Ich habe dort allein gewohnt und hatte alles für mich, aber das Geld von der Scheidung war irgendwann alle, und mein Exmann findet es allmählich nicht mehr lustig, wenn ich ihn anrufe und bitte, mir einen Scheck zu schicken. Er ist nicht mehr für mich verantwortlich, was eine große Erleichterung für ihn ist. Und für mich auch. Ich will sein Geld nicht. Es ist, als hätte ich ihn die ganze Zeit nur angerufen, um ihn um irgendetwas zu bitten, das er mir nie gegeben hat, nie hat geben können, und als hätte ich es nur getan, damit er die Gelegenheit hat, Nein zu sagen.
Als mein Bier alle ist, sind sie immer noch zugange. Wenn es einem elend geht, gibt es wirklich nichts Ekelhafteres als zwei Menschen, die so wahnsinnig viel Spaß miteinander haben.
Ich werfe meinen Kronkorken, den ich so fest umklammert habe, dass er einen ringförmigen Abdruck in meiner Hand hinterlassen hat, zum Fenster raus und nehme das letzte Bier aus dem Kühlschrank. Der Blonde wird bald losmüssen zur Kirche, und bei diesem Gedanken fühle ich mich etwas besser. Ich weiß, dass er sich hassen wird, und sie wird er auch hassen, weil es ihre Schuld ist, dass er sich hasst. In einer halben Stunde wird er auf den Rücken eines hübschen Kirchenmädchens starren, das mit jemand anderem zusammen ist, jemand Stärkerem, stärker, als er selbst je sein könnte. Er wird auf seine knittrige Stoffhose runterschauen und wissen, dass er sie nie haben wird.
Ich nehme die Flasche aus dem Fenster und schalte die Klimaanlage an. Dann rufe ich Ben an; anscheinend hat er gerade geschlafen. Ben macht immer, was ich sage, weil er in mich verliebt ist und ich manchmal mit ihm ins Bett gehe. Er überlässt mir immer die Initiative, und meistens melde ich mich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ihm mehr schuldig, als mir lieb ist.
»Komm, wir gehen was trinken«, sage ich. »Ich hab kein Bier mehr da.«
Er sagt, er ist müde und hat einen Kater, und dann meint er seufzend, ich soll ihm eine Stunde geben. Eine Stunde ist nicht allzu lang, und ich stimme zu. Ich muss noch duschen und irgendwas zum Anziehen finden, ein bisschen Eyeliner auftragen und mir Concealer unter die Augen schmieren. Ich weiß schon, wo wir hingehen, da, wo wir immer hingehen: in diese Karaoke-Bar, in der man zu jeder Tages- und Nachtzeit trinken kann. Es ist ein Asiladen, aber es gibt eine Jukebox mit jeder Menge Johnny-Cash-Songs, die Klospülung funktioniert immer, und es interessiert keinen, wenn man sich volllaufen lässt. In manchen Läden schmeißen sie einen raus, wenn sie sehen, dass man vom Barhocker fällt oder den Kopf auf den Tresen legt, um ein Nickerchen zu halten, aber nicht bei Shenanigan’s.
Der Blonde murmelt irgendwas, das Unterhemd über dem Kopf. Vielleicht rennt er jetzt nach Hause, um sich vor dem Gottesdienst halbwegs herzurichten. Vielleicht schlägt er sich mit der Faust auf die Brust und sagt Gott, wie sehr es ihm leidtut, dass er mit einer Atheistin aus New York City geschlafen hat, mal wieder, und dass er aufhören wird, eigentlich schon aufgehört hat, weil es das allerletzte Mal war.
Statt zu duschen, lege ich mich aufs Bett und starre auf die Baumwipfel.
Unsere Wohnung geht über den gesamten ersten Stock eines alten Kolonialhauses. Jede von uns hat zwei große Zimmer und ein eigenes Bad. Wir teilen uns eine Küche, ein Esszimmer und einen kleinen Nebenraum, in dem unsere Waschmaschine und der Trockner aufeinanderstehen. In der frisch renovierten Wohnung unter uns wohnen ein Mann und der Sohn seiner verstorbenen Geliebten — sie mögen sich zwar nicht, aber ihnen gehört jeweils eine Hälfte der Wohnung, und gerade ist ein schlechter Zeitpunkt zum Verkaufen, sagt Melinda. Ich lausche auf laute Stimmen, auf irgendwelche Stimmen, aber es ist immer so still da unten. Ich stelle mir vor, wie sie in ihren Pantoffeln vor dem Fernseher sitzen und essen, vollkommen unabhängig voneinander, als würde der andere gar nicht existieren.
Ben ruft mich aus dem Auto an. Ich ziehe meine Lieblingsjeans und ein sauberes Shirt an, checke im Spiegel mein Gesicht und stelle mich dann auf die Toilette, um mich ganz zu sehen. Ich brauche neue Klamotten und Schuhe. Ich hab keine Ahnung, wie ich es schaffe, mit dem bisschen Geld von meiner Doktorandenstelle klarzukommen — es ist echt wenig —, aber irgendwie schaffe ich es. Die anderen nehmen Kredite auf, damit sie schick essen gehen und sich Kleider und High Heels kaufen können.
»Danke fürs Abholen«, sage ich und lasse mich in den Beifahrersitz seiner grauen Limousine sinken.
»Kein Ding. Wo willst du hin?«
»Dieses Spielchen können wir uns heute sparen, oder?«, frage ich und klappe den Aschenbecher zu.
»Wenn du meinst«, sagt er.
Das Shenanigan’s ist keine drei Meilen entfernt, aber in einer so kleinen Stadt ist das weit. Ich ziehe in immer kleinere Städte, und die Entfernungen dehnen sich entsprechend aus. Fünf Meilen waren früher nichts. Jetzt kommen mir drei total weit vor, lächerlich. Und wenn es draußen kalt ist oder regnet — vergiss es. Mein letzter Exfreund ist in Los Angeles aufgewachsen und hatte überhaupt kein Problem damit, fünfzehn Meilen für Sushi zu fahren, was einer der Gründe war, warum es zwischen uns nicht funktioniert hat. Genau genommen nicht die Entfernung selbst, sondern die Art, wie Entfernungen unsere jeweilige Welt geformt haben.
»Hast du den ganzen Tag geschlafen?«, frage ich.
»Ist spät geworden gestern.«
»Du hast wieder dieses Videospiel gespielt.«
Er klappt den Aschenbecher auf und zündet sich eine Zigarette an.
Ich habe ihn dieses Spiel schon früher spielen sehen, es besteht eigentlich nur aus Codes, eine kryptische Ansammlung von Zahlen und Symbolen, die mir immer das Gefühl gegeben hat, ich sei dämlich, deswegen mache ich mich darüber lustig. Und natürlich spielt auch ein Mädchen mit, das er mag, ein Mädchen, das tausend Meilen weit weg wohnt, sodass er sich vorstellen kann, sie ist wunderschön und macht bestimmt alles mit, sodass er sich ausmalen kann, sie werden sich vielleicht verlieben.
Wir sitzen an der Bar, da, wo es am nächsten zum Klo und zur Jukebox ist. Ben gibt Michelle seine Karte, und sie bringt uns zwei Miller Lite. Ich weiß, dass er mich später sowieso nichts von der Rechnung übernehmen lässt, aber ich habe kein allzu schlechtes Gewissen deswegen, denn selbst wenn wir Shots bestellen, werden es höchstens dreißig Dollar.
»Lust auf Billard?«, fragt er.
»Nö.«
Er geht zur Toilette, und ich trinke so lange mein Bier und versuche, jeden Blickkontakt zu meiden. Die anderen Doktoranden kommen nur donnerstags, da ist Steakabend: Ein Stück Fleisch, eine Ofenkartoffel und ein Salat für sieben Dollar.
Als er zurückkommt, erzähle ich ihm, dass ich Melinda vorhin eine Stunde lang beim Sex zugehört habe und dachte, die würden nie fertig.
»Du hast dich direkt vor ihre Tür gestellt?«, fragt er.
»So ziemlich, ja.«
»Wie würdest du’s finden, wenn sie das bei dir machen würde?«
»Was kümmert dich das? Du kannst sie doch eh nicht leiden.«
»Ich finde nur, das macht man nicht«, sagt er.
»In New York kennen die Leute keine Privatsphäre — sie hängen einfach einen Vorhang mitten ins Zimmer und tun so, als wären sie allein.«
Genau wie Melinda ist auch Ben ein Dichter, aber er schreibt nicht über Obst oder Bäume. Er schreibt über McRibs, Fabriken und Walmart. Er schreibt über mich. Es gibt ein Gedicht über das eine Mal, als ich in Crescent City Münzen ins Wasser geworfen habe, um sein I Ging zu befragen, und ein anderes über den Nachmittag, an dem wir uns in einem Waffelhaus in Memphis getroffen haben und er an meiner Haut erkannt hat, dass ich mit jemand anders geschlafen hatte. Und dann gibt es das eine, in dem ich in Unterhose Don DeLillo lese, während er Lasagne macht. Er schafft es, dass ich mich selbst anders sehe, liefert mir Bilder, die ich allein nicht hätte. Ich wüsste gar nicht mehr, dass ich in Unterhose Don DeLillo gelesen habe, wüsste nichts mehr von all dem, was er für wichtig erachtet hat. Es ist, als bekäme ich zu meinen eigenen Erinnerungen noch seine dazu.