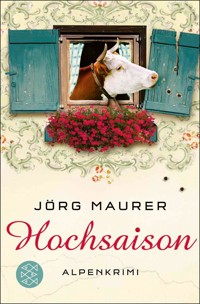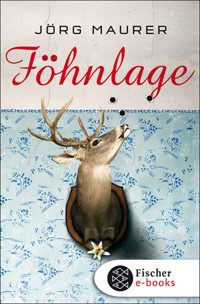9,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
Nur der Föhn kennt die ganze Wahrheit. Kommissar Jennerweins waghalsigster Fall – der zehnte Alpenkrimi von Nr.1-Bestsellerautor Jörg Maurer Kommissar Hubertus Jennerwein gönnt sich eine Auszeit. Ein wenig überrascht ist er schon, dass er auf dem Weg ins Allgäu gleich einen sehr bekannten Kollegen trifft. Aber bevor die beiden ins Fachsimpeln kommen, erreicht Jennerwein ein Hilferuf aus dem Kurort: Ursel Grasegger, Bestattungsunternehmerin a.D., hat eine blutige Morddrohung gegen Ignaz erhalten. Ihr Mann ist seit Tagen unauffindbar. Ist er in den Händen von Entführern? Oder hat er heimlich etwas Illegales geplant, was nun schiefgegangen ist? Jennerwein weiß nur zu gut, dass die Graseggers beste Mafiaverbindungen haben. Aber er verspricht Ursel, Ignaz' Spur außerdienstlich zu verfolgen – und bringt sich in noch nie gekannte Gefahr. Sein Team geht derweil tödlichen Umtrieben von Medizinern nach, eine frühere Freundin von Ignaz kündigt ihre bevorstehende Ermordung an, und auf einmal steht Jennerwein vor dem Abgrund seiner Polizeikarriere…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jörg Maurer
Am Abgrund lässt man gern den Vortritt
Alpenkrimi
Über dieses Buch
Der Schritt vom Weg führt immer weiter.
Kommissar Hubertus Jennerwein will sich eine Auszeit gönnen. Aber schon vor der geplanten Abreise trifft er auf dem Bahnhof einen Kommissar-Kollegen aus dem Allgäu und wird aufgehalten. Gerade als die beiden so richtig ins ermittlerische Fachsimpeln kommen, erreicht Jennerwein ein Hilferuf aus dem Kurort: Ursel Grasegger hat eine blutige Morddrohung gegen ihren Mann erhalten. Ignaz ist seit Tagen unauffindbar. Ist er in den Händen von Entführern? Oder hat er heimlich etwas Illegales geplant, was nun schiefgegangen ist? Jennerwein weiß nur zu gut, dass die Graseggers als einstige Bestatter beste Mafiaverbindungen haben. Aber in dieser Ausnahmesituation verspricht er Ursel, Ignaz‘ Spur außerdienstlich zu verfolgen. Er ahnt nicht, in was für üble Gefahren er sich damit bringen wird. Sein Team geht derweil tödlichen Umtrieben in einem Krankenhaus nach, eine frühere Freundin von Ignaz kündigt ihre bevorstehende Ermordung an, und auf einmal steht Jennerwein nicht vor einer Auszeit, sondern vor dem Abgrund seiner Polizeikarriere …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bestsellerautor Jörg Maurer stammt aus Garmisch-Partenkirchen. Er studierte Germanistik, Anglistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und wurde als Autor und Kabarettist mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kabarettpreis der Stadt München, dem Agatha-Christie-Krimi-Preis, dem Ernst-Hoferichter-Preis, dem Publikumskrimipreis MIMI und dem Radio-Bremen-Krimipreis.
Die Webseite des Autors: www.joergmaurer.de
Inhalt
Vorwort
1 10
2 10
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10
12 10
13 10
14 10
15 10
16 10
17 10
18 10
19 10
20 10
21 10
22 10
23 10
24 10
25 10
26 10
27 10
28 10
29 10
30 10
31 10
32 10
33 10
34 10
35 10
36 10
37 10
38 10
39 10
40 10
41 10
42 10
43 10
44 10
45 10
46 10
47 10
48 10
49 10
50 10
51 10
52 10
53 10
54 10
55 10
56 10
57 10
58 10
59 10
60 10
61 10
62 10
63 10
64 10
65 10
66 10
67 10
68 10
69 10
70 10
Nachspiel
Lob-ster
Vorwort
Geschätzte Liebhaber der Grausamkeit, des Sadismus, der Abgeschmacktheit und der Qual, werte Anhänger der ungezügelten Mordlust, des Deckensturzes und des langsamen Versinkens im Sumpf!
Der Vorhang hebt sich zum nächsten Bravour-, Husaren- und Bubenstück von Kommissar Jennerwein, der nun schon zum zehnten Mal unbeirrt das Böse, das Nachtseitige und Dunkle im Alpenland bekämpft, der den Riss, der durch die Welt geht, unermüdlich zu kitten versucht. In diesen zehn Jahren der Jennerwein’schen Odyssee wurde so emsig gegen die zehn biblischen Gebote verstoßen, dass es im zehnten Roman angebracht scheint, diese symbolisch hoch aufgeladene Zahl entsprechend zu würdigen. Aus diesem Grunde soll es ausschließlich zehnte Kapitel geben.
Denn gerade das zehnte Kapitel – dem einen oder anderen mag es beim Lesen von Kriminalromanen schon aufgefallen sein – ist in der Spannungsliteratur immer von zentraler Bedeutung. In Kapitel zehn werden die ersten Spuren zur Auflösung des Falles gelegt, dort passiert stets Außergewöhnliches, Überraschendes, Fragwürdiges und Bedenkliches. Schon in einer der ersten Erzählungen des Genres, in Theodor Fontanes raffinierter Kriminalnovelle Unterm Birnbaum, beginnt das zehnte Kapitel mit der Verhaftung des Raubmörders Hradscheck. Die Technik hat sich gehalten bis zu einem der Höhepunkte der Gattung: In Patricia Highsmiths Der talentierte Mr Ripley fährt Tom Ripley mit seinem Freund Dickie in Kapitel 10 hinaus aufs Meer und – Vorsicht, Spoilerwarnung! – erschlägt ihn dort mit dem Ruder.
Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Eines ist jedenfalls sicher: Wenn in Kapitel 10 immer noch kein Verbrechen geschehen ist, dann ist der Schmöker, den Sie gerade in Händen halten, kein Kriminalroman. Gleichwohl: In Franz Kafkas Roman Das Schloß beginnt Kapitel 10 mit dem Satz: »Auf die wild umwehte Freitreppe trat K. hinaus und blickte in die Finsternis.« Mehr Spannung geht eigentlich nicht.
Doch nun sind alle Klappstühle aufgestellt, die Sitzkissen verteilt, das Licht im Zuschauerraum verlischt, der Vorhang hat sich inzwischen vollständig gehoben. Von Ferne erklingt alpenländische Musik, in der Kulisse lauert schon der verschlagen dreinblickende Mann mit dem spitzen Dolch. Wenden Sie Ihren Blick vorsichtig zur nächsten Seite und seien Sie willkommen zur dekalogischen Festaufführung des Jennerwein-Universums!
110
Seit Anbeginn zählte der Mensch mit den Fingern. Die Zehn stand wohl auch deshalb für Anfang und Ende aller Zahlen und erschien so als magische Grenze.
»Irgendwann kommen wir beide in das Alter, wo wir nicht mehr klettern können wie die jungen Steinböcke. Und was dann?«
»Noch kraxle ich überallhin, das kannst du mir glauben!«
»Auch auf die Geiffelspitze?«
»Auch da komme ich locker rauf, aber ganz locker. Du wirst es morgen sehen. Aber wie ist es mit dir? Wenn du willst, dann ziehe ich dich das letzte steile Stück.«
»Ich nehme dich beim Wort.«
»Abgemacht.«
»Vielleicht sollten wir uns wirklich leichter zugänglichere Verstecke suchen.«
»Wie jetzt? Etwa mit Hacke und Schaufel nachts im Garten –«
Ignaz Grasegger unterbrach mitten im Satz, denn es kam ein Fußgänger die kleine Straße herauf, die am Grundstück der Familie Grasegger vorbeiführte. Sie erkannten ihn schon von weitem, es war der Rohrstangl Markus, der seit neuestem einen Atemschlauch auf der Oberlippe trug – »beheizbar«, wie er sofort ausführte, kaum dass er stehen geblieben war.
»Das ist sicher praktisch im Winter«, sagte Ignaz Grasegger lächelnd, »zum Beispiel beim Skispringen.«
Ursel versetzte ihm einen kleinen Rippenstoß.
Der Rohrstangl Markus hatte es an der Lunge, obwohl er nie geraucht hatte und darüber hinaus so gut wie nie aus diesem heilklimatischen Luft- und Schnupperkurort herausgekommen war. Man erzählte sich, dass die Rohrstangls ein vererbliches Lungenleiden plagte, ein pneumologischer Familienfluch, denn bei vielen seiner Onkel und Tanten hatte es in irgendeiner Weise an der Lunge gefehlt. Einer war trotzdem Sänger geworden, aber der Markus war der Erste mit Atemschlauch.
»Das hat mir die Krankenkasse bis auf den letzten Nickel gezahlt«, sagte er jetzt stolz und deutete auf das Plastikteil. »Zuerst wollte sie zwar nicht blechen, die Hundskrankenkasse, aber dann habe ich damit gedroht, dass ich die Sache ins Fernsehen bringe, in so ein kritisches Verbrauchermagazin. Die suchen ja heutzutage geradezu nach einem Missstand. Da ist die Kasse in die Knie gegangen und hat zähneknirschend gelöhnt.«
Die Sonne senkte sich auf das gegenüberliegende Karwendelmassiv und zauberte neue, fast mediterrane Farben in die wogenden Bergwälder.
»Zähneknirschend!«, wiederholte der Rohrstangl und deutete abermals auf den Plastikschlauch, der um seine Brust herum in den Rucksack führte. »Sauteuer. Und stufenlos regelbar.«
Ursel und Ignaz bewunderten die rasselnde Atemhilfe mit der gebotenen Höflichkeit und warteten geduldig, bis der Rohrstangl endlich fertig erzählt hatte und schließlich weiterzog.
»Der redet ja mit dem Schlauch noch mehr als ohne«, sagte Ignaz, als er außer Hörweite war.
»So viel Sauerstoff macht wahrscheinlich gesprächig.«
Die beiden Graseggers standen an den Gartenzaun gelehnt und blickten hoch zur Alpspitzwand, die sich in diesen Nachmittagsstunden begierig in der Sonne zu aalen schien wie ein Pauschaltourist auf der Südterrasse. Stumm und bedeutungsvoll zeigte Ignaz auf einen bestimmten Punkt des Berges, an dem der dunkelgrüne Hochwald in den hellen Kalkfels überging. Ursel lächelte wissend. Beide betrachteten die Stelle lange und versonnen. Ein Radler strampelte auf einem uralten Vehikel vorbei und grüßte ehrerbietig. Es war der Wasserableser Nuss, aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des ersten Vorsitzenden des Skiclubs, fast wäre er ins Schleudern gekommen vor lauter Ehrfurcht. Die Graseggers nahmen hier am Gartenzaun die Parade ab. Auch Generalleutnant Witzel, der auf dem Klapprad vorbeifuhr, grüßte schneidig. Trotz ihrer legeren Gartenkleidung stellten Ursel und Ignaz respektable bürgerliche Erscheinungen dar, die Jahre und die reichlichen Schicksalsschläge hatten äußerlich keine besonderen Spuren hinterlassen. Ursel war immer noch eine herbe, üppige Schönheit mit vollen Lippen und vor Intelligenz blitzenden, blauen Augen, Ignaz hingegen war ein stattlicher, gütig und hilfsbereit dreinschauender Biedermann, dem man seine sämtlichen Wertsachen anvertraut hätte, wenn man an einem belebten Badestrand ins Wasser ging.
»Ja, es ist schon besser, wenn wir unsere Dependancen nach und nach auflösen«, sagte Ignaz leise und wandte sich dabei Ursel zu. »Und morgen –«
Wieder brach er mitten im Satz ab, denn der nächste Spaziergänger war im Anmarsch, diesmal von der anderen Seite. Heute war einfach keine ruhige Unterhaltung möglich. Sie erkannten schnell den Wieslinger Johann, den pensionierten Postler und passionierten Schafkopfspieler. Er kam ohne Atemhilfe aus, dafür zog er einen Dackel an der Leine.
»Euer Garten ist dieses Jahr wirklich schön geraten«, sagte er. »Alles so akkurat gepflegt. Man sieht schon, dass ihr viel Zeit habt.«
»Man tut, was man kann, man hat, was man hat«, antwortete Ursel und ließ ihren Blick über die von ihr sorgfältig gestutzte Rosenhecke schweifen.
»Ich habe gehört, ihr arbeitet bald wieder in eurem alten Beruf?«, fragte der Wieslinger interessiert.
»So, hast du das gehört? Mag schon sein.«
»In der Zeitung ist es auch gestanden. Mit einem Bild von euch.«
»Es steht viel in der Zeitung.«
So gleichgültig Ignaz das sagte, so brennend hatte er die ganzen Jahre darauf gewartet, wieder als Bestatter arbeiten zu dürfen. In wenigen Wochen lief ihre Bewährungsfrist ab, die ihnen wegen ihrer kriminellen Doppelbestattungsidee damals aufgebrummt worden war. Das Berufsverbot wurde damit ebenfalls aufgehoben. Sie waren auf dem besten Weg, in die bürgerliche Kurve einzubiegen. Reingewaschen von allen Sünden, dem Bösen entkommen, praktisch engelsgleich und quasi mitten in der Himmelfahrt.
»Habt ihr denn schon Voranmeldungen?«, fragte der Wieslinger.
»Voranmeldungen für was?«
»Für euer altes und neues Geschäft natürlich. Ich könnte mir vorstellen, dass man von euch gerne eingegraben werden will.«
»Bist du interessiert, Wieslinger? Du siehst eigentlich noch ganz gesund aus.«
»Ich rede nicht von mir, sondern mehr so allgemein.«
»Das tun wir doch auch.«
Sie ratschten eine Weile über dies und das, dann trollte sich der Wieslinger mit seinem Dackel, und sie waren wieder allein. Sie lehnten sich an den Zaun und sahen den Föhnwölkchen am Himmel zu, wie sie sich langsam über dem ganzen Talkessel ausbreiteten wie Sahnespritzer im Kaffee. Es fehlte bloß noch, dass ein durstiger Nachmittagsgott kräftig umrührte und das ganze Werdenfelser Land ausschlürfte. Völlig ungetrübt war aber die Freude an diesem Tag nicht. Sorgenfalten erschienen auf Ursels Stirn. Die Graseggers standen zwar kurz vor ihrem Eintritt ins bürgerliche Leben, doch gerade deswegen mussten unbedingt noch einige Sachen, die aus der dunklen Vergangenheit in die Gegenwart herüberreichten, erledigt werden.
»Ich würde sagen, wir lösen das Versteck auf der Geiffelspitze auf und holen das ganze gelbe Zeugs da raus«, sagte sie. »Was meinst du dazu?«
Ignaz nickte bedächtig.
Das »gelbe Zeugs« war die familieninterne Bezeichnung für die Goldbarren und Goldmünzen, die sich im Lauf ihrer kriminellen Laufbahn angesammelt hatten. Verdächtige Spuren wie Seriennummern, Herkunftsangaben, Reinheitsgrade und Echtheitszertifikate waren aus den Stücken herausgefeilt worden, und die gesamten gelben Liegenschaften waren in luftigen Höhen über die Alpen verteilt. Kleine Bestände befanden sich in den umliegenden Bergen, in Tagesausflugsweite, für Ursel und Ignaz fußläufig leicht zu erreichen, aber hübsch abseits der touristischen Wander- und Kletterwege. In der Rüscherlsenke befand sich zum Beispiel eine Dependance, auf dem Isingergrat ebenfalls. Für andere Verstecke mussten sie ins Ausland fahren. Einer der Plätze lag mitten in den österreichischen Alpen, und einer, ganz klassisch, in der Schweiz. Das Versteck jedoch, das unterhalb der Geiffelspitze lag, konnte man von ihrer Terrasse aus fast sehen, und oft schauten Ursel und Ignaz in klaren Nächten hinüber zu dem steinigen Schließfach. Den Graseggers blieb allerdings auch gar nichts anderes übrig, als ihre Ersparnisse auf diese Weise anzulegen, eine herkömmliche Aufbewahrung verbot sich von selbst. Seit Jahren schon ging Ignaz mit dem Akku-Steinschneider ins Gebirge, suchte sich ein schönes Plätzchen aus, beobachtete die gegenüberliegenden Bergwände stundenlang mit dem Fernglas, schnitt dann, wenn er sicher war, dass ihm niemand zusah, ein passendes Loch in die Felswand, setzte eine kleine Stahlkassette ein und verdeckte sie wieder mit einem präparierten Stein. Mit einem unauffälligen Zugseil konnte er das Behältnis bequem öffnen und schließen. Seit einigen Jahren waren die Dependancen sogar mit Bewegungsmeldern bestückt. Sollte eines der Verstecke doch zufällig entdeckt und geöffnet werden, gab es Alarm im Hause Grasegger, der Standort wurde dann aufgegeben und sicherheitshalber nicht mehr angesteuert. Das war aber erst ein einziges Mal passiert.
»Hast du einen Vorschlag, wo wirs in Zukunft hintun könnten?«, fragte Ignaz. »Vielleicht doch in ein Schließfach? Dann sollten wir morgen gleich einen größeren Rucksack mitnehmen.«
Ursel schüttelte den Kopf.
»Keine gute Idee. Und selbst wenn wir einen noch so sicheren und bequemen Ort finden, es bleibt immer das Problem, das Zeugl in Bargeld umzuwandeln. Der Hehler –«
Da kam die Nachbarin, die Weibrechtsberger Gundi, die Straße herunter, eine der größten Ratschkathln des Kurorts. Heute war einfach kein guter Tag für solche Gedankenspiele. Noch zwanzig Meter entfernt, legte sie schon los. Ob sie denn schon wüssten. Nein, was. Das und das, von dem und jenem. Doch die Weibrechtsberger Gundi spürte, dass man ihr nicht ganz so konzentriert zuhörte, und ging nach einigen versuchten Klatschgüssen beleidigt davon.
»Wenn die wüsste«, sagte Ursel. »Dann hätte sie wirklich was zu ratschen.«
Die Umwechslung des Goldes in Bargeld war in der Tat das größte Problem bei dieser Art des Vermögens. Der Hehler verlangte inzwischen fast die Hälfte. Er wusste, dass es für die Graseggers keine andere Möglichkeit der Verflüssigung gab.
Ursel und Ignaz lösten sich vom Gartenzaun und gingen ins Haus.
»Hast du deinen Rucksack schon gepackt?«
Ignaz wies nickend auf das braune Unikum, das schon sein Großvater im Gebirge benutzt hatte. Morgen war Wandertag. So nannten sie es, wenn sie zu einer ihrer Niederlassungen gingen. Sie gaben die fröhlich singenden Ausflügler, grüßten nach allen Seiten, fotografierten, nahmen Umwege, holten dann ihr Gold aus dem Felsen. Ignaz überprüfte seinen antiken Rucksack, den »Affen«, noch einmal. Eine Regenhaut. Eine Windjacke. Ein paar Landjäger. Eine Glock 17C samt Munition. Ein Präzisionsfernglas. Ein Smartphone mit einsatzbereiter Ortungs-App. Zwei Flaschen Bier samt Kühlmanschetten. Etwas Werkzeug. Morgen war die Geiffelspitze dran. Sie würden zunächst auf die gegenüberliegende Seite gehen und das Versteck intensiv beobachten. Dann erst würden sie zuschlagen. Ignaz schnürte den Rucksack zu und stellte ihn zu Boden.
»Wann gibts denn Abendessen?«
»Na, die Ochsenbackerl brauchen schon noch vier Stunden.«
Ignaz murrte, aber er wusste, dass Ochsenbackerl unter vier Stunden nichts anderes als eine Katastrophe waren.
»Was gibt es dazu, zu den Backerln?«
»Das weiß ich noch nicht. Vielleicht Süßkartoffeln mit Wirsing.«
Ignaz schüttelte den Kopf.
»Süßkartoffeln mit Wirsing?«
»Warum nicht?«
»Das passt nicht zu Ochsenbackerl.«
»Was willst dann du für eine Beilage?«
»Kohlrabi.«
»Kohlrabi hat zurzeit keine Saison.«
»Haben wir keinen eingefrorenen?
»Kohlrabi einfrieren? Spinnst du?«
Ignaz wandte sich missmutig an Ursel.
»Ich geh noch ein Stück an die frische Luft.«
»Wann bist du wieder da?«
»Um acht.«
»Sei pünktlich.«
So schnell, wie der kleine eheliche Streit aufgeflammt war, so schnell war er auch wieder verpufft.
210
In der Bibel gibt es zehn Gebote, zehn ägyptische Plagen, zehn geheilte Aussätzige, zehn wartende Jungfrauen, zehn Tage, in denen Daniel geprüft wurde, zehn Gerechte, die man in Sodom nie und nimmer findet, zehn Generationen von Adam bis Noah, zehn Rebellionen der Kinder Israels gegen Gott …
Ignaz Grasegger war ein gutherziger Mensch, er strahlte Großzügigkeit und Edelmut aus, und er wusste um seine Wirkung. Seine bürgerliche Erscheinung war sein Kapital und hatte ihn schon oft aus misslichen Situationen gerettet. Ignaz hatte von seinen Vorfahren zwar viel Rebellisches und Krawotisches geerbt, aber er wusste sich zu mäßigen und Zurückhaltung zu wahren. Er hatte bei all seinen Gesetzesübertretungen immer darauf geachtet, dass niemand zu Schaden kam. Oder zumindest schmerzfrei blieb. Seine Goldvorräte waren auf saubere Weise zusammengekommen. Denn Delikte wie Schmuggel, Steuerbetrug, Umtausch von Schwarzgeld und Markenfälschungen fand Ignaz nicht verachtenswert. Wem schadete schon die Schattenwirtschaft? Oder genauer gesagt: Wem schadete sie mehr als die ganz reguläre Wirtschaft das tat? Ignaz hielt den Staat jedweder Couleur für einen unersättlichen und ungerechten Moloch, dem ein paar Nadelstiche nicht weh taten. Er bedauerte nur, nicht in den Graubereichen der Cyberkriminalität mitmischen zu können, dafür fühlte er sich usermäßig einfach nicht mehr fit genug. Da hätte man Geschäfte machen können! Ein paar Ideen hätte er schon in diese Richtung gehabt, aber ihm fehlten die Grundlagen eines Nerds.
Ignaz warf seine Allwetterjacke über und trat auf die Straße. Er blickte noch einmal zurück und betrachtete wohlgefällig das schmucke Haus, das sie jetzt schon einige Jahre bewohnten. Das alte war allerdings noch schöner gewesen. Es war damals bis auf die Grundmauern niedergebrannt, und sie konnten von Glück sagen, dass sie nicht darin umgekommen waren. Sie hätten genug Geld gehabt, um auf diesem Grundstück ein neues zu bauen, aber wenn man ausschließlich Schwarzgold und demzufolge nur Schwarzgeld zur Verfügung hat, ist das nicht so einfach. Ignaz lenkte seine Schritte zur Bushaltestelle. Er hatte vor, Elli zu besuchen. Vielleicht war das nicht mehr lange möglich, es stand schlecht um sie. Elli Müther war eine alte Freundin von ihm, ihr geistiger Zustand hatte sich in den letzten Monaten rapide verschlechtert, das bereitete ihm große Sorgen. Jetzt stand ihr auch noch eine komplizierte Operation bevor. Vielleicht war sie ja ansprechbar, und er konnte ihr Trost spenden.
Ignaz bog in die Fußgängerzone des Kurorts ein. Viele grüßten ihn oder lüpften ganz altmodisch den Hut. Er grüßte freundlich zurück. Aber selbst wenn Ignaz zornig zurückgegrüßt hätte, hätte es bei ihm nobel und honorig ausgesehen. Er war so ein Typ. Er betrachtete die Geschäfte. Schon wieder hatte ein Nagelstudio eröffnet. Es war zwar ein Tattooladen, aber Ignaz fasste alle Dienstleistungen, die sich mit körperlichen Äußerlichkeiten beschäftigten, unter dem Oberbegriff Nagelstudio zusammen. Er blickte auf die Uhr. Kurz entschlossen betrat er die Gemäuer der alteingesessenen Metzgerei Moll. In die war schon sein Großvater gegangen. Und wie schon der Opa hielt es auch Ignaz zwei volle Stunden ganz ohne Essen einfach nicht aus.
»So, Grasegger, wie gehts?«
»Geht schon.«
»Drei Leberkäsesemmeln, wie immer?«
»Nein, nur zwei. Bei uns gibts bald Abendessen.«
»Und was wird bei euch Feines gekocht?«
Ignaz antwortete unkonzentriert und leichthin:
»Ochsenbackerl.«
Das war ein Fehler. Hätte er nur Krautsalat gesagt. Oder Apfelkücherl. Die Metzgerin verzog ihren Mund zu einer spitzen Schnute.
»So, Ochsenbackerl, aha. Die habt ihr aber nicht bei uns gekauft, oder?«
»Ich weiß nicht –«
»Stimmt mit unserem Fleisch was nicht? Schon wochenlang wart ihr nicht mehr da!«
»Nächstes Mal kaufen wir wieder bei euch. Ganz bestimmt. Versprochen.«
Die Metzgerin blieb bei ihrem pikierten Ton.
»So, ja, das werden wir dann sehen.«
»Servus, Mollin.«
»Vergiss deine Leberkäsesemmeln nicht, Grasegger.«
Er verließ die Metzgerei, ging ein paar Schritte und betrachtete sich im nächsten Schaufenster. Ursel hatte schon recht. Lange ging das nicht mehr gut mit den Wandertagen zu den alpinen Dependancen. Er war kein junger Steinbock mehr, der überall hinaufkletterte. Jemand anders musste das für sie besorgen. Die Kinder? Ihr Sohn Philipp lebte in Amerika, er hatte an der Yale Wirtschaftswissenschaft studiert, dann noch ein Maschinenbaustudium draufgesetzt, in dem er gerade seinen Abschluss zum Master of Science oder Doktor machte, Ignaz wusste das gar nicht so genau. Er kam ein- oder zweimal im Jahr zu Besuch. Aber er war solch ein verdammter Schisser. Er schien überhaupt nichts von ihm oder Ursel geerbt zu haben. Wie der sich schon bei den Ortungsgeräten angestellt hatte!
»Wofür braucht ihr die denn? Und wieso wollt ihr eine eigene Frequenz haben? Und warum müssen es unbedingt die extrateuren Modelle mit dem Tarnkappen-Modus sein?«
Vielleicht sollte sich Ignaz vertrauensvoll an seine Tochter Lisa wenden. Sie arbeitete in der Tourismusbranche, war viel unterwegs. Den beiden Kindern waren vor Jahren natürlich eigene Alpendependancen eingerichtet worden. An ihren achtzehnten Geburtstagen hatten sie den genauen Ort erfahren. Philipp, der bürgerliche Spießer, war aus allen Wolken gefallen. Hatte etwas davon gefaselt, dass er sein Geld selbst verdienen wolle. Und ehrlich verdienen. Ehrlich! Als ob da viel zusammenkäme außer am Ende ein durchschnittlicher Zirbelholzsarg. Lisa jedoch war ein kleines bisschen mutiger als Philipp. Immer schon. Lisa hatte einen der 20-Unzen-Batzen genauso verzückt und gierig in der Hand gewogen, wie das Ursel immer tat, wenn sie einen gelben Spaziergang machten. Ignaz war sich sicher. Die zierliche Lisa sollte das mit dem gelben Zeugs in Zukunft erledigen. Er musste die Sache mit Ursel besprechen.
Ignaz ging zum Loisachuferweg hinunter. Er packte seine Leberkäsesemmeln aus und ließ sich auf einer Bank nieder. Schon setzten sich zwei Dutzend schnatternde Enten vom anderen Ufer in Bewegung. Ignaz klappte die dick belegten Semmeln auf, nahm eine warme Scheibe in die Hand und verschlang sie gierig. Aus ihm würde nie ein Feinschmecker werden. Er hielt es mit allerlei großen Philosophen, die die Fresserei der Feinschmeckerei vorzogen. Heißhungrig biss er in die zweite Scheibe. Die Semmeln selbst waren für die Enten, das war seine Art der Trennkost. Und noch einmal dachte er an Lisa. Sie trug das Krawotische der Familie Grasegger in sich, sie musste er ansprechen. Immerhin hatte auch sie die Idee mit der Funküberwachung gehabt, Philipp hatte lediglich die Technik geliefert. Und prompt hatten sie dann auch eine Warnmeldung erhalten. Die Niederlassung am Brucksteingrat war wohl aufgebrochen worden, sie hatten aber nichts darüber in der Zeitung gelesen und machten seitdem einen großen Bogen um die Stelle. Manchmal sinnierte Ignaz darüber, was dort wohl geschehen sein mochte.
Seine Lieblingsphantasie war das junge, blasse Gelsenkirchener Paar auf Urlaubsreise, das sich etwas vom Alpenwanderweg entfernt und genau unter das Versteck gesetzt hatte. Ignaz sah sie vor sich, wie sie sich ausstreckten, den wolkenlosen Himmel betrachteten, die würzige Luft einatmeten, die es in Gelsenkirchen so nicht gab, wie sie Zukunftspläne schmiedeten, wie ihr Blick auf eine kleine, unnatürliche Rille im Fels fiel.
»Schau mal. Da hat jemand was reingeritzt.«
»Wo? Lass sehen.«
Sie schafften es, den Stein herauszuziehen. Sie entdeckten die Kassette. Den kleinen Nanosender bemerkten sie nicht. Als sie den Inhalt sahen, wurde ihnen schlecht. Hastig machten sie sich auf den Heimweg, wogen die Barren mit der Küchenwaage, studierten danach die aktuellen Goldpreise. Sie mussten sich augenblicklich setzen, sie atmeten schwer durch. So viel Gold auf einem Haufen schlägt einem erst mal auf den Magen, wenn man es nicht gewohnt ist, dachte Ignaz.
»Eigentlich müssten wir das Zeug ja –«
»Meinst du?«
»Das ist sicherlich nichts Legales.«
Sie schwiegen. Zitternd saßen sie da. Sie malten sich in schrecklichen Farben alle möglichen Verbrechen aus.
»Nazigold«, sagte der junge Mann schließlich.
»Ganz bestimmt«, erwiderte sie.
Ignaz hatte die uralten Stahlkassetten von seinem Vater verwendet. Im Berg waren sie noch einmal kräftig nachgerostet. Die Kassetten sahen tatsächlich aus wie alte Schatullen vom Reichswehramt für Volksgesundheit. Ignaz stellte sich das gedachte junge Paar aus dem Ruhrgebiet dünn, blass und mit vor Angst getrübten Augen vor.
»Na ja, wenn es Nazigold ist, dann wird das ja wohl niemandem mehr fehlen«, sagte sie schwach.
Die beiden hatten natürlich kein Schließfach. Sie wollten auch keines aufmachen. Sie suchten nach todsicheren Verstecken. Doch die waren äußerst lächerlich. Sie schichteten die Klumpen jeden Tag um, nicht ohne die Vorhänge vorher zu verschließen. Sie ließen an der Wohnungstür neue Schlösser anbringen. Sie wechselten sich bei den Nachtwachen ab. Sie verließen das Haus nicht mehr. Sie konnten ihre Berufe nicht mehr ausüben. Genüsslich stellte sich Ignaz vor, wie sie nach und nach verwahrlosten. Sie stritten, die Beziehung litt, es ging auch sonst steil bergab. Sie saßen auf dem Schatz und konnten sich nichts dafür kaufen. Dann eines Tages kam ihnen der rettende Gedanke. Kurz entschlossen reisten sie nach Rom, in die Stadt, die alle Probleme löst. Die Goldstücke in ihren Koffern brannten wie Feuer. Sie schlichen sich nachts zum Trevi-Brunnen und ließen die zweieinhalb Kilo Barren und Münzen ins Wasser gleiten. Mit dem großen Platsch schloss sich der Vorhang über ein dunkles und schreckliches Kapitel in ihrem Leben. Fortan lebten sie glücklich und zufrieden.
Ignaz Grasegger stieg in den Bus und setzte sich auf einen freien Platz. Bis zum Krankenhaus waren es fünf Stationen. Er würde nicht länger als eine Stunde bleiben und auf jeden Fall wieder pünktlich zum Essen zurück sein. Ochsenbackerl! Ein herrliches Abendessen. Draußen schob sich die bunte, herbstliche Landschaft vorbei. Die leicht geschwungenen Kramphügel, das breite, unbegradigte Loisachbett. Die Bäume am Uferrand trugen ihr farbenfrohes Blätterkleid in Gelb-, Orange- und Rottönen. Ignaz entspannte sich und döste ein wenig. Wenn er allerdings etwas aufmerksamer gewesen wäre, hätte er im Bus eine Person bemerkt, die ganz und gar nicht hier hereinpasste.
310
Odysseus wanderte neun Jahre und kehrte im zehnten heim, Troja war neun Jahre belagert und fiel im zehnten. Zehn Jahre währte auch der Kampf der Olympier unter Zeus gegen die Titanen unter Kronos.
Ursel kniff die Augen kurzsichtig zusammen und warf einen Blick durch die Sichtscheibe des Ofens: Die Ochsenbackerl bewegten sich leicht zitternd in der Reine mit der blauen Emailleschicht, die Sauce warf Sprechblasen, sie murmelte und maulte leichthin, als würde sie dort drinnen alte Küchengeheimnisse ausplaudern. Ursel nickte zufrieden. Das würde heute Abend das rechte Festmahl werden, eine passende Einstimmung zum morgigen Wandertag. Die gute Laune wurde nur durch die Tatsache getrübt, dass sie gleich den Ruach anrufen musste.
Im Bayrischen nennt man einen »Ruach« einerseits einen habgierigen Menschen, andererseits wird als Ruach auch die Habgier selbst bezeichnet. Der Sünder ist mit seiner Sünde sozusagen im selben Begriff eingesperrt. Im alpenländischen Raum versteht man in der Ganovensprache unter einem Ruach aber auch einen Schieber, speziell einen Hehler. Die Verbindung zum hebräischen Rûaḥ (Geist, Atem, Wind, Beseelung) liegt nahe, ein schöner lautmalerischer Ausdruck, der das Geräusch des Windes oder des Atmens nachahmt. Aber was hat die Rûaḥ zum Ruach gemacht? Letzterer haucht dem wertlosen und toten Diebesgut sozusagen Leben ein, indem er es zu quicklebendigem Geld macht. An diesen Haaren könnte man den gierigen und trotzdem notwendigen Ruach herbeiziehen. Der Haus-Ruach der Graseggers forderte einen Haufen Geld für seine Dienste. Er verlangte jedes Mal mehr. Das musste aufhören. Sie waren jetzt schon beim Spitzenhehlersatz von 49 Prozent.
Ursel schnipselte an den Beilagen für das Abendmahl herum, warf das Messer auf den Tisch und rief den Ruach an. Sie bat um ein Treffen, erfuhr – warum war sie nicht überrascht? –, dass die Geschäfte schlecht liefen, dass alles in letzter Zeit wegen der unberechenbaren Weltpolitik ziemlich mühsam geworden sei, dass der Goldpreis sinke und sinke und immer weiter sinke, dass die Russen und die Araber sowieso wieder mehr auf Diamanten setzten, kurz: dass unter 51 Prozent nichts zu machen sei. Ursel legte wütend auf. Sie schnaubte. Sie blubberte wie die Ochsenbackerlsauce im Backofen. Ihr Trachtendutt, der das einzig richtig Altmodische an ihr darstellte, zitterte. Der schwarze, festgebundene Haarknoten schien sie immer ein wenig nach hinten zu ziehen. Sie richtete sich auf. Herb, massig, funkensprühend, drohend tatendurstig schien sie. Sie blies sich ein paar heruntergefallene Schläfenlöckchen aus dem Gesicht und überlegte, wie es auf dem steinigen Weg zum ehrsamen Leben weitergehen sollte.
Da bog ein übel aussehender Typ um die Ecke, lief auf sie zu, holte mit der entsicherten Handgranate aus, um sie in ihre Richtung zu werfen. Ohne mit der Wimper zu zucken, hob sie ihre doppelläufige Flinte und schoss ihn über den Haufen. Der übel aussehende Typ mit der Narbe quer durchs ganze Gesicht kippte nach hinten um, die Granate explodierte in seiner Hand. Ursel schaltete den Computer wieder aus. Wenn sie sich so ärgerte wie eben über den unverschämten Ruach, ging sie immer in den Keller und streifte den Virtual-Reality-Anzug über. Sie rief dann das Programm mit dem virtuellen Schießstand auf und begann zu zielen. Auf bewegliche Scheiben. Auf davonstiebende Hirsche. Auf übel aussehende Typen, die mit Handgranaten auf sie zuliefen. In ihrem VR-Anzug spürte sie Hitze, Kälte und Regen. Jeden Schuss und Schlag am Körper. Philipp hatte ihr zusätzlich noch einen Helm, der einen Panoramablick ermöglichte, und haptische Sensoren besorgt. Das war alles schön und gut, sie sollte allerdings mit Ignaz wieder einmal in den Wald gehen und ganz analog und altmodisch auf Blechbüchsen schießen. Ursel wusste, dass sie gierig nach Nervenkitzel und Gefahr war. Das war auch der Grund, warum sie momentan ein leises, erregtes Zittern in sich spürte. Sie freute sich auf morgen, auf den Moment, in dem sie das Gold wieder in der bloßen Hand wiegen konnte. Das verbotene Gold. Das Mafiagold. Der Schatz von Sméagol, dem abtrünnigen Hobbit.
Ursel betrachtete den Zeitungsartikel, den sie an die Wand gepinnt hatte. Von einem ehemaligen Bestattungsunternehmerehepaar war da die Rede, das wieder auf den rechten Weg gekommen sei, weil sich »Verbrechen einfach nicht lohne«. Die Familie Grasegger wäre ein leuchtendes Vorbild für die sonst so orientierungslose Jugend. Und auch die passende Bibelstelle, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, fehlte nicht. Der Zeitungsartikel über die beiden reuigen Graseggers hing direkt neben einem Ausriss, der einen unauffälligen Typen zeigte, der sich augenscheinlich in dem dunklen Anzug mit der dezent gepunkteten Krawatte nicht recht wohl fühlte. Er blickte zu Boden, hatte die eine Hand hinter dem Rücken wie ein Kellner, der gerade mittelmäßigen Rotwein ausgeschenkt hat, mit der anderen Hand nahm er eine große Urkunde entgegen.
Zur gleichen Zeit stieg Ignaz aus dem Bus. Er schüttelte den Kopf und grummelte. Er hätte Elli doch eine der Leberkäsesemmeln übrig lassen sollen. So kam er bei seinem Krankenbesuch mit leeren Händen zu ihr. Ignaz blickte auf. Da vorne lag sie schon, die vermaledeite Klinik mit ihren grauen, abweisenden Außenmauern, die Elli ganz und gar verschlungen hatte. Ignaz wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass auch ihm dort Übles bevorstand.
410
»Jede Lüge will zehn andre zum Futter haben, wenn sie nicht sterben soll.«
(Sprichwort)
Der Mann auf dem Foto, das Ursel gerade eben auf dem Zeitungsausriss betrachtet hatte, stand jetzt leibhaftig am Bahnsteig des kleinen Bahnhofs. Er war ein gutaussehender Mann in mittlerem Alter, dessen Miene etwas Spitzbübisches hatte. Er blickte genauso aufmerksam und interessiert über die Gleise hinweg in die Ferne, wie die Graseggers vorhin über den Gartenzaun auf die Alpenkulisse geschaut hatten. Der unauffällige Mann zeigte ein wenig Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Hugh Grant, gerade erst vor ein paar Tagen bei einem Restaurantbesuch hatten ihn zwei reifere Damen am Nebentisch daraufhin angesprochen.
»Sind Sie es wirklich?«
»Wer?«
»Na, der Schauspieler! Vier Hochzeiten und ein Todesfall?«
»Sie meinen Hugh Grant?«
Er hatte mysteriös gelächelt und die Frage einfach im Raum stehenlassen.
»Kaum zu glauben«, sagte die eine Dame. »Woher können Sie so gut Deutsch?«
»Ich habe deutsche Vorfahren«, antwortete er wahrheitsgemäß.
»Ach, erzählen Sie!«
»Mein Urgroßvater lebte um die 19. Jahrhundertwende hier in der Gegend. Er übte den schönen, aber gefährlichen Beruf des Holzknechts aus. Überdies war er Ensemblemitglied im Bauerntheater. In unserer Familie wurde schon immer gerne geschauspielert. Eines Tages …«
Die beiden Damen hörten das ganze Abendessen über staunend zu. Erst beim Dessert kamen ihnen leichte Zweifel.
Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein war außer Dienst, er konnte sich den kleinen Spaß erlauben. Es heißt ja oft, dass man Polizisten, Ganoven und Lehrer zweihundert Meter gegen den Wind riechen kann, doch Jennerwein war solch eine unaufdringliche, dezente Erscheinung, dass noch nie jemand auf den Gedanken gekommen war, hinter dieser Fassade stecke der emsige und unermüdliche Ermittler, der knallharte Befragungsspezialist und messerscharfe Analytiker. Was man Jennerwein allerdings momentan durchaus ansah, war die Tatsache, dass er sich im entspannten Urlaubsmodus befand. Er war auf dem Weg in den Norden. Er hatte vor, mit dem Zug nach Kiel zu reisen und von dort aus das Fährschiff nach Göteborg zu nehmen. Stockholm … Helsinki … Polarkreis … Vielleicht landete er zu guter Letzt noch am Nordpol. Er wollte sich treiben lassen, so wie er das damals als junger Mensch getan hatte, als er mit zwanzig Mark in der Tasche per Anhalter in den Süden gefahren war. Jennerwein legte den Kopf in den Nacken und dehnte seinen Rücken, als wollte er seinem Körper beweisen, dass sie beide Ferien hatten. Er schlenderte ein paar Schritte sommerfrischlerisch dahin, doch plötzlich blieb er stehen. Sein Blick war auf eine Stelle des zerkratzten und ausgetretenen Bahnsteigrands gefallen. In der Nähe der Steinkante bemerkte er einen kleinen, rötlichen Fleck. Er ging in die Hocke und betrachtete die winzigen Glassplitter, die sich um den Fleck verteilt hatten. Es war zweifellos ein Brillenglas. Und es deutete alles auf Blutspritzer hin. Unwillkürlich griff er in die Tasche, holte einen Bleistift heraus und bewegte einen der Splitter vorsichtig zu sich her.
»Hey, passen Sie auf, das ist doch gefährlich, so nah an der Bahnsteigkante!«, brüllten zwei bahnblaue Uniformhosenteile neben ihm.
Jennerwein sah hoch und erkannte im Besitzer der zerknitterten Beinkleider einen besorgten Schaffner, der sich um den vermeintlich Lebensmüden kümmern wollte. Schnell stand Jennerwein auf und ging weiter. Man musste nicht hinter alle Geheimnisse kommen.
Jennerwein war alles andere als lebensmüde. Er fühlte sich jetzt schon, nach wenigen Tagen Urlaub, lebendiger als je zuvor. Keiner seiner Kollegen hatte es für möglich gehalten, dass Jennerwein es wahrgemacht und ein Sabbatical genommen hatte. Eigentlich hatte ihn sein Chef darauf gebracht.
»Jennerwein, wenn überhaupt einer so eine Auszeit braucht, dann Sie«, hatte Dr. Rosenberger mit seiner dröhnenden Stimme verkündet. »Sie haben eine Aufklärungsquote von hundert Prozent, von wem kann man das schon sagen! Die Ehrung war vollkommen verdient.«
Die »Ehrung« war der Bayrische Verdienstorden, den ihm der Ministerpräsident persönlich angesteckt hatte. Er hatte Jennerwein allerdings verwechselt und ihn für einen Sportfunktionär gehalten. Alle Zeitungen hatten davon berichtet. Einer spontanen Eingebung folgend, hatte der Kommissar eine Reise nach Schweden gebucht. Jennerwein hatte keine besondere Beziehung zu diesem Land, aber er stellte es sich als locker und unangestrengt vor. Er wollte dort ausspannen, sich erholen, zur Ruhe kommen. Einen einzigen festen Termin gab es allerdings, in drei Tagen, bei einem Arzt, einem Spezialisten für Akinetopsie.
Der Zug in die Landeshauptstadt musste in wenigen Minuten einfahren. Jennerwein blickte wieder auf die Gleise, diesmal selbstverständlich in gebührendem Abstand zur Bahnsteigkante. Es war für Jennerwein ungewohnt, keinen dienstlichen Termin vor sich zu haben, keine Akten im Zug wälzen zu müssen, nicht dauernd darüber zu grübeln, was denn der Pistoleneinschuss im Winkel von dreißig Grad im Körper des verstorbenen Bäckermeisters nun bedeutete. Vorher am Fahrkartenschalter hatte der Urlaub begonnen. Ein herrlicher Augenblick, trotz Warteschlange. Das Einzige, was ihn genervt hatte, war das neugierige norddeutsche Ehepaar hinter ihm in der Reihe gewesen. Wer und was er denn wäre, wo er denn herkäme, dem Dialekt nach doch wohl aus dem Süden. Wo er denn hinfahre, wie lange er dort bliebe, wo er unterkäme, warum er so schweigsam sei. Er war zu höflich, um die beiden brüsk abzuweisen. Nach einer Viertelstunde wusste er alles von ihnen, er wiederum hatte überhaupt keine Lust, sich als Kriminalbeamter der bayrischen Polizei zu outen.
»Sagen Sie schon!«
»Ich wollte jetzt eigentlich nicht an meinen Beruf denken.«
»Ist er so schlimm, der Beruf?«
»Ganz im Gegenteil. Ich liebe ihn über alles.«
Jennerwein war unbegabt für Lügen aller Art. Er hasste es zu lügen. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil es sich auf die Dauer als viel zu kompliziert herausstellte. Das hatte er als neunjähriges Kind schon erkennen müssen. Damals wollte er einmal testen, wie es denn wäre zu schwindeln, und er hatte den Eltern von einem Treffen mit Tante Agnes auf der Straße erzählt. Das war moralisch gesehen keine Lüge, sondern eher eine – ja, was? –, vielleicht eine Geschichte. Zur moralisch verwerflichen Lüge gehört immer ein Vorteil, der sich für den Lügner aus dieser Lüge ergibt. Er hatte also die Begegnung mit Tante Agnes erfunden, um sich trainingshalber durch die Widersprüche des Treffens zu quälen.
»Aber die ist doch gar nicht hier.«
»Das dachte ich auch. Aber dann ist sie plötzlich aufgetaucht.«
»Was hat sie gesagt?«
Schließlich stand Tante Agnes, die dieses Treffen natürlich abstritt, als Lügnerin da, und Hubertus schämte sich sehr. Das war seines Wissens nach das letzte Mal, dass er gelogen hatte. Und hier, gegenüber dem nervigen Ehepaar? Wiederholt hatte er versucht, sich möglichst unfreundlich von ihnen abzuwenden, doch ohne Erfolg, sie hatten nicht lockergelassen. Dann war er an der Reihe gewesen. Endlich.
»So, Herr Kriminalkommissar, wo fahren wir denn hin?«, röhrte die Schalterbeamtin lautstark. »Aha, nach Schweden. Auch schön. Haben Sie die richtige Creme für die Mitternachtssonne dabei?«
Jetzt wussten es alle dreißig Leute in der Halle.
Jennerwein betrachtete die blanken Gleise, die in ihm immer schon ein Gefühl des Fernwehs erzeugt hatten. Dann hob er den Blick. Große Teile des Himmels waren inzwischen grau und schmutzig. So schnell ging das hier im Alpenvorland. Dichte Wolkenpakete schoben sich vor die Sonne, die Menschen drängten sich an ihm vorbei zur überdachten Mitte des Bahnsteigs, um dort Schutz zu suchen vor dem zu erwartenden Regenguss.
Und dann spürte er plötzlich eine schwere Männerhand auf der Schulter.
»Kommissar Jennerwein?«
Die Stimme war ihm unbekannt. Oder hatte er sie doch schon gehört? Er drehte sich nicht um, warf lediglich einen kurzen Blick auf die breiten Finger des Fremden. Der Mann konnte anpacken. War das ein Krimineller, den er überführt hatte? Der sich an ihm rächen wollte? Gonzales war vor drei Monaten aus der JVA entlassen worden, aber würde der ihm die Hand so derb und vertraulich auf die Schultern legen? War es einer der Fessler-Brüder, die ihm damals beim Marder-Fall entwischt waren? War er in Gefahr? Dieser nicht überdachte Bereich des Bahnsteigs war inzwischen vollkommen menschenleer, er selbst war natürlich unbewaffnet, und die Selbstverständlichkeit, mit der der Fremde ihm die Hand auf die Schulter gedrückt hatte, verhieß nichts Gutes. Sollte er einen Überraschungsangriff starten, sich schnell bücken, den Arm dabei packen und versuchen, den Mann mit einem Judogriff zu Boden zu werfen? Er stand jedoch so, dass der andere unweigerlich auf den Gleisen landen würde, wenn der Wurf gelang. Und das bei dem bald einfahrenden Zug.
»Jennerwein stimmt doch, oder?«
Der Mann hinter ihm sprach Dialekt, schweren süddeutschen Dialekt, den er momentan nicht einordnen konnte. Jennerwein hatte keine Ahnung, wer das war. Er drehte sich langsam und vorsichtig um. Er begriff nicht gleich. Dann der Schock. Diesen Mann, der ihm jetzt breit grinsend ins Gesicht blickte, hätte er im Leben nicht erwartet.
Vor ihm stand der Allgäuer Kriminalhauptkommissar Kluftinger aus Kempten.
510
Auch im Computerzeitalter spielt die Zehn eine große Rolle: Mit der 1 und der 0 ist es möglich, jede beliebige Zahl darzustellen. Dazu der Informatiker»witz«: Es gibt genau zehn Arten von Menschen. Die, die binäre Zahlen verstehen, und die, die es nicht tun.
Man hätte nicht auf Anhieb sagen können, um welches Geräusch es sich bei dem saftig klatschenden Fllapff! handelte. In gleichförmigem Abstand von ein oder zwei Sekunden ertönte so etwas wie ein tropfender Wasserhahn, der immer näher kam. Es hätten auch mehrere nicht ganz ernstgemeinte Ohrfeigen sein können. Oder die genüsslichen Hiebe eines französischen Sternekochs beim Plattieren eines Kalbsmedaillons. Es waren jedoch nur die Plastikschlapfen von Hilfspfleger Benni Winternik, der den Krankenhausgang herunterkam. Winternik war ein bartloses, zaundürres Jüngelchen um die zwanzig, er hatte sich für das soziale Jahr verpflichtet und arbeitete schon seit zwei Monaten auf der Station. Er war allerdings ziemlich enttäuscht darüber, dass sie ihm bei all seinen Interessen und Fähigkeiten, die er sich zugutehielt, so wenig verantwortungsvolle Arbeiten übertragen hatten. Er war hier eigentlich nur der Laufbursche für alle. Seine dunkelblaue Arbeitskluft, in die sie ihn gesteckt hatten, verstärkte den unmedizinischen, subalternen Eindruck, er sah eher aus wie ein Monteur oder vielmehr wie der Hiwi eines Monteurs. Viele Patienten erfasste deshalb eine leichte Irritation, wenn er ins Zimmer kam, um Mineralwasser nachzuschenken oder die Betten aufzuschütteln. Heute hatte man ihm eine besonders entwürdigende Aufgabe zugeteilt, nämlich die, mit einer Tippliste für die Wahl zur »Miss World« herumzugehen und sie von möglichst vielen Klinikmitarbeitern ausfüllen zu lassen.
Das Fllapff! verstummte. Winternik war an einer offenen Tür stehen geblieben, im Krankenzimmer beugte sich Schwester Zilly gerade über einen Patienten, um ihm eine Injektion zu verabreichen. Der Patient lag entspannt auf der Seite, hatte die Hose heruntergezogen und blickte fröhlich drein. Er pfiff sogar den bayrischen Defiliermarsch. Die Schwester war bekannt für ihre schnellen und schmerzlosen Injektionen. Patienten schwärmten von ihr, und ihre Ablenkungsmanöver bei Kindern waren legendär. Winternik wedelte aus der Ferne mit der Liste, deutete darauf, nahm eine sexy Model-Pose ein, rieb dann Daumen und Mittelfinger aneinander. Schwester Zilly nickte beiläufig. Sie interessierte sich wie Winternik nicht die Bohne für solche unterirdischen Wettbewerbe, aber das waren oft die erfolgreichsten Zocker. Sie setzten hoch und machten auf diese Weise die Wetten spannender. Schwester Zilly (die auf dieser Berufsbezeichnung bestand und nicht als »Pflegefachkraft« oder gar »Fachgesundheits- und Krankenpfleger/-in« bezeichnet werden wollte) wandte sich wieder dem Patienten zu.
»Sie werden jetzt einen klitzekleinen Stich spüren. Platz eins für Miss Vatikanstadt.«
»Wie bitte?«, fragte der Patient.
In diesem Moment fuhr sie mit der spitzen Nadel in den Gesäßmuskel. Doch der Gepiekste war viel zu abgelenkt, um irgendetwas zu spüren.
»Aha, interessant. Vatikanstadt auf Platz eins«, sagte Winternik lächelnd und trug den Tipp in seine Liste ein.
»In meiner Kitteltasche sind Münzen«, sagte Schwester Zilly. »Nehmen Sie sich fünf Euro raus.«
Während sie weiter an ihrem Patienten arbeitete, griff Winternik vorsichtig in ihre Kitteltasche, wühlte ein wenig und fingerte schließlich die Euromünzen heraus. Er stand schräg hinter ihr, und er war ihr jetzt so nahe gekommen, dass er den Duft ihrer Haare riechen konnte. Er hatte einen guten Blick auf ihre Schläfe und den äußeren Augenwinkel. Ihr Lidstrich war zerlaufen, der Bindehautsack, der das Schläfengewebe abschloss, war geschwollen. Hatte sie geweint?
»Danke«, sagte er leise zu ihr, warf eine der Münzen in die Luft und fing sie wieder auf.
Fllapff! Fllapff! Fllapff! Winternik noppte sich weiter. Dragica, die gründlichste, fleißigste und zuverlässigste Mitarbeiterin des Reinigungsdienstes, kniete am Boden und wischte. Gerade war sie dabei, die Eckleiste mit einer Bürste zu säubern.
»Willst du auch mitwetten?«, fragte Winternik.
»Um was gehts diesmal?«
»Die Wahl zur Miss World.«
»Wenn Serbien mitmacht, dann ja. Euro kriegst du später.«
Es wurde permanent gewettet in diesem Flügel des Krankenhauses. Fußballweltmeisterschaft, Bundestagswahlen, Eurovision Song Contest, jetzt eben das. Früher hatten sie auch Patienten mitwetten lassen, bis die dumme Sache passiert war. Einer hatte bei einer Fußball-WM die richtige Endspielpaarung und das genaue Endspielergebnis vorhergesagt, war aber dann in der Halbzeit vor Aufregung gestorben. Was sollte man tun? Den trauernden Verwandten den Gewinn vorenthalten? Oder ihnen die 89 Euro geben? Beides wäre irgendwie nicht pietätvoll gewesen.
»Serbien als Miss World, guter Tipp«, sagte Winternik zu Dragica.
Im Stationszimmer der Station 8 war Schichtwechsel, und er reichte die Liste unter den Anwesenden herum. Niemand konnte sich eine ironische Bemerkung bezüglich Schwester Zillys laienhaftem Tipp verkneifen.
»Vatikanstadt – gibt es da überhaupt Frauen?«, fragte ein Krankenpfleger. »Und wenn, dürfen die dann an Misswahlen teilnehmen?«
Auf dem Namensschild des Pflegers stand D. Buck. Viele kurzsichtige Patienten misslasen den abgekürzten Vornamen als Doktortitel und hielten ihn für einen Arzt. Buck ließ es sich gern gefallen.
»Und wenn da Vatikanstädterinnen teilnehmen«, sinnierte Buck weiter, »wie werden die wohl aussehen?«
Während Benni Winternik das Wettgeld kassierte, trudelte die Belegschaft der heutigen Nachtschicht langsam ein. Die der Nachmittagsschicht war noch teilweise anwesend, doch das Personalzimmer der Station 8 wurde auch gerne von anderen medizinischen Kräften besucht. Der Grund war der, dass Selda Gençuc, die türkische MTA, den besten Kaffee im ganzen Krankenhaus brühte, mit genau abgemessenen Zugaben von geheimnisvollen Kaffeegewürzen. Winternik war froh, dass er heute seine Earphones dabeihatte, denn Kreysel packte im Nachtdienst immer seinen unerschöpflichen Vorrat an unwitzigen Anekdoten aus. Eine solche Labertasche ist immer dabei, dachte Winternik. Wahrscheinlich gab es schon bei den Höhlenmenschen Labertaschen.
»Dolle Geschichte gehört«, begann Kreysel und sog an seiner kalten Pfeife. »Müsst ihr euch vorstellen. Sein Arztkittel ist blitzsauber, er hat ein Stethoskop umgeworfen, das typische Arztlächeln, er geht von Zimmer zu Zimmer, hat die Spritze in der Hand, spritzt da, punktiert dort, die ganze Station 11 macht er durch, geht dann wieder auf Station 12 und legt sich gemütlich in sein Patientenbett. Diagnose: Wahnvorstellung. Oder die Geschichte von dem falschen Feuerwehrmann«, schloss er ohne Pause an. »Kennt jemand die?«
Natürlich kannten alle die Geschichte, aber als er beginnen wollte, leuchtete eine rote Lampe auf, ein Patient hatte geklingelt. Alle schossen von den Stühlen hoch, doch Schwester Zilly war zuerst an der Tür.
Die Frau, die geklingelt hatte, war schwach, sie hatte eine schwere OP hinter sich, und auch schon wieder vor sich. Sie nickte Zilly zu und deutete mit dem Kopf zum Nachtkästchen, auf dem ein Glas stand. Die Deckenlampe brannte, ein leerer Stuhl war an das Bett gerückt.
»Hatten Sie noch Besuch?«, fragte die Schwester während des Einschenkens.
»Ja, war ganz lustig«, antwortete die Patientin mit müder Stimme.
»Ein Verwandter?«
»Ein Clown.«
Ach so. Diese Patientin hatte Besuch von den Clowndoktors bekommen. Sie waren in letzter Zeit eine ziemliche Plage, diese Gericlowns. Lachen sei die beste Medizin, hieß es. Und so wurde die Verwaltung bombardiert mit Anfragen von freien Clowndoktortruppen, Straßenkünstlern und Pantomimelehrgangsabsolventen. Meistens taten sie nicht mehr, als sich grell zu schminken, in den Zimmern herumzutapsen und Blumenvasen umzustoßen.
»Wie viele waren es?«
»Nur einer.«
»Und was hat er gemacht?«
»Er hat mit mir geredet.«
Die Schwester verabschiedete sich, ging ins Stationszimmer und sah im Dienstplan nach. Heute waren keine Clowns angemeldet. Diese Typen kamen, wann sie wollten, dachte sie ärgerlich. Manche standen im Verdacht, bei den Patienten abzukassieren.
Kreysel, die Labertasche, war schon bei der nächsten Geschichte. Ein paar Nachtschichtler hörten höflich zu. Schwester Zilly schlug ihr Buch auf. Jemand strickte. Winternik hatte die Kopfhörer aufgesetzt und hörte Musik seiner Generation. In seiner Brusttasche steckte die Liste mit den Wetten. Er nahm sie beiläufig heraus und überflog sie, ob er schon mit allen durch war:
Benni Winternik
F
Kreysel
S
MTA Selda Gençuc
P
Schwester Zilly
V
D. Buck
A
Ingo, der Masseur
A
Dragica
SRB
Winternik faltete das Blatt zusammen und legte es auf den Tisch. Fllapff! machte es, als er aufstand, um nach dem nächsten Patienten zu sehen, der geklingelt hatte.
610
Der Zehnt war eine mittelalterliche Steuer, die meist in Naturalien zu bezahlen war. Der Weinzehnt (oder »nasse Zehnt«) beispielsweise war auf gekelterte Weine zu entrichten. Eine ähnliche Abgabe auf landwirtschaftliche Erträge stellt im Islam der ’Uschr (»das Zehntel«) dar.
So zielsicher Ursel vorhin dem üblen Angreifer ins Herz geschossen hatte, so punktgenau stieß sie jetzt mit der Gabel in eines der Ochsenbackerl und hob es vorsichtig aus dem saucigen Gebrodel heraus. Sie legte es auf ein Holzbrett, schnitt es an und prüfte, ob es sich auch innen gut vollgesogen hatte. Es hatte. Die restlichen Ochsenbackerl blubberten leicht zitternd in der Röhre, die dunkelglänzende Flüssigkeit, in der sie schwammen, warf Blasen, und mit jedem Blubb stiegen jetzt, nach drei Stunden Kochzeit, herrliche Gerüche auf.
Ursel war mehr der Ofen-Typ, während Ignaz, der ebenfalls gerne und hervorragend kochte, mehr den klassischen Pfannen-Typ darstellte. Beiden gemeinsam jedoch war die beinahe ehrfürchtige Liebe zur Sauce, zur reinen Essenz des Geschmacks. Die Sauce schien ihnen der Höhepunkt jeglicher Kochkunst, das Nonplusultra der Gaumenfreuden. Sie hatten schon einmal ernsthaft erwogen, ein exklusives Saucen-Restaurant aufzumachen, auf der Speisekarte sollten nur Bratensäfte und Béchamels stehen, Mayonnaisen, Aiolis, Grüne Saucen, Rouilles und Cumberlands … Aber gehen die Leute in ein Restaurant, das von zwei ehemaligen Beerdigungsunternehmern geführt wird?
Ursel strich sich die Schürze glatt und drehte die Temperatur am Ofen herunter. Ein Löffelchen von der dickflüssigen Masse hatte sie herausgenommen, sie wartete kurz, bis die gröbste Hitze verflogen war, dann schlürfte sie ungeniert. Beide Graseggers gehörten nicht zu der Sorte von Feinschmeckern, wie man sie in den Spitzenrestaurants sitzen sah, lustlos das Teuerste aufspießend, es übellaunig betrachtend und im Mund hin und her schiebend wie eine angriffsschwache Fußballmannschaft den Ball. Die Graseggers waren, man muss es so deutlich sagen, verfressene Zeitgenossen. Das Erstaunliche war, dass sie nicht noch beleibter waren, bei den Mengen, die sie zu sich nahmen. Aber sie hatten Glück mit ihrem Stoffwechsel, sie setzten nicht allzu übermäßig an.
Wieder blies Ursel sich ein paar heruntergefallene Schläfenlöckchen aus dem Gesicht. Eine Stunde noch, dann waren die Ochsenbackerl fertig. Sie machte sich daran, die Beilagen vorzubereiten. Süßkartoffel-Wirsing-Püree. Böhmische Serviettenknödel. Als sie das Radio anschaltete, erfüllten sofort die kristallklaren Gesänge der Herbratzederdorfer Dirndln den Raum. Von den Kindern wurden Ursel und Ignaz wegen ihrer Liebe zur Volksmusik oft mit beißendem Spott überzogen. Warum es denn die allerneueste Surround-Sound-Hi-Fi-Schnick-Schnack-Anlage mit 500-Watt-Boxen sein musste, wenn sie ausschließlich solches Gejaule hörten? Die Kinder hatten ja keine Ahnung. Eine der Herbratzederdorfer Dirndln jodelte jetzt solo, ihre Stimme schepperte wie ein schartiges Messer auf dem Schleifstein. Ursel riss sich von dem Gesang los, sie dachte darüber nach, was noch an der Sauce fehlte. Ein altes Hausrezept verlangte nach einem Tannenzweig, der in der letzten Stunde mitgekocht wurde. Sie verließ das Haus, ohne die Tür abzuschließen, lief über die kleine Wiese zum angrenzenden Wäldchen, erntete einige saftig grüne Tannenzweige und warf sie in die Sauce wie Miraculix das bei einem Zaubertrank getan hätte. Es war auch ein Zaubertrank. Wenn es Ochsenbackerl gab, erfüllte ihr Ignaz immer jeden Wunsch.
Ursel leckte sich die Finger und schloss die Tür des Backofens wieder. Es war ein leistungsfähiger Backofen einer großen deutschen Haushaltsgeräte-Firma, der eine besondere Funktion der Selbstreinigung durch Pyrolyse hatte. Dabei wurden 600 Grad Celsius erreicht, das brannte den Schmutz vollständig weg. Gold schmolz jedoch erst bei 1064 Grad. Der Umbau des Backofens in einen Schmelzofen, in dem kleine, leicht verkäufliche Münzen hergestellt werden konnten, lag nahe.
»Ich frage nicht, wozu ihr das braucht«, hatte Philipp gesagt.
»Geht das jetzt, oder geht das nicht?«, hatte Ignaz gegengefragt.
»Also, bis 900 Grad kommen wir schon«, sagte Philipp, der Superingenieur, den die Aufgabe reizte, den Ofen hochzutunen. »Aber ich weiß nicht, ob wir noch viel mehr Temperatur rausholen können. Ich müsste verschiedene Module einbauen, zusätzliche Relais. Noch mehr Feuerschutzmaßnahmen. Und natürlich jede Menge Wandverdickungen. Elfhundert Grad wären dann zu erreichen. Aber sicher nur ein paar Sekunden lang.«
Philipp hatte ihnen den Ofen umgebaut. Die Explosionsgefahr war groß. Man musste das Haus verlassen. Aber sonst war alles gutgegangen. Sie hatten es ein paarmal probiert. Nach dem fünften Guss hatte allerdings der Hörl Sepp von den Gemeindewerken angerufen.
»Grüß dich, Graseggerin.«
»Grüß dich, Hörl. Was gibts?«
»Bei euch im Haus stimmt was nicht. In der letzten Woche haben wir einen irrsinnig hohen Stromverbrauch gemessen. Habt ihr einen Heizstrahler dauernd laufen lassen? Oder ist aus euch plötzlich eine zwanzigköpfige Familie geworden?«
Das war also zu auffällig. Es half nichts, um den Ruach kam man nicht herum.
Die Ochsenbackerl blubberten alleine vor sich hin. Ursel verließ die Küche, schlenderte durch den Garten und lehnte sich wieder an den Zaun. Als sie hinüber zur fernen Geiffelspitze sah und die Stelle suchte, an der der dichte Nadelwald in Schotter und Geröll überging, als sie das Gold quasi dort zwischen den Steinen hervorblitzen sah, nickte sie wieder versonnen. Und wie bei den Ochsenbackerl blubberte in ihr eine feine und prickelnde Kitzelspannung auf. Gefahr war Dressing für ihre Seele. Ein paar Leute gingen vorbei, grüßten. Sie grüßte flüchtig zurück.
Die Abenddämmerung legte sich über das Tal. Sie blickte hoch zum tiefblauen Himmel, die große fette Wolke war weitergezogen, und die Gemütlichkeit, die den ganzen Tag noch ein letztes herbstliches Mal glühend und unbarmherzig auf den Talkessel gebrannt hatte, ging langsam hinter dem Waxensteingebirge unter. Einige Mücken taumelten surrend durch die Luft und flogen geradewegs in den Tod. Sie landeten in den Schnäbeln der gierigen Haubenmeisen. Auch andere Vögel saßen in den Ästen und belferten sich an. Der heisere Schrei eines wütenden Fuchses ließ sie verstummen, die Nacht kam auf das Land zu wie ein schlingerndes Auto, das nicht mehr zu bremsen war. Die Alpspitze glich jetzt einem abgebrochenen Zahn, steil aufragend und blutig in allen denkbaren unappetitlichen Rottönen. Schnaken und Gelsen, die sich den ganzen Tag über mit Touristenblut vollgesogen hatten, schwirrten trunken herum und schleppten böse Krankheiten mit sich. An den Kanten der Waxensteine brannte das Abendrot wie loderndes Feuer. Der Wind strich durch die Wälder. Die Gemütlichkeit war endgültig untergegangen.
710
Zur Zeit der Französischen Revolution wurde der Versuch unternommen, den Tag in zehn Stunden einzuteilen. Im Französischen Revolutionskalender, der von 1792 bis 1805 galt, bestand ein Monat aus drei Dekaden, eine Woche hatte also zehn Tage. Am arbeitsfreien zehnten Tag wurde das »Fest der Vernunft« gefeiert.
Jennerwein starrte Kommissar Kluftinger perplex ins Gesicht. Er konnte es immer noch nicht so recht glauben. Kluftinger hielt seinem Blick stand, auch er schwieg und lächelte freundlich zurück. Sekunden vergingen. Eine Bahnhofsdurchsage durchschnitt die Stille. Dann war es wieder ruhig. Es schien so, als ob keiner von beiden sich die Blöße geben wollte, etwas ganz und gar Naheliegendes zu sagen. So etwas wie: Klein ist die Welt! Oder: So sieht man sich wieder! Der Allgäuer nahm die Hand langsam von der Schulter Jennerweins.
»Was machen Sie denn hier, Kollege?«, sagten beide gleichzeitig und mussten lachen darüber.
»Ja, gibts denn so was«, sagte Jennerwein, »jetzt hätte ich um ein Haar einen bayrischen Beamten mit einem Judowurf auf die Gleise befördert. Das hätte eine Schlagzeile gegeben!«
»Vor allem hätte es eine Riesensauerei gegeben«, fügte Kluftinger trocken hinzu. »Es ist lange her. Ich meine: unsere letzte Begegnung. Es muss so um 98 oder 99 herum gewesen sein, das sind jetzt fast zwanzig Jahre.«
»Möglich, ja.«
»Seitdem schon mal wieder im Allgäu gewesen?«
»Nicht dass ich wüsste.«
Jennerwein musterte den anderen. Der bodenständige Kriminalhauptkommissar, den er damals kennengelernt hatte, hatte sich eigentlich kaum verändert. Obwohl: Etwas fülliger war er schon geworden. Das ist bei mir aber sicherlich auch nicht anders, dachte Jennerwein. Hatten sie sich damals eigentlich geduzt?
»Dienstlich unterwegs?«, fragte Kluftinger.
»Nein, ich trete gerade meinen Urlaub an«, antwortete Jennerwein. »Stockholm. Ein paar Wochen. Und selber?«
Kluftinger deutete mit dem Daumen über die Schulter.
»Ich war drüben in Kochel am See. Im Museum.«
»Schön!«
»Franz Marc.«
»Franz Marc, soso. Blaue Pferde. Welche gesehen?«