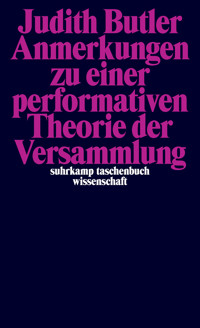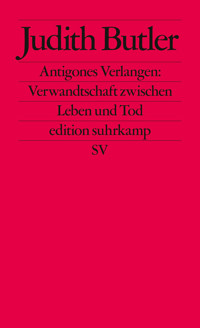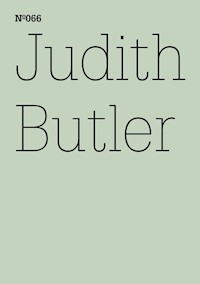29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kritiker des Staates Israel und seiner Siedlungspolitik geraten schnell unter den Verdacht des Antisemitismus - so auch die prominente jüdische Philosophin Judith Butler. In ihrem neuen Buch geht Butler der Frage nach, wie eine Kritik am Zionismus aus dem Judentum selbst heraus möglich, ja ethisch sogar zwingend ist. In einer eindringlichen Auseinandersetzung mit Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas, Walter Benjamin, Primo Levi und den Palästinensern Edward Said und Mahmoud Darwish entwickelt sie eine neue jüdische Ethik, die sich gegen die von Israel ausgeübte und vom Zionismus legitimierte staatliche Gewalt sowie Israels koloniale Unterdrückung von Bevölkerungsgruppen wendet. Diese Ethik steht ein für die Rechte der Unterdrückten, für die Anerkennung des Anderen und die Infragestellung der jüdischen Souveränität als alleinigem Bezugsrahmen der israelischen Staatsraison. Aus der Erfahrung von Diaspora und Pluralität heraus plädiert Butler für einen Staat, in dem Israelis und Palästinenser, Juden und Nichtjuden gleichberechtigt zusammenleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Judith Butler
Am Scheideweg
Judentum und die Kritik am Zionismus
Aus dem Englischen von Reiner Ansén
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Kritiker des Staates Israel und seiner Siedlungspolitik geraten schnell unter den Verdacht des Antisemitismus – so auch die prominente jüdische Philosophin Judith Butler als ihr 2012 der Adorno-Preis der Stadt Frankfurt verliehen wurde. In ihrem neuen Buch geht Butler der Frage nach, wie eine Kritik am Zionismus aus dem Judentum selbst heraus möglich, ja ethisch sogar zwingend ist. In einer eindringlichen Auseinandersetzung mit Hannah Arendt, Emmanuel Lévinas, Walter Benjamin, Primo Levi und den Palästinensern Edward W. Said und Mahmoud Darwish entwickelt sie eine neue jüdische Ethik, die sich gegen die von Israel ausgeübte und vom Zionismus legitimierte staatliche Gewalt sowie Israels koloniale Unterdrückung von Bevölkerungsgruppen wendet. Diese Ethik steht ein für die Rechte der Unterdrückten, für die Anerkennung des Anderen und die Infragestellung der jüdischen Souveränität als alleinigem Bezugsrahmen israelischer Staatsraison. Aus der Erfahrung von Diaspora und Pluralität heraus plädiert Butler für einen Staat, in dem Israelis und Palästinenser, Juden und Nicht-Juden gleichberechtigt zusammenleben.
Über die Autorin
Judith Butler, geb. 1956, ist Professorin für Rhetorik und Komparatistik an der University of California, Berkeley. Sie ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart und gilt als wichtigste Theoretikerin der Geschlechterforschung. Mit ihrem Buch »Das Unbehagen der Geschlechter« (1991) legte sie die Grundlage der Queer Theory. Bei Campus erschien von ihr zuletzt »Raster des Krieges. Warum wir nicht jedes Leid beklagen« (2010). Judith Butler wuchs in Cleveland, Ohio, auf. Ihre Eltern, von ungarischer und russischer Herkunft, waren praktizierende Juden und politisch engagiert. Sie besuchte eine jüdische Schule und nahm Unterricht in jüdischer Ethik.
Inhalt
Danksagung
Einleitung – Trennung von sich, Exil und die Kritik des Zionismus
Kapitel 1: Unmögliche, unumgängliche Aufgabe – Said, Lévinas und die ethische Forderung
Kapitel 2: Unfähig zu töten – Lévinas kontra Lévinas
Kapitel 3: Walter Benjamin und die Kritik der Gewalt
Kapitel 4: Aufblitzen – Benjamins messianische Politik
Kapitel 5: Ist Judentum Zionismus? Oder: Arendt und die Kritik des Nationalstaates
Kapitel 6: Das Dilemma des Pluralen – Kohabitation und Souveränität bei Arendt
Kapitel 7: Primo Levi für die Gegenwart
Kapitel 8: »Was sollen wir tun ohne Exil?« – Said und Darwish an die Zukunft
Abkürzungen
Anmerkungen
Danksagung
Die Fertigstellung des Buchmanuskriptes wurde mit ermöglicht durch den American Council of Learned Societies, die Ford Foundation, das Humanities Research Fellowship der University of California in Berkeley und den Mellon Foundation’s Award for Distinguished Scholarship in the Humanities. Ich habe sehr viel aus Gesprächen mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen gelernt, von denen viele auch im Lauf der Jahre frühere Fassungen einzelner Kapitel dieses Buches gelesen oder gehört haben. Sie waren nicht immer meiner Ansicht, aber ihre Auffassungen waren mir beim Schreiben wichtig und ich habe versucht, ihnen möglichst gerecht zu werden. Zu ihnen gehören Jacqueline Rose, Amnon Raz-Krakotzkin, Samera Esmeir, Michel Feher, Étienne Balibar, Idith Zertal, Saba Mahmood, Joan W. Scott, Wendy Brown, Anat Matar und Amy Hollywood. Ich danke meinen Studenten an der European Graduate School und an der UC Berkeley für ihre Beteiligung an der Arbeit mit den Schriften von Hannah Arendt und Walter Benjamin in den Seminaren. Gelernt habe ich auch von Studenten und Kollegen am Birkbeck College, der Birzeit University, der Université Paris-VII, der New York University, am Dartmouth College, am Pomona College und an der Columbia University, wo ich Teile des vorliegenden Buches vorgetragen habe, sowie aus Gesprächen mit Omar Barghouti, Joelle Marelli, Tal Dor, Manal Al Tamimi, Beshara Doumani, Mandy Merck, Lynne Segal, Udi Aloni, Leticia Sabsay, Kim Sang Ong-Van-Cung, Alexander Chasin und Frances Bartkowski. Ich danke Amy Jamgochian, Colleen Pearl und Damon Young für ihre unverzichtbare Hilfe mit dem Manuskript. Und ich bin Susan Pensak und Wendy Lochner von Columbia University Press zu großem Dank für Ihre Beharrlichkeit verpflichtet, auch wo ich selbst zögerlich war.
Einige Kapitel basieren zwar auf bereits veröffentlichten Texten, sie wurden jedoch sämtlich für dieses Buch überarbeitet. Die Einleitung und Kapitel 1 gehen auf zwei Quellen zurück: »Jews and the Binational Vision« in Logos 3, Nr. 1 (Winter 2004) sowie auf einen Vortrag bei der »Second International Conference on an End to Occupation, a Just Peace in Israel-Palestine: Towards an Active International Network in East Jerusalem« am 4. und 5. Januar 2004 mit dem Titel »The Impossible Demand: Lévinas and Said«, Mitaam 10 (2007), vorgetragen auch als Edward Said Memorial Lecture, Princeton University 2006. Kapitel 2 beruht auf einem kürzeren Text mit dem Titel »Être en relation avec autrui face à face, c’est ne pas pouvoir tuer« in Bruno Clément und Danielle Cohn-Lévinas (Hg.): Emmanuel Lévinas et les territoires de la pensée, erschienen in der Reihe Epimethée bei Presses Universitaires de France 2007. Kapitel 3 ist eine überarbeitete Fassung von »Critique, Coercion, and the Sacred Life of Benjamin’s ›Critique of Violence‹«, Erstveröffentlichung in Hent de Vries und Lawrence E. Sullivan (Hg.): Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World, New York: Fordham University Press 2006. Kapitel 5 ist eine Neuformulierung von Überlegungen zu Hannah Arendt, die zuerst in meiner Besprechung von Hannah Arendts Jewish Writings unter dem Titel »›I merely belong to them‹« in London Review of Books 29, Nr. 9, 10. Mai 2007, S.26–30 erschienen sind und ihrerseits zu einem großen Teil zurückgehen auf meine Ausführungen in »Is Judaism Zionism?«, veröffentlicht in dem Band The Power of Religion in Public Life mit Cornell West, Jürgen Habermas und Charles Taylor, New York: Columbia University Press 2011. Kapitel 7 ist eine überarbeitete Fassung meines Textes »Primo Levi for the Present«, zuerst veröffentlicht in Frank Ankerschmitt (Hg.), Refiguring Hayden White, Stanford: Stanford University Press 2008. Kapitel 8 wurde zuerst im Oktober 2010 als Edward Said Memorial Lecture an der American University of Cairo vorgetragen und ist auch erschienen in ALIF: Journal of Comparative Poetics 32 (2012).
Einleitung – Trennung von sich, Exil und die Kritik des Zionismus
Vielleicht beginnt jedes Buch in einem formalen Sinn mit dem Nachdenken über seine eigene Unmöglichkeit, aber der Abschluss des hier vorgelegten Buches hing davon ab, dass mit dieser Unmöglichkeit gearbeitet wurde, ohne zu einer klaren Lösung zu kommen. Von dieser Unmöglichkeit muss etwas im Text erhalten bleiben, auch wenn es das ganze Projekt ständig in Gefahr bringt. Sollte das Buch zunächst die Behauptung widerlegen, jegliche Kritik am Staat Israel sei faktisch antisemitisch, wurde daraus später eine Meditation über die Notwendigkeit des Verweilens beim Unmöglichen. Ich will das im Folgenden zu klären versuchen, zunächst aber klipp und klar das Risiko benennen, das mit diesem Versuch einhergeht. Sollte es mir gelungen sein zu zeigen, dass man zur Kritik der staatlichen Gewalt, der kolonialen Unterdrückung von Bevölkerungsgruppen, der Vertreibung und Enteignung auf jüdische Quellen zurückgreifen kann, dann habe ich damit zugleich zeigen können, dass eine jüdische Kritik der von Israel ausgeübten staatlichen Gewalt zumindest möglich, wenn nicht sogar ethisch geboten ist. Wenn ich ferner zeigen kann, dass durchaus jüdische Werte der Kohabitation oder des Zusammenlebens mit Nicht-Juden zum ethischen Kernbestand des Diaspora-Judentums gehören, dann lässt sich daraus auch ableiten, dass die Verpflichtung auf soziale Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit integraler Teil säkularer, sozialistischer und religiöser jüdischer Traditionen ist. Das sollte nicht weiter überraschen, muss aber inzwischen konsequent betont werden angesichts eines öffentlichen Diskurses, der jede Kritik der israelischen Besatzung, der innerisraelischen Ungleichbehandlung, der Beschlagnahmung von Land und der Bombardierung eingeschlossener Bevölkerungsgruppen (wie im Zuge der Operation Cast Lead), ja der schon Einwände gegen die Einbürgerungsvoraussetzungen in diesem Land für antisemitisch oder antijüdisch erklärt – und zwar nicht im Dienst des jüdischen Volkes und ohne jede Berufungsmöglichkeit auf das, was wir allgemein als jüdische Werte bezeichnen könnten. Anders gesagt: Es wäre schon eine schmerzliche Ironie, wenn der jüdische Kampf um soziale Gerechtigkeit selbst als antijüdisch hingestellt würde.
Gehen wir einmal davon aus, dass ich zeigen kann: Wesentliche jüdische Überlieferungen lassen Widerstand gegen staatliche Gewalt und koloniale Vertreibung und Beherrschung nicht nur zu – sie verlangen sie sogar. In diesem Fall kann ich mich auf ein anderes Jüdischsein berufen als das, in dessen Namen der israelische Staat zu sprechen behauptet. Und ich helfe damit zu zeigen, dass es nicht nur bedeutsame Unterschiede – säkulare, religiöse, geschichtliche – unter Juden gibt, sondern dass es in dieser Gemeinschaft auch aktive Auseinandersetzungen über den Sinn von Gerechtigkeit, Gleichheit und die Kritik staatlicher Gewalt und kolonialer Unterdrückung gibt. Wäre das alles und hätte ich bis hierhin überzeugend argumentiert, dann wäre damit belegt, dass es bestimmt nicht anti-jüdisch oder gegen-jüdisch ist, die Formen der staatlichen Gewalt zu kritisieren, die der politische Zionismus eingeführt und aufrecht erhalten hat (wozu die umfangreichen Enteignungen der Palästinenser 1948, die Landannexion 1967 und die fortlaufenden Konfiszierungen palästinensischer Grundstücke im Zuge der neuen Grenzbefestigungen und des Siedlungsbaus gehören). Das allein ist schon wichtig, da Israel beansprucht, das jüdische Volk zu vertreten und die öffentliche Meinung zu der Annahme neigt, Juden »unterstützten« Israel, ohne an ebenfalls jüdische Traditionen des Anti-Zionismus und an die Mitarbeit von Juden in Bündnissen gegen die israelische Kolonialherrschaft über die Palästinenser zu denken.
Gelingt mir das alles, stehe ich jedoch sofort vor einem anderen Problem. Mit der Behauptung, es gebe eine bedeutende jüdische Tradition des Einsatzes für Gerechtigkeit und Gleichheit, eine Tradition, die notwendig zu einer Kritik am israelischen Staat führen muss, eröffne ich eine jüdische nicht-zionistische, ja anti-zionistische Perspektive mit dem Risiko, aus dem Widerstand gegen den Zionismus selbst einen »jüdischen« Wert zu machen und damit indirekt ethische Ausnahmeressourcen des Judentums zu beteuern. Soll die Kritik des Zionismus jedoch effektiv und substanziell sein, muss dieser Anspruch auf eine Sonderstellung zugunsten fundamentalerer demokratischer Werte zurückgewiesen werden. So wichtig es auch sein mag, jüdische Widerstände gegen den Zionismus aufzuzeigen, erfordert dies doch, kritisch infrage zu stellen, dass ein rein jüdischer Bezugsrahmen – wie alternativ und progressiv auch immer – hier als definierender Horizont des Ethischen ausreicht. Die Opposition gegen den Zionismus verlangt den Bruch mit einem exklusiv jüdischen Denkrahmen der Ethik sowie der Politik.
Jedes legitime Nachdenken über eine politische Lösung für die Region müsste von den gegensätzlichen ethischen und politischen Traditionen ausgehen, die dort das Verhalten, das Denken, die Zugehörigkeitsweisen und die Antagonismen bestimmen. Anders gesagt: Obgleich man ganz gewiss sagen kann, dass es jüdische Grundlagen für eine Kritik der staatlichen Gewalt gibt, die auch legitimerweise auf den Staat Israel selbst anzuwenden sind, bleibt das doch heute ein unvollständiges (obgleich wichtiges) Argument. Würden die Grundsätze der Gleichheit und Gerechtigkeit in der Bewegung gegen den politischen Zionismus ausschließlich aus solchen Quellen hergeleitet, würden sie sich sofort als ungenügend, ja als widersprüchlich erweisen. Tatsächlich erweitert noch die Kritik des Zionismus, wenn sie exklusiv jüdisch ist, die jüdische Hegemonie im Nachdenken über diese Region und wird gegen ihren Willen Teil dessen, was wir den Zionistischen Effekt nennen könnten. Alles, was die jüdische Hegemonie in der Region erweitert, ist Teil des Zionistischen Effekts, ganz gleich, ob es sich als zionistisch oder antizionistisch begreift oder nicht. Gibt es einen Weg aus dieser Zwickmühle, wenn man zugleich weiterhin den Anspruch Israels bestreiten will, die Juden und das Judentum zu repräsentieren und wenn man weiterhin die Verknüpfung zwischen dem Staat Israel und dem jüdischen Volk, ja den jüdischen Werten, wie sie von vielen immer wieder hergestellt wird, durchtrennen will?
Mich überrascht immer wieder, dass viele Leute glauben, sich zu seinem Jüdischsein zu bekennen bedeute, sich zum Zionismus zu bekennen oder zu glauben, dass jeder, der in die Synagoge geht, auch Zionist sein muss. Ebenso beunruhigend ist, wie viele Leute glauben, das Judentum ablehnen zu müssen, weil sie die Politik des Staates Israel nicht akzeptieren können. Solange der Zionismus über die Bedeutung des Jüdischseins bestimmt, kann es keine jüdische Kritik an Israel und keine Anerkennung derjenigen geben, die jüdischer Herkunft oder jüdischer Prägung sind und das Recht des Staates Israel infrage stellen, im Namen jüdischer Werte oder auch des jüdischen Volkes zu sprechen. Gewiss lassen sich bestimmte Prinzipien der Gleichheit, der Gerechtigkeit und des Zusammenlebens aus unspezifisch ausgelegten jüdischen Quellen herleiten, aber wie soll das möglich sein, ohne diese Prinzipien damit zu jüdischen zu machen und damit andere Ansätze anderer religiöser und kultureller Herkunft und Praxis auszulöschen oder zu entwerten?
Ein Ausweg könnte vielleicht im Nachdenken darüber liegen, was es überhaupt heißt, diese Grundsätze aus jüdischen Quellen herzuleiten. Die Idee einer solchen Herleitung hat immer etwas Zweideutiges: Wenn die betreffenden Grundsätze jüdische Quellen besitzen, bleiben sie dann im Zuge ihrer Entwicklung und historischen Umgestaltung ausschließlich jüdische Grundsätze oder verlassen sie diesen exklusiven Rahmen bis zu einem gewissen Grad? Wir können noch allgemeiner die Frage stellen, ob die Prinzipien der Gerechtigkeit und Gleichheit, um die es in jeder Kritik am israelischen Staat und an jedem anderen Staat geht, der sich vergleichbarer Ungerechtigkeiten schuldig macht, nicht immer zu Teilen aus unterschiedlichen kulturellen und historischen Quellen stammen und dennoch keiner von diesen exklusiv »gehören«. Zu diesen Quellen können wir die klassische griechische Überlieferung zählen, die französische Aufklärung und die Kämpfe um die Befreiung von der Kolonialherrschaft im 20. Jahrhundert. In diesen wie in anderen Fällen lässt sich sagen, dass derartige Grundsätze aus ganz spezifischen kulturellen Quellen hergeleitet sind, aber das bedeutet keineswegs, dass sie ausschließlich einer einzigen Tradition entstammen. Um überhaupt einen Gerechtigkeitsbegriff aus einer spezifischen Tradition herleiten zu können, muss er Spielraum besitzen, um aus dieser Tradition auszuscheren und seine Anwendbarkeit außerhalb seines Herkunftsrahmens unter Beweis zu stellen. In diesem Sinn ist die Loslösung von der Tradition Vorbedingung jeder Tradition mit starken politischen Grundsätzen. Das Dilemma liegt also auf der Hand: Beruft sich die Kritik staatlicher Gewalt auf Prinzipien oder Werte, die letzten Endes exklusiv oder von Grund auf jüdisch in einem religiösen, säkularen oder historischen Sinn sind, dann wird das Judentum zu einer privilegierten kulturellen Ressource und bleibt der jüdische Bezugsrahmen der einzige privilegierte Bezugspunkt der Kritik staatlicher Gewalt. Übt man diese Kritik aber, weil man gegen die Grundsätze jüdischer Souveränität ist, die diese Region, das historische Palästina, beherrschen, und weil man für ein Ende der Kolonialherrschaft im Westjordanland und Gaza und für die Rechte der über 750.000 Palästinenser eintritt, die 1948 und dann durch immer weitere Landbeschlagnahmungen gewaltsam vertrieben wurden, dann tritt man damit für eine Politik ein, die die Belange sämtlicher Bewohner dieses Landes gleich und fair berücksichtigen würde. In diesem Fall hätte die Behauptung gar keinen Sinn, es seien spezifisch jüdische Bezugspunkte, die eine Grundlage der politischen Kohabitation, ja der doppelten Nationalität innerhalb eines Staates bieten können, denn es geht ja gerade um die Entwicklung eines politischen Ansatzes, der nicht nur eine Vielfalt von Bezugsrahmen zulässt, sondern zudem für einen Binationalismus eintritt, der überhaupt erst nach dem Ende der Kolonialherrschaft denkbar wird. Statt für einen simplen Multikulturalismus plädiere ich dafür, dass die weitreichende und gewaltsame Hegemonialstruktur, die der politische Zionismus diesem Land und seiner Bevölkerung aufzwingt, beendet wird und an seine Stelle eine neue Politik tritt, die den Siedlerkolonialismus aufgibt und komplexe und antagonistische Formen des Zusammenlebens vorsieht und damit eine Alternative zum desolaten Binationalismus bietet, wie er derzeit praktiziert wird.
Zur Herleitung von Grundsätzen
Überlegen wir zunächst, was es überhaupt bedeutet, bestimmte Grundsätze aus einer kulturellen Überlieferung zu gewinnen und von dort aus zu den weiter gefassten politischen Fragen überzugehen. Wie schon bemerkt, wirft die Behauptung, bestimmte Prinzipien seien aus jüdischen Quellen »hergeleitet«, die Frage auf, ob diese Prinzipien jüdische bleiben, wenn sie in einer heute aktuellen Lage mit ganz neuen historischen Gegebenheiten entfaltet werden. Oder handelt es sich von vornherein um Prinzipien, die unterschiedlichen kulturellen und geschichtlichen Quellen entstammen und damit keiner von ihnen exklusiv »gehören«? Hängt die Verallgemeinerbarkeit der fraglichen Grundsätze im Kern eben davon ab, dass sie letztendlich nicht einem einzigen kulturellen Ort oder einer einzigen Tradition zugehören, aus der sie hervorgegangen sein mögen? Trägt gerade dieses Nichtgehören, dieses Exil zur Verallgemeinerbarkeit und Übertragbarkeit der Prinzipien der Gerechtigkeit und Gleichheit bei?
Wenn solche Grundsätze aus jüdischen Quellen hergeleitet werden, schließt manch anderer daraus wohl, dass es sich hier um ursprünglich, wesenhaft, ja endgültig jüdische Werte handelt. Daraus folgt dann, dass man sich zum Verständnis dieser Werte mit jenen religiösen, säkularen und historischen Überlieferungen befassen muss, womit das Judentum zur privilegierten kulturellen Ressource wird und der jüdische Bezugsrahmen der einzige oder zumindest entscheidende bleibt, um das Problem der Kohabitation und sogar der Existenz von zwei Nationen in einem Staat zu durchdenken. Damit versäumen wir die Loslösung von einem exklusiven kulturellen Bezugsrahmen des Judentums. Und das hat ganz besonders widersprüchliche und unannehmbare Folgen, wenn wir über Gleichheit und Gerechtigkeit in Israel/Palästina nachdenken wollen.
Auch wenn ein solcher Schluss unannehmbar ist, scheint dieses Paradox nur schwer zu umgehen. Eines scheint indes schon jetzt klar: Gleichheit, Gerechtigkeit, Zusammenleben und die Kritik staatlicher Gewalt können jüdische Werte nur bleiben, wenn sie nicht ausschließlich jüdische Werte sind. Das bedeutet, dass in der Artikulation solcher Werte das Primat und die Exklusivität des jüdischen Bezugsrahmens negiert werden muss und dass diese Artikulation sich gleichsam von sich selbst trennen und ihre eigene Zerstreuung betreiben muss. Ich hoffe in der Tat zeigen zu können, dass eben diese Zerstreuung eine Möglichkeitsbedingung für den Gedanken der Gerechtigkeit bildet, eine Voraussetzung, die wir gerade in diesen Zeiten besser nicht aus dem Blick verlieren. Nun mag man sagen: »Aha, Zerstreuung – ein jüdischer Wert! Hergeleitet von der messianischen Zerstreuung und anderen theologischen Figuren der Diaspora! Sie wollen vom Judentum loskommen, können es aber nicht!« Wenn jedoch die Frage der ethischen Beziehung zum Nicht-Juden entscheidend für die Frage geworden ist, was überhaupt jüdisch ist, dann können wir das Jüdische nicht in dieser Beziehung selbst festmachen. Relationalität bedeutet Dislozierung der Ontologie, und das ist auch etwas Gutes. Es geht nicht darum, die Ontologie des Juden oder des Jüdischseins zu stabilisieren, sondern vielmehr darum, die ethischen und politischen Implikationen einer Alteritätsbeziehung zu verstehen, die unumkehrbar und definierend ist und ohne die fundamentale Konzepte wie Gleichheit oder Gerechtigkeit nicht viel Sinn ergeben würden. Eine solche – gewiss nicht singuläre – Beziehung beinhaltet die obligatorische Überschreitung von Identität und Nation als definierende Bezugsrahmen. Der Bezug zur Alterität ist darin für die Identität konstitutiv, das heißt, er unterbricht die Identität und diese Unterbrechung ist Voraussetzung ethischer Bezüglichkeit. Ist das nun ein jüdisches Konzept? Ja und nein.
Die naheliegende Antwort auf eine solche Position ist die Behauptung, die Juden könnten in der Zerstreuung nicht überleben und das, was ich als ethischen Ansatz der Annäherung jüdisch/nicht-jüdisch anbiete, wäre eine Gefahr für die Juden. Aber die ethische Loslösung von sich selbst ist keine Selbstauslöschung und auch kein Inkaufnehmen der Selbstauslöschung. Diesem Argument kann auf verschiedenen Wegen wirkungsvoll begegnet werden. Erstens: Nichts lädt so sehr zur Aggression ein wie die gewaltsame Institutionalisierung kolonialer Unterdrückung, die der unterworfenen Bevölkerung grundlegende Selbstbestimmungsrechte vorenthält. Zweitens: Es gibt nicht nur gute Belege dafür, dass Zerstreuung gerade der tatsächliche Überlebensmodus der Juden gewesen ist;1 darüber hinaus basiert die Annahme, Zerstreuung sei eine zu überwindende Bedrohung für die Juden, oftmals auf der Vorstellung, »Zerstreuung« sei eine Form des Exils aus dem Heimatland (Galuth mit der einzigen Umkehrmöglichkeit der »Rückkehr« in das Heimatland).2 Wenn Zerstreuung nicht nur geografisch, sondern auch ethisch verstanden wird, ist sie genau der Grundsatz, der nach Israel/Palästina »heimgebracht« werden muss, um zu einer Politik zu kommen, in der nicht die eine Religion oder Nationalität Souveränität über die andere beanspruchen kann, sondern in der faktisch die Souveränität selbst der Zerstreuung unterliegt. Ich werde darauf noch ausführlich eingehen; hier will ich nur darauf hinweisen, dass darin eines der wichtigsten politischen Anliegen von Edward Said in seinen letzten Lebensjahren gelegen hat.
Es mag paradox erscheinen, Alterität oder »Unterbrechung« in den Mittelpunkt ethischer Beziehungen zu stellen. Zunächst muss jedoch klar sein, was diese Begriffe bedeuten sollen. Man könnte die Auffassung vertreten, der entscheidende Zug jüdischer Identität sei ihre Unterbrechung durch Alterität oder Anderssein, das heißt die Tatsache, dass der Bezug zu den Nicht-Juden nicht nur die Situation der Diaspora definiert, sondern eine ihrer grundlegenden ethischen Beziehungen selbst. Diese Aussage mag wohl stimmen (d.h. zu einer Menge wahrer Aussagen gehören), behält die Alterität aber einem schon vorhergehenden Subjekt als Prädikat vor. Der Bezug zur Alterität wird so zu einem Prädikat unter anderen, das »Jüdischsein« beschreibt. Etwas ganz anderes ist es, diesen Bezug dahingehend zu verstehen, dass er die Idee des »Jüdischen« als statisches Sein eines »Subjekts« selbst infrage stellt. Wenn dieses Subjekt zu »sein« heißt, bereits in eine bestimmte Relationalität eingetreten zu sein, dann eröffnet dieses »Sein« einen »Modus der Bezüglichkeit« (nach dem etwa Lévinas im Verhältnis zu Winnicot gedacht werden kann). Ob man der Meinung ist, Sein müsse neu als Modus der Bezüglichkeit gedacht werden oder überzeugt ist, dass Bezüglichkeit der Ontologie als solcher widerspricht, ist hier weniger wichtig als der Vorrang der Relationalität im Nachdenken über das Problem. Überdies ist die Art Bezüglichkeit, um die es hier geht, eine solche, die den Einheitscharakter des Subjekts, seine Selbstübereinstimmung und Univozität »unterbricht« oder infrage stellt. Anders ausgedrückt widerfährt dem »Subjekt« hier etwas, was es aus dem Zentrum der Welt herausrückt; ein Anspruch von anderswoher ergeht an mich oder teilt mich sogar von innen, und nur durch diesen Riss in meinem Selbstsein habe ich überhaupt die Möglichkeit, mit anderen in Beziehung zu treten. Wenn man diesen Ansatz als »jüdische Ethik« begreifen will, ist das nur zum Teil richtig. Die Formulierungen sind jüdisch und nicht-jüdisch, und ihr Sinn liegt eben in dieser gleichzeitigen Zusammenführung und Trennung. Man muss diese – in sich selbst doppelte – Perspektive verstehen, um begreifen zu können, weshalb Diaspora als Bezugsrahmen entscheidend für die theoretische Konzeption von Kohabitation und Binationalität sein könnte, sofern es überhaupt ein praktikables »Zusammenleben« unter Bedingungen der kolonialen Unterwerfung geben kann, die einer solchen Politik nicht zustimmt. Daher muss am Anfang jedes Koexistenzprojektes die Demontage des politischen Zionismus stehen.
Diese Sicht der Diaspora verdeutlicht auch, weshalb Perspektiven von »anderswo« bei diesen regionalen Fragen berücksichtigt werden sollten. Der Staat Israel gründete sich selbst, indem er palästinensische Bevölkerungsgruppen anderswohin auswies und Juden von anderswo ein wirkliches Verständnis der unterschiedlichen Gründe für die Aufrechterhaltung der Kolonialherrschaft im Namen der Demokratie absprach. Mit der Auffassung, niemand dürfe von außen über das Geschehen innen urteilen, sollen alle möglichen Argumente auf den nationalistischen Rahmen Israel beschränkt werden. Wenn man jedoch nach »innen« blickt, stellt man fest, dass das »Anderswo« sich bereits im Regionalen befindet und es im Kern definiert. Palästinenser leben sowohl diesseits wie jenseits der Grenzen des etablierten Staates; die Grenzen selbst stellen eine dauerhafte Beziehung zu durch sie ausgeschlossenen und beobachteten Gebieten und Bevölkerungsgruppen her. Diese Beziehung ist durch gewaltsame Enteignung, Überwachung und die letztendliche Kontrolle der palästinensischen Rechte auf Bewegungsfreiheit, Land und politische Selbstbestimmung durch den Staat Israel charakterisiert. Die Beziehung ist also entlang dieser Grenzen zementiert und sie ist ausgesprochen bejammernswert.
Ein ganz ähnliches Problem ergibt sich aus der Auffassung, diese Idee der ethischen Relationalität sei aus jüdischen Quellen »hergeleitet«. Das ist einerseits richtig, eine wahre Aussage (was indes weder heißt, dass diese Quellen die einzigen relevanten sind, noch, dass diese Gedanken nicht auch andere Quellen haben). Wie die Debatte zwischen Jürgen Habermas und Charles Taylor klargemacht hat, macht es einen Unterschied, ob man (a) behauptet, dass bestimmte Werte aus religiösen Quellen hergeleitet und anschließend in eine Vernunftsphäre mutmaßlich ohne religiöse Zugehörigkeit übertragen werden (Habermas), oder ob man (b) behauptet, dass die religiösen Gründe, die wir für unser Handeln angeben, ganz bestimmten Idiomen zugehören und nie vollständig aus diesen diskursiven Feldern zu lösen sind (Taylor).3 Ganz gleich, welche dieser Positionen man einnimmt, man begibt sich so oder so auf das Feld der Übersetzung, denn entweder muss der säkulare Gehalt auf die eine oder andere Weise aus dem religiösen Diskurs extrahiert werden oder aber der religiöse Diskurs muss sich über die Gemeinschaft hinaus, die sein Idiom teilt, verständlich machen. Auch wenn also eine bestimmte Konzeption aus jüdischen Quellen »hergeleitet« ist, muss sie erst übersetzt werden, um allgemein mitteilbar zu sein und ihre Relevanz auch außerhalb eines kommunitären (religiösen oder nationalen) Rahmens zu erweisen. Die Ursprünge einer Praxis sind, wie Nietzsche sagt, »Welten entfernt« von ihrer schlussendlichen Umsetzung und Bedeutung – ein wichtiger Aspekt seines Begriffs der Genealogie.4 Eine solche Grenzüberschreitung zwischen den Welten erfordert jedoch einen Prozess der kulturellen Übersetzung. Im Lauf der Zeit vollzieht sich eine gewisse Transposition der Überlieferung (und ohne die institutionalisierte Wiederholung solcher Transpositionen können Traditionen sich gar nicht durchsetzen). Das heißt nicht nur, dass Tradition erst in der immer wieder vollzogenen Loslösung von sich selbst entsteht, sondern auch, dass eine Ressource zu ethischen Zwecken erst »verfügbar« wird, wenn sie in eine Sphäre der Übersetzung und Übertragbarkeit eintritt. Das impliziert keine Übersetzung von einem religiösen in einen säkularen Diskurs (wobei davon ausgegangen wird, dass das Säkulare seine ursprünglich religiöse Formulierung überschreitet), und das bedeutet auch nicht notwendig, dass die Tradition ihrem eigenen kommunitären Rahmen immanent bleibt. Was vielmehr zunächst »Ressource« ist, aus der man schöpft, durchläuft in eben diesem Prozess eine Reihe von Veränderungen. Eine solche Ressource muss tatsächlich erst eine gewisse zeitliche Bewegung durchlaufen haben, um für die Gegenwart bedeutsam oder erhellend werden zu können; nur durch eine Reihe von Verschiebungen und Transpositionen wird eine »geschichtliche Ressource« für die Gegenwart relevant und anwendbar oder kann sie ihre Wirksamkeit erneuern. Diese zeitliche Bewegung ist zugleich eine räumliche, da die Bewegung von einem topos zum anderen nicht von einem einheitlichen, kontinuierlichen und stabilen geografischen Grund ausgehen kann, sondern die Topografie selbst verändert, insbesondere, wo sich Fragen des Landbesitzes mit historischen Ansprüchen verbinden. Legitimität erhält eine Tradition sehr oft durch eben das, was ihrer Effektivität entgegenwirkt. Um effektiv zu sein, muss eine Überlieferung sich von den besonderen historischen Umständen ihrer Legitimation lösen und ihre Anwendbarkeit auf neue zeitliche und räumliche Gegebenheiten unter Beweis stellen. In gewissem Sinn können solche Ressourcen überhaupt nur wirksam werden, wenn sie ihre historische oder textuelle Verankerung verlieren, und das bedeutet: Nur indem »Boden aufgegeben« wird, kann eine ethische Ressource der Vergangenheit zu erneuter Blüte gelangen und sich erneuern, und zwar inmitten übereinstimmender und konkurrierender ethischer Ansprüche im Rahmen eines Prozesses der kulturellen Übersetzung, mit dem zugleich soziale Bindungen und der geografische Raum selbst neu vermessen werden.
Ethik, Politik und die Aufgabe des Übersetzens
Die Wendung hin zum Übersetzen kann zweierlei Probleme mit sich bringen. Einerseits könnte man annehmen, Übersetzung sei eine Assimilation religiöser Bedeutungen an etablierte säkulare Bezugsrahmen. Auf der anderen Seite könnte die Annahme stehen, Übersetzung sei die Suche nach einer gemeinsamen Sprache über partikulare Diskurse hinaus. Wenn Übersetzung jedoch ein Schauplatz ist, an dem die Grenzen einer gegebenen Episteme sichtbar werden und an dem eine Episteme zur Neuartikulation ohne Neutralisierung des Anderssein gezwungen ist, dann haben wir ein Terrain betreten, auf dem weder von der Überlegenheit säkularer Diskurse noch von der Selbstgenügsamkeit partikularer religiöser Diskurse ausgegangen wird. Und wenn wir akzeptieren, dass der Säkularismus religiösen Quellen entstammt, von denen er sich nie ganz freimachen kann, scheint diese Art der Polarisierung der Debatte nicht mehr sinnvoll.
Meine eigenen Überlegungen zur Rolle der Übersetzung in der ethischen Begegnung stützen sich teilweise auf jüdische Quellen, die ich jedoch zu Zwecken der politischen Philosophie übernehme und umformuliere. Mein eigener Weg besitzt so einen doppelten Ausgangspunkt: erstens die jüdische Tradition und zweitens den Bruch mit einem kommunitaristischen Diskurs ohne zureichende Ressourcen für das Leben in einer Welt der sozialen Vielfalt und für die Schaffung einer Basis des Zusammenlebens über religiöse und kulturelle Unterschiede hinweg.
Als Versuch der Überwindung der scharfen Trennung von Ethik und Politik sollen die nachfolgenden Kapitel die wiederholte Überschneidung dieser beiden Sphären vor Augen führen. Sobald Ethik nicht mehr ausschließlich als Disposition oder Handlung eines fertigen Subjekts begriffen wird, sondern vielmehr als relationale Praxis in Erwiderung auf eine Pflicht, die ihren Ursprung außerhalb des Subjekts hat, stellt die Ethik Konzeptionen des souveränen Subjekts und der Selbstidentität infrage. Ethik bezeichnet dann eben jenen Akt, der denen Platz einräumt, die »nicht ich« sind und die mich damit über meinen Souveränitätsanspruch hinaustragen in Richtung einer Herausforderung meines Selbstseins von anderswoher. Die Frage, ob und wie dem anderen »Grund einzuräumen« ist, wird so zu einem zentralen Aspekt der ethischen Reflexion. Anders ausgedrückt führt diese Reflexion das Subjekt nicht auf sich selbst zurück, sondern ist vielmehr zu verstehen als ek-statische Bezüglichkeit, als ein Weg des Hinausgetragenwerdens über sich selbst, des der Souveränität und der Nation Enteignetwerdens im Zuge der Antwort auf Ansprüche von jenen, die man weder vollständig kennt noch sich vollständig ausgesucht hat. Aus dieser Konzeption der ethischen Beziehung ergibt sich eine Neukonzeption sowohl sozialer Bindungen wie politischer Pflichten, die uns über den Nationalismus hinausführt.
Ich schlage eine Neuausrichtung dieser wichtigen Ethikkonzeption vor. Der Anspruch des Anderen, um einen Augenblick auf Lévinas’ Terminologie zurückzugreifen, erreicht mich immer über die Sprache oder irgendein Medium. Soll dieser Anspruch wirksam werden, zu einer Antwort führen oder meinen Sinn für Verantwortung wecken, muss er im einen oder anderen Idiom »empfangen« werden. Es genügt nicht, diesen Anspruch als vorontologisch und damit als aller Sprache vorausgehend zu bezeichnen. Sinnvoller ist es zu sagen, dass der Anspruch von anderswo zu eben jener Struktur der Adressierung gehört, mit der die Sprache Menschen aneinander bindet. Wenn wir diese Deutung akzeptieren, müssen wir indes auch akzeptieren, dass die Struktur der Adressierung immer über »irgendeine« Sprache, ein Idiom oder beides gewusst und erfahren wird. Natürlich kann ein mögliches Subjekt innerhalb dieser Struktur auch verfehlt werden. Manchmal gibt es »einen«, der überhaupt nicht angesprochen wird oder der ganz an der Grenze dieser Struktur festgemacht wird, als Ausscheidung und Überrest der etablierten Formen der Interpellation. Man wird also auch nicht adressiert; um sich darüber beklagen zu können, muss man sich aber schon als adressierbar begreifen. Man könnte angesprochen werden, wenn einem nur die Formen der Adressierung zugewandt wären. Oder man stößt auf einen Begriff oder eine Beschreibung, die irgendwie »falsch« sind, findet sich aber wieder im Zwischenraum zwischen Richtigstellung und eigenem Gespür für das Falsche und hängt auf fatale Weise in der Luft.
Daher können wir auf vielfache Weise angesprochen oder falsch oder zu Unrecht angesprochen werden oder uns veranlasst sehen, in widersprüchlicher oder inkonsistenter Weise auf bestimmte Anrufe zu antworten, die an uns ergehen oder die unsere Umgebung festhält. Manche Anrufe sind auch von Rauschen begleitet, sodass wir nicht immer sicher sein können, was genau von uns verlangt wird oder was wir tun sollen. (Kafkas verschiedene nicht zugestellte Botschaften scheinen hier Lévinas in wichtiger Hinsicht zu widersprechen, ebenso wie Avital Ronells Überlegungen zu versäumten Anrufen.5)
Hier steht eindeutig das Gebot auf dem Spiel. Soll ich auf eine an mich ergehende ethische Forderung eingehen, muss ich die Sprache ausmachen können, in der sie formuliert ist und mich in ihrer Begrifflichkeit zurechtfinden. Es ist ganz und gar nicht sicher, ob ein Gebot auch von mir »empfangen« wird, wie wir aus Moses’ Geschichte wissen: Seine Gefolgsleute verlieren den Glauben an das Ergehen dieses Gebotes und Moses selbst zerschmettert die Gebote zunächst, bevor er sie seinem Volk überbringt. Wir kennen diese Geschichte in verschiedenen Fassungen und sie erreicht uns aus der Vergangenheit. Für Lévinas erreicht sie uns in jedem jetzigen Augenblick durch das »Antlitz«, das uns gebietet, nicht zu töten und das von keinerlei historischer oder textueller Vorgabe abhängt. Für Lévinas ist das kein Moment der Interpretation, obwohl wir wissen, dass wir darüber streiten können, was als Antlitz zählt und was nicht.6 Jedes Zeichen der Verletzbarkeit zählt als »Antlitz«. Wenn das ethische Gebot aus der Vergangenheit ergeht, als »Ressource« für mich in der Gegenwart – in Form der Botschaft eines alten Textes, als überlieferte Praxis, die die Gegenwart in irgendeiner Weise erhellt oder mich in der Gegenwart zu einem bestimmten Verhalten führen kann –, dann kann es nur »aufgenommen« oder »empfangen« werden, indem es ins Heutige »übertragen« wird. Rezeptivität ist immer eine Frage der Übersetzung, eine psychoanalytische Einsicht, auf der Jean Laplanche beharrt hat. Mit anderen Worten: Ohne Übersetzung kann ich keine Forderung und erst recht kein Gebot aus einem historischen Anderswo empfangen, und weil Übersetzungen verändern, was sie übertragen, verwandelt sich die »Botschaft« in der Übertragung von einem raumzeitlichen Horizont in den anderen. Nach Gadamer »verschmelzen« diese Horizonte in der Übersetzung,7 aber dem würde ich entgegenhalten, dass die Übersetzung in eben jener historischen Kontinuität, von der Gadamer und andere in der hermeneutischen Tradition ausgehen, eine Kluft aufreißt. Was geschieht, wenn Horizonte versagen oder wenn es gar keine Horizonte gibt? Selbst die Überlieferungen, die für Kontinuität zu sorgen scheinen, reproduzieren sich in der Zeit nicht, indem sie dieselben bleiben. Als wiederholbare sind sie Abweichungen und unvorhersehbaren Abfolgen unterworfen. Eine gewisse Unterbrechung oder Kluft ist Voraussetzung dafür, dass eine Tradition als neu wieder in Erscheinung treten kann. Das Idiom der Übermittlung einer Forderung ist nicht dasselbe, in dem sie aufgenommen wird, insbesondere nicht, wenn die Forderung zeitlich-topografische Grenzen überquert. Etwas geht auf dem Weg ins Hier und Jetzt verloren und anderes kommt durch die Form der Übermittlung des sogenannten »Gehalts« der Botschaft hinzu. Die Kontinuität erleidet einen Bruch, was bedeutet, dass die Vergangenheit nicht auf die Gegenwart »angewendet« wird und aus ihren Reisen nicht intakt hervorgeht. Was sich in der Gegenwart als lebendig erweist, ist der teilweise Niedergang des Gewesenen.
Wenn wir nun darüber nachdenken, was das für uns heute bedeuten könnte, wird uns recht bald klar, dass wir gar nicht genau wissen, wen wir mit diesem »wir« meinen oder wie wir die Zeitlichkeit, in der wir leben, am besten denken sollen. Diese Desorientierung ist aber gar nichts Beklagenswertes, sie ist vielmehr Voraussetzung jedes neuen Nachdenkens über Territorium, Besitz, Souveränität und Kohabitation. Wenn die Ressourcen einer Religion vielfältig und unterschiedlich sind, können an uns schließlich auf der Basis unterschiedlicher Traditionsstränge mehrere Arten von »Forderungen« ergehen, und das erklärt auch die offene Debatte über die Schrift, talmudische Haltungen und hermeneutische Differenzen in der Auslegung des Koran. Das ist auch der Grund, weshalb Lévinas’sche Gebote – entgegen Lévinas’ eigenen Behauptungen – der Forderung nach Interpretation oder Übersetzung nicht vorhergehen und sie nicht zunichte machen können. Wie wir wissen, ist die Hermeneutik nicht nur die Wissenschaft von der besten Auslegung religiöser Texte, sondern betrifft auch die Frage, wie wir diese Texte in unserer eigenen Gegenwart lesen sollen und wie wir am besten die zeitlichen und geografischen Grenzen überwinden, die ihre Entstehung und ihre heutige Anwendbarkeit kennzeichnen.8
Gegenüber der Überzeugung von der Kontinuität »des Wortes« über die Zeit und der Übersetzung als bloßer Vermittlung dieser Kontinuität müssen wir zu jener Kluft zurückkehren, die Übertragung erst möglich macht, und uns die Frage stellen, was es für eine ethische Haltung der Vergangenheit bedeuten könnte, in ein Übertragungsfeld mit Ressourcen aus ganz anderen und in sich komplexen Traditionen einzutreten. Und dabei habe ich nicht nur die (nach wie vor wichtigen) unterschiedlichen Stränge innerhalb der jüdischen Überlieferung im Auge, sondern auch Wege, auf denen jüdische Ressourcen in nicht-jüdischen Diskursen aufgenommen und ausgearbeitet werden; darüber hinaus geht es mir um die Frage, weshalb diese ganz bestimmte Form der sprachlichen Grenzüberschreitung tatsächlich von zentraler Bedeutung dafür ist, was jüdische Ressourcen überhaupt sind und sein können. Erst in einem Feld kultureller Übersetzung werden partikulare ethische Ressourcen verallgemeinerbar und wirksam. Diese Behauptung ist nicht nur beschreibender Art: Religiöse Überlieferungen gedeihen nur im Kontakt mit anderen religiösen und nicht-religiösen Einrichtungen, Diskursen und Werten. Dieser Kontakt stellt auch an sich schon einen Wert dar. Erst durch die Dislozierung und Übertragung aus einer raumzeitlichen Konfiguration in die andere kommt eine Tradition in Kontakt mit der Alterität, mit der Sphäre des »nicht ich«. Von Lévinas übernehme ich die These, wonach es diese Berührung mit der Alterität ist, die dem ethischen Schauplatz, der mich in die Pflicht nehmenden Beziehung zum Anderen, Leben einhaucht. So wird die Kluft in der Übertragung zur Voraussetzung des Kontakts mit dem, was außer mir ist, Träger einer ek-statischen Bezüglichkeit und Schauplatz der Begegnung von Sprachen, und so kann sich etwas ganz Neues ereignen.
Um zu klären, wie in die Tradition eingebundene ethische Gebote für uns gegenwärtig werden, verfolgen wir gern den räumlichen und zeitlichen Weg einer Überlieferung zurück. Dient jedoch die Übersetzung als Träger dieser Übertragung aus der Sprache, in der das Gebot formuliert wurde, in die Sprache, in der es empfangen wird, müssen wir sowohl Sprache wie Zeitlichkeit anders denken. Wenn ein Gebot mich nicht unmittelbar aus meinem eigenen Idiom, sondern von anderswoher erreicht, wird mein eigenes Idiom von ihm unterbrochen, und das bedeutet, dass Ethik an sich schon eine gewisse Abweichung vom mir vertrauten Diskurs verlangt. Geht zudem mit dieser Unterbrechung eine Aufforderung zur Übersetzung einher, kann Übersetzung nicht einfach die Anpassung des Fremden ans Vertraute sein; vielmehr muss sie eine Öffnung zum Unvertrauten sein, eine Enteignung bisherigen Grundes, ja die Bereitschaft, Grund aufzugeben zugunsten dessen, was im Rahmen der etablierten epistemologischen Felder nicht direkt erfassbar ist. Diese Grenzen des Wissbaren werden aber von Machtregimes festgelegt, sodass wir in der ethischen Reaktion auf einen Anspruch, der sich nicht in einen bereits abgesegneten Bezugsrahmen einfügen lässt, zugleich in eine kritische Auseinandersetzung mit der Macht eintreten. Daher kann Spivak sagen: »Übersetzung ist ein Feld der Macht.«9 Oder, wie Talal Asad zur Praxis der kulturellen Übersetzung bemerkt: Sie »ist immer schon in Machtbedingungen verstrickt«.10
Nur im Durchgang durch nicht festgelegte, nicht autorisierte Modi des Wissens erscheint etwas wie Ethik in der Matrix der Macht. Und das heißt, dass Traditionen ihre Kontinuität und ihren festen Grund aufgeben, wenn sie auf Ansprüche eingehen, die aus widersprüchlichen diskursiven Feldern stammen, die die Angemessenheit überkommener epistemologischer Bezugsrahmen infrage stellen. Übersetzung in diesem Sinne führt denn auch an die epistemischen Grenzen jedes gegebenen Diskurses, indem sie den Diskurs in eine Krisis hineinzieht, aus der er sich durch keine Strategie der Assimilation und Einhegung der Differenz befreien kann.
Wenn wir verstehen, wie wir zu bestimmten Geboten oder Verboten erst in Übersetzung Zugang gewinnen, erfolgt dieser Zugang für uns nicht durch eine historische Rückkehr zu Zeit und Ort des Originals, eine Rückkehr, die ohnehin unmöglich wäre. Wir können uns nur an das halten, was uns die Übersetzung zur Verfügung stellt, was sie hervorbringt und in unserer Gegenwart beleuchtet. So ist der Verlust des Originals Bedingung dafür, dass eine bestimmte »Forderung« in der Übermittlung durch Sprache und Zeit überlebt. Was hier überlebt, ist also zugleich zerstört und lebendig. Die destruktive und die erhellende Dimension der Übersetzung werden dann zum eigentlich noch Lebendigen, zu dem, was noch leuchtet; das bedeutet, die Übersetzung ist die religiöse Ressource mit Bezug zu unserer Gegenwart. Akademisch betrachtet könnte man sagen, die Lévinas’sche Forderung lässt sich nur mithilfe von Benjamins Übersetzungstheorie verstehen; darauf werde ich im Folgenden noch zurückkommen. Die Übertragung macht die Forderung gegebenenfalls erst verfügbar. Das bedeutet aber auch, dass die Forderung unter Umständen unlesbar bleibt; möglicherweise erreicht sie uns – wenn sie uns überhaupt erreicht – nur in Bruchstücken und ist nur in Teilen erkennbar.
Wenn der Prozess der Übersetzung rückwirkend religiöse Ressourcen für das ethische Denken definiert, bedeutet die Ableitung alternativer politischer Vorstellungsmöglichkeiten aus diesen Ressourcen deren Erneuerung oder vielmehr ihre Streuung und Verwandlung. In diesem Sinn lässt sich vielleicht in Derridas »dissémination« ein Wiedergänger der messianischen Zerstreuung erkennen.11 Möglicherweise erklärt so betrachtet ein religiöser Begriff, der in einen textuellen Sinn (den er natürlich immer schon mit sich führte) übertragen wird, der jede Rückkehr zu hypothetischen Ursprüngen infrage stellt und implizit für eine kabbalistische Zerstreuung göttlichen Lichtes steht, Derridas eigene Bewegung von der Dissemination im Frühwerk zum Messianischen in den späteren Schriften. Es wäre falsch zu sagen, Derrida sei unvermittelt religiös geworden oder bestimmte Begriffe wie das Messianische und die Messianizität seien in seinem Werk auf verdeckte Weise religiös geblieben. Schließlich ist die Schrift Schauplatz dieser Transposition und Dislozierung; sie beinhaltet nicht einfach den Gedanken der »Zerstreuung«, sondern zerstreut vielmehr eben diesen Gedanken.
In jüngeren Debatten wird gern die Frage aufgeworfen, wie sich religiöse Diskurse in öffentliche Diskurse und in demokratische Partizipation und Reflexion übertragen lassen, wobei man davon ausgeht, dass der religiöse Diskurs in der Übertragung zugunsten des öffentlich-demokratischen ausgeschaltet wird. Die Annahme ist die, dass Religion eine Form von Partikularismus, Tribalismus oder Kommunitarismus ist und der »Übersetzung« in eine normale oder rationale Sprache bedarf, um im öffentlichen Leben einen legitimen, beschränkten Platz einnehmen zu können. In diesen Debatten wird meist vorausgesetzt, dass es eine gemeinsame öffentliche Sprache oder eine säkulare Form der Vernunft gibt, die nicht selbst religiös sind, aber als Vermittler religiöser Ansprüche dienen können und müssen. Andernfalls drohe Religion zur Basis des öffentlichen Diskurses und der politischen Partizipation und zur Legitimationsbasis des Staates selbst zu werden. Auffassungen dieser Art wurden von Talal Asad und Saba Mahmood in ihren umfangreichen Arbeiten zum Islam, von Charles Taylor in seinen Studien zum Christentum und von vielen anderen infrage gestellt, für die Religion nicht durch Säkularismus überwunden wird, sondern ganz im Gegenteil gerade durch die Bedingungen des Säkularismus zur Hegemonie gelangt. Für diese Autoren ist der Säkularismus entweder selbst Produkt der Religion und von religiösen Werten durchdrungen (Pellegrini, Jakobsen) oder die Trennung von Säkularem und Religiösem ist ihrerseits ein Instrument zur Aufrechterhaltung der Hegemonie des Christentums (Mahmood, Hirschkind) und zur Auslöschung des Islam.
Der Fall Israel macht solche Debatten in der Regel komplizierter, da er die Frage des »Jüdischseins« im religiösen und nicht-religiösen Sinn aufwirft, eine Frage, die mit einer weiteren verknüpft ist, nämlich mit der Frage, ob der Status des Staates Israel als jüdischer Staat letzten Endes ein religiöser ist. Manche Liberale argumentieren, dass Israel ein jüdischer Staat ist und entweder (wegen der Ausnahmeumstände des Nazi-Völkermords an den Juden) als Ausnahme vom liberalen Postulat der notwendigen Säkularität des Staates betrachtet werden muss oder aber, so paradox das klingen mag, als liberale Demokratie nur für Juden zu verteidigen ist,12 und das trotz des israelischen Staatsbürgerrechts, das den Juden innerhalb der Staatsgrenzen umfangreichste Vorrechte einräumt und die Rückkehr von Juden aus der Diaspora nach Palästina fördert, während den Palästinensern das Recht auf Rückkehr in Gebiete verwehrt wird, die 1948 und später immer wieder gewaltsam enteignet wurden. Linksgerichtete Zionisten beklagen den Aufstieg der religiösen Rechten in Israel und begreifen sich selbst als säkulare Alternative. Was heißt aber »säkular« im Kontext eines jüdischen Staates? Wir könnten argumentieren, »jüdisch« bedeute nicht die Zugehörigkeit zum religiösen Judentum. Aus diesem Grund schrieb Hannah Arendt ganz bewusst über das »Judentum« als kulturelle, historische und politische Kategorie, die die geschichtliche Lage von Bevölkerungsgruppen kennzeichnet, die ihre Religion praktizieren oder auch nicht und die sich explizit mit dem Judentum identifizieren oder auch nicht.13 Für Arendt ist der Begriff des Judentums ein Versuch, eine Vielzahl gesellschaftlicher Identifikationen zusammenzuhalten, ohne diese miteinander in Einklang bringen zu können. Es gibt nicht die eine Definition und es kann sie nicht geben. Arendts Position wäre zureichend, wäre sie nicht so durch und durch europäisch geprägt: Das »Judentum« schließt hier tendenziell die Mizrahim mit ihren kulturellen Ursprüngen im arabischen Raum14 ebenso aus wie die Sephardim, deren Vertreibung aus Spanien (seinerseits schon Schwellengebiet des europäischen Imaginären) zu komplexen kulturellen Verwebungen mit anderen Traditionen führte (z.B. griechischen, türkischen und nordafrikanischen). Gilt der Begriff »jüdisch« schon als säkularer Begriff, ist Israel kein religiöser Staat, sondern muss sich gegen religiöse Extremisten verteidigen. Kann das Jüdischsein überhaupt je vollständig von seinen religiösen Hintergründen gelöst werden, oder ist seine säkulare Form Resultat oder Effekt einer ganz bestimmten religiösen Geschichte? Oder ist es dem Religiösen – in diesem Fall also dem Jüdischen – wesentlich, sich permanent von seiner religiösen Geschichte zu lösen?
Ich stelle diese Fragen, ohne mir einer Antwort sicher zu sein, ja ohne auch nur zu wissen, ob ich die Antworten kennen muss, um dieses Buch weiterzuführen. Schließlich schreibe ich kein Buch über Religionsgeschichte oder auch Religionsphilosophie. Vielmehr versuche ich zu verstehen, inwiefern das Exil – oder emphatischer die Diaspora – zur Idee des Jüdischen selbst gehört (nicht analytisch, sondern historisch, das heißt im Zeitverlauf). In diesem Sinne heißt Jude »sein« sich von sich selbst zu trennen, hineingeworfen sein in eine Welt der Nicht-Juden, in der man ethisch und politisch seinen Weg inmitten einer unumkehrbaren Heterogenität finden muss. Die Idee des Exils oder der Galuth charakterisiert in der jüdischen Kultur eine Bevölkerungsgruppe, die einen Ort verloren hat und nicht an einen anderen heimkehren konnte. Die Idee der »Rückkehr« bleibt dem Exil in seiner Verbindung mit Zion und dem Zionismus inhärent. Innerhalb des zionistischen Diskurses gilt die Galuth daher als Fall, der nur durch Rückkehr in die Heimat behoben oder wiedergutgemacht werden kann. Die Diaspora hingegen bezeichnet eine Bevölkerung und sogar eine »Macht«, die von der Kohabitation mit den Nicht-Juden abhängt und die zionistische Verknüpfung von Volk und Land vermeidet.15 Diese Unterscheidung verläuft ganz anders, wenn man sie auf die Palästinenser von 1948 oder auch auf all jene anwendet, die im historischen Palästina gewaltsam ihres Landes enteignet wurden. Jüdische Bevölkerungsgruppen wurden unter dem Naziregime, soweit sie nicht zerstört wurden, ihrer Heimat und ihres Landes beraubt, aber sie wurden nicht Palästinas beraubt. Die Vorstellung, eine gewaltsame Enteignung anderer könne rechtmäßig die eigene Enteignung kompensieren, kann für sich keinerlei legitime ethische oder rechtliche Begründung in Anspruch nehmen. Wird indes das jüdische Rückkehrrecht als biblisch verstanden, müssen wir uns in jedem Fall gegen die Inanspruchnahme der Religion zur Rechtfertigung international geächteter Verbrechen der Enteignung und Vertreibung der Palästinenser zur Wehr setzen. Gewiss muss man sehr sorgfältig über das Rückkehrrecht (der Palästinenser) im Verhältnis zum Rückkehrergesetz (der Israelis) nachdenken, ganz besonders, wenn die Wiedergutmachung des einen Exils durch die Verhängung eines anderen das begangene Verbrechen eindeutig nicht wiedergutmacht, sondern wiederholt.
Ich hoffe zeigen zu können, inwiefern die Rückwendung des Diaspora-Gedankens auf Palästina und die Einsicht, dass dieser Gedanke dort schon auf vielfache Weise in Verwendung ist, uns bei einem neuen Nachdenken über Kohabitation, Binationalismus und die Kritik der Gewalt behilflich sein kann. Ich folge Edward Saids wichtigen Überlegungen in Freud und das Nichteuropäische und versuche mir vorzustellen, was geschähe, wenn zwei »Traditionen« der Dislozierung zusammenliefen und eine post-nationale Politik hervorbrächten, die auf dem Anspruch des Flüchtlings auf Schutz vor illegitimer juristischer und militärischer Gewalt basiert. Um diesen Ansatz Saids zu durchdenken, müssten wir die Bedingungen für die Übersetzung einer Form der Dislozierung in die andere festlegen, und wir müssten uns der Grenzen der Übersetzbarkeit vergewissern. Die unterschiedlichen kulturellen Ausprägungen von Exil und Diaspora werden für eine solche Übersetzung von großer Bedeutung sein.16
Said selbst vertrat zwar säkulare Ideale, aber er verstand doch, wie Geschichten konvergieren und Formen des Exils sich ähneln und zu einem neuen Ethos und zu einer neuen Politik in der Region führen können. Wie man sich das vorstellen kann, wird Thema im letzten Kapitel dieses Buches sein. Für Said ist das eine unmögliche, aber nichtsdestoweniger unausweichliche Aufgabe. Einen anderen Ansatz vertritt Étienne Balibar, der die Übersetzungspraxis mit einer Verteidigung des Säkularismus und dem politischen Versprechen der Diaspora verknüpft. Balibar schreibt: »Übersetzungsprozesse können sich in religiösen Universen abspielen, aber diese Übersetzungen beinhalten eben, dass diese Universen keine rein religiösen sind. Das ›Religiöse‹ als solches ist unübersetzbar.«17 Wir haben Grund zu fragen, weshalb das so sein muss.18 Übersetzung betrifft immer das, was zurückbleibt und was übertragen wird. Irgendetwas bleibt gewiss immer unübertragen, aber das trifft auch für eine Übersetzung Kafkas aus dem Deutschen oder Lispectors aus dem Portugiesischen und im Übrigen auch auf alle Übersetzungen im Rahmen der Vereinten Nationen zu. Gibt es überhaupt irgendeine Übersetzung, die nicht vom Unübersetzbaren abhängt? Wäre dem nicht so, dann wären alle Übersetzungen vollkommen, das heißt, jedes Element eines ersten Textes fände seine adäquate Entsprechung in einem zweiten. Ich denke, diese Vorstellung der vollständigen Übersetzbarkeit war eben jenen religiösen Traditionen eigen, die das Neue Testament vollkommen, das heißt ohne Rest in alle möglichen Sprachen übersetzen wollten. Soll das vermeintliche Wort Gottes und sollen göttliche Ge- und Verbote generell fehlerfrei und vollständig übermittelt werden, muss tatsächlich von der Möglichkeit einer vollkommenen und transparenten Übersetzung ausgegangen werden. Dennoch bezeichnet Balibar Religion als das »Unübersetzbare« und nimmt damit an, dass sie ihren religiösen Charakter durch die Übersetzung einbüßt; die Übersetzung nimmt somit jedem Anspruch und jeder Behauptung das religiöse Element.19 Besitzt Übersetzung jedoch eine theologische Geschichte – verschwindet diese dann einfach, sobald die Übersetzung als neutrale Vermittlerin religiöser Auffassungen ins Spiel kommt? Und wenn Übersetzung selbst ein religiöser Wert wäre, wie Benjamin in seinem Frühwerk nahelegt?20 Wie sollen wir die Lage dann beschreiben? Hat die Übersetzung ihre religiöse Herkunft vollständig überwunden? Oder stellt sie uns nur in anderer Terminologie erneut vor das Problem der religiösen Bedeutung? Die Übersetzung macht Heteronomie zum konstitutiven Risiko jeder religiösen »Übertragung«. In diesem Sinn »disseminiert« sie das Original, sie setzt es dem Nichtreligiösen und Profanen aus und zerstreut es gleichsam in einer Heteronomie von Werten. So betrachtet bewegt sich die Übersetzung inmitten von Ruinen und entzündet hier und dort die Vergangenheit.
Balibar kommt auf den Übersetzungsprozess zurück und verbindet ihn mit der Diaspora, um zur Artikulation transnationaler Formen der Staatsbürgerschaft zu gelangen. Er schreibt: »[W]as Bedingung eines effektiven Multikulturalismus zu sein scheint … ist zugleich eng verbunden mit kulturübergreifenden Prozessen der Hybridisierung und multiplen Affiliationen, die ›diasporischen‹ Individuen und Gruppen das Leben erschweren – da solche Prozesse mit der Melancholie des Exils einhergehen –, jedoch die materielle Voraussetzung für Übersetzungsprozesse zwischen weit auseinanderliegenden kulturellen Universen bilden.«21 Wollen wir aber den Moment der Übersetzung nicht als rein säkularen heiligen (und der Säkularismus hat seine eigenen Formen der Selbstheiligung), folgt daraus, dass religiöse Bedeutungen in der Übersetzung fortgeschrieben, disseminiert und verwandelt werden. Weder verlassen wir die religiöse Sphäre zugunsten einer nichtreligiösen noch verharren wir in einem selbstreferenziellen religiösen Universum. Das Religiöse wird in diesem Prozess in etwas anderes verwandelt und nicht transzendiert. Diese Verwandlung blockiert zugleich die Rückkehr zu einem ursprünglichen Sinn; das heißt, das Religiöse wird überall verstreut und signifiziert nur im Kontext einer diasporischen, postnationalen und nicht-identitären Bewegung, einer affirmativen Unreinheit.
Einerseits beschreibe ich hier eine anti-hegemonistische Bewegungsrichtung der Übersetzung. Der eine Diskurs wird vom anderen unterbrochen und hört auf, hegemonialer Grund zu sein, um Platz zu schaffen für das, was seine eigene Intelligibilität infrage stellt. Die Übersetzung wird zur Voraussetzung einer transformativen Begegnung, sie eröffnet einen Raum für Alterität inmitten der Übertragung. Auf der anderen Seite prüfe ich Möglichkeiten einer Ethik, die bei den Bedingungen des Empfangs von Botschaften oder Ge- und Verboten aus einer anderen diskursiven Sphäre ansetzen, die sich nicht so einfach in die eigene hinein assimilieren lässt. Gebote wie »Du sollst nicht töten« oder sogar »Liebe deinen Nächsten« lassen sich also überhaupt nur verstehen und annehmen, wenn sie in die konkreten Umstände übertragen werden, in denen man lebt, in die unmittelbaren Gegebenheiten, die historisch und geografisch aufgeladen sind, in die Schauplätze der Gewalt, die das tägliche Leben mitprägen. In diesem Sinn gibt es ohne Übersetzung keine ethische Antwort auf den Anspruch, den jeder andere an uns hat; andernfalls wären wir ethisch nur an die gebunden, die schon so sprechen wie wir, in der Sprache, die wir schon kennen. Betrachten wir also den Bezug zum Nicht-Juden und zum Nicht-Jüdischen als ethische Verpflichtung und Forderung des Judentums, wird aus der hier beschriebenen historischen Bewegungsrichtung der Übersetzung zugleich die ethische Bewegung der Reaktion auf die Ansprüche jener, die nicht vollständig als Teil der »Nation« anerkennbar sind und deren ethische Stellung mit einer Verschiebung der Nation als alleinigem Bezugsrahmen ethischer Beziehungen einhergeht. Aus dieser Verschiebung ergibt sich die kollektive Bemühung um eine politische Ordnung nach Grundsätzen der Gleichheit und Gerechtigkeit für sämtliche Bevölkerungsgruppen der Region. So gesehen lässt sich durchaus von einem jüdischen Weg zu einer bestimmten Vorstellung sozialer Gerechtigkeit und demokratischer Politik sprechen, denn Gleichheit und Gerechtigkeit gälten hier für alle, ungeachtet ihrer Religion, ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität und Herkunft. Es mag paradox klingen zu sagen, es gebe einen jüdischen Weg zur Einsicht, dass Gleichheit für eine Bevölkerung als ganze unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit garantiert werden muss, aber genau das ist die Konsequenz einer Universalisierung, die eine aktive Spur in diese Richtung ebenso mobilisiert wie den Bruch mit der Ordnung, von der diese Bewegung ausging.
Jenseits unhaltbarer Formen des Binationalismus
Natürlich gibt es innerhalb eines erklärt säkularen Rahmens gute Argumente gegen den politischen Zionismus und für eine Politik der Gleichberechtigung von Palästinensern und Juden im historischen Palästina, Argumente gegen rassistische Formen des Staatsbürgerrechts innerhalb Israels, für die Umkehr jahrzehntelanger Landenteignungen und kolonialer Besiedelung durch den israelischen Staat, für die Selbstbestimmung der Palästinenser und gegen den brutalen Einsatz von Polizei und Militär zum Schutz illegaler Besatzung und dagegen, dass einer ganzen Bevölkerungsgruppe international anerkannte Rechte vorenthalten werden.22 Der große Vorteil dieser Argumente liegt darin, dass sie eine Sprache sprechen, die als universell gilt und dass sie das Recht zum Widerstand gegen koloniale Unterdrückung einfordern, das allen Bevölkerungsgruppen zukommt, denen effektive Selbstverwaltung, Bewegungsfreiheit und Staatsbürgerrechte vorenthalten werden. Solche Argumente sind wirkungsvoll, und ich werde einige von ihnen hier entwickeln. Abweichend von dieser wichtigen säkularen Tradition bin ich aber der Auffassung, dass man zu diesen Grundsätzen von verschiedenen Voraussetzungen her kommen kann und dass unsere Voraussetzungen nicht notwendig entfallen, wenn man zu Einsichten wie folgender gelangt: Nur durch ein Ende des politischen Zionismus, der den Staat Israel beharrlich auf Prinzipien jüdischer Souveränität gründet, können umfassendere Gerechtigkeitsgrundsätze für die Region umgesetzt werden. Die Frage des kulturellen Zionismus bleibt davon unberührt; er ist nicht notwendig mit der Verteidigung einer bestimmten Staatsform verbunden und betont hier und da auch den Unterschied zwischen Israel als Nation und Eretz Yisrael als Land. Tatsächlich konnte in den frühen zionistischen Debatten der 1920er und 1930er Jahre infrage gestellt werden, ob der Zionismus überhaupt territoriale Ansprüche impliziert. Ich schreibe hier weder vom Standpunkt des kulturellen noch des politischen Zionismus, bin aber überzeugt, dass die Geschichte dieser Unterscheidung verdeutlicht, dass solche Begriffe historische Umkehrungen und Verwandlungen durchlaufen, die wir heute effektiv aus dem Blick verloren haben.
In den Vereinigten Staaten bedeutet die Frage: »Sind Sie Zionist?« meistens: »Glauben Sie an das Existenzrecht Israels?« Diese Frage setzt immer schon voraus, dass sich aus der bestehenden Form des Staates legitime Gründe für dessen eigene Existenz ergeben. Argumentiert man indes, dass möglicherweise weder die derzeitigen Gründe seiner Existenz noch die derzeitige Form des Staates legitim sind, gilt das als genozidale Position. So wird jede politische Diskussion über die legitimen Existenzgründe eines Staates in dieser Region sofort zum Schweigen gebracht, weil die Frage nach der Legitimität (ohne noch zu wissen, wie sie schließlich beantwortet wird) nicht als wesentliches Reflexionsmoment demokratischer Politik anerkannt wird, sondern vielmehr als verdeckter Wunsch gilt, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgelöscht zu sehen. Ganz offensichtlich ist unter solchen Bedingungen keine vernünftige Diskussion über Legitimität möglich. Da ferner Zionismus inzwischen gleichbedeutend ist mit jüdischen Souveränitätsansprüchen auf vormals palästinensisches Land, mag die Frage besser lauten: »Welche Politik könnte als legitim für ein Gebiet betrachtet werden, das derzeit von jüdischen und palästinensischen Israelis sowie von Palästinensern unter Besatzung bewohnt wird und nicht mehr von Hunderttausenden Palästinensern, die ihres Landes durch systematische und fortgesetzte Enteignung im Zuge eines anhaltenden Siedlerkolonialismus beraubt wurden?« Fragt man, welche Art Politik allen diesen Ansprüchen gerecht zu werden sucht, ist man offensichtlich kein Zionist mehr im heutigen Sinn dieses Begriffs. Vergessen sind in diesem Szenario nicht nur die verschiedenen Formen des Zionismus, die Gebietsansprüche abgelehnt haben, sondern auch die frühen Bemühungen um die föderative Verwaltung eines binationalen Staates. Die Befürwortung eines binationalen Staates gilt inzwischen als antizionistisch, was aber nicht immer so war. In Anbetracht der heutigen Formen des Zionismus bin ich jedenfalls der Auffassung, dass man nicht Zionist sein und zugleich für ein gerechtes Ende der kolonialen Unterdrückung kämpfen kann. Sogar die sozialistischen Experimente der Kibbuz-Bewegung waren integraler Teil des Siedlerkolonialismus, was bedeutet, dass Sozialismus in Israel als vereinbar mit kolonialer Unterdrückung und Expansion galt.
Natürlich sind viele Menschen mit jüdischem Hintergrund zu antizionistischen Positionen und zu dem Schluss gelangt, dass sie deshalb auch nicht länger Juden sein können. Mein Eindruck ist, dass der Staat Israel sie zu diesem Schluss beglückwünschen würde. Führt die Opposition gegen die derzeitige Politik Israels und allgemeiner gegen den Zionismus zu dem Schluss, dass man sich nicht länger als Jude begreifen will, bedeutet das effektiv eine Bestätigung der Auffassung, Jude zu sein heiße Zionist zu sein, eine historische Gleichsetzung, die man ablehnen muss, wenn man das Jüdischsein nach wie vor mit dem Kampf um soziale Gerechtigkeit verknüpft sehen will. Wieder andere Menschen mit jüdischem Hintergrund verstummen angesichts der derzeitigen Politik Israels. Oft verabscheuen sie die Besatzung und sind empört über israelische Militärschläge gegen Zivilisten in Gaza; manchmal wünschen sie sich auch Formen des binationalen Zusammenlebens, die gerechtere und lebensfähigere, weniger gewaltsame politische Strukturen für die Region ermöglichen könnten. Sie fürchten jedoch, mit dieser Kritik den Antisemitismus anzuheizen und sind der Meinung, öffentliche Kritik sei inakzeptabel, wenn sie für den Antisemitismus und für Verbrechen gegen Juden instrumentalisiert werden kann. Tatsächlich prägt dieser Doublebind inzwischen beinahe konstitutiv viele Juden in der Diaspora.
Was bedeutet diese Unfähigkeit, sich laut und deutlich für jene Prinzipien einzusetzen, die für die Befreiung des jüdischen Volkes selbst so wichtig waren? Im Folgenden werde ich mich mit dieser ausweglosen Stummheit beschäftigen, die im öffentlichen Diskurs sowohl Primo Levis wie Hannah Arendts zu beobachten ist, und ich werde die Frage stellen, welche Folgen sie für die heutige Kritik hat, welche selbst auferlegten Grenzen und welche Risiken sie mit sich bringt. Denn wenn wir hinnehmen, dass jede Israelkritik faktisch antisemitisch ist, zementieren wir nur jedes Mal, wenn wir uns Schweigen verordnen, die Gleichsetzung von Israelkritik und Antisemitismus. Wehren kann man sich dagegen nur, indem man deutlich und immer wieder mit starkem kollektivem Rückhalt zeigt, dass die Kritik an Israel gerecht ist und dass sämtliche Formen des Antisemitismus und sonstiger Rassismen absolut unannehmbar sind. Nur wenn diese Doppelposition im öffentlichen Diskurs deutlich wird, wird auch eine nicht-zionistische jüdische Linke »fassbar«, das heißt eine jüdische/nicht-jüdische Linke, die als »Partner für den Frieden« infrage kommen könnte.
Meine Position sollte klar sein, aber es ist mir auch wichtig, dass ich zu diesen bestimmten Werten und Prinzipien über meinen eigenen Hintergrund gelange, insbesondere über Prägungen meiner Schulzeit und frühen Kindheit in jüdischen Gemeinschaften und über das Engagement in Bildungsprogrammen meiner Synagoge, das mich zum Philosophiestudium geführt hat. Ich denke, manche Werte, die sich in der Prägung meiner Kindheit und Jugend herausgebildet haben, finden sich heute in meinem ethischen und politischen Widerstand gegen den Zionismus wieder. Natürlich habe auch ich eine ganz persönliche Geschichte, wahrscheinlich mehrere, aber ich komme an dieser Stelle auf Autobiografisches nicht zu sprechen, um diese bestimmte Geschichte zu verfolgen (das werde ich vielleicht an anderer Stelle tun und dabei auch Auskunft geben über die Verluste meiner Familie unter der Naziherrschaft und über die Art und Weise, wie dieser Hintergrund meine Arbeit über Geschlechterzugehörigkeiten und sogar mein Verständnis von Fotografie und Film beeinflusst hat). Hier möchte ich jedoch Folgendes betonen: (a) Ein bestimmtes Verständnis der jüdischen Werte der Diaspora ist entscheidend für die Formulierung einer Kritik des Nationalismus und des Militarismus. (b) Der ethische Bezug zum Nicht-Juden war und bleibt Teil eines antiseparatistischen und nicht-identitären Denkens ethischer Bezüglichkeit, demokratischer Pluralität und globaler Koexistenz. (c) Widerstand gegen den illegitimen Einsatz juristischer und staatlicher Gewalt (die zugleich auch wirtschaftliche Ausbeutung und Verarmung fördert) gehört zur Geschichte jener radikal demokratischen sozialen Bewegungen, an denen Juden ganz zentral beteiligt waren, Juden, die sich gegen mutwillige Zerstörungen unter Bevölkerungsgruppen durch Staaten mit dem Ziel der Aufrechterhaltung hegemonialer oder totalitärer Kontrolle und gegen rechtlich sanktionierte Formen des Rassismus sowie gegen alle Formen kolonialer Unterdrückung und Gebietsenteignung gewandt haben. Zudem waren (d) die Lebensumstände der Staatenlosen und Flüchtlinge entscheidend für mein Verständnis der Menschenrechte und der Kritik am Nationalstaat, an Internierung und Einkerkerung, an der Folter und ihrer Rechtfertigung durch Gesetz oder Politik. All dies führte mich mit vielen Jahren Verzögerung zum Werk von Hannah Arendt, deren Kritik am Nationalstaat und am Zionismus eine entscheidende Verbindung herstellt zwischen der Vertreibung der Juden aus Europa und der Gerechtigkeit der Ansprüche all jener – eingeschlossen die Palästinenser –, die ihres Heims, ihres Landes und ihrer politischen Selbstbestimmungsrechte beraubt wurden. Und schließlich (e) betonen die Trauerformen der jüdischen Tradition (das Schiwa-Sitzen und das Sprechen des Kaddisch