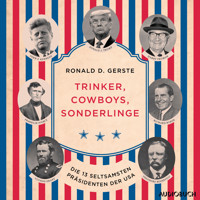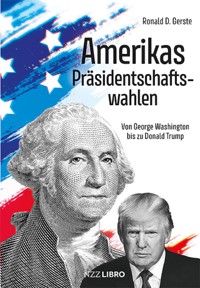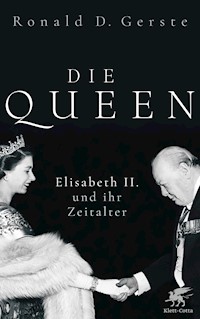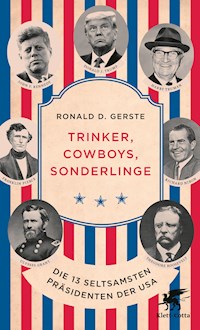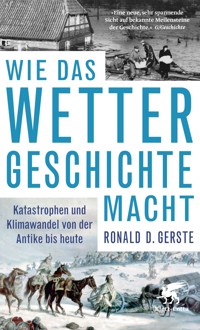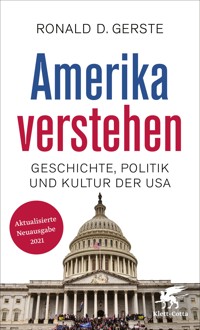
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die USA am Scheideweg – wie angeschlagen ist die Weltmacht nach vier Jahren Trump, was macht sie dennoch stark und gleichzeitig so gespalten? Amerika nach Trump – die vermeintliche Schutzmacht westlicher Demokratien scheint uns Europäern zunehmend fremd zu werden. Der Amerika-Experte Ronald D. Gerste beschreibt die vielfältigen Facetten eines mächtigen, verunsicherten – und manchmal beängstigenden – Landes. Eine kompakte Reise durch Kultur und Geschichte einer Nation, die niemanden gleichgültig lässt. Es waren Bilder, die man nach mehr als 70 Jahren transatlantischer Partnerschaft nicht für möglich gehalten hätte: das Capitol in Washington, Symbol der amerikanischen Demokratie, welche Europa über die Jahrzehnte des Kalten Krieges beschützt hatte, wurde von einem wütenden Mob gestürmt. Viele trugen das Sternenbanner - und traten die Werte, für welche die Fahne steht, mit Füßen. Inspiriert hatte die Menge ein Präsident, der den Ausgang einer Wahl, seine Niederlage, verleugnet hatte - der dramatische und für viele Beobachter abstoßende Höhepunkt einer vierjährigen Amtszeit voller Unwahrheiten und Hasstiraden. Nicht erst mit Trump, aber durch ihn ganz besonders ist die Schutzmacht USA für viele Europäer fremd geworden. Deutsche und andere Europäer teilen mit den Amerikanern wesentliche Werte und unsere Kultur wird in ganz beträchtlichem Maße von amerikanischen Institutionen, von Hollywood bis Facebook, mitgeprägt. Doch Vieles an Amerika und den Amerikanern erscheint uns merkwürdig oder gar erschreckend: die Allgegenwart von Schusswaffen, die tiefe Religiosität, der manchmal exzessive Patriotismus (»America can't do wrong!«), die Kluft zwischen den Rassen, zwischen Metropolen und einer pittoresken, oft aber auch öden Provinz, zwischen intellektuellen Eliten und Rednecks im Pickup-Truck - und grölend in der Rotunda des Capitols. Der Amerika-Experte Ronald D. Gerste führt den Leser durch Geschichte und Gegenwart, durch Kultur und Politik, durch Glanz und Schatten eines fernen Freundes, der heute über sich selbst erschrocken und verwirrt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ronald D. Gerste
Amerika verstehen
Geschichte, Politik und Kultur der USA
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2017/2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © Alex Gakos/Shutterstock.com
Karten: Rudolf Hungreder, Leinfelden-Echterdingen
Gesetzt von Eberl & Kœsel Studio GmbH, Krugzell
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-98487-3
E-Book: ISBN 978-3-608-11651-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Inhalt
Einleitung: Die erschütterte Demokratie
1. Der Aufstieg eines fernen Landes: Kolonialzeit und Unabhängigkeit
2. Die junge Nation: Eine konfliktreiche Geschichte
3. Der Weg zur Weltmacht: Das 20. Jahrhundert
4. Die Säulen der Macht: Weißes Haus, Kapitol und Supreme Court
5. Patriotismus und Exzeptionalismus:
America can’t do wrong!
6. Das afroamerikanische Amerika: Die Ungleichheiten im System
7. Heiligtum und Fluch: Schusswaffen
8. Zwischen Silikonchips und Rost: Industrie und Verkehr
9. Gesundheit und Bildung:
America’s business is business!
10. Ein Weg eklatanter Widersprüche: Der
American Way of Life
Epilog: Die Fackel der Freiheit
Anmerkungen
Zeittafel
Die Präsidenten der USA
Ausgewählte Literatur
Karten
Einleitung: Die erschütterte Demokratie
Sternenbanner wehen im Wind. Die Fahne hat viele unvergessene Bilder geprägt, auch Generationen später mit hohem Wiedererkennungswert – und bei Millionen von Betrachtern Bewunderung in solchen Momenten ausgelöst. Die Stars and Stripes auf den Boulevards von Paris, als die Alliierten im Sommer 1944 die Stadt – und bald darauf Westeuropa – von den Nazis befreit hatten. Als Staffage bei der berühmten Rede von John F. Kennedy in Berlin 1963. An beinahe gleicher Stelle 24 Jahre später, als Ronald Reagan dem sowjetischen Parteichef zurief: Mr. Gorbachev, tear down this wall! – und sich kaum jemand vorstellen konnte, dass diese Vision so schnell Realität werden sollte. Emporgezogen zu den Klängen von The Star-Spangled Banner bei den Siegerehrungen von Olympischen Spielen und von staubbedeckten Feuerwehrleuten kurz nach dem 11. September 2001 am Ground Zero in New York. Und ein Bild für die Ewigkeit – oder: solange es Menschen gibt – ist das Foto jener Fahne neben einem Mann namens Buzz Aldrin, die nie von einem Windstoß bewegt werden wird: im Mare Tranquilitatis, am 21. Juli 1969, als die ganze Welt gebannt vor den Fernsehgeräten saß, über alle ideologischen Differenzen hinweg Amerikas Astronauten Tribut zollte und selbst jenseits des Eisernen Vorhangs vielerorts für die drei Männer gebetet wurde.
Sternenbanner wehten in großer Zahl im Wind an einem kalten Januarnachmittag, als sich die Welt fragte, was mit Amerika geschehen war, ob seine Demokratie und seine Werte noch eine Zukunft haben. Ob sie sich von einer beispiellosen Attacke würden erholen können, ob dieses große Land, das auch in der multipolaren Welt nach Ende des Kalten Krieges in so vielen Bereichen dominiert, aus der Dunkelheit würde hervorgehen können, um das zu erleben, was der größte Präsident der USA, Abraham Lincoln, in einer anderen bedrückenden Zeit, auf dem Höhepunkt des Amerikanischen Bürgerkrieges, a new birth of freedom, eine Wiedergeburt der Freiheit genannt hatte.
Die Menschen, die am 6. Januar 2021 das Capitol in Washington erstürmten, vor denen die Kongressabgeordneten und Senatoren und sogar der Vizepräsident in Sicherheit gebracht werden mussten – den zu hängen in Sprechchören skandiert wurde, nachdem er nicht länger den Lügen des ersten Mannes im Staat über angebliche Wahlfälschungen zu folgen bereit war – trugen das Sternenbanner in unterschiedlichsten Formen mit sich: an Fahnenstangen (mit denen einige von ihnen auf Polizisten einprügelten), als Kopftücher über den meist bärtigen Gesichtern oder als Umhang. Doch es waren auch andere Fahnen zu sehen. Eine von ihnen hatte eine schmerzhafte historische Bedeutung: es waren die Stars and Bars der Konföderierten, der Südstaaten in jenem Bürgerkrieg, das Symbol eines auf der menschenverachtenden Institution der Sklaverei basierenden Systems. Es war ein Staatswesen, das von keinem Land der Welt diplomatisch anerkannt worden war und das in einem blutigen Konflikt niedergerungen werden musste. Was den Generälen der Konföderation versagt blieb, schafften die Gewalttäter des Jahres 2021: Die Fahne einer zutiefst rassistischen Ideologie wurde in einer Art verblendeten Triumphzuges durch die Rotunda des Capitols getragen.
Der Blickfang für die geschockte Weltöffentlichkeit und für die große Mehrheit der an jenem Tag ebenfalls entsetzten Amerikaner war eine andere Art der Fahne, ein Design der jüngeren Vergangenheit. Die Sterne – in einigen Entwürfen drei, in andere fünf – fallen kaum auf, sie wirken zwergenhaft neben den fünf großen Lettern: T, R, U, M, P. Für eine Mehrheit der Amerikaner, für praktisch alle Liberalen und auch für viele Konservative war der Vandalismus, die Verachtung der demokratischen Institutionen der USA und die Gewaltbereitschaft, die unter anderem einen Polizisten sein Leben kosteten, nachdem ihm Landsleute, die wahrscheinlich sonst rituell ihre Unterstützung für law and order und für our brave men and women in uniform beschwören, mit einem Feuerlöscher den Schädel eingeschlagen hatten, ein bitterer, aber nicht unlogischer Höhe- und Schlusspunkt einer in der Geschichte der USA einmaligen Präsidentschaft.
Die vier Jahre zwischen dem 20. Januar 2017 und dem gleichen Tag im Jahr 2021 wurden von einem Mann dominiert, der eine gänzlich andere Biografie hatte als alle seine Amtsvorgänger – und einen gänzlich anderen Charakter, ein einzigartiges Verständnis von seiner Rolle und seiner Verantwortung im immer noch mächtigsten Amt der Welt. Über diese vier Jahre haben Regierungen in aller Welt mit einer Mischung aus Sorge (vor allem bei den westlich geprägten Demokratien) und Amüsement (eher in autokratischen Regimen) die oft sprunghaften Entschlüsse beobachtet und sich an seiner eines Staatsmannes oft unwürdigen Rhetorik entsetzt oder erfreut. Die USA, über viele Jahrzehnte ein berechenbarer (wenn auch kaum uneigennütziger) Partner oder Konkurrent in der Weltpolitik, wurden unter ihrem 45. Präsidenten manchmal zu einer irrlichternden Komponente. Dass die Betonung dennoch auf »manchmal« liegen kann, zeigt die Stärke ihrer Institutionen wie dem State Department und dem Pentagon auf, die ein Maß von Normalität zu sichern in der Lage waren. Die Erwähnung der Streitkräfte weist immerhin auf einen positiven Aspekt der Präsidentschaft Trumps: unter seiner Führung wurden keine neuen Kriege begonnen und Amerikas Beteiligung an fernen und verlustreichen Konflikten heruntergefahren. Die Militärpräsenz der USA vor allem in Afghanistan und im Irak zu verringern, war eines seiner Wahlversprechen gewesen und entsprach zweifellos dem Wunsch vieler Amerikaner über Parteigrenzen hinweg. Der Krieg in Afghanistan war zum längsten in der amerikanischen Geschichte geworden, währte fast doppelt so lang wie die tragische Verstrickung der USA in den Vietnamkrieg und brachte dem geschundenen Land am Hindukusch alles andere als einen Frieden.
Es lässt sich argumentieren, dass Donald John Trump im November 2016 weniger deswegen gewählt wurde, weil ihn viele Amerikaner für eine besonders gewinnende Persönlichkeit hielten, sondern auch deshalb, weil die Demokraten eine Kandidatin ins Rennen schickten, die selbst Stammwähler der Partei als rundum unsympathisch empfanden. Diese erhielt zwar die Mehrheit der Wählerstimmen, doch bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen zählt – wie noch erläutert wird – allein die Mehrheit im Wahlmännerkollegium, dem electoral college. Dort brachte Trump es auf 306 Stimmen, was um einiges über der erforderlichen Mindestzahl von 270 liegt und ihn von einem landslide, einem Erdrutschsieg sprechen ließ. Wie es der Zufall wollte, bekam vier Jahre später sein Rivale, der nunmehrige 46. US-Präsident Joe Biden ebenfalls 306 Wahlmännerstimmen und hatte bei den Wählerstimmen einen durchaus beeindruckenden Vorsprung von mehr als sieben Millionen.
Der im Januar 2021 unter solch einzigartigen Umständen aus dem Amt geschiedene Präsident unterschied sich in seiner Biografie nachhaltig von den Lebensläufen seiner Vorgänger. Während der Schauspieler Ronald Reagan, der letzte Quereinsteiger in die Politik in der Galerie amerikanischer Präsidenten, immerhin acht Jahre lang Gouverneur von Kalifornien gewesen war, hatte Donald Trump nie für ein öffentliches Amt kandidiert, nicht einmal für den örtlichen Board of Education oder einen Sitz in der Bezirksvertretung, geschweige denn für Repräsentantenhaus oder Senat in Washington oder für das Amt des Gouverneurs im Heimatstaat, welcher in Trumps Fall New York war, bevor er als Präsident seinen Wohnsitz in sein Resort Mar-a-Lago in Palm Beach im Sonnenstaat Florida verlegte – in New York City kündeten die Wahlergebnisse zu deutlich von Trumps Unbeliebtheit in der Metropole. Ein traditioneller Weg zur Präsidentschaft war bis dahin die Ausübung einen hohen elective office, eines Amtes, in das man von den Wählerinnen und Wählern gewählt worden war und in dem man sich bewährt hatte. Bill Clinton und George W. Bush beispielsweise waren wie Ronald Reagan Gouverneure, Barack Obama ein Senator gewesen. Ein anderer überkommener Pfad zur Präsidentschaft ist Kriegsheldentum: Mit George Washington, Ulysses S. Grant und Eisenhower stiegen drei Oberkommandierende in größeren Konflikten zu Präsidenten auf. Bei mehreren anderen Präsidenten spielte die militärische Komponente in der Biografie zumindest eine mitentscheidende Rolle wie bei Andrew Jackson, Zachary Taylor, Theodore Roosevelt und selbst bei John F. Kennedy, dessen Erlebnisse im Pazifikkrieg 1943/44 von den Medien (und mit kräftiger Unterstützung von Vater Joe Kennedy senior) zum Heldenepos umgeformt wurden. Donald Trump trug nur während seiner Schulzeit an einer Privatschule mit integrierter Kadettenausbildung, der New York Military Academy, Uniform und nach seinem Abschluss 1964, im Alter von 18 Jahren, nie wieder. Indes: He didn‘t serve his country! – Mit dieser einst für eine politische Karriere fast verhängnisvollen Feststellung steht Donald Trump, dem ein Fersensporn den Wehrdienst und damit einen möglichen Einsatz in Vietnam ersparte, nicht allein. Bill Clinton und Barack Obama dienten auch nie in den Streitkräften, bevor sie Commander-in-chief wurden. Die Zeiten haben sich indes für potenzielle Präsidentschaftskandidaten nicht nur beim Militärdienst geändert, seit die Wehrpflicht für junge Amerikaner 1973 abgeschafft wurde. Auch die Anforderungen der Öffentlichkeit an das Privatleben ihrer Kandidaten und letztlich ihres Präsidenten sind liberaler geworden und spiegeln die Realität der amerikanischen Gesellschaft wieder. Bei Ronald Reagan war es eine von Journalisten im Wahlkampf 1980 gebührend hervorgehobene Besonderheit, dass er der erste geschiedene Präsident wurde – immerhin 191 Jahre nach Einführung des Präsidentenamtes. Im Jahr 2016 störten sich selbst religiös-konservative Wählerschichten nicht an den zwei Scheidungen des Donald Trump.
Zahlreiche Beobachter der Entwicklung in den USA hatten mit Trumps Amtsantritt die Vermutung, dass die vielbeschworene Würde des Amtes auch den neuen Mann im Weißen Haus prägen könnte und er mit der immensen Verantwortung wachsen würde. Man hatte sich getäuscht. Der ehemalige Immobilienmagnat und Reality TV-Star zeigte schnell ein Verhalten – und eine Ausdrucksweise – die selbst die von Historikern weniger gut eingeschätzten ehemaligen Präsidenten plötzlich in einem sonnigeren Licht dastehen ließ. Der während seiner Amtszeit von 2001 bis 2009 vor allem wegen dem Irakkrieg heftig kritisierte George W. Bush wirkte plötzlich wie die Verkörperung eines klassischen Gentleman. Bush hatte als unmittelbarer Zeuge der Vereidigung Trumps bereits Bedenken, nachdem dieser eine düstere Rede vor dem Capitol hielt. Der 43. Präsident, seinerseits Sohn des 41. Präsidenten, soll auf Trumps apokalyptische Vision mit den Worten That was some weird shit reagiert haben.
Die von Trump betriebene Politik wurde vom liberalen Amerika schnell kritisiert; die meist ebenfalls vor den Kopf gestoßenen Europäer verbrämten ihre Enttäuschung zunächst hinter diplomatischen Floskeln. Das galt vor allem für den von ihm initiierten Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran, an dessen Zustandekommen neben Russland und China auch Frankreich, Großbritannien und Deutschland beteiligt waren. Dieser Schritt erfreute seine Anhänger unter den konservativen jüdischen Wählerinnen und Wählern in den USA, die in Trumps Schwiegersohn im Weißen Haus eine Präsenz hatten, und seinen Freund, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu – einer der wenigen ausländischen Regierungschefs, der in den vier Amtsjahren Trumps keine Beschimpfung durch den US-Präsidenten über sich ergehen lassen musste. Auf noch mehr Unverständnis traf der amerikanische Rückzug vom Pariser Klimaschutzabkommen. Die globale Erwärmung hatte Trump verschiedentlich als hoax, frei übersetzt als Verarschung bezeichnet, und Maßnahmen gegen diese würden nur Jobs in den USA und die Gewinne amerikanischer Unternehmen gefährden. Die enge und schon traditionelle Verbundenheit zwischen der Republikanischen Partei und der fossil fuel industry, also den großen Öl- und Kohlekonzernen, erlebte unter und dank Trump eine neue Blütezeit. Umwelt- und Klimaschutzvorschriften wurden ausgehöhlt oder abgeschafft, das Bohren nach Öl in seit langem gehegten Naturschutzgebieten wie in Alaska wurde noch bis in die letzten Tagen seiner Präsidentschaft hinein freigegeben. Trump machte deutlich, dass ihm an Umwelt und Klima wenig, am Profit für amerikanische Unternehmen viel lag. Das zeigten fast erwartungsgemäß auch die von ihm durchgesetzten Steuersenkungen, von denen bevorzugt die top one percent, wie der mehrmalige demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders die Reichen zu nennen pflegt, oder – the top point one percent – die Superreichen profitierten.
Dennoch: es war nicht einmal so sehr seine Politik, die heftige Kritik auslöste und ihm zwei Amtsenthebungsverfahren einbrachte, sondern die Facetten seiner Persönlichkeit, die in einem zunehmend erschreckenden Maße offenbar wurden. Es kann sogar gemutmaßt werden, dass Trump im November 2020 wiedergewählt worden wäre, hätte er eine moderne Variante des Schweigegelübdes abgelegt und in seinen vier Jahren im Amt wenig gesagt (dem in den 1920er Jahren regierenden und sehr wortkargen Calvin Coolidge, genannt Silent Cal vergleichbar) und vor allem nichts getweetet. Es waren die in seinen verbalen oder geposteten Äußerungen erkennbar werdenden Grundzüge seines Wesens, seine absolute Fixierung auf die eigene Person, die immer bedenklichere und abstoßendere Formen annahm. Sein Verhältnis zur Wahrheit war dabei ein Kernpunkt: die von ihm verächtlich als fake news bezeichneten Mainstream-Medien, die in der Tat vom ersten Tag seiner Präsidentschaft aus allen Rohren auf ihn schossen, zählten während seiner Amtszeit letztlich mehr als 20 000 unwahre Aussagen des Präsidenten, vulgo auch Lügen genannt.
Des Präsidenten teilweise hasserfüllte Rhetorik und sein Verlangen nach absoluter, selbstverleugnender Loyalität ihm gegenüber– nicht gegenüber der Verfassung, nicht gegenüber der amerikanischen Nation – bekamen vor allem seine engsten Mitarbeiter zu spüren. Der turnover, das schnelle Ausscheiden aus Positionen, das sich schwindelerregend drehende Personalkarussell, übertraf unter Trump alles bisher in der amerikanischen Präsidentschaft Dagewesene. Wer ihm nicht bedingungslos zu dienen bereit war, wurde gefeuert und bekam oft noch einen Schwung Beleidigungen nachgeworfen wie sein erster Außenminister Rex Tillerson, den Trump nach seiner Entlassung als dumb as a rock bezeichnete. So nahm es nicht wunder, dass die Qualität des Personals im Weißen Haus und besonders am Kabinettstisch immer weiter abnahm und Kompetenz keine Rolle im Vergleich zu Gehorsam und deutlich bekundeter Verehrung spielte. Nach der Erstürmung des Capitols durch Trump-Anhänger traten einige der noch verbliebenen Getreuen zurück oder distanzierten sich verbal; die dabei ausgedrückte Enttäuschung und Empörung wurde weithin als too little, too late eingeschätzt. Auch ausländische Regierungschefs bekamen Kostproben Trumpscher Verärgerung zu spüren: Kanadas Premierminister Justin Trudeau sei two-faced, »sehr unehrlich und schwach«, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron »sehr, sehr gemein«, Bundeskanzlerin Angela Merkel ruinierte seiner Ansicht nach Deutschland und die EU war für ihn ein Feind. Grobe Worte allein indes müssen nicht zwangsläufig unwahr sein.
Der ehemalige FBI-Chef James Comey sagte nach dem Sturm auf das Capitol gegenüber der deutschen Wochenzeitung Die Zeit: »Für Trump gibt es nur einen Fixstern: ihn selbst. Es geht ihm nie um die Nation, nicht einmal um die Leute, die er vergangene Woche zum Capitol dirigiert hat und denen er versprach, er stehe ihnen bei – um dann in Pantoffeln Fernsehen zu schauen.«[1] Bis zur Präsidentschaft Trumps galt der von 1969 bis 1974 regierende Richard Nixon als jener Präsident, der sich die bis dahin schlimmste Verfehlung im Amt hatte zuschulden kommen lassen und deswegen auf dem Höhepunkt der Watergate-Affäre zurücktreten musste (gleichwohl hat ausgerechnet Nixon enorme Verdienste um Natur-, Umwelt- und Artenschutz[2] – auch diese versuchte Trump rückgängig zu machen). Auf die Frage der Zeit, wer der schlimmere Präsident war, der 37. oder der 45., hatte Comey eine klare Antwort: »Trump! Nixon fühlte sich, sosehr er auch ein schlechter Mensch war, als Rechtsanwalt an Normen, Regeln und Traditionen gebunden. Trump ist ein absoluter Narzisst, der sich an kein Wertesystem hält. Er ist der Schlimmste.«[3]
Ob die Strategie der Demokraten, ein Impeachment, ein Absetzungsverfahren gegen Trump einzuleiten wegen angeblicher Einflussnahme auf ukrainische Politiker, ihm belastendes Material gegen den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und dessen Sohn zukommen zu lassen, das von vornherein keine Chance hatte, im Senat die notwendige Zweidrittel-Mehrheit zu bekommen, zu den weisesten politischen Aktionen des frühen 21. Jahrhunderts gehört, mögen Historiker entscheiden. Trumps Basis und die ihm gewogenen Medien, allen voran Fox News, hielten dabei unverbrüchlich zu ihm. Die Menschen, die zu ihm standen und stehen, zeigten dabei auf, was in vielen modernen Gesellschaften beobachtet wird: dass man in einem Zeitalter mit einer kaum noch übersehbaren Vielfalt von Informations- und auch Desinformationsquellen, von 24-Stunden-Nachrichtenkanälen unterschiedlichster Qualität und Ausrichtung, von sozialen Medien und Plattformen, die sich der »User« ganz gezielt nach der dort dominierenden Ideologie und Weltsicht aussucht, eine »alternative Realität« finden und sie zum Zentrum der eigenen Wahrnehmung machen kann. Man hört lieber das, was einem gefällt, auch wenn es nicht den Tatsachen entspricht als etwas Reales, das vom politischen Gegner kommt. Bei Wahlkampfauftritten von Trump brandete der Jubel seiner Anhänger auch dann auf, wenn der Mehrheit unter ihnen bewusst war, dass Aussagen des Präsidenten keinerlei Basis in der Wirklichkeit hatten wie die Ankündigung, es würden neue Industrieanlagen in einem wirtschaftlich und infrastrukturell geplagten Staat des Rust Belt entstehen – sie jubelten ungeachtet der den meisten wohl bekannten Tatsache, dass diese Anlagen in China gebaut werden. Der einst von dem Marineoffizier Stephen Decatur, einem Helden des Krieges gegen Großbritannien von 1812 bis 1814 geprägte Spruch Our country! In her intercourse with foreign nations, may she always be in the right. But our country: right or wrong! gilt nicht nur für eine traditionelle, inzwischen weithin überkommene Einschätzung der Rolle der USA in den internationalen Beziehungen (zu Decatur, dem berühmten Zitat und zu dem lange gepflegten America can’t do wrong kommen wir später zurück), sondern auch für das innen- und gesellschaftspolitische Selbstverständnis. Wenn es »mein Präsident« ist, der es sagt, kann es nicht falsch sein, selbst wenn es falsch ist. Ein Trump-Anhänger wird dessen Worte stets den Ausführungen eines Anderson Cooper oder eines Don Lemon von CNN vorziehen. Damit soll indes nicht behauptet werden, dass nur konservative Amerikaner Zuflucht in einer alternativen Realität suchen. Auch bei den als »links« eingestuften Strömungen gibt es eine selektive Wahrnehmung. Gerade angesichts der Auswüchse rechter Gewalt muss man sich fragen, in welcher Welt manche der gerade vom genannten CNN und vergleichbaren Medien hofierten sogenannten »Aktivisten« (ein Wort, dass im Mainstream-Media-Speak wie in vergangenen Zeiten ein Adelstitel mit einem Hauch von Verehrung benutzt wird) der Black Lives Matter-Bewegung leben, wenn sie Defund the Police!, also eine radikale Kürzung der Polizeibudgets fordern. Die Verbitterung gegenüber Gesetzeshütern ist nach scheußlichen Gewaltakten durch einzelne Polizisten gegen Afroamerikaner zwar verständlich, eine solche pauschale Verdammnis einer ganze Berufsgruppe, ohne die Amerikas Gesellschaft angesichts der allgegenwärtigen Schusswaffen möglicherweise längst in einer Orgie der Gewalt untergegangen wäre, aber geradezu selbstmörderisch. Wer würde die Bewohner benachteiligter Stadtviertel vor Aufmärschen bewaffneter Rassistengruppen schützen, wenn nicht die Polizei?
Eine divergente Wahrnehmung durch unterschiedliche Bevölkerungs- und Wählerschichten wurde auch bei der großen Krise der Gegenwart, der Coronavirus-Pandemie sichtbar. Trump tat den Virus in einer Frühphase der Pandemie als besiegt ab, bevor die USA das Land mit der höchsten Zahl von Todesopfern wurden. Dementsprechend hat sich seither eine Zweiteilung der Antwort auf die Bedrohung herauskristallisiert. Trump-Anhänger waren und sind teilweise immer noch weniger besorgt als Anhänger der Demokraten, republikanische Gouverneure und Bürgermeister zögerten weitaus länger, zum Beispiel eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen einzuführen. Die insgesamt schwache Reaktion der Regierung auf die neuartige Herausforderung hat möglicherweise weniger an Trumps Stammwählerpotenzial gerüttelt als bei jenen Wechselwählern und Unabhängigen für Entfremdung gesorgt, die 2016 für seinen Wahlsieg entscheidend waren. Für die Mainstream-Medien, deren Rund-um-die-Uhr-Thema Nummer eins die Pandemie ist – nicht nur in den USA! – war Trumps schwache Reaktion ein eklatantes Zeichen seiner mangelnden Befähigung zum höchsten Staatsamt.
Unzweifelhaft gingen seine rückläufigen Umfragewerte mit der Ausbreitung der Pandemie einher. Für Beobachter, die im Wahljahr 2020 nicht ausschließlich auf die Epidemiologie, sondern auf das Politik- und Demokratieverständnis der Kandidaten blickten, war etwas anderes bedenklicher. Bei den Demokraten traten zunächst mehr als zwanzig Persönlichkeiten an, was eine erfrischende Manifestation von Vielfalt und Engagement war, nachdem vier Jahre zuvor das Feld von vornherein zu Gunsten der Kandidatin des Establishments, Hillary Clinton, bestellt – Anhänger von Bernie Sanders würden sagen: manipuliert – war. Bei den Republikanern war Trump unumstritten. Im Laufe des reduzierten Wahlkampfes, in dem es nur wenige Massenveranstaltungen angesichts Lockdowns und social distancing gab und in dem die Auseinandersetzung zwischen den beiden großen Parteien überwiegend virtuell stattfand, ließ Trump wiederholt verlauten, dass es für ihn nur zwei denkbare Wahlausgänge geben konnte: seinen Sieg oder eine gestohlene, eine manipulierte Wahl. Mit dieser Einstellung, die man vermutlich als eine Attacke auf die amerikanische Verfassung, zumindest aber als eine Geringschätzung der Constitution ansehen mag, legte er bei den radikaleren, den eher zu einer gewalttätigen Verarbeitung von Frustrationen neigenden Teilen seiner Anhängerschaft einen gefährlichen Grundstein.
Er sollte sich in diese düstere Vision bis hin zu einem offensichtlichen totalen Realitätsverlust steigern. Die Demokraten entschieden sich nach einem weitgehend fairen Reigen von primaries, von Vorwahlen, relativ frühzeitig für einen sicheren Kandidaten. Mit Joe Biden schickte man einen erfahrenen Politiker aus der Mitte des ideologischen Spektrums ins Rennen. Der in sogenannte einfache Verhältnisse hineingeborene Biden hatte den Staat Delaware 36 Jahre im Senat vertreten und war acht Jahre lang der Vizepräsident während der Amtszeit Barack Obamas. Mit bei Amtsantritt 78 Jahren ist Biden der älteste amerikanische Präsident und der erste aus dem kleinen Staat Delaware. Biden, ein über Parteigrenzen weithin geschätzter Mann, hatte in seinem Leben Schwierigkeiten wie sein Stottern und Tragödien zu überwinden: Seine erste Frau und seine kleine Tochter wurden im Dezember 1972, wenige Wochen nach seiner erstmaligen Wahl in den Senat, bei einem Autounfall getötet. Möglicherweise nachhaltige Folgen hatte der Tod seines Sohne Beau im Mai 2015 im Alter von nur 46 Jahren an einer Krebserkrankung. Dieser Verlust, der Biden schwer traf, war wahrscheinlich der Grund für ihn, 2016 nicht für die Präsidentschaft zu kandidieren. Es ist ein interessantes Gedankenspiel sich vorzustellen, wie die USA heute aussähen, wie ihr standing in der Welt wäre, hätte Biden bereits damals schon kandidiert – es dürfte nicht unrealistisch sein zu vermuten, dass mit ihm anstelle von Hillary Clinton auf dem Ticket der Demokraten es nie zu einer Präsidentschaft Trumps gekommen wäre.
Der Wahlsieg Bidens über Trump, zu dem es dann vier Jahre später kam, war sowohl im Wahlmännerkollegium als auch bei der Zahl der absoluten Wählerstimmen deutlich. Im Gegensatz zu dem Sieg Trumps 2016 (er bekam nur eine Minderheit der Wählerstimmen), der noch in der Wahlnacht feststand, dauerte es 2020 mehrere Tage bis zum Endergebnis. Vor allem in den swing states, in den Staaten, in denen ein Wechsel von Trump zu Biden erwartet wurde (wie in Wisconsin und Pennsylvania) oder in denen dies einer völligen Neuordnung der politischen Verhältnisse entsprach (wie in Arizona und Georgia) wurde lange und wiederholt ausgezählt. Angesichts der a priori-Ankündigung Trumps, seine Wahlniederlage als Wahlbetrug anzusehen, wurde dort wahrscheinlich gewissenhafter gezählt als je zuvor in der jüngeren US-Geschichte. Das hinderte Trump freilich nicht, das Wahlergebnis nicht anzuerkennen und ungeachtet mehrere Dutzend Niederlagen vor verschiedenen Gerichten im Laufe der nächsten Wochen weiter von einer gestohlenen Wahl zu schwadronieren. Das Verhalten des chief executive war ein neuerlicher Angriff auf die amerikanische Verfassung und ein Schlag ins Gesicht von Zehntausenden von Wahlhelfern (dass diese in Georgia oft schwarz waren, wie bei der Demografie des Staates nicht überraschend, verleitete einige seiner Anhänger zu rassistischen Tiraden). Es folgten Anrufe bei – republikanischen – Offiziellen mit der Aufforderung, ihm die notwendigen Stimmen zu beschaffen. Lassen wir noch einmal Ex-FBI-Chef James Comey zu Wort kommen: »Er hat sich wie ein Mafiaboss der Cosa Nostra verhalten. Das amerikanischen Volk hat 2016 einen sehr schlechten Menschen gewählt. Zum Glück erkennen das immer mehr Leute.«[4]
Für viele indes bedurfte es dazu erst der Ereignisse des 6. Januar 2021. Die Bilder vom Sturm eines Capitols durch einen Mob entsetzten Amerikaner unterschiedlicher politischer Überzeugung bis auf die hard-Anhänger des scheidenden Präsidenten, die darin einen Akt sehen, to take our country back, ihr Land zurückzubekommen von vermeintlichen Feinden. Man suchte nach Vergleichen, nach Ländern, in denen so etwas möglich war und recherchierte auf der Landkarte und bei Wikipedia nach Staaten in Afrika und ehemaligen Sowjetrepubliken. Wie konnten die USA, so fragten sich Amerikaner, so tief sinken? Die Sprache der Bilder war eindrücklich, das Gegröle des Mobs in den Wandelgängen des Capitols verstörend, die von einem der Aufrührer bereit gehaltenen Plastikhandschellen ließen gar noch Schlimmeres, gerade noch Verhindertes – eine geplante Geiselnahme von Abgeordneten, wie zum Beispiel der dritthöchsten Person im Lande, der Sprecherin des Repräsentantenhauses? – vermuten. Die Zeitschrift The Economist, linker Tendenzen unverdächtig, zeigte in ihrem Editorial auf den Verantwortlichen: »Vor vier Jahren stand Donald Trump vor dem Capitol, um vereidigt zu werden und versprach das ›amerikanische Blutbad‹ (American carnage) zu beenden. Seine Amtszeit endet damit, dass der amtierende Präsident einen Mob auffordert, zum Kongress zu marschieren – und ihn dann zu loben, nachdem er zur Gewalt gegriffen hatte. Seid nicht im Zweifel, dass Mr. Trump der Autor dieses tödlichen Angriffs auf das Herz der amerikanische Demokratie ist. Seine Lügen haben die Unzufriedenheit gestärkt, seine Missachtung der Verfassung diese auf den Kongress gerichtet und seine Demagogie hat die Lunte angezündet. Die übertragenen Szenen von dem das Capitol stürmenden Mob, die in Moskau und Beijing Häme auslösten und in Paris und Berlin beklagt wurden, sind die Mr. Trumps unamerikanische Präsidentschaft definierenden Bilder.«[5]
Der Hinweis auf die Hauptstädte der Verbündeten weist auf ein Dilemma, das die USA noch für einige Zeit begleiten wird und das eine der zahlreichen Herausforderungen für Präsident Biden sein wird. Über viele Jahre haben sich amerikanische Regierungen – und Medien – ein Urteil über andere Länder und deren demokratische oder undemokratische Systeme angemaßt. Diese Rolle als Juror auf der Weltbühne hat einen schweren Schaden erlitten. So schrieb eine große Tageszeitung wenige Tage nach dem Wüten des Mobs im Herzen der amerikanischen Volksvertretung nachdenklich: »Der versuchte Staatsstreich im Capitol bedroht Amerikas Rolle als weltweiter Promoter der Demokratie. Das Spektakel von Trump, wie er seine Anhänger über die grundlosen Vorwürfe von Wahlbetrug zum Capitol in Bewegung setzt während dort die Volksvertreter den Wahlsieg von Joe Biden zertifizieren, ist ein Propaganda-Coup für Washingtons Feinde. Es hat weltweit Pro-Demokratie-Bewegungen untergraben und ein Modell für Möchtegern-Autokraten geliefert.«[6]
Die jüngsten Ereignisse haben deutlich gemacht, dass sich der zwiespältige Charakter der amerikanischen Nation nicht länger hinter irgendwelchen Rekordwerten des Dow Jones, dem medial so viel beachteten burschikosen Charme von Start-up-Idolen aus Silicon Valley und dem Medaillenspiegel von Olympischen Spielen, all diesen Manifestationen des permanenten amerikanischen Um-jeden-Preis-siegen-Müssen, verstecken lässt. Es gibt nicht ein Amerika, glanzvoll und stark und voller Helden. Es gibt viele Amerikas, die sich in denkbarem Kontrast gegenüber stehen: das Land der Hochhäuser aus Marmor, Stahl und Glas hier, das Land mit teilweise verlassenen, verkommenen Provinzorten, reich an zugenagelten Schaufensterfronten dort. Es gibt ein Amerika einer intellektuellen Elite und ein anderes, dessen Einwohner auf dem Globus den amerikanischen Kontinent zu finden nicht in der Lage sind und deren geistige Nahrung aus Sportsendungen und den Kardashians besteht. Die Letzteren hat Donald Trump erfolgreich angesprochen, organisiert und radikalisiert, vielfach enthemmt bis hin zur Gewaltbereitschaft. Es gibt ferner – den seherischen Worten Martin Luther Kings zum Trotz, wonach einst die Menschen nach ihrem Charakter und nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden – nach wie vor ein »schwarzes Amerika«, so wie es auch eines der illegalen, überwiegend hispanischen Einwanderer gibt. Die Gegensätze zwischen den Superreichen und den erbärmlich Armen ist krasser als in jedem europäischen Land, die Verbreitung von Schusswaffen und die Zahl deren Opfer ist exorbitant. Auf der Weltbühne ist das Land nach wie vor ein militärischer Gigant, daheim ist die Infrastruktur dringend überholungsbedürftig. Seit seiner Gründung vor mehr als 240 Jahren scheint in diesem Land alles ein paar Nummern größer zu sein als in der Alten Welt, im Guten wie im Schlechten. Weltuntergangsszenarien sind heute so wenig realistisch wie es sie in (noch) schwierigeren Zeiten waren: die USA haben nicht nur ihre ganz großen Krisen – wie um 1860, nach 1929, nach den turbulenten 1960er und frühen 1970er Jahren mit Vietnamkrieg, Watergate und der Ermordung herausragender Persönlichkeiten wie Martin Luther King, John und Robert Kennedy – überstanden, sondern sind aus ihnen gestärkt hervor gegangen. Gleichwohl: einen Vertrauens- und Imageverlust wie in der Gegenwart mussten sie noch nie aufholen.
Die USA strahlen jenseits ihrer Landesgrenzen vielfältig aus, ganz besonders nach Europa, dem Kontinent der Vorfahren der Bevölkerungsmehrheit: politisch, wirtschaftlich, kulturell und nicht zuletzt im Konsumverhalten. Viele Europäer lehnen Amerikas Großmachtpolitik ab oder stehen ihr zumindest kritisch gegenüber und haben gleichzeitig einen Faible für amerikanische Filme und Freizeitmode, lieben ihr amerikanisches (wenn auch in China produziertes) IPhone und nutzen amerikanische soziale Medien wie Twitter und Facebook, ziehen den Service von Uber dem traditionellen Taxi vor und nächtigen im Urlaub – wenn ein solcher nach der Pandemie wieder möglich wird – mit Hilfe von Airbnb, das Reiseerlebnis vielleicht noch gewürzt durch ein von Tinder vermitteltes date.
Die USA beeinflussen so viele unserer Lebensbereiche – als Deutsche, Österreicher, Schweizer, als Europäer –, dass es vollkommen berechtigt ist, zu verfolgen, was sich »dort drüben« abspielt: im Weißen Haus und im Kongress, in Hollywood und an der Wall Street. Dieses Buch soll einige der Eigentümlichkeiten dieses großen Landes erklären und auch erzählen, wie Amerika und die Amerikaner zu dem wurden, was sie sind. Ob wir es mögen oder nicht, die USA bestimmen unser Dasein, unser Schicksal mit. Die Erschütterungen der jüngsten Zeit mögen – so bleibt zu hoffen – für uns Europäer langfristig vielleicht auch Positives bewirken. Das angeblich alte Europa – Old Europe,