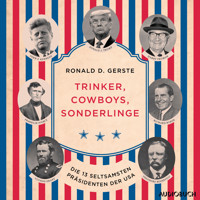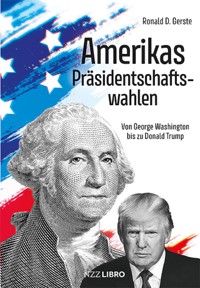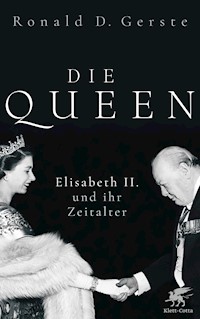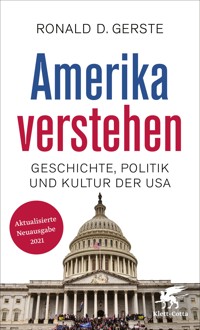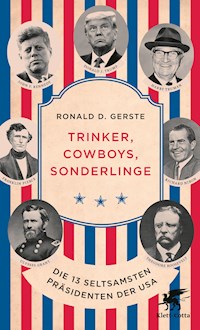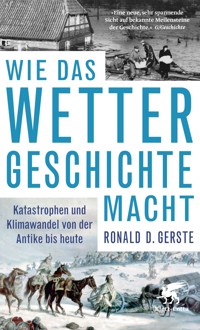12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Acht dramatische Jahrzehnte und der Kampf gegen Seuchen, Schmerz und Tod Anschaulich und lebensnah erzählt Ronald D. Gerste die umwälzenden Ereignisse und wissenschaftlichen Entwicklungen in der erstaunlich dynamischen Zeit von 1840 bis 1914, in der die Medizin ungeahnte Fortschritte machte: ein packendes Porträt einer entfesselten Epoche, die Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik revolutionierte – mit bleibenden Folgen bis in unsere Gegenwart. Die außergewöhnlich dramatischen Jahrzehnte zwischen 1840 und 1918 markieren eine Wendezeit, die bis heute unser Dasein und Leben prägen. Innerhalb dieser Jahre entwickelte sich die moderne Medizin und veränderte das Verhältnis des Menschen zu seinem Körper und dessen Leiden nachhaltig. Heilungserfolge wurden möglich, an die bisher nicht zu denken gewesen war, und schufen die Grundlage unseres heutigen Lebens. Es waren Forscher, Mediziner und Ärzte wie Koch, Semmelweis und Morton, die unsere Moderne begründeten. Diese Pioniere der Gegenwart zu begleiten heißt auch, sich auf eine Zeitreise in eine atemberaubende Epoche zu begeben – in der die Eisenbahn und das Dampfschiff den Menschen zu fernen Horizonten brachten, in der die Welt wahrhaft globalisiert wurde und in der neue Gedanken und Überzeugungen zu Umbruch und Revolution führten. Doch der Mensch bleibt der Mensch und die Natur lässt sich nicht endgültig bezwingen: Am Ende der hoffnungsvollen Epoche stehen eine von Staatsmännern geschaffene Katastrophe und, fast wie ein tragisches Nachwort zur Saga der Triumphe, eine von Viren verursachte Pandemie: die Spanische Grippe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ronald D. Gerste
Die Heilung der Welt
Das Goldene Zeitalter der Medizin 1840 – 1914
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021, 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg unter Verwendung eines Fotos von © Bridgeman, akg-images
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96594-0
E-Book ISBN 978-3-608-11643-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog
Hände waschen, Leben retten
1.
Menschenbilder
2.
Stille in Boston
3.
Todbringende Hände
4.
Die
Great Exhibition
5.
Chloroform
6.
Die Frau mit der Lampe
7.
Räder aus Stahl
Schicksale: Phineas Gage
8.
Karte des Todes
9.
Bücher
10.
Rotes Kreuz
11.
Wunden der Nation
Schicksale: James Madison DeWolf
12.
Antisepsis
Schicksale: Joseph Merrick (Der Elefantenmann)
13.
Augenlicht
14.
Erbfeinde
15.
Wissenschaftsnation
16.
Kokain
17.
Schwester Carolines Handschuhe
Schicksale: James Garfield
18.
Tollwut und Cholera
Schicksale: Elizabeth Stride
19.
Strahlenbilder
Schicksale: Kaiserin Elisabeth
20.
Jahrhundertwende
Schicksale: Adele Bloch-Bauer (Die Frau in Gold)
21.
Jüdische Pioniere
22.
Menetekel
23.
Unheilbar
Epilog
Pandemie
Sternstunden der Medizin und Naturwissenschaften
Anmerkungen
Prolog: Hände waschen, Leben retten
1. Menschenbilder
2. Stille in Boston
3. Todbringende Hände
4. Die Great Exhibition
5. Chloroform
6. Die Frau mit der Lampe
7. Räder aus Stahl
Schicksale: Phineas Gage
8. Karte des Todes
9. Bücher
10. Rotes Kreuz
11. Wunden der Nation
Schicksale: James Madison DeWolf
12. Antisepsis
Schicksale: Joseph Merrick
13. Augenlicht
14. Erbfeinde
15. Wissenschaftsnation
16. Kokain
17. Schwester Carolines Handschuhe
Schicksale: James Garfield
18. Tollwut und Cholera
Schicksale: Elizabeth Stride
19. Strahlenbilder
Schicksale: Kaiserin Elisabeth
20. Jahrhundertwende
Schicksale: Adele Bloch-Bauer
21. Jüdische Pioniere
22. Menetekel
23. Unheilbar
Epilog: Pandemie
Bildnachweis
Namen- und Sachregister
Prolog
Hände waschen, Leben retten
Auf den ersten Blick sah es im Supermarkt aus wie immer. Die Obstabteilung zeigte eine üppige Vielfalt, die Fleisch- und Wursttheke war exzellent sortiert, und auf Freunde kleiner, süßer Sünden warteten mehrere Regalmeter von Pralinen und Schokoladen, von Vollmilch bis zu Tafeln mit knapp 90 Prozent Kakaoanteil und exotischen Beigaben wie Chilischoten oder Meersalz. Nur zwei Eigentümlichkeiten im Sortiment mochten dem aufmerksamen Kunden beim Bummel durch die Konsumwelt auffallen. Es gab kein Klopapier. Und es klaffte eine weitere Lücke: dort, wo bei den Produkten zu Sauberkeit und Hygiene normalerweise die Fläschchen unterschiedlicher Größe zu finden waren, die weltweit als Hand Sanitisers gelten; die deutsche Sprache hat dafür den etwas umständlichen Begriff Händedesinfektionsmittel(1).
Der Supermarkt lag in der Einkaufszone von Stuttgart oder Berlin, in einem Einkaufszentrum am Rande von Düsseldorf oder über der Elbe in Magdeburg, er war in Wien oder in Luzern. Und auch in anderen Ländern bot sich ein ähnliches Bild, als zunächst wenige, dann immer mehr und schließlich alle Menschen mit Gesichtsmaske(1) zum Einkaufen gingen, mit misstrauischen Blicken andere Kunden musterten und dann das Geschäft meist schnellstmöglich wieder verließen.
Es war ein Frühjahr im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts.
Auf den ersten Blick sah der Eingang zur Klinik aus wie immer. Die Ärzte und Medizinstudenten kamen mit dem gerade von Letzteren bekannten, überwiegend fröhlichen Geräuschpegel aus einem Komplex des großen, vom seligen Kaiser Joseph II. konzipierten Krankenhauses, der geradezu der Kontrapunkt zu der Abteilung bildete, die zu betreten die Gruppe im Begriff war. Sie kamen vom Tod und gingen zu neuem Leben. Hinter ihnen lagen die morgendlichen Sektionen, das Studium des menschlichen Körpers und der Ursachen des Ablebens – die Pathologie des Allgemeinen Krankenhauses(1) Wien war die größte und berühmteste in der zeitgenössischen Medizin. Und sie betraten die Erste Geburtshilfliche(1) Klinik, eine von zwei Abteilungen, deren Flure vom Schreien neugeborener Babys widerhallten.
Das Gelächter, die angeregte Konversation der jungen Mediziner verstummte, als sie – meist erst auf den zweiten Blick – bemerkten, was in dem Eingangsbereich an diesem Tag so anders war. Ein Waschgefäß stand dort auf einem Tisch, daneben ein Behältnis mit einer streng riechenden Flüssigkeit. Und eine Tafel, auf der unmissverständliche Worte geschrieben standen. Von heute an, so las man mit Erstaunen, teilweise auch mit Entrüstung, können die Herren Collegae den Kreißsaal und die Wöchnerinnenstation nur betreten, nachdem man sich die Hände ausgiebig mit einer Chlorkalklösung(1) gewaschen habe(2). Ohne Ausnahme. Die Studiosi empfanden es mehrheitlich als Zumutung – doch sie gehorchten. Manche Revolutionen fangen unscheinbar an; dies war eine: Ein Kind zur Welt zu bringen musste nicht länger ein Todesurteil für die Mutter bedeuten.
Es war ein Frühjahr um die Mitte des 19. Jahrhunderts.
Vieles, was uns selbstverständlich erscheint, hat irgendwo, irgendwann einen Anfang gehabt. Wer bei Google Suchbegriffe wie »Geschichte des Händewaschens« oder »History of Handwashing«(3) eingibt, wird Ergebnisse erhalten, in denen fast immer und oft schon im ersten Satz der Name des Ignaz Philipp Semmelweis(1) auftaucht. Manche dieser Beiträge erwecken gar den Eindruck, dass man vor dem Wirken dieses ungarischstämmigen Arztes in Wien, vor 1847, sich nicht oder kaum die Hände gewaschen hat. Sicherlich war die Neigung zu dieser uns heute grundlegend erscheinenden Körperhygiene über die Epochen von der Vorstellungswelt der Menschen und natürlich ihrer sozialen Stellung abhängig gewesen. Grob verallgemeinernd gesprochen verbinden wir mit unserem Bild von der griechischen, vor allem aber der römischen Antike mit ihren Bäderanlagen und Aquädukten – auch wenn diese vor modernen Hygienikern allein aufgrund der Wasserqualität wenig Gnade finden würden – eher einen Sinn der Menschen für körperliche Sauberkeit als mit manchen von Badezimmern und Toiletten freien Schlössern des europäischen Adels der Frühen Neuzeit. Wie dem auch sei – das Händewaschen(4) aus einem medizinischen Motiv, zur Prävention, in diesem Fall als einem Mittel gegen eine himmelschreiend hohe Müttersterblichkeit, geht in der Tat ganz überwiegend auf Ignaz Philipp Semmelweis zurück. Die auf ihn verweisenden Beiträge, auf die Google schnellstmöglich stößt, meist in Zeitungen, Zeitschriften und anderen Medien online publiziert, sind fast alle im gleichen Jahr erschienen. Im Jahr 2020.
Das Leben, wie wir es kennen und unter normalen Umständen für selbstverständlich halten, beruht auf Erfahrungen und Fortschritten derer, die vor uns kamen – Fortschritte, die oft hart und unter Opfern erkämpft werden mussten, wie es uns die Vita von Semmelweis(2) zeigt. Bewusst werden wir uns der Linien, die das »moderne« Dasein mit der Vergangenheit verbinden, oft erst, wenn die Normalität bedroht ist, in Zeiten von Krisen und Ungewissheit. Auf die Frage nach den Wurzeln dieser uns vertrauten, aber letztlich doch fragilen Moderne wird ein jeder gemäß seiner eigenen Weltsicht eine individuelle Antwort geben. Man mag auf die Erfindung der Buchdruckerkunst um die Mitte des 15. Jahrhunderts verweisen, ohne welche die Vermehrung und Verbreitung von Wissen kaum denkbar wäre. Es können gesellschaftliche Fortschritte als Morgenröte der Gegenwart gelten, wie die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung des Frauenwahlrechts oder die Etablierung der Demokratie als Staats- und Regierungsform. Technik- und Digitalfreaks werden möglicherweise auf eine erst rund 40 Jahre zurückliegende Wegscheide verweisen, als das Wort Computer nicht mehr allein in Zusammenhang mit Institutionen wie NASA und CIA verwendet wurde, sondern das Präfix Home bekam, als die ersten Ataris und Macintoshs in bürgerliche Wohn- und Arbeitszimmer Einzug hielten.
Nichts indes – weder die technische Ausrüstung oder das schönste Auto in der Garage noch die weitesten Reiseaktivitäten und selbst nicht die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen der eigenen Existenz – bestimmt so unmittelbar unser Leben, unsere Befindlichkeit wie der körperliche und auch der mentale Zustand. Gesundheit oder das Fehlen derselben, Krankheit, sind die elementarsten Faktoren, die das eigene Leben definieren, lenken und irgendwann – unausweichlich – beenden. Das Vorliegen einer Krankheit oder allein die Erwartung, dass eine solche uns treffen könnte, letztlich gar die Angst vor einem viele oder gar alle Menschen heimsuchenden pathologischen Geschehen sind in der Lage, alles scheinbar Vertraute, Sichere zu erschüttern und das Leben Einzelner oder Vieler in eine ganz andere Richtung zu lenken.
Wenn es um den Beginn der Moderne aus der Sicht unserer Körperlichkeit, unserer Gesundheit geht, fällt der Verweis auf eine Epoche unvergleichbaren Fortschritts leicht. Es ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, in der Entdeckungen und Erfindungen wie nie zuvor gemacht wurden, in der allmählich die weißen Flecken auf der Landkarte der medizinischen Möglichkeiten kleiner wurden. Dieses Buch soll in diese Zeit entführen, den Leser an den wichtigsten Ereignissen teilnehmen lassen, die unser heutiges Leben erst ermöglichen, und einige der Wegbereiter, der Pioniere dieser faszinierenden Ära lebendig werden lassen, ohne dass es einen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf eine globale Perspektive erheben könnte; die Schauplätze unserer Handlung sind Europa und Nordamerika.
Es ist gleichwohl keine Medizingeschichte. Es soll eher ein Zeitgemälde einer auf so vielen Gebieten fortschrittsgläubigen Epoche sein, betrachtet aus primär medizinischer Sicht. Die Durchbrüche der Ärzte in ihrer Goldenen Zeit sind eingebettet in eine beispiellose Innovationsfreudigkeit dieser Jahre, für die unter anderem das Aufkommen von lebensechten Bildern (Daguerreotypien und Fotografien) steht, die gegen Ende des Jahrhunderts auch noch sich zu bewegen lernten, in denen sich der Siegeszug der Eisenbahn vollzieht und Echtzeitkommunikation dank auf dem Meeresboden verlegter Kabel möglich wird. Die Ärzte und Forscher setzen zu ihren Pioniertaten vor dem Hintergrund einer sich rasch wandelnden Demografie mit dem rasanten Wachstum von Städten und einer massiven Industrialisierung an – und sie tun dies in einem sich wandelnden politischen Umfeld. Immer stärker bestimmen in dieser Epoche Ideologien und Parteibildungen die Debatten, neue Nationalstaaten wie Deutschland und Italien entstehen. Nach wie vor ist Großbritannien die Weltmacht Nummer eins, doch auf diese Rolle bereiten sich zunehmend die Vereinigten Staaten nach einem blutigen, auch aus medizinischer Sichtweise epochalen Bürgerkrieg vor. Und so werden uns nicht nur Semmelweis und Robert Koch und Louis Pasteur und Sigmund Freud begegnen, sondern auch Baumeister und Eisenbahnpioniere und einige der Herrscher, welche die Epoche prägten – eine davon, wir werden sie als Handelnde und als Patientin sehen, gab gar dem Zeitalter seinen Namen.
Stichwort Zeitalter: Als zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts würde man gemeinhin die Jahre von 1850 bis 1900 bezeichnen. Die auf dem Titel dieses Buches zu findenden Jahreszahlen ziehen die Grenzen etwas großzügiger. Das liegt nicht nur daran, dass Historiker gern vom »langen 19. Jahrhundert« sprechen; sie meinen damit die Zeit bis 1914 und lassen es oft mit der Französischen Revolution ab 1789, manchmal aber auch mit Napoleons endgültiger Niederlage 1815 und dem Wiener Kongress beginnen (womit es ein versetztes, aber kein längeres Jahrhundert wäre). Es hat vielmehr damit zu tun, dass schon kurz vor der Jahrhundertmitte zahlreiche Weichen für die Zukunft gestellt wurden, unter anderem durch die Revolutionen der Jahre 1848/49. Vor allem aber damit, dass zwei der großartigsten medizinischen Entwicklungen – abermals muss unterstrichen werden: ohne die unser Leben heute nicht denkbar wäre – in den 1840er Jahren stattfanden.
Diese Saga mit dem Jahr 1914 zu beenden, ist auch notwendig, um deutlich zu machen, dass der Buchtitel eine Erwartung einer sich manchmal an sich selbst berauschenden Zeit wiedergibt und keine Realität. Die Welt kann nicht geheilt werden. Sie kann allenfalls verbessert, lebenswerter gemacht werden, und dafür stehen viele der Handelnden in diesem Buch. Das Jahr 1914 markiert das Scheitern vieler Hoffnungen, das grausame Erwachen aus dem Traum, dass es immer nur aufwärts gehen werde. Es waren keine Ärzte, welche die Katastrophe auslösten. Doch dass auch diese stets eines Scheiterns ihrer Bestrebungen gewärtig sein müssen, soll der Epilog symbolisieren. Er erzählt von einer Pandemie, die nicht in den Griff zu bekommen war.
Die Ärzte, die Wissenschaftler, die Erfinder der Epoche, der wir uns nähern wollen, waren meist – es gab Ausnahmen – von einem fast unerschütterlichen Zukunftsglauben erfüllt, von der Vorstellung eines stetig besseren Morgen. Ein bedeutender Chirurg, Ferdinand Sauerbruch(1), der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also mitten in unserer Saga, geboren wurde, schrieb später rückblickend auf seine Jugendjahre: »1875 kam ich in Barmen zur Welt. Der Zeit, in der ich geboren wurde und in der ich aufwuchs, wäre die Lebensangst der heutigen völlig unverständlich gewesen.« Er sei herangewachsen »inmitten einer Zeit des Wohlstandes und einer zuversichtlich vorwärtsblickenden Lebensauffassung«.[1]
Sie liegt wirklich lange zurück.
Scheinbar unendlich fern und doch so vertraut wirkend: Die 1840er Jahre waren eine Dekade enormen Fortschrittes und vielfach auch der Lebensfreude – wie auf diesem scheinbar zeitlosen Bild der Fotografiepioniere Hill und Adamson mit dem Titel ›Edinburgh Ale‹.
1.
Menschenbilder
Amerikaner lieben es, die Ersten zu sein (oder die Größten), und Robert Cornelius(1) war keine Ausnahme. Sein selbstgewisser Gesichtsausdruck im Moment seines Triumphes hat sich über Generationen bewahrt; die Zuversicht eines Angehörigen der noch jungen Nation jenseits des Atlantiks wirkt auch heute noch auf den Betrachter frisch und authentisch. Als es getan war, schrieb Robert Cornelius auf die Rückseite seines Werkes mit Stolz die Worte: »The first light picture ever taken. 1839.«[1]
Er irrte sich, was er aber nicht wissen konnte angesichts der Kommunikationsmöglichkeiten der Epoche, in der Nachrichten von der Alten in die Neue Welt mit der Geschwindigkeit (und in der »Mailbox«) eines Segel-, immer öfter aber auch eines Dampfschiffes transportiert wurden. Robert Cornelius(2) erfuhr daher mit Verzögerung, dass das erste »Lichtbild« kurz zuvor in Europa entstanden war, in Frankreich. Doch Cornelius, ein Tüftler und Erfinder aus Philadelphia, war dennoch ein Pionier und erwarb deshalb das in seiner Heimat so wertgeschätzte Prädikat First. Denn in den (wahrscheinlich) ersten Oktobertagen des Jahres 1839 schuf Cornelius das erste Selbstporträt in der Geschichte der Fotografie – das erste Selfie in heutigem Sprachgebrauch.
Was an diesem Foto auch mehr als 180 Jahre später fasziniert, ist die Lebendigkeit von Cornelius(3)’ Physiognomie, sein wahrscheinlich beabsichtigt zerzaustes Haar, sein scharfer Blick leicht am Betrachter vorbei. Es wirkt fast gespenstisch: Ungeachtet der Flecken und Schäden auf der Silberplatte beschleicht den modernen Betrachter der Eindruck, Cornelius könnte sich im nächsten Moment bewegen, zu uns sprechen. Viele später im 19. Jahrhundert entstandenen Fotos zeigen Menschen, die – oft durch ihren abweisenden Gesichtsausdruck oder durch die aus heutiger Sicht wenig attraktiven Frisuren in einem Zeitalter vor Erfindung des Shampoos – unnatürlich wirken, fest in einer anderen, vergangenen Welt verankert sind. Cornelius(4) indes ist auf seinem großen Werk einer von uns – nur vielleicht etwas forscher, etwas selbstgewisser.
Die Erfindung der Fotografie zeigt geradezu exemplarisch auf, wie schnell Neues, Faszinierendes sich zu Beginn jener Epoche, die eine Blütezeit für Innovationen, gerade auch medizinischer Natur, wurde, sich ausbreitete, begeistert aufgegriffen wurde – und dass manchmal verschiedene Individuen, oft Tausende von Kilometern getrennt, gleichzeitig kurz vor einem Durchbruch standen oder diesen auch erzielen konnten. Über Jahrhunderte war das Ansinnen, das Bildnis eines Menschen zu erschaffen, auf Angehörige bestimmter sozialer Schichten begrenzt. Ein Porträt oder die Darstellung einer Gruppe von Menschen erforderte die Anwesenheit und die Fähigkeiten eines Malers sowie die Mittel, diesen zu bezahlen. Manchmal tat es indes auch ein Zeichenstift in der Hand eines begabten Freundes oder Familienmitgliedes. Einige solcher Zeichnungen sind berühmt – weil Objekt und manchmal auch Zeichner berühmt waren oder es später wurden wie im Fall der von Franz Theodor Kugler(1) zehn Jahre vor Erfindung der Fotografie angefertigten Zeichnung des noch jungen Heinrich Heine(1).
Mussten ein Landesherr oder vielleicht seine Konkubine noch tagelang Modell sitzen (oder vielleicht auch stehen oder liegen), wenn sie sich von einem Hofmaler porträtieren lassen wollten, so bedurfte es für das Objekt der von Robert Cornelius(5) angewandten Methode nur noch eines Zeitaufwandes von 15 oder 20 Sekunden. Dies und die weitgehend problemlose Verfügbarkeit der Platten und der notwendigen Chemikalien (ein gewisses Budget vorausgesetzt) führte in kürzester Zeit zu einer Demokratisierung des Porträts. Und zu einer Allgegenwart von Bildnissen von Menschen ab etwa 1840: Berühmten und Unbekannten, Jungen und Alten, aber auch Gesunden wie Kranken. Der Mann, der Robert Cornelius um einige Wochen oder gar Monate geschlagen hatte beim Bestreben, das erste light picture zu schaffen, war Louis-Jacques-Mandé Daguerre(1), der sein wahrscheinlich bereits im Jahr 1838 entstandenes Foto am 19. August des folgenden Jahres in Paris vorstellte; dieser Tag wird in Werken zur Fotografiegeschichte meist als die Geburtsstunde der Technik und auch der Fotografie als Kunstform bezeichnet. Daguerre war indirekt auch an einem Ur-Prototyp beteiligt gewesen, der primär Joseph Nicéphore Niépce(1) zugeschrieben wird. Er entstand 1826 oder 1827 und war aus Niépces Arbeitszimmer in Saint-Loup-de-Varennes aufgenommen. Die mit lichtempfindlichem Asphalt beschichtete Platte bedurfte einer Belichtungszeit von acht Stunden. Dieser Umstand und das Resultat, eine recht undeutliche Anordnung von Gebäuden, sprachen gegen eine weite Verbreitung der von Niépce als Heliographie bezeichneten Methode – ein Begriff, der angesichts der benötigten hohen und langzeitigen Intensität von Sonnenlicht durchaus angemessen war.
Daguerres(2) Methode, die auf der Lichtexposition von Silberplatten (bald aus Kostengründen durch silberbeschichtete Platten aus anderen Materialien wie Kupfer ersetzt) beruhte, war praktikabler. Zunächst jedenfalls, bis einige Jahre später andere Verfahren wie die Kollodium-Nassplatte und das erste Positiv-Negativ-Verfahren des Briten Henry Fox Talbot(1) aufkamen. Als Daguerreotypie war die Methode indes bis weit nach der Jahrhundertmitte vor allem in Amerika populär. Daguerres heute weltberühmte Aufnahme, die Ansicht des Boulevard du Temple in Paris, zeigt die beiden ersten fotografisch dokumentierten Menschen. Ihre Namen sind nicht überliefert; es sind ein Schuhputzer und sein Kunde im linken Vordergrund. Ihnen muss Daguerre eingeschärft haben, sich über die gesamte Belichtungszeit nicht zu bewegen, bevor er wieder in sein Zimmer im dritten Stock stürmte, an dessen Fenster er seine Kamera aufgestellt hatte. Die anderen zu diesem Zeitpunkt sicherlich auf dem Boulevard anwesenden Flaneure wurden aufgrund dieser recht langen Zeitspanne nicht erfasst; sie hinterließen nicht einmal einen Schatten auf diesem einzigartigen historischen Dokument.
Vielsagend ist der schnelle Gang der Ereignisse: Im August 1839 berichtet Daguerre(3) einer breiteren Öffentlichkeit über die Innovation, einige Wochen später fertigt Cornelius(6) sein Selbstporträt an – und bereits wenige Monate darauf eröffnet am Broadway in New York das erste kommerzielle Fotostudio, das angesichts des Zustroms von Kunden umgehend ein Erfolg wird. Robert Cornelius steigt ebenfalls in das Geschäft ein und eröffnet Studios in Philadelphia und Washington. Die Begeisterung der Zeitgenossen für diese neue Technologie spiegelt ein sich zunehmend zumindest im Bürgertum ausbreitendes Lebensgefühl wider: eine fast grenzenlose Offenheit für technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, sei es für die durch die Eisenbahn möglich gewordene individuelle Mobilität, sei es für die in der Fotografie Ausdruck findende Freude am eigenen Bildnis oder dem der Familie, sei es am medizinischen Fortschritt, den dieses dynamische Jahrzehnt, die 1840er Jahre, in so ungewöhnlich nachhaltigem Maße erleben wird.[2]
Fast könnte man es einen Fingerzeig nennen: Die beiden Inhaber des Daguerreian Parlor in Manhattan sind bis zu dessen Eröffnung am 4. März 1840 in einer Branche tätig gewesen, die wir heute als Medizintechnik bezeichnen würden. Alexander Wolcott(1) und John Johnson(1) fertigten bis dahin Geräte für Dentisten an. Und die Medizin ihrerseits machte sich die Fotografie umgehend zunutze. Der französische Arzt Alfred François Donné(1) war einer der führenden Mikroskopiker(1) der Epoche und hatte sich unter anderem durch die Erforschung der Absonderungen aus dem Urogenitaltrakt von Syphilis(1)- und Gonorrhoe(1)-Patienten einen Namen in der Fachwelt gemacht. Das war freilich eine Thematik, über die in einer breiten Öffentlichkeit nicht oder nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Im Zuge dieser Subspezialisierung entdeckte Donné 1836 das Protozoon Trichomonas vaginalis (das immerhin noch im Jahr 2016 von einer deutschen Fachgesellschaft zum »Einzeller des Jahres« gewählt wurde), den Erreger der Trichomoniasis(1), einer sexuell übertragbaren Erkrankung. Donné war so begeistert von den Welten, die das Mikroskop(2) – das um 1840 bei weitem noch nicht so leistungsfähig war wie die später von Robert Koch und Louis Pasteur benutzten Modelle – offenbarte, dass er aus eigener Tasche 20 Mikroskope kaufte, sie in einem Hörsaal der Universität in Paris aufstellte und damit relativ große Gruppen von Studenten unterrichten konnte.
Die Dokumentation dessen, was Donné(2) und seine Studenten unter dem Mikroskop(3) sahen, war indes oft unbefriedigend; die Befunde – ob menschliches Gewebe, ob Einzeller oder die Trichomonaden – konnten allenfalls per Zeichnung festgehalten und so für den Unterricht oder zur Publikation von Erkenntnissen genutzt werden. Dementsprechend war Donné elektrisiert, als er von Daguerres(4) Erfindung, bekannt gegeben nur einige Straßenzüge entfernt in Paris, hörte. Donné war ebenso wie Daguerre und wie praktisch alle an der Fotografie interessierten Zeitgenossen davon überzeugt, dass es endlich eine »objektive« Bildgebung gab, eine Methode, die Dinge zeigte, wie sie sind, neutral und unbestechlich. Man würde bald mit einer gewissen Enttäuschung lernen, dass Bilder verändert werden können, dass die Fotografie lange vor Photoshop ein Medium war, das sich prächtig zur Manipulation eignet. Manchmal aus ästhetischen Gründen, manchmal zu politischen und Geschäftsinteressen dienenden Zwecken. In erstere Kategorie gehört die in den 1850er Jahren entstandene und von Queen Victoria(1)s Gatten, Prinz Albert(1), sehr geschätzte Komposition Fading Away des britischen Fotografen Henry Peach Robinson(1), die das Sterben einer blassen jungen Frau – das Antlitz und auch der Titel deuten auf die »Schwindsucht(1)«, die Tuberkulose – im Kreise der Familie zeigt. Es entsprach voll dem Zeitgeschmack mit seiner Betonung der Werte des (groß-)bürgerlichen Familienlebens einerseits und einem Todeskult andererseits. Allerdings setzte Robinson die Szene und die Figurengruppe aus nicht weniger als fünf Negativen zusammen.
Donné(3) indes war an der authentischen Wiedergabe der mikroskopischen(4) Befunde interessiert und sicherte sich kompetente Unterstützung. Er begann mit einem jungen Mann namens Léon Foucault(1) zusammenzuarbeiten. Dieser hatte ein Medizinstudium begonnen, dies indes abgebrochen, da er sich nicht zur Arbeit an einer menschlichen Leiche und damit der üblichen Lernmethode im Fach Anatomie(1) überwinden konnte. Er würde seinen Weg in der Wissenschaft dennoch und ohne universitären Abschluss gehen und einer der berühmtesten Physiker des 19. Jahrhunderts werden. Sein Experiment im Pantheon von Paris 1851 mit einem Pendel, das als Foucaultsches Pendel in die Geschichte einging und mit dem er die Erdrotation nachwies, war eine der Glanzstunden der Wissenschaft.
Donné(4) und Foucault(2) arbeiteten an einer Methode, die Lichtstärke und damit die Bildqualität des Mikroskops(5) zu verbessern, und setzten dabei auch die Kraft der – ansonsten noch nicht wirklich zur Beleuchtung genutzten – Elektrizität in einem Photo-électrique-Mikroskop ein. Mit Daguerres(5) Technik und dank hoher Lichtintensität konnten sie Bilder mit einer für damalige Verhältnisse sehr kurzen Belichtungszeit zwischen 4 und 20 Sekunden anfertigen. Donné mikrofotografierte(1) alle denkbaren Körperflüssigkeiten von Blut über Speichel bis hin zu schambesetzteren Ausscheidungen, dazu Zellen oder Zellbestandteile aus unterschiedlichen menschlichen und tierischen Organen. Auch die elementaren Ingredienzen der menschlichen Fortpflanzung wurden bilddokumentiert, die Eizellen der Frau ebenso wie Spermien. Und selbstverständlich fotografierte Donné seine Entdeckung, die Trichomonaden. Die Bildsammlung erschien schließlich 1844 in einem Atlas unter dem Titel Cours de Microscopie(6) – der Vorläufer von Generationen derartiger Lehrbücher, die jeder Medizinstudent in seinem Grundstudium verinnerlichen muss.[3]
Von der Fotografie einzelner Gewebe des menschlichen Körpers bis zur Dokumentation eines, wie die Mediziner sagen, makroskopischen Befundes, der Fixierung des Erscheinungsbildes eines kranken Menschen zur Betrachtung durch Ärzte und Studenten – und im Laufe der Jahre immer häufiger durch eine an Bizarrem und Gruseligem interessierte Laienöffentlichkeit – war es nur ein kleiner Schritt. In Edinburgh gründeten David Octavius Hill(1) und Robert Adamson(1) 1843 ein Fotostudio, das im Verlauf von nur wenigen Jahren eine wahre Schatzkiste von Fotografien produzierte, die zurecht als früher Ausdruck einer neuen Kunstform gelten (und heute in den National Galleries of Scotland zu sehen sind). Hill war ein bereits etablierter Maler mit einem wachen Sinn für lohnende Motive und, so es sich um Personen handelte, deren geschicktes Arrangement. Die beiden schufen Landschaftsaufnahmen und Stadtansichten; jene von Edinburgh gewähren einen Blick in eine ferne Epoche, mit weitgehend freien Straßen, auf denen nur vereinzelt eine Kutsche zu sehen ist. Vor allem aber brachten sie die Porträtdarstellung, gerade vier oder fünf Jahre nach Erfindung der Fotografie, auf ein später nur von wenigen erreichtes Niveau. Neben teilweise experimentellen Einzelporträts wie einer rätselhaften, der Kamera den Rücken zukehrenden Frau – eine höchst ungewöhnliche Komposition, da wohl jeder andere Fotograf weltweit auf Gesichter fokussierte – und einer halb im Schatten liegenden Nude Study eines jungen Mannes sind es vor allem die mit Akribie geplanten Gruppenporträts, welche die Menschen aus einer fernen, längst untergegangenen Welt so lebendig erscheinen lassen: So lacht uns Hill zusammen mit zwei Freunden in Edinburgh Ale bei gefüllten Biergläsern fast schelmisch an, als wolle er unterstreichen, dass auch in den 1840er Jahren der Slogan »Life is good!« gelten konnte. In einem anderen Werk von Hill(2) und Adamson(2) mit dem langen Titel Miss Ellen Milne, Miss Mary Watson, Miss Watson, Miss Agnes Milne and Sarah Wilson sind fünf junge Frauen vor der Kamera gruppiert. Die direkten Blicke, die sie dem Betrachter zuwerfen, ernst aber keineswegs abweisend, wollen wenig zu späteren Klischees dieser Epoche von ritualisierter, keuscher Sittsamkeit passen.[4]
Ganz anders war die persönliche Situation einer Frau, die Hills(3) und Adamsons(3) waches Gespür für ein den Rahmen des Normalen, Konventionellen sprengendes Motiv sofort angesprochen haben dürfte. Wahrscheinlich hat es die beiden einiges an Überredungskunst gekostet, die Dame dazu zu bringen, sich für die Kamera in Position zu stellen. Denn sie war schwer und angesichts der Möglichkeiten der zeitgenössischen Medizin unheilbar krank. Das Bildnis Woman with a goiter zeigt eine Frau mittleren Alters mit dem unübersehbaren Symptom einer schweren Schilddrüsenerkrankung, einem mehr als kindskopfgroßen Kropf(1). Es ist das erste bekannte Foto eines an einer spezifischen Krankheit leidenden Menschen. Trotz des den damaligen wie den heutigen Betrachter schockierenden Befundes dürfte die Frau mit dem Kropfleiden den jungen Fotografen Robert Adamson(4) noch überlebt haben. Als von schwächlicher Gesundheit beschrieben – oft ein Hinweis auf eine Tuberkulose(2) –, starb Hills Partner 1847 im Alter von nur 26 Jahren.
Die Zuversicht, das bürgerliche Selbstbewusstsein, das zahlreiche der von Fotografen wie Hill und Adamson porträtierten Personen ausstrahlen, wie zum Beispiel der junge Chirurg James Young Simpson(1), speiste sich aus der Überzeugung, in einer Zeit fast unbegrenzten Fortschrittes zu leben, der oft mit atemberaubender Geschwindigkeit daherkam. Diesen Zukunftsglauben verkörperte zwar vor allem die Eisenbahn, er wurde aber auch noch von einer anderen Erfindung genährt, die neue Dimensionen im Verständnis von Zeit und Kommunikation eröffnete. Die Übermittlung von Zeichen und letztlich von Informationen über größere Distanzen erlebte ihren Durchbruch. Nachdem 1809 der Anatom Samuel Thomas von Soemmering(1) mit einem elektrischen Telegrafen experimentiert hatte, gelang in den 1830er Jahren mehreren Erfindern die Übertragung elektrischer Zeichen. Der berühmte Mathematiker Carl Friedrich Gauß(1) konnte 1833 zusammen mit dem Physiker Wilhelm Eduard Weber(1) eine solche Verbindung zwischen der Sternwarte in Göttingen und dem Zentrum der Universitätsstadt einrichten. Wirklich anwenderfreundlich wurde die Telegrafie durch die Innovationen des Amerikaners Samuel Morse(1), der nicht nur einen Schreibtelegrafen entwickelte, sondern auch eine Abfolge elektrisch über Leitungen übertragener Zeichen einführte, die in ihrer Reihung für jeweils einen bestimmten Buchstaben standen: das sogenannte Morse-Alphabet. Als Geburtsstunde dieser sich bald über die ganze Welt ausbreitenden Nachrichtentechnologie gilt die Übertragung eines kurzen Bibelzitats – What hath God wrought? – über eine rund 60 Kilometer lange Telegrafenleitung von Washington nach Baltimore am 24. Mai 1844.
Die Leitungen des Telegrafen durchzogen schnell die Länder Europas und verliefen häufig direkt neben den frisch verlegten Eisenbahnschienen, im Miteinander des Personen- und Güterverkehrs und des Datenflusses. Es war eine Revolution in der zwischenmenschlichen und schnell auch zwischenstaatlichen Verständigung. Informationen, im spezifischeren Sinn Nachrichten, konnten jetzt in Echtzeit und über größere Distanzen verschickt werden; sie ließen den Brief, die herkömmliche Depesche hinter sich. Eine Mitteilung des österreichischen Staatskanzlers Metternich in Wien an seinen preußischen Amtskollegen in Berlin, direkt oder in diplomatischer Manier über die österreichische Botschaft, konnte Letzteren binnen Minuten erreichen, nachdem der Bewahrer der postnapoleonischen Restauration auf dem europäischen Kontinent diese in der Hofburg aufgegeben hatte. Die Schnelligkeit der Informationsübermittlung kam indes vor allem der Allgemeinheit, oder – vorsichtiger ausgedrückt – ihrer gebildeten und politisch interessierten Schicht zugute. Es war ein »Lesezeitalter«, in dem nicht nur Buchhändler gediehen und Bibliotheken wohlbesucht waren, sondern vor allem in Kaffeehäusern und vergleichbaren Lokalitäten sich Einzelne oder ganze Lesegesellschaften über Gazetten und Journale beugten. Wer zum Beispiel im klassischen Kaffeehaus Leipzigs, dem Arabischen Coffe Baum, eine Tageszeitung aufschlug, fand bislang Neuigkeiten aus Paris, Wien oder London (oder auch aus Dresden) mit einer Datierung, die mehrere Wochen zurücklag. Mit der Ausbreitung des Telegrafen kam ein neuer Begriff auf: Aktualität. In den Zeitungsredaktionen, die mancherorts mehrere Ausgaben pro Tag herausgaben, konnten nun Nachrichten ins Blatt gesetzt werden, die erst am gleichen Tag aus einer fernen Stadt, einer weit entlegenen Region eingegangen waren; die geschilderten Ereignisse mochten sich erst Stunden vor der Drucklegung zugetragen haben. Das Publikum war nun zeitnah bei Ereignissen jenseits, oft weit jenseits des Horizonts dabei.
In diesem neuen Informationszeitalter, in einer Epoche, in der sich nach mehr als 30 Jahren konservativer Restauration und Repression, nach oft von der Obrigkeit forcierter biedermeierlicher Zurückgezogenheit ins Private enormer sozialer und politischer Sprengstoff angesammelt hatte, konnten die über den Telegrafen eintreffenden und dann mit zeitlicher Verzögerung im normalen Postverkehr präzisierten und mit Hintergrundinformationen gestützten Neuigkeiten aus Paris wie der sprichwörtliche Funke im Pulverfass wirken. Dort war es im Februar 1848 abermals zu einer Revolution gekommen. In einer weit weniger gewalttätigen Erhebung, als es die große Französische Revolution gewesen war, hatten die Franzosen dennoch einen König aus dem Land gejagt (seinen Kopf konnte Louis Philippe(1) im Gegensatz zu seinem Vorfahren Ludwig XVI. behalten). Bald war das Revolutionsfeuer in vielen europäischen Haupt- und Residenzstädten entfacht.
Bis zur Verlegung eines Unterseekabels, das Europa mit Nordamerika verband, dauerte es noch bis ins nächste Jahrzehnt. Deshalb kam die Kunde von einer Revolution, die viel nachhaltiger und segensreicher war als alle Aufstände des Schicksalsjahres 1848 und die den Beginn der Moderne für die Medizin bedeutete, ein gutes Jahr zuvor noch mit der Geschwindigkeit eines Dampfschiffes nach Europa. Sie kam aus der Neuen Welt und überall, in Europa und allen anderen Kontinenten, hatten die Menschen und ihre Ärzte seit Urzeiten auf eine solche Nachricht gewartet.
Es war eine Sternstunde der Menschheit: Am 16. Oktober 1846 wurde in Boston unter Äthernarkose operiert und der alte Traum vom Sieg über den Schmerz wahr. Das Gemälde von Robert Cutler Hinckley entstand 1882, als die Anästhesie längst Routine war und der Chirurgie dadurch ungeahnte Möglichkeiten eröffnet wurden.
2.
Stille in Boston
Keiner der Zuschauer, die an diesem Morgen in großer Zahl die Reihen des Hörsaales füllten, erwartete ernsthaft, Zeuge eines historischen Augenblicks zu werden und der Uraufführung einer der segensreichsten Erfindungen beizuwohnen. Die Herren – es waren ausschließlich Männer, denn für Frauen gab es nach herrschendem Verständnis keinen Platz in der Welt der Medizin – trugen lange Gehröcke über ihren von Westen bedeckten weißen Hemden mit den modernen steifen Kragen, hatten Spazierstöcke zum Zeichen ihrer Würde in der Hand und auf den Köpfen hohe Zylinderhüte, die sie nach Betreten des Auditoriums abnahmen, auch um dem Hintermann nicht die Sicht auf das Spektakel zu versperren.
Die Ärzte Bostons und die Medizinstudenten der nahe gelegenen Harvard University(1) hatten sich an diesem Freitagmorgen wieder einmal eingefunden, um der großen Persönlichkeit der amerikanischen Chirurgie, dem 68-jährigen John Collins Warren(1), bei einer seiner für die Fachwelt öffentlichen Operationen zum Zwecke der Fortbildung, vielleicht auch des voyeuristischen Grusels, beizuwohnen. Wenn der als Hörsaal dienende Operationsraum des Massachusetts General Hospital(1) an diesem Tag bis auf die letzte Sitzreihe gefüllt war, so lag dies auch daran, dass man ein besonderes Amüsement erwartete, hatte doch das Gerücht die Runde gemacht, es werde möglicherweise operiert, ohne dass der Patient Schmerzen verspüre. Doch die Hoffnungen, einem der unzähligen Wundermittel und Wunderliches verheißenden Gaukler, an denen die Medizin so überreich war, bei seiner Blamage zuzuschauen, sollten in der nächsten Stunde aufs Angenehmste, aufs Sensationellste enttäuscht werden.
In den Briefen, Erinnerungen und Tagebüchern, die viele der Beobachter hinterließen, spiegeln sich stattdessen Fassungslosigkeit und Bewegung wider angesichts des Schauspiels, das ihrer nun harrte, und Dankbarkeit, es miterlebt zu haben. Denn dort, wo seit Menschengedenken Agonie und Pein, Qual und Verzweiflung geherrscht hatten, traten plötzlich Stille und Hoffnung ein. Es war Freitag, der 16. Oktober 1846. Im Verhältnis des Menschen zu seinen körperlichen Leiden würde nach dem Tag von Boston nichts mehr so sein, wie es einst war.
Gegen zehn Uhr betrat Warren(2) den Hörsaal. Selbstsicher bis zur Blasiertheit, kalt bis zum Zynismus, kündigte der berühmte Chirurg mit emotionsloser Stimme an, dass in der Tat ein Gentleman an ihn herangetreten sei »mit dem erstaunlichen Anspruch, einen zur Operation anstehenden Patienten schmerzfrei zu machen«. Schmerzfrei – welch eine Vermessenheit! Wie manch einer der Zuschauer so ließ auch Henry J. Bigelow(1), ein begabter, junger Bostoner Arzt, der die Ereignisse dieses Vormittags ausführlich beschrieben hat, die Gedanken zurückschweifen durch die Geschichte der Heilkunst der letzten 3000, 4000 Jahre. Bigelow, Spross einer Medizinerfamilie, war sich bewusst, dass sich eigentlich nicht viel verändert hatte, seit die ersten Heilkundigen (wenn sie denn diese Bezeichnung verdienten) im Zweistromland, in Afrika oder im präkolumbianischen Amerika ein Skalpell angesetzt hatten. Jeder operative Eingriff bedeutete unvorstellbare Schmerzen für die Unglücklichen, die sich ihm unterziehen mussten.
Die Mediziner hatten seit der Antike nach Abhilfe gesucht, Kräuterextrakte und alkoholgetränkte Schlafschwämme ebenso probiert wie Opium(1) und die von dem deutschen Arzt Franz Anton Mesmer(1) entwickelte Methode der »Magnetisierung«, die einen hypnoseähnlichen Zustand erzeugte, eine Art von Suggestion – alles war vergebens gewesen. Sobald der Chirurg den ersten Schnitt führte, der Dentist die Zange ansetzte, hallten Lazarette und Hospitäler wider von den Schreien der Gequälten. Der Schmerz schien der schicksalhafte Begleiter der operativen Medizin zu sein.
Bigelow(2) wusste, dass der Schmerz nicht nur eine unvorstellbare Qual für den Patienten war, er stellte andererseits auch die Medizin vor sehr enge Grenzen. Nur einige wenige Krankheiten konnten überhaupt operiert werden, an Eingriffe im Brust- oder Bauchraum konnte bei schreienden, sich auf dem Tisch trotz der starken Arme der »Krankenwärter« windenden Menschen gar nicht gedacht werden. Selbst in einem großen Krankenhaus wie dem Massachusetts General Hospital(2) fanden oft nicht mehr als zwei Operationen pro Woche statt; operiert wurde nur, wenn es unvermeidbar erschien. Dabei war Schnelligkeit das oberste Gebot für jeden Chirurgen. Der Eingriff musste beendet sein, bevor der Kranke am Schock seiner Qualen sterben konnte. So waren die bedeutendsten Operateure der Epoche auch die schnellsten. Jean-Dominique Larrey(1), Napoleons Leibchirurg, vermochte einen Arm im Schultergelenk in zwei Minuten zu amputieren(1). Und der berühmteste europäische Chirurg in diesem Jahre 1846, Sir Robert Liston(1) in London, operierte mit einer unvorstellbaren, virtuosen Rapidität, so flink, dass er einmal bei einer hohen Oberschenkelamputation versehentlich einen Hoden des Patienten und zwei Finger des Assistenten mitentfernte.
Was die Spannung an diesem Morgen noch erhöhte: Viele der Ärzte und Medizinstudenten im Auditorium erinnerten sich daran, dass vor gut einem Jahr schon einmal ein junger Kollege, der Zahnarzt Horace Wells(1) aus Hartford im benachbarten Bundesstaat Connecticut, von Warren(3) die Erlaubnis bekommen hatte, ein Mittel zur Verhinderung des Operationsschmerzes, hier an gleicher Stelle, in diesem Hörsaal, vorzuführen. Damals hatte der Patient ein von Wells bereitgestelltes Gas eingeatmet, schien nach wenigen Atemzügen ohnmächtig zu werden, hatte jedoch – wie Millionen Kranke vor ihm – aufgeschrien, als Warren den Hautschnitt machte. Wells wurde mit Pfiffen und Rufen wie »Swindle, swindle!« aus dem Hörsaal getrieben.
Auch diesmal schien das große Versprechen hohl zu sein, als Warren(4) auf seine Uhr sah und mit den von allgemeinem Gelächter begleiteten Worten »Da Dr. Morton(1) nicht eingetroffen ist, nehme ich an, er ist anderweitig beschäftigt«, andeutete, dass man es abermals mit einem Prahler zu tun gehabt habe. Bigelow(3) war sich da nicht so sicher. Er kannte den 27-jährigen Zahnarzt William Thomas Green Morton als einen gewissenhaften Vertreter seiner Zunft, und er wusste, dass wenige Tage zuvor in dessen Bostoner Praxis Erstaunliches geschehen war.
Morton(2), am 9. August 1819 auf einer Farm in einer ländlichen Region des Staates Massachusetts in bescheidene Verhältnisse hineingeboren, hatte nur eine rudimentäre Schulausbildung; früh musste er arbeiten, um für sich und seine Familie zum Lebensunterhalt beizutragen. Er wechselte häufig die Jobs und war in einige Geschäfte verwickelt, die anrüchig, vielleicht gar kriminell waren – in der amerikanischen Gesellschaft, vor allem jener dieser Jahre, in der making money ein hoher Wert ist, sank und sinkt die Verdammnis reziprok zu den erwirtschafteten Beträgen. Schließlich wandte er sich der Zahnmedizin(1) zu. Seine Biografen sind sich nicht einig, ob er das Fach wirklich am Baltimore College of Dental Surgery(1) studiert hat oder es, wie damals meist üblich, als Gehilfe eines Dentisten erlernt hat. In Mortons Fall war sein Lehrer niemand anderes als Horace Wells(2). Morton schließlich eröffnete eine eigene Praxis in Farmington, unweit von Connecticuts Hauptstadt Hartford. Bei seiner Ankunft in dem kleinen Ort fiel ihm umgehend die 15-jährige Tochter der führenden Familie Farmingtons auf, Elizabeth Whitman(1). Es war die sprichwörtliche Liebe auf den ersten Blick. Elizabeth, die er im Mai 1844 heiratete, wurde in Mortons stürmischem Leben seine wichtigste Stütze und Vertraute, die an ihn glaubte, als sich alle gegen ihn verschworen zu haben schienen. Morton(3) war ein begabter und geschickter Dentist, und bald konnte er in Boston, der Metropole Neuenglands, eine Praxis eröffnen. Hier arbeitete er weiter an einem Gedanken, der ihn schon lange umtrieb.
Am Abend des 30. September, gut zwei Wochen vor jenem Vormittag im Massachusetts General Hospital(3), hatte zu später Stunde ein Patient an Mortons(4) Tür geklopft. Eben H. Frost(1), ein Musiker, litt unter fürchterlichen Zahnschmerzen, hatte gleichzeitig aber panische Angst vor der Qual der Extraktion. Morton hatte, wie gesagt, eine Zeitlang mit dem unglücklich gescheiterten Horace Wells zusammengearbeitet und war fasziniert von der Idee, die Inhalation eines betäubenden Gases könne einen Rausch- oder gar Schlafzustand erzeugen, der für äußere Reize unempfindlich mache – und besonders für Schmerzen. Wells(3) hatte mit Stickoxydul(1), auch Lachgas genannt, gearbeitet; Mortons Experimente konzentrierten sich hingegen zunehmend auf den Schwefeläther(1), dessen Dämpfe offensichtlich die Sinne verwirren konnten. So ließ er den von Zahnschmerzen geplagten abendlichen Gast Ätherdämpfe einatmen und entfernte mit schnellem Griff den kranken Zahn(2). Als Frost, aus seiner Bewusstlosigkeit erwachend, ihn fragte, wann es denn losgehe, deutete Morton auf den am Boden liegenden Zahn. Der Dentist stand nun kurz vor einer Entdeckung, die der ganzen Menschheit zugutekommen konnte – was man wohl nur von den wenigsten Erfindungen behaupten kann. Er schrieb Warren(5) an und erhielt von diesem die Erlaubnis, seine »Zubereitung« an diesem Freitagmorgen vorzustellen.
Es war nun zwanzig Minuten nach zehn, jener vollen Stunde, zu der man eigentlich den Eingriff angesetzt hatte. Warren(6) wollte sich gerade dem Patienten zuwenden, einem jungen Mann namens Gilbert Abbott(1), der unter einem gutartigen Tumor(1) unterhalb des Kiefers litt, als die Hörsaaltür aufflog und Morton(5) atemlos hereinstürzte. Er hatte bis zur letzten Minute zusammen mit einem Instrumentenmacher an dem Flüssigkeitsbehälter gearbeitet, den er unter dem Arm trug und der an ein Retortengefäß erinnerte.
Morton(6) mag bemerkt haben, dass einigen Zuschauern der Spott ins Gesicht geschrieben stand. Doch er wirkte gefasst, ging auf Abbott(2) zu und erklärte ihm mit ruhiger Stimme, was er vorhatte. Abbott fasste Vertrauen zu Morton und war vermutlich für jeden Versuch dankbar, die bei der Exzision zu erwartenden Schmerzen zumindest zu lindern. Morton ließ ihn aus dem großen Glaskolben, in dem sich eine undefinierbare Flüssigkeit befand, einatmen. Nach einer Reihe von Atemzügen rollten Abbotts Augen nach oben, und sein Kopf sank leicht auf dem Operationsstuhl zurück, den Zuschauern die kleine Erhebung an seinem Hals deutlich zeigend. Morton wandte sich an Warren(7) und bemühte sich um eine feste Stimme: »Ihr Patient ist bereit, Doktor!«
Warren(8) beugte sich über Abbott(3) und machte mit einem jener Messer, die damals nicht gereinigt, geschweige denn sterilisiert, sondern nur abgeputzt wurden, den Hautschnitt. Für einen Moment hielt Warren inne, denn der Initialschrei, den er bei den unzähligen Operationen seiner langen Chirurgenlaufbahn stets vernommen hatte, blieb aus. Abbott regte sich nicht. Plötzlich wurde es still im Hörsaal. Warren unterband die leicht spritzenden Gefäße und exstirpierte den Tumor(2) ohne Mühe. Mit schnellen, geschickten Bewegungen verschloss der Routinier die Wunde. Die ganze Operation nahm kaum mehr als fünf Minuten in Anspruch.
Abbott(4) zeigte immer noch keine Regung. Warren(9) richtete sich auf und drehte sich langsam zum Publikum, das kaum zu atmen wagte. Sie alle bemerkten die Veränderung im Gesicht des Chirurgen. Da war kein Hochmut, kein Sarkasmus mehr, nur grenzenlose Verwunderung, wenn nicht gar Rührung. Der sonst so eiskalt wirkende Arzt hatte Mühe, seiner Emotionen Herr zu werden, als er mit bebender Stimme jenen Satz sprach, der zum bedeutungsvollsten in der Medizingeschichte wurde: »Gentlemen, this is no humbug!«
Nein, es war kein Humbug. Es war eine Revolution, ein Segen, ein Wunder, das der Heilkunde neue Möglichkeiten eröffnete und Eingriffe ermöglichte, an die sich bislang noch kein Operateur herangewagt hatte – wie die heute simpel wirkende Entfernung eines vereiterten Blinddarms, die damals einem Todesurteil gleichkam. Als Gilbert Abbott(5) aus seinem schlafähnlichen Zustand erwachte und es kaum begreifen konnte, dass bereits alles überstanden sei, war jedem der anwesenden Ärzte und Studenten klar, dass von diesem Hörsaal aus schlagartig eine neue Epoche ausginge und ein jeder von ihnen behaupten konnte, dabei gewesen zu sein.
Letzte Zweifel wurden wenige Tage später beseitigt, als Morton(7) seine Methode bei jenem Eingriff anwandte, der für die Ärzte den Höhepunkt zeitgenössischer Chirurgie, für den Kranken das Schlimmste an Qual und Verstümmelung darstellte: die Amputation(2) eines Beines. Auch diesmal blieb es, als die Säge die extrem sensible Knochenhaut berührte, still.
An jenem 16. Oktober 1846 war die Sorge um den Patienten bei Morton(8) größer als die Erleichterung über die gelungene Demonstration. Seine Frau Elizabeth(2) notierte, wie ihr Mann erst am Nachmittag wieder heimkam, nachdem er offenbar Abbott(6) beobachtet hatte und Folgen der Narkose(1) bei ihm befürchtete: »Es wurde zwei Uhr, es wurde drei Uhr. Und es war schon fast vier, als Dr. Morton heimkam. Sein freundliches Gesicht war so angespannt, dass ich befürchtete, er sei gescheitert. Er nahm mich in den Arm, dass ich fast davor war, ohnmächtig zu werden, und sagte sanft: ›Well, meine Liebe, ich hatte Erfolg.«[1]
Drei Wochen nach der Premiere der Methode informierte Henry J. Bigelow(4) die Fachwelt Neuenglands mit einem Vortrag vor der Boston Society of Medical Improvement(1) über das kaum Glaubhafte. Von der Neuen Welt breitete sich die Kunde in Briefen und wissenschaftlichen Kurzberichten über den Erdball aus. Eines der ersten die Transatlantikroute befahrenden Dampfschiffe, die zu dem sich etablierenden Unternehmen des Reeders Samuel Cunard gehörende Acadia, verließ den Hafen von Boston am 3. Dezember 1846, stoppte kurz und planmäßig im zu Großbritanniens nordamerikanischem Besitz (ab 1867 das Land Kanada) gehörenden Halifax und erreichte nach stürmischer Überquerung des Ozeans am 16. Dezember Liverpool. In der Postkiste befanden sich Briefe von Bostoner Augenzeugen an britische Kollegen, darunter ein längeres Schreiben Henry Bigelows an den in London lebenden amerikanischen Botaniker Francis Boott(1). Die Kunde von der ersten schmerzlosen Operation reiste indes auch als Gesprächsstoff auf dem Dampfer mit; der Schiffschirurg hatte so viel über den Äther(2) und seine Wirkung erfahren, dass er umgehend nach Ankunft in Liverpool einem ärztlichen Kollegen berichtete. Und auch eine Liverpooler Zeitung druckte am 18. Dezember einen ersten Bericht ab.
Bigelows(5) Brief elektrisierte natürlich auch Boott(2), der wiederum mit Robert Liston(2) gut bekannt war. Ihm vermittelte er Bigelows enthusiastischen Bericht. Londons Starchirurg war alles andere als ein Zögerer und beschloss, umgehend die neue Methode auszuprobieren – Schwefeläther(3) war eine wohlbekannte und verfügbare Substanz. Bereits am 21. Dezember 1846 wandte Robert Liston in London im Operationssaal erstmals die Äthernarkose(2) an. Er entfernte das bei einem Unfall zertrümmerte und schließlich – bei den damaligen Hygieneverhältnissen in den Kliniken nicht verwunderlich – von einer Wundinfektion(1) zerfressene Bein eines Butlers namens Frederick Churchill(1) in einer rekordverdächtigen Zeit von 25 Sekunden – der nicht uneitle Chirurg hatte meist einen Assistenten an seiner Seite, der die Zeit maß. Auch Frederick Churchill wurde erst durch den Anblick des blutenden Stumpfes davon überzeugt, dass die gefürchtete Operation bereits überstanden war, ein Anblick, dessentwegen der Patient zum zweiten Mal binnen weniger Minuten das Bewusstsein verlor. Listons Beurteilung der neuen Erfindung war, wie immer bei diesem Poltergeist, frank und frei: »This yankee dodge, gentlemen, beats mesmerism hollow!«
Der »Yankee-Trick«, für den der Bostoner Arzt und Schriftsteller Oliver Wendell Holmes(1) den Begriff Anesthesia(3) empfahl, schlug auch in der deutschen Medizin ein wie eine Bombe. Am 24. Januar 1847 führte der Erlanger Chirurg Johann Ferdinand Heyfelder(1) die erste Äthernarkose(4) in Deutschland durch: »Michael Gegner(1), 26 Jahre alt, Schumachergeselle, blass, abgemagert und nicht kräftig, seit längerer Zeit an einem umfangreichen, kalten Abszess(1) auf der linken Hinterbacke leidend, begann am 24. Januar Vormittags dritthalb Stunden nach eingenommenem Frühstück, das in einer Suppe bestand, die Ätherinhalationen(5) mit Hilfe eines Apparates, der aus einer Schweinsblase und einer Glasröhre zusammengesetzt war, durch den Mund bei verschlossenen Nasenöffnungen …«[2] Diese Operation gelang so ermutigend, dass Heyfelder bereits im März auf einhundert Narkosen(4) zurückblicken konnte. Die neue Methode erleichterte das Chirurgenhandwerk ungemein, so dass sich Heyfelder zu dem nicht allzu pietätvollen Lob hinreißen ließ, das Operieren gehe nun so gut »wie an einer Leiche«. Die Äthernarkose wurde überall schnell Allgemeingut im Repertoire der Chirurgen und Dentisten, ihre wundertätige Wirkung füllte die Spalten jeder Zeitung, in den Städten wie in der teilweise noch vorindustriellen Provinz.
Doch bald wurde deutlich, dass auch dieser epochale Fortschritt seinen Preis hatte und ein Betäubungsmittel stets auch eine Gefahr darstellt oder, wie es der Kommentator einer medizinischen Fachzeitschrift Jahre später süffisant formulierte: »Man sah dem geschenkten Gaul ins Maul und fand, dass er neben den guten auch schlimme Eigenschaften habe.«[3] Im Februar 1847 gab es erstmals einen Todesfall durch Äthernarkose(5), weitere folgten und wurden in den Fachzeitschriften ausführlich geschildert. Angesichts der völligen Unkenntnis der zeitgenössischen Ärzte von den pharmakologischen Wirkungen von Äther(6) und anderen Narkotika, bei dem noch rudimentären Wissen um die Physiologie(1) von Herz und Kreislauf unter dem Einfluss eines inhalierten Gases, vor allem aber in Anbetracht der groben, auf reinen Schätzungen beruhenden Dosierung – das Narkotikum wurde oft »nach Gefühl« auf ein Taschentuch geträufelt, mit dem man das Gesicht des Patienten bedeckte – nimmt es Wunder, dass es nicht zu wesentlich mehr tödlichen Narkosezwischenfällen(6) kam.
So begeistert die Bostoner Erfindung auch von der Welt aufgenommen wurde, ihres Protagonisten harrte der wohl hässlichste und tragischste Prioritätenstreit in der Geschichte der modernen Wissenschaft. Aus der im Ansatz angelegten amerikanischen Erfolgsstory wurde eine Saga von Hass und Unglück. William Thomas Green Morton(9) hatte gehofft, der Menschheit zu dienen und sich selbst zu nützen. Der Gedanke, mit seiner Entdeckung(7) möglichst viel Geld zu verdienen, war damals für einen echten »Yankee« ebenso wie für eine auf Expansion angelegte amerikanische Gesellschaft nichts Verwerfliches. Zunächst wollte Morton die Identität der wunderwirkenden Substanz geheim halten und hatte, da der charakteristische Duft des Äthers(7) wohl den meisten Zuhörern im Auditorium des Massachusetts General Hospital(4) bekannt vorgekommen wäre, aromatische Öle, gewonnen aus Orangen, zur Verschleierung beigegeben. Seine Bemühungen um eine Patentierung scheiterten, nicht zuletzt, da er alles andere als ein kalter Abzocker war. Denn als ihm die Ärzte des Hospitals drohten, auf weitere Narkosen zu verzichten, wenn er ihnen nicht die Substanz verriete, gab er nach – er wollte nicht dafür verantwortlich sein, wenn abermals sinnlose Quälerei triumphierte.
Doch selbst die Ehre, der Entdecker der Narkose(8) zu sein, wurde ihm streitig gemacht. Mit der Urgewalt eines bösen, alptraumhaften Geistes tauchte ein ehemaliger Lehrer Mortons(10) auf: der Arzt und Chemiker Charles Jackson(1). In einem frühen Stadium seiner Experimente hatte Morton mit Jackson unter anderem auch über den Äther(8) und dessen betäubende Eigenschaften diskutiert. Dies berechtigte Jackson nach eigener Einschätzung, sich als Erfinder der Narkose zu fühlen und Morton um immer größere Geldbeträge zu erpressen. Was der bald physisch wie psychisch unter endlosen Streitereien, Petitionen und Gegenveröffentlichungen leidende Morton nicht wissen konnte: Jackson war ein am Rande der Geisteskrankheit stehender chronisch-besessener Plagiator. Jahre zuvor hatte Jackson auf einer Atlantiküberfahrt den Erfinder Samuel Morse(2) kennengelernt, der ihm launig von seiner elektrischen Telegraphie erzählte. Kaum an Land gegangen, behauptete Jackson, er habe das »Morsen« erfunden, eine Anmaßung, die Morse in einen Jahre währenden Rechtsstreit trieb. Jackson verfügte über hervorragende Kontakte zur wissenschaftlichen Welt in Europa und setzte sofort nach Mortons erfolgreicher Demonstration Depeschen an die französische Akademie der Wissenschaften(1) in Marsch, in denen er sich selbst als Vater der Narkose und Wohltäter der Menschheit feierte. Die Spuren dieser schizoiden Dreistigkeit blieben: Noch immer wird Jackson in manchen Enzyklopädien zu den Wegbereitern der Narkose(9) gezählt.
Diese Ehre hätte weit mehr der unglückliche Horace Wells(4) verdient, der nun auch an Morton(11) und an die Öffentlichkeit herantrat und auf seine frühen Erfahrungen verwies, denen lediglich der Erfolg bei dem großen Auftritt unter Warrens Augen versagt geblieben war. Eine späte Rechtfertigung und bittersüße Ironie der Geschichte: Das von Wells benutzte Lachgas(2) hat in der modernen Anästhesie(10) längst wieder einen festen Platz eingenommen, während Äther(9) und Chloroform(1) schon seit langem obsolet sind. Auch Wells wurde von dem Prioritätenstreit seelisch aufgefressen – »My brain is on fire!«, schrie er sich von der Seele – und machte im Januar 1848 noch einmal Schlagzeilen: In New York wurde er verhaftet, nachdem er mehrere Prostituierte mit Säure bespritzt hatte. In seiner Zelle atmete er(5) Chloroform ein und öffnete sich dann, während seine Sinne durch eine Erfindung schwanden, deren Ruhm ihm nicht vergönnt war, die Pulsadern.
Als ob Jackson(2) und Wells(6) für den gepeinigten Morton(12) nicht genug der Mitbewerber waren, tauchte nun noch ein vierter Entdecker auf. Aus dem weltabgeschiedenen Örtchen Jefferson im Staat Georgia, tief im Süden, im sklavenhaltenden Antebellum South, meldete sich der Landarzt William Crawford Long(1). Heute besteht kein Zweifel daran, dass er bereits am 30. März 1842, viereinhalb Jahre vor dem Tag von Boston, in seiner Praxis eine Operation unter Äthernarkose(10)(11) durchgeführt und dies noch in mehreren Fällen wiederholt hat. Allein, er behielt dies für sich, ganz so, als könne er keinen Vorteil für die auf die Schmerzfreiheit wartende Menschheit erkennen. Die Mentalität künftiger Medizinergenerationen, die jede Forschungsarbeit auf immer subspezialisierteren Kongressen vorstellen, war Long ebenso fremd wie die grundlegende Weisheit der modernen Wissenschaft: Publish or perish; wer nicht publiziert, wird keine Karriere machen. Im Falle Longs, der nichts anderes sein wollte als ein Landarzt, war sein Fehler, die Fachwelt nicht über seine Ergebnisse mit dem Äther(11) zu unterrichten, nicht zum Schaden für ihn, sondern für die vielen Patienten, die zwischen 1842 und 1846 noch ohne jedwede Betäubung operiert werden mussten.
William Thomas Green Morton(13) war kein Heiliger, sondern ein Mensch mit Schwächen, die er vielleicht weniger gut kaschieren konnte als andere Pioniere in der Goldenen Zeit der Medizin. Doch er allein war es, der die erste Narkose(12) öffentlich vornahm, ins Bewusstsein der Zeit einbrachte und wie nur wenige andere die Grundlage für unser modernes und scheinbar so sicheres Leben schuf. Dass seine Pioniertat ihm selbst kein Glück brachte, ist ein Schicksal, das Morton mit einem anderen Wegbereiter teilte, der im Herzen der Alten Welt, in Wien, die zweite bislang unbesiegte Geißel der Medizin neben dem Schmerz zu bekämpfen suchte: die Infektion(1).
Pioniere müssen neue Ideen oft gegen erbitterten Widerstand durchsetzen. Kaum eine Lebensgeschichte eines Neuerers ist so verdienstvoll für Frauen überall auf der Welt und gleichzeitig so voller Tragik wie die des Ignaz Philipp Semmelweis.
3.
Todbringende Hände
Der Tod, dieser Tod machte auch vor den Toren der Reichen und Mächtigen nicht halt. Kaiser Josef II.(1), der Sohn Maria Theresias und schon zu Lebzeiten mit dem Begriff »Reform« eng verbunden, hatte seinen Untertanen ein Krankenhaus bauen lassen, wie es die Welt noch nicht gesehen hatte. Das Allgemeine Krankenhaus(2) in Wien war ein Produkt des rationalen Denkens und Planens im Zeitalter der Aufklärung, von strenger Geometrie, einem System von Innenhöfen und Hunderten von Krankenbetten. Die besten Ärzte der Epoche sollte es anziehen, wie den Geburtshelfer(1) Lucas Johann Böer(1). Doch auch dessen Kunst kam an ihre Grenzen, als der kranke, an Tuberkulose(3) im Endstadium leidende Kaiser ihn zu seiner angeheirateten Nichte rufen ließ, Prinzessin Elisabeth, der Frau des Thronfolgers der Habsburgermonarchie und Neffen Josefs, Prinz Franz. Zwar entband Böer die junge Frau, die als letzte und platonische Liebe des Kaisers geschildert wird, von einem zunächst gesunden kleinen Mädchen. Nur zwei Tage nach der Entbindung jedoch erkrankte die 22-jährige Elisabeth schwer, bekam hohes Fieber und starb. Josef II., ihr kaiserlicher Onkel und Verehrer, legte sich nur zwei Tage später in jenem kalten Winter des Jahres 1790 zur ewigen Ruhe. Die Todesursache der jungen Frau war das Kindbettfieber(1), auch Puerperalfieber genannt. Böer konnte nur wie jeder Arzt hilflos mit den Schultern zucken. Das Kindbettfieber schien eine schicksalhafte Geißel der Menschheit zu sein, bekannt seit der Antike würde es die Mütter dieser Welt zweifellos begleiten bis zum Jüngsten Tag.
Ein halbes Jahrhundert später konnten die wohlsituierten Wiener Familien, von der kaiserlichen über jene der zahlreichen Hofräte in einem für seine ausgeprägte Bürokratie bekannten Staatswesen bis hin zu denen der in dieser Zeit des Booms prosperierenden Kaufleute und Industriellen, diesen Tod zumindest in Grenzen von sich fernhalten. Die Oberschicht brachte ihre Kinder daheim zur Welt, im eigenen Herrenhaus oder der eigenen Villa, und mit etwas Glück konnte den Gebärenden das Schicksal der weithin vergessenen Prinzessin Elisabeth erspart bleiben. Nur etwa einmal auf einhundert solcher Hausgeburten in der Aristokratie und im Großbürgertum musste man das Hinscheiden einer jungen Mutter und nicht selten auch ihres Neugeborenen beweinen.
Die überwiegende Mehrzahl der Wiener Bevölkerung allerdings waren keine »Hochherrschaften«, sondern Kleinbürger und Proletarier. Ihre Frauen brachten die Kinder im Allgemeinen Krankenhaus(3) zur Welt. Doch das einst vom seligen Kaiser Josef eingeweihte Hospital war, sobald es ums Gebären ging, kein Sinnbild medizinischer und sozialer Moderne. Es lag wie ein dunkler Schatten über den schwangeren Wienerinnen. Je näher ein Geburtstermin zu rücken schien, desto besorgtere Blicke galten dem Kalender. Es war stadtbekannt, dass die beiden geburtshilflichen(2) Kliniken des Allgemeinen Krankenhauses im täglichen Wechsel für Neuaufnahmen zuständig waren, für Frauen, bei denen die Wehen einsetzten und die nun in den großen Krankenzimmern ein Bett zugewiesen bekamen, in denen andere Frauen, vor allem die ganz armen und die unverheirateten werdenden Mütter oft gar die letzten zwei Monate ihrer Schwangerschaft verbrachten – eine fürsorgliche Maßnahme des Staates, mit der man Niederkünfte im Schatten von Scham und gesellschaftlicher Verachtung und die oft folgende Tötung des Neugeborenen durch die verzweifelte Mutter zu verhindern suchte. Noch etwas anderes wusste ganz Wien: In der Ersten Geburtshilflichen(2) Klinik grassierte das Kindbettfieber(2) in erschreckendem Ausmaß, eine Einlieferung dort wurde von vielen Schwangeren als eine Art Todesurteil angesehen. So versuchten immer wieder Frauen, die Aufnahme in der Ersten Klinik zu vermeiden, wenn diese am entscheidenden Tag für Gebärende verantwortlich war, und unter allen Umständen es unter Wehen irgendwie bis zur Nachmittagsstunde zu schaffen, in der die Bereitschaft wechselte. Dann war die Zweite Geburtshilfliche(1) Klinik zuständig – zwar kam es auch hier zu Todesfällen durch Kindbettfieber, doch das war bekanntermaßen weit seltener der Fall als in der Ersten Klinik; die Sterblichkeitsrate der Mütter lag in der Zweiten Geburtshilflichen Klinik meist nur leicht über jener der Hausgeburten.
Die klassischen Erklärungsversuche der Ärzteschaft versagten hier besonders eklatant. Gemeinhin machte man Miasmen(1), krankheitsauslösende Stoffe in der Luft oder im Boden, oft auch sogenannte konstitutionelle Schwächen der Patientinnen für solche epidemieartigen schweren fiebrigen Erkrankungen verantwortlich. Dies alles griff im Falle der beiden Gebärkliniken(3) überhaupt nicht. Die Patientinnen lagen im gleichen Gebäude, atmeten die gleiche Luft, bekamen das gleiche Essen. Es war ein schwacher Trost für die Wiener Klinikleitung, zu erfahren, dass die österreichische Hauptstadt nicht allein stand. Im Zuge der Europa erfassenden Industrialisierung wuchsen die Städte, nahm die Bevölkerung zu – vor allem jenes demografische Segment, das man die unteren Schichten (oder in Wien: das gemeine Volk) nannte. So bauten der Staat oder die Kirchen spezielle Gebärkliniken, in Berlin und Paris und New York. Die Niederkunft, seit Jahrhunderten im privaten Rahmen des eigenen Heims, der eigenen Bauernkate abgehalten, wurde zu einem quasi-öffentlichen, von den Autoritäten begleiteten und dokumentierten Ereignis.
Es lag sicher nicht an der intellektuellen und wissenschaftlichen Qualität der am Allgemeinen Krankenhaus(4) in Wien tätigen Mediziner. Viele von ihnen waren in Fachkreisen hochangesehen, einige waren gar weltberühmt. Gerade um die Mitte des 19. Jahrhunderts erblühte in der Donaumetropole die ärztliche Kunst, das Forschen am menschlichen Körper und seinen Krankheiten, erneut. Erneut, da es zu Zeiten der Kaiserin Maria Theresia Mitte des 18. Jahrhunderts um deren Hofarzt, den Niederländer Gerard Van Swieten(1), eine weithin gerühmte »Wiener Medizinische Schule(1)« gegeben hatte. Für die Koryphäen, die sich ab den 1840er Jahren hier versammelten und zu denen später unter anderem der große Chirurg Theodor Billroth(1) gehören sollte, wurde bald der Begriff der »Zweiten Wiener Medizinischen Schule(1)« geprägt.
Der Wegbereiter dieses Aufschwungs war ein Mann, der das bis dahin wenig reputierliche Fach der Pathologie, präziser gesagt: der Pathologischen Anatomie(2), zu einer Grundlage des medizinischen Wissens und Verständnisses machte: Carl von Rokitansky(1). Seit 1830 arbeitete Rokitansky an der Pathologisch-Anatomischen Anstalt(1) der Universität Wien, vier Jahre darauf wurde er Professor und Leiter des Pathologisch-Anatomischen Museums(1). Seine Sektionen, von denen er in den 45 Jahren seiner Tätigkeit mehr als 30 000 durchführte, waren das wichtigste Forum zum Erwerb von Wissen für die Medizinstudenten, übertroffen allenfalls von seinen Vorlesungen, in denen der Gelehrte eine anschauliche Sprache pflegte, um krankhafte Befunde zu beschreiben. So verglich er den Schleim in einer entzündeten Gallenblase mit »Anchovispaste«, die Blut- und Sekretfüllung einer Zyste mit »Himbeermarmelade« und die Konkremente in einem krebskranken Magen mit »Kaffeesatz«.[1] Dem mit den Jahren ansteigenden Ruf Rokitanskys wurden die Räumlichkeiten, in denen er den wichtigsten Aspekt seines Berufs ausübte, nicht gerecht. Seine Sektionen fanden in einer Baracke im »Leichenhof«(3) des Allgemeinen Krankenhauses(5) statt. Das beeinträchtigte seinen Eifer für die Pathologie als Wissenschaft nicht, und für seine Studenten waren die meist vier bis sechs Sektionen an einem Vormittag ein Höhepunkt in ihrem Lernprozess. Die hohe Müttersterblichkeit in der Ersten Geburtshilflichen(3) Klinik und deren räumliche Nähe – es waren nur wenige Schritte vom Sektionsraum bis zur Gebärklinik – sorgten dafür, dass frisch entbundene, am Kindbettfieber(3) gestorbene Frauen regelmäßig auf Rokitanskys Tischen landeten – manchmal auch ihre schnell verstorbenen Babys. Das Entsetzliche, aber auch Geheimnisvolle des von eitrigen Abszessen(2) durchsetzten Körpers der Frauen beeindruckte einen Studenten aus dem ungarischen Teil der Habsburgermonarchie so sehr, dass er beschloss, sich auf die Geburtshilfe(4) zu spezialisieren. Sein Name war Ignaz Philipp Semmelweis(3).
Der junge Mann war am 1. Juli 1818 in Buda, einer der beiden Hälften der ungarischen Hauptstadt Budapest, in eine wohlhabende, großbürgerliche Kaufmannsfamilie geboren worden. Sein Geburtshaus kann man durchaus im Stil der Zeit als Palais bezeichnen, es ist heute Sitz des seinen Namen tragenden medizinhistorischen Museums. Ignaz wuchs in einer wahrhaft multikulturellen Gesellschaft heran, das Reich der Habsburger war Heimstatt von gut einem Dutzend Nationalitäten und von (mindestens) elf verbreiteten Sprachen. Des jungen Mannes Gebrauch der deutschen Sprache war vom donauschwäbischen Dialekt seiner Familie geprägt; es war ein Merkmal, das ihn in seinen Jahren in Wien zum Fremden stempelte – nicht schlimm, solange man unauffällig bleibt; Grund für Diskriminierung und Spott, wenn man sich mit den Vorgesetzten und den Autoritäten anlegt. Außerdem sprach er Ungarisch fließend und lernte in der Schule bereits in jungen Jahren Latein. Bildung spielte für seine Familie eine wichtige Rolle. Wie seine Brüder besuchte Semmelweis(4) ein katholisches Gymnasium, nach dessen Abschluss er zunächst in Pest, auf der anderen Seite der Donau, Philosophie studierte. 1837 zog er nach Wien, um dort an der Universität Jura zu studieren; er wollte dem Rat seines Vaters folgen und Militäranwalt werden.