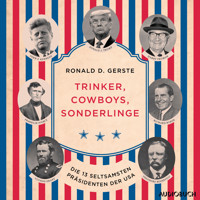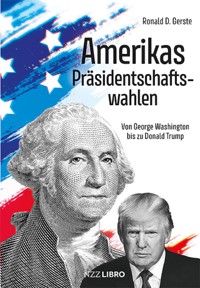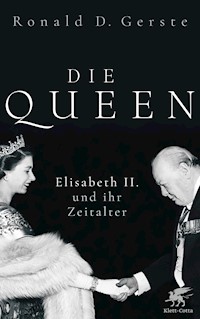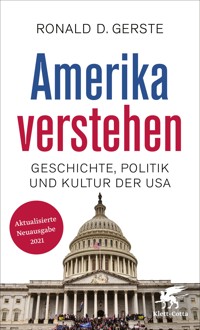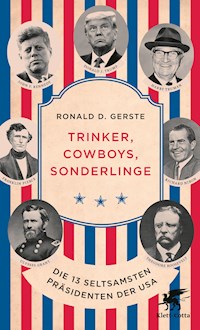9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hitzejahre, klirrende Kälte, Sturmfluten: Eindrucksvoll zeigt Ronald D. Gerste, wie langfristige Klimaveränderungen und einzelne Wetterereignisse sich auf die Gesellschaften und die Kulturen der Menschheit auswirkten und sogar den Verlauf der Geschichte beeinflussten. Hitzejahre, klirrende Kälte, Sturmfluten: Eindrucksvoll zeigt Ronald D. Gerste, wie langfristige Klimaveränderungen und einzelne Wetterereignisse sich auf die Gesellschaften und die Kulturen der Menschheit auswirkten und sogar den Verlauf der Geschichte beeinflussten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ronald D. Gerste
Wie das Wetter Geschichte macht
Katastrophen und Klimawandel von der Antike bis heute
Impressum
Bildnachweis:
akg-images: S. 30, 53, 117, 128, 160, 165, 182, 189, 227, 239, 245, 278; Veintimilla/akg-images: S. 58; Jost Schilgen/akg-images: S. 60; Album/Universal Pictures/akg-images: S. 199; Urs Schweitzer/akg-images: S. 206; Tony Vaccaro/akg-images: S. 245; Lothar Heidtm/ picture-alliance/akg-images: S. 249; dpa/picture-alliance/akg-images: S. 264; Universal Images Group/Universal History Archive/akg-images: S. 271.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2015, 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung folgender Abbildungen:
akg-images/picture-alliance/Lothar Heidtm (Flut in Hamburg-Wilhelmsburg)
akg-images (Russischer Feldzug 1812. Rückzug der Grande Armee)
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96253-6
E-Book: ISBN 978-3-608-10847-7
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar
Inhalt
Prolog
Optimum und Imperium: Von der Blüte Roms ins »dunkle Zeitalter«
Die Aura der Demokratie
Der fahle Schatten der Sonne und die Pest des Justinian
Zeugnisse der Klimageschichte
Das abrupte Ende der Maya-Hochkultur
Die Mittelalterliche Warmperiode
Götterwind
Der lange Regen, der Große Hunger, der Schwarze Tod
Die Kleine Eiszeit
Der »Protestantische Sturm« rettet England vor der Armada
»The coldest winter in memory …«
Die Fortune des George Washington
Hagel – das Totenglöcklein des Ancien Régime
»Regen ist konterrevolutionär!«
Die festgefrorene Flotte
Napoleons Schicksal I: Russische Wetterextreme
Napoleons Schicksal II: Regen und Schlamm bei Waterloo
»Regen wie das Rauschen eines mächtigen Katarakts …«
Das Jahr ohne Sommer
Nebel über München
Als der Vormarsch der Wehrmacht einfror
D-Day: Die Ruhe inmitten des Sturms
Sommerhitze über der Wolfsschanze
Die Nebel des Krieges – Hitlers letzte Offensive in den Ardennen
Der Hungerwinter
Sturmflut
Operation Eagle Claw – eine Präsidentschaft endet im Sandsturm
Hurrikan Katrina
Kalifornien trocknet aus
Die kurze Geschichte der (derzeitigen) globalen Erwärmung
Anmerkungen
Prolog
Thorkel Farserk muss ein gleichermaßen athletischer wie gastfreundlicher Mann gewesen sein. Als ihn die Kunde ereilte, dass sein Cousin Eirik zu Besuch käme, wollte ihm Thorkel ein angemessenes Festmahl bereiten. Ein Schaf musste es sein. Mehrere dieser Tiere wurden auf einer Insel in Sichtweite von Thorkels Farm gehalten. Da kein Boot zur Verfügung stand, stieg Thorkel ins Wasser und schwamm kurzerhand zu dem kleinen Eiland – mit, so steht zu vermuten, allenfalls dem Notwendigsten bekleidet. Auf der anderen Seite angekommen, griff sich Thorkel ein Schaf und schwamm mit ihm auf dem Rücken wieder zurück. Dem Schmaus mit Verwandten stand nichts mehr im Wege.
Was Thorkels Nahrungsbeschaffung so bemerkenswert macht, ist weniger die Tatsache, dass das Schaf als alt beschrieben wird und somit auch nach Stunden auf dem Rost von zäher Konsistenz und leicht ranzigem Nachgeschmack gewesen sein muss. Wirklich aufhorchen lässt der Schauplatz von Thorkels kulinarisch motiviertem Fitnessnachweis. Der Farmer musste eine knapp zwei Kilometer lange Strecke zwischen dem Ufer am Hvalseyjarfjord und dem Inselchen Hvalsey sowie retour zurücklegen. Dieser Landstrich liegt in Grönland.
Beschrieben wird Thorkel Farserks Leistung im Landnámábok, einer Sammlung isländischer Geschichten der Landnahme und Besiedlung Islands und Grönlands durch Angehörige einer Kultur, die wir als »Wikinger« kennen.1 Thorkel und die Seinen siedelten sich dort wahrscheinlich um die Jahre 990 bis 1000 an. Aus der Beschreibung seiner Exkursion und der dabei zurückgelegten Distanz haben moderne Forscher errechnet, dass das Wasser mindestens 10° Celsius warm gewesen sein musste, hätte doch Thorkel (und vermutlich auch das Schaf) diese Tortur sonst kaum überlebt. Dass er über eine ausgeprägte, ihn vor Kälte schützende Unterhautfettschicht verfügte, kann angesichts des durchschnittlichen Ernährungsstandes der Menschen im späten 10. Jahrhundert weitgehend ausgeschlossen werden – vor allem wenn es sich um körperlich hart arbeitende Zeitgenossen wie Thorkel handelte, die (wie etwa neunzig Prozent der Europäer jener Epoche) der Erde einen Ertrag abringen und meist von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang körperlich hart arbeiten mussten. Heute indes ist das Wasser, in das Thorkel einst stieg, im Schnitt um die 3° bis 6° Celsius warm – oder besser gesagt kalt.2
Vieles war anders auf dieser größten Insel des Planeten vor rund eintausend Jahren. Wenn die Siedler auf Grönland einen der ihren zur letzten Ruhe betteten, senkten sie seine körperliche Hülle wie in den Ländern ihrer Vorfahren, in Norwegen und Schweden, in die Erde. Heute jedoch ist der Boden auf Grönland meist dauerhaft gefroren, so dass es unmöglich ist, Erdbestattungen durchzuführen. Das Grönland der Gegenwart ist ungeachtet aller dahinschmelzenden Packeismassen ein unwirtlicherer, kälterer Ort als im vorletzten Millennium, der Epoche um das Jahr 1000 und der folgenden ein, zwei Jahrhunderte.
Die Besiedlung Grönlands – und, in weit stärkerem und dauerhaftem Maße, von Island – vor rund eintausend Jahren ist ein gutes Beispiel dafür, wie besondere Eigenschaften des Klimas menschliche Kulturen beeinflussen können. Weite Teile Nord- und Mitteleuropas erfreuten sich vom 10. bis zum 13., vielleicht auch bis ins frühe 14. Jahrhundert hinein eines überdurchschnittlich milden, geradezu warmen Klimas. »Erfreuen« ist das passende Wort, denn die Auswirkungen der heute als mittelalterliche Warmzeit bezeichneten Klimaepoche waren für die Mehrheit der Europäer und ihrer Gesellschaften positiv. Missernten und mit ihnen Hungersnöte wurden seltener, die Bevölkerung wuchs kräftig an. Da das irdische Dasein für viele Menschen nicht ausschließlich ein reiner Kampf ums Überleben war, wurden Energien für andere Unternehmungen freigesetzt, für Bauprojekte zum Beispiel – das Hochmittelalter brach zu neuen architektonischen Ufern auf und hinterließ uns vor allem in Kirchen und Kathedralen, aber auch in profanen Bauwerken, in Brücken, Aquädukten und Burgen Hinterlassenschaften, die noch heute manch eine Stadt oder eine Kulturlandschaft prägen. Man rodete die Wälder – aus heutiger, vom ökologischen Denken dominierter Sicht kein rundum begrüßenswertes Unterfangen – um Raum für landwirtschaftliche Nutzflächen und neue Siedlungen zu schaffen. Und Orte zur Besiedlung suchte man auch dort, wo bislang keine Menschen – oder keine Angehörigen der eigenen Ethnie – lebten: in unterbesiedelten Regionen an der Peripherie des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wie jenen Landstrichen, aus denen Jahrhunderte später ein Staatswesen namens Preußen hervorgehen sollte. Oder man brach in bislang dem Europäer nicht oder kaum bekannte Teile der Welt wie Island oder Grönland auf, um dort Ableger der eigenen Kultur, in diesem Fall der nordeuropäischen Kultur der Wikinger anzulegen und zum Gedeihen zu bringen. Es waren die Wikinger, denen sogar der Sprung auf einen gänzlich fremden Kontinent gelang. Nordeuropäer siedelten für einige Jahre – durch das milde Klima der »Alten Welt« in der Landnahme wie auch bei ihrer Überfahrt begünstigt – in Nordamerika. Die Schifffahrtsrouten zwischen Norwegen und Island sowie Grönland blieben damals oft das ganze Jahr eisfrei, was das weitere Vordringen und den Nachschub erleichterte. »Klimahistoriker sind der Meinung,« so der Historiker Wolfgang Behringer, »dass auch Stürme in dieser Zeit selten waren, so dass die sagenhafte Seetüchtigkeit der Wikinger – vor der Erfindung des Kompasses und ohne Komfort an Bord – nicht zuletzt durch die Gunst des Klimas ermöglicht war.«3
Sie nannten den fernen Kontinent Vinland, Land des Weines. Ob der Begriff nur für den nachweisbaren Siedlungsraum um L’ Anse aux Meadows im kanadischen Neufundland oder bis hinunter nach Massachusetts galt, wo man die äußerste Speerspitze wikingischer Exploration vermutet – dort wachsen heute nirgendwo Reben –, bleibt offen. Der Nordostzipfel Amerikas ist ebensowenig ein Weinland wie die große, semi-autonome Insel unter dänischer Oberhoheit, die bis auf regionale und jahreszeitliche Ausnahmen im frühen 21. Jahrhundert ein »grünes Land« war. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass die Wikinger bei der Namensgebung ihrer Entdeckungen ein gewisses PR-Talent hatten – niemand würde sich samt seiner Familie an fernen Gestaden mit einer Bezeichnung wie »Shitland« niederlassen wollen – so trafen sie zweifellos damals auf klimatische und infrastrukturelle Bedingungen, die signifikant anders und menschenfreundlicher waren als die Küstenstreifen, die sich dem heutigen Grönlandtouristen von den geheizten Kabinen des Kreuzfahrtschiffes aus darbieten.
Klima indes kann sich wandeln – kaum einem Zeitalter ist dies bewusster als dem gegenwärtigen. Die Mittelalterliche Wärmeperiode hielt nicht ewig an, sondern nur gut drei bis knapp vier Jahrhunderte. Als Grönland immer kälter und unwirtlicher wurde, zogen die letzten der nordischen Siedler ab – in Nordamerika vollzog sich diese Entwicklung viel schneller, da man sich mit den Einheimischen, die man skraenklingar nannte, nicht vertrug. Da dieser Kontinent aus europäischer Perspektive in Vergessenheit geriet, waren jenen Bewohnern, die wir heute Indianer oder Native Americans nenne, fast fünf weitere Jahrhunderte ohne fremde Eroberer beschieden. Auf Grönland hinterließen die Wikinger einige Bauwerke wie die steinerne Kirche von Hvalsey, die in einer Spätphase, um 1300, erbaut wurde und der nicht mehr allzu viele Andachten beschieden waren. Und sie hinterließen Gräber.
Dem im Durchschnitt warmen Hochmittelalter schlossen sich Epochen an, in denen die wesentlichen Merkmale des europäischen Klimas mit weit dramatischeren historischen Phasen assoziiert sind, wie den für viele Zeitgenossen als schier endlos erlebten Regenfällen ab etwa 1315. Und schließlich führte die sogenannten Kleine Eiszeit im 17. Jahrhundert, die uns zwar das Genre der Wintermalerei schenkte, in die Krise des 17. Jahrhunderts, einem Zeitalter religiöser und sozialer Erschütterungen, mit Pestzügen und Hexenverbrennungen, vor allem aber in die Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges.
Der Rückblick auf die Auffälligkeiten des historischen Klimas und seinen erkennbaren Wandel wird durch den heutigen Diskurs nicht gerade erleichtert. Für die große Mehrheit der Klimatologen, Geophysiker und andere Wissenschaftler steht aufgrund des Datenmaterials fest, dass die Welt heute eine globale Erwärmung erlebt, die ausgeprägter ist als alle anderen belegten Schwankungen. Dass vierzehn der fünfzehn wärmsten dokumentierten Sommer in das noch junge 21. Jahrhundert fallen, scheint eine deutliche Sprache zu sprechen. Die allermeisten Experten sehen für diesen Klimawandel eine anthropogene Ursache oder zumindest einen anthropogenen, in Ergänzung zu möglichen natürlichen Schwankungen wirkenden Faktor: die von einer sich dramatisch vermehrenden Menschheit in die Atmosphäre abgelassenen Emissionen, die die Atmosphäre unseres Planeten nach dieser Auffassung rasant und mit unabsehbaren Folgen aufheizen.
Dieser Mehrheitsmeinung hat es nicht gut getan, dass einige wissenschaftliche Publikationen sich als schlampig konzipiert oder übertrieben herausstellten, ebenso wenig wie der »Alarmismus« mancher Verkünder einer vom Menschen verursachten globalen Erwärmung. Aber eine Schlagzeilen heischende Weltuntergangsstimmung zu verbreiten, erscheint manchen Klimaforschern als der sicherste Weg, Forschungsmittel zu akquirieren. Solche inhaltlichen wie psychologischen Schwachstellen werden von jenen dankbar aufgegriffen, die als Klima(wandel)skeptiker oder Klimawandelleugner gelten. Die Debatte hat inzwischen längst einen häufig religiös erscheinenden Eifer angenommen, mit einer weitgehend unversöhnlich erscheinenden Polarisierung der Standpunkte. In den Medien erscheint kaum ein Artikel, ein Essay oder eine Sendung zum Thema Klimawandel und Klimaschutz, ohne dass in Leserbriefen oder Kommentaren im Netz gegen den Weltuntergangsalarmismus zu Felde gezogen wird. Erinnern Sie sich an die eiskalten Nächte des gerade überstandenen Winters, heißt es dort typischerweise – das fühlte sich doch wahrlich nicht wie Klimaerwärmung an? Auch die Klimageschichte wird längst von beiden Seiten in Beschlag genommen. Die mittelalterliche Warmperiode wird von Kritikern der herrschenden Lehre des anthropogenen, vom Menschen verursachten oder mitverursachten, Klimawandels als probates Beispiel dafür genommen, dass es immer schon ein Auf und Ab der Durchschnittstemperaturen und der Wetterbedingungen gab und geben wird. Und dass wir getrost die Schlote rauchen lassen und mit unseren Autos tagein, tagaus im Stau stehen dürfen, ohne dass dies Folgen für den Planeten hätte. Schaut, so lautet das Argument, erwärmtes Klima gab es schon damals, und niemand ließ anno 1015 Treibhausgase ab! Im scheinbar folgerichtigen nächsten Schritt wird darauf hingewiesen, wie gut es jenen Teilen der Menschheit im Hochmittelalter ging, die sich – wie die meisten unserer europäischen Vorfahren – dieser wärmeren Jahresdurchschnittstemperaturen mit milderen Winter erfreuten. Und wie schlimm es vielerorts in der Kleinen Eiszeit wurde, als Babys an den Brüsten ihrer Mütter erfroren und der Tod in den Wintermonaten reiche Ernte einfuhr. Es wirkt dann beinahe hilflos, wenn aus den Reihen derjenigen, die vom anthropogenen Klimawandel überzeugt sind, die Wärmeperiode des Hochmittelalters mit Grafiken und Datenmaterial ein wenig klein geredet wird: Es sei bei weitem nicht so warm gewesen wie heute, der Klimawandel der Gegenwart sei mit nichts zu vergleichen.
Unabhängig davon, welchem Standpunkt man anhängt, sind zwar weite Teile der Gesellschaften in den Industrienationen davon überzeugt, dass der Klimawandel vom Menschen verursacht wird und Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollten, doch findet sich gleichzeitig einflussreicher Widerstand. In der führenden Industrienation auf diesem Globus, den USA, steht praktisch die halbe politische Klasse der Lehre von der durch den Menschen induzierten globalen Erwärmung ablehnend gegenüber. Im amerikanischen Kongress findet sich kein Abgeordneter oder Senator mit einem großen R (für Republikaner) in Klammern hinter seinem Namen, der sich zum Modell des anthropogenen Klimawandels bekennen würde. Die Verbindungen dieser Partei (und auch zahlreicher Demokraten) mit der Fossil-Fuel-Industrie, vor allem zu den Ölproduzenten sind – ganz besonders zu Wahlkampfzeiten – tief und innig. Eine so machtvolle und einflussreiche Industrie hat kein Interesse daran, dass weniger fossiler Brennstoff gefördert und konsumiert wird oder daran, dass Verbraucher vom Auto auf einen Hochgeschwindigkeitszug umsteigen (dessen Baupläne in praktisch allen von republikanischen Gouverneuren regierten Bundesstaaten gestoppt wurden). In anderen Ländern agieren die Lobbyisten und ihre Spendenempfänger in den Parlamenten ein wenig zurückhaltender. Doch das Klima, sein Wandel und die Folgen solchen Wandels werden auf absehbare Zeit ein politisches Thema bleiben.
In diesem Buch geht es aber vor allem darum, wie das Klima das Gedeihen oder Vergehen menschlicher Gesellschaften beeinflusst hat. Doch neben dieser Makroebene des Klimas wird auch die Mikroebene, das Wetter, in den Blickwinkel geraten. Während das Wetter etwas Kurzfristiges, Episodenhaftes ist, das über einen Tag oder ein paar Wochen ein historischer Faktor sein kann, ist Klima eine kumulative Erfahrung, die Gesamtheit der meteorologischen Bedingungen an einem Ort oder in einer Region über einen längeren Zeitraum – im Falle des Mittelalterlichen eine Warmzeit über drei bis vier Jahrhunderte.
Während wir die historischen Konsequenzen des Klimas quasi in Zeitlupe mitverfolgen können, wie das Erblühen der grönländischen Siedlungen und die bitteren Winter der von Krisen geschüttelten Frühen Neuzeit, ist der »impact« des Wetters auf die Geschichte etwas manchmal geradezu dramatisch Augenblickliches – wie jene gerade 24-stündige Ruhe in den Sommerstürmen des Jahres 1944, welche die Landung der Alliierten in der Normandie ermöglichte. Natürlich liegt ein Titel wie »Das Wetter (oder das Klima) schreibt Geschichte« nah. Doch bleiben wir realistisch: Es ist ein Faktor, einer von meist vielen. Es war unbestreitbar einer der kältesten Winter der russischen Geschichte, der den Vormarsch der Armeen Hitlers im Dezember 1941 stoppte. Aber andere Faktoren spielten ebenfalls eine Rolle: der unerwartet heftige Widerstand der Roten Armee, die Weite des Landes mit ihren Konsequenzen für die Versorgung der Wehrmacht (wie 129 Jahre zuvor der Grande Armée Napoleons), der von Hitler selbst befohlene abrupte Wechsel der Hauptstoßrichtung der Invasion. Der Russlandfeldzug wäre vielleicht auch so zum Wendepunkt der Eroberungspläne der Nazis geworden. Aber unzweifelhaft veränderte das spezifische Wetter während einiger entscheidenden Wochen den Gang der Geschichte in die Richtung, die wir im Nachhinein als selbstverständlich, fast logisch erachten. Doch die Geschichte kennt keine vorgegebene Unausweichlichkeit. Im Zeitalter der Glaubenskriege wäre die wichtigste Bastion des Protestantismus mit Leichtigkeit an die militärisch stärkste katholische Macht gefallen, wenn die Nordsee für nur wenige Wochen deutlich ruhiger gewesen wäre. Die Konsequenzen für die weitere Entwicklung Europas wären unübersehbar gewesen: ein Siegeszug der Inquisition und der Intoleranz, das frühe Ende einer kulturellen Blüte, die Dominanz der spanischen Sprache bis auf den heutigen Tag – und dies in ganz Amerika, auch in den Estados Unidos. Die Welt sähe gänzlich anders aus. Die Stürme im Sommer 1588, die der Armada mehr Schaden zufügten als die Royal Navy um Sir Francis Drake, kippten die Balance, wiesen den historischen Abläufen an einer Weggabelung eine andere Richtung als jene, auf die bereits Kurs genommen war.
Setzen wir die Segel und besuchen einige dieser Wegmarken. Sie sind leicht eurozentrisch geraten, worin natürlich keine Missachtung gegenüber ferneren Kulturen zum Ausdruck kommen soll, sondern dem eigenen Erleben und jenem wohl der meisten Leser Rechnung getragen wird. Aber auch Ostasien, Nord- und Mittelamerika werden uns begegnen. Wetter und Klima, das Kurzzeitige und das größere Abschnitte Überspannende, waren oft mehr als nur das sprichwörtliche Zünglein an der Waage, sondern ganz signifikante Entscheidungsfaktoren. Für frühere Epochen indes lassen sich bequem Trennlinien nachweisen, mit warmen und regenreichen Sommern in England und fürchterlicher Dürre in Mittelamerika oder in Indien. Heute indes handeln wir (oder handeln nicht) in dem Wissen, dass auf einem relativ kleinen Planeten sich das Wetter hier von jenem dort unterscheiden mag, dass es aber mehr und mehr als ein Klima wahrgenommen wird, mit dem wir und unsere Kinder leben müssen. Und dass wir zwar nicht wie Thorkel Farserk ins Wasser steigen müssen, wohl aber alle in einem – nach Mehrheitsmeinung: zerbrechlichen – Boot sitzen.
200 v. Chr. bis 300 n. Chr.
Optimum und Imperium: Von der Blüte Roms ins »dunkle Zeitalter«
Im Jahr 98 unserer Zeitrechnung schrieb der römische Historiker Tacitus über eine der fernsten Provinzen des Imperium Romanum: »Caelum crebris imbribus ac nebulis foedum; asperitas frigorum abest« – etwas frei übersetzt: »Der Himmel ist durch häufigen Regen und Nebel verschleiert, aber es wird nicht bitterkalt.« Er sprach über die Insel Britannicum, wo die römischen Besitzungen das heutige England und Wales umfassten.
Heute erfreut sich Rom, zu Tacitus Zeiten die Hauptstadt eines Weltreiches, im Schnitt an etwa 2500 Stunden Sonnenschein pro Jahr, während London mit 1500 auskommen muss. In manchen Monaten ist der Unterschied noch deutlicher: Im Januar sind es durchschnittlich 130 Sonnenscheinstunden in Rom und nur 45 in London. Damals, vor fast zweitausend Jahren, war es sehr ähnlich. Tacitus mag die Dauer des Regens in Kombination mit niedrigen Temperaturen befremdet haben, doch selbst eine der klimatisch eher weniger einladenden Provinzen des Imperium Romanum wurde nach seiner Beobachtung nicht von harten Wintern heimgesucht. Regen, wenngleich nicht so häufig wie in Britannien, war Tacitus aus Rom und dem Mittelmeerraum gewohnt – der Niederschlag war in aller Regel jedoch mit warmen, angenehmen Temperaturen verbunden. Die Blütezeit des Römischen Reiches in den ersten beiden nachchristlichen Jahrhunderten war durch ein überwiegend stabiles Klima geprägt, dessen Temperaturen den heutigen – also eines Zeitalters globaler Erwärmung – entsprachen. Gleichzeitig waren Niederschläge zumindest so regelmäßig, dass nennenswerte Dürreperioden in Italien und auch in anderen mediterranen Regionen ausblieben, was vor allem für die römischen Provinzen Africa (dem heutigen Tunesien und dem Küstenstreifen Libyen) und Aegyptus galt, von denen vor allem Letztere für die Ernährung der übervölkerten Metropole Rom eine entscheidende Rolle spielte.
Tacitus war ein penibler Beobachter, der sich Gedanken über die Zusammenhänge von Klima und Ökonomie machte. Seine Beschreibung Britanniens lässt auf klimatische Bedingungen auf der Insel schließen, die noch höhere Jahresdurchschnittstemperaturen aufwiesen als in unserer Zeit: »Der Boden kann, abgesehen vom Olivenbaum, der Weinrebe und den übrigen Pflanzen, die gewöhnlich nur in heißeren Gegenden wachsen, Feldfrüchte tragen und ist reich an Vieh: langsam werden sie reif, schnell kommen sie hervor; der Grund für beides ist derselbe: die hohe Feuchtigkeit von Boden und Himmel.« (Tacitus. Agricola XII) Olivenbäume in Sussex? Weinreben entlang der Themse? Wenn es im Süden Englands und Wales heute wieder zaghaften Weinbau gibt, wird dies auf die aktuelle Klimaerwärmung zurückgeführt. (Die britische Weinwirtschaft gehört wahrscheinlich zu jenen wenigen Institutionen, die – wenngleich nicht allzu outspoken – im Klimawandel etwas Erfreuliches mit der Aussicht auf wirtschaftliche Expansion der eigenen Branche sehen.) Die Gesamtzahl der meist sehr kleinen Winzereien und Weingärten dürfte bei etwa 400 liegen. Olivenbäume findet man im heutigen United Kingdom allenfalls in dem wohl temperierten und feucht-schwül gehaltenen Gewächshaus eines Botanischen Gartens. Britannien muss Tacitus als ein klimatisches Paradies erschienen sein, vergleicht man seine Beschreibung der Insel mit der einer anderen Region, einem Gebiet, dessen Bewohner sich wiederholt der Eroberung durch Rom widersetzt hatten: dem Territorium, das heute Deutschland ausmacht. In seinem Werk Germania versammelte Tacitus wenig einladende Attribute zum dortigen Klima: raue Wälder, furchtbare Sümpfe, stürmisches Wetter und ein Boden, auf dem keine Obstbäume und nur kleinwüchsige Rinder gedeihen.
Das Jahr 98, in dem Tacitus wahrscheinlich seine Charakterisierung Britanniens als Teil der Biografie seines Schwiegervaters, des Senators und Feldherrn Gnaeius Julius Agricola, verfasste, fiel in eine historisch bedeutsame Zeit: dem Regierungsantritt von Trajan. Dieser Herrscher, mit vollem Namen Marcus Ulpius Traianus, gilt als einer der »guten Kaiser« (98–117), neben Hadrian (117–138), Antoninus Pius (138–161) und Marc Aurel (161–180). Selbst unter ihnen ragt Trajan heraus; eine Historiografie nennt ihn gar den besten princeps seit Einführung des Kaisertums, des Prinzipats, durch Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.). Trajan war der erste Imperator, der aus der Provinz stammte, auch wenn der Nachfahre römischer Siedler in Südspanien überwiegend in Rom aufwuchs, wo sein Vater Karriere in der Politik machte. Vor allem aber: Mit Trajan und seiner Regierungszeit ist die größte Ausdehnung des römischen Reiches verbunden. Es erstreckte sich von der Atlantikküste bis zum Euphrat, die gesamte nordafrikanische Küstenregion gehörte ebenso zum Imperium Romanum wie weite Teile des heute als Naher Osten bezeichneten Gebietes; das weiteste Vordringen gen Orient führte römische Legionäre für kurze Zeit bis an den Persischen Golf. Von den modernen europäischen Nationalstaaten waren unter anderem Spanien, Frankreich, Portugal, die Schweiz, Österreich, Rumänien und Griechenland in ihren heutigen Grenzen gänzlich unter Roms Kontrolle. Markant, vor allem mit Blick auf die weitere Entwicklung, sind die Grenzen, an die das Imperium im geografischen wie symbolischen Sinne stieß. Im Osten widersetzten sich die Parther im Gebiet des heutigen Iran der Eroberung – Partherkriege waren für viele Kaiser fester Bestandteil der Außenpolitik. Undenkbar war zur Trajanschen Blütezeit indes, dass später ein Kaiser, Gordian III., im Kampf gegen die Parther im Jahr 244 den Tod finden und ein anderer sogar noch schmählicher in deren Gefangenschaft sterben würde, wie Valerian nach 260. Auch an Germanien scheiterten die Eroberungs- und Kultivierungsbemühungen der Römer. So versuchten sie, das eigene Territorium gegen die oft rastlosen Völkerschaften östlich des Rheins und der Elbe mit einer Verteidigungsanlage, dem Limes, zu schützen. Eine ähnliche Strategie verfolgten sie auch im regnerischen und mäßig kalten Britannien: Trajans Nachfolger Hadrian ließ einen steinernen Wall zur Abgrenzung gegen die feindlichen Völkerschaften im heutigen Schottland anlegen, der seinen Namen trägt und dessen Überreste heute eines der beeindruckendsten archäologischen Dokumente des Imperium Romanum darstellen.
Zum Siegeszug des Römischen Reichs und zur Konsolidierung seiner Herrschaft auf nicht weniger als drei Kontinenten trugen zahlreiche Faktoren bei. Die hochentwickelte Schrift- und Dokumentationskultur Roms ermöglichte Verwaltungsstrukturen, die bei der Expansion, die in der aufsteigenden Republik begonnen hatte, unerlässlich waren. Unzweifelhaft waren Roms Fähigkeiten, seine militärische Macht zu organisieren und auszubauen, mitentscheidend zunächst für die Niederringung des Rivalen Karthago in den drei Punischen Kriegen im dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Die Berufsarmee, die gut gedrillten und (meist) kompetent geführten Legionen, zeigten sich den meisten weit weniger strukturierten Streitkräften der Epoche als überlegen. Den Legionären winkten für ihren Dienst und ihre Opfer Lohn: die Belohnung mit Land, meist in den Provinzen, die damit latinisiert wurden, oft auch das römische Bürgerrecht. Gerade das Rechtssystem machte Rom attraktiv, auch für die zunächst mit Gewalt unterworfenen Völkerschaften. Im Römischen Reich gab es eine Rechtssicherheit, die zwar weit entfernt vom heutigen Verständnis des Begriffs ist, aber hoch über den archaischen Verhältnissen anderer Enthnien stand. In der zunehmenden Öffnung gegenüber anderen kulturellen Einflüssen kann ein weiterer Aspekt gesehen werden, dem Rom seinen Aufstieg verdankt. Vor allem der Einfluss des noch zu Zeiten der Republik eroberten Griechenlands hinterließ bei der römischen Elite Spuren und war ein Segen für das römische Bildungssystem. Auch der Austausch mit anderen, teilweise deutlich älteren Kulturen wie jener Ägyptens wirkte befruchtend.
Undenkbar wäre der Aufstieg Roms indes ohne politische und wirtschaftliche Stabilität gewesen. Beides hing, vor allem in einer schließlich die Millionengrenze an Einwohnern erreichenden Metropole wie Rom, von der Versorgungslage ab: Der plebs brauchte panem et circenses, musste mit Entertainment und einem gefüllten Magen und Unterhaltung bei Laune gehalten werden. Dies gelang über viele Dekaden, weil Schiffe aus Ägypten, der »Brotkammer des Reiches«, Rom mit Korn versorgten. Die Fruchtbarkeit des Niltals und die außerordentlich günstigen klimatischen Verhältnisse in anderen Teilen des Reiches sowie der Bau von Strassen und die Anlage von Städten waren für das Gedeihen der Landwirtschaft ganz wesentliche Voraussetzungen. Das Rom und mit ihm das Europa der rund drei Jahrhunderte vom Ende der Republik bis zum Ende der »guten« Kaiserzeit erfreuten sich eines Klimas von geringer Variabilität, wenigen Extremen und mittleren Temperaturen wie Niederschlägen, die zur Blüte des Imperium Romanum mit beitrugen. Man nennt diese Zeit daher auch das Roman Climatic Optimum, das Klimaoptimum der Römerzeit. Wie bei anderen Klimaepochen ist eine scharfe Eingrenzung schwierig; die unter der Kapitelüberschrift genannte Zeitspanne ist eine sehr großzügige Zuordnung. Und wie bei jeder anderen Charakterisierung von Klima und Wetter gilt natürlich auch für Roman Climatic Optimum, dass es sich um eine generelle Tendenz, eine auf Mittelwerten basierende Einschätzung handelt. Die Tatsache, dass es im heutigen Deutschland in jener Epoche ähnlich warm wie heute und in Britannien vielleicht noch wärmer war, heißt nicht, dass keine strengen Winter möglich waren. Weder Wetter noch Klima sind etwas Beständiges und damit streng kategorisierbar. In unserer von political correctness geprägten Epoche muss auch beim Blick zurück auf vergangene Zeiten und Kulturen der sprachlichen Sensibilität Rechnung getragen werden. Der Terminus des Roman Climatic Optimum ist natürlich eurozentrisch, oder genauer: romzentriert. In ihm schwingt eine – aus vielerlei Gründen angebrachte – Bewunderung für Rom mit. Ein jeder Leser dieses Buches profitiert von dem kulturellen Erbe Roms: die Lettern auf diesen Seiten sind römische, keine arabischen Schriftzeichen, keine griechischen oder kyrillischen Buchstaben. Die Blüte Roms, sein Optimum nicht nur in klimatischer, sondern auch in machtpolitischer Hinsicht zu betrachten, darf natürlich nicht den Blick darauf verstellen, dass viele Menschen, die in diesem Imperium lebten und leben mussten, vor allem die Sklaven in den Villen der betuchten römischen Bürger, in den Bergwerken und in den Arenen der Gladiatoren, dem in der Populärkultur vielleicht bekannteste Tätigkeitsfeld Unfreier, das eigene Dasein und die Gesellschaftsform der über ihr Schicksal Herrschenden wohl weit weniger optimal empfanden.
Es ist kein Zufall, wenn bei der Betrachtung der Klimageschichte der letzten 12000 Jahre und besonders der letzten zwei- bis dreitausend Jahre eine Tendenz deutlich wird: Warmperioden stehen eher für kulturelle und gesellschaftliche Blüte, für Weiterentwicklung und Fortschritt; Kälteperioden hingegen sind eher von Instabilität und Krisenerscheinungen geprägt. Fast die gesamte historische Entwicklung der Menschheit mit der Entwicklung der Schrift und die Entstehung erster Kultur- und Organisationsformen spielte sich in einer Warmperiode ab, dem Holozän. Dieser bis heute andauernde Abschnitt der Erdgeschichte geht mit einer Klimaerwärmung einher, die allerdings keine konstante Entwicklung ist: Auch im Holozän kam es wiederholt zu Temperaturrückgängen wie etwa in der Periode von etwa 4100 v. Chr. bis 2500 v. Chr., in der sich unter anderem weite Teile der Sahara von einer Savannenlandschaft in eine Wüste verwandelten. Der Beginn des Holozäns wird von Wissenschaftlern auf 11700 Jahre vor dem Jahr 2000 definiert; die Analyse von Sedimenten des Maarfelder Maares in der Eifel kommt zu einem vergleichbaren Ergebnis und datiert den Beginn des Holozäns auf etwa 9640 v. Chr.
Die Erzählung des Schweizer Schriftstellers Max Frisch, Der Mensch erscheint im Holozän, ist freilich als Parabel zu verstehen. Die Menschheit hatte einige Jahrzehntausende der Genese unter weit widrigeren klimatischen Bedingungen hinter sich und zumindest in der Spätphase der letzten Kaltzeit (populär auch »Eiszeit« genannt), die vor mehr als 100000 Jahren begann und vor rund 12000 Jahren endete, neben dem täglichen Kampf ums Überleben hier und dort Ausdrucksformen eines frühen Kunstempfindens entwickelt. Die berühmten Felsenmalereien in spanischen und französischen Höhlen stammen aus dieser Kaltzeit, die heute im Naturhistorischen Museum in Wien zu bewundernde Venus von Willendorf ist eine beeindruckende Skulptur, die etwa 25000 v. Chr. entstanden ist.
Weit weniger bewundernswert als diese Neigung zu künstlerischem Gestalten ist möglicherweise eine andere Folge menschlichen Wirkens, dessen unsere Vorfahren verdächtig sind. Gegen Ende des Pleistozäns und beim Übergang zum Holozän kam es zum Aussterben der sogenannten Megafauna. Zahlreiche Tierarten, die während der Kaltzeit auf allen Kontinenten heimisch waren, verschwanden. Plötzlich – und »plötzlich« bedeutet: im Laufe einiger Jahrhunderte – starben in verschiedenen Regionen der Erde Tiere mit mehr als 1000 Kilogramm Körpergewicht wie der Säbelzahntiger, das Wollnashorn und das Mammut aus. Nur Afrika und Teile Asiens blieben davon verschont – ohne diese Ausnahmen wüssten wir heute nicht, was ein Elefant oder ein Flusspferd ist. Nur vom Wollmammut überlebte eine Herde bis weit in die historische Zeit hinein, bis etwa 1700 vor Christus, auf einer heute zu Russland gehörenden Insel im Nordmeer, der Wrangelinsel (heute ein Unesco-Weltkulturerbe). Das Aussterben der Riesen auch dort fällt zusammen mit den ersten Spuren menschlicher Besiedlung auf dem Eiland – was wohl kaum ein Zufall sein dürfte. So ist denn auch eine der Hypothesen zur Erklärung des Verschwindens der Megafauna an der Wende zum Holozän die Überjagung durch den Menschen, also schlichtweg: die Ausrottung. Angesichts einer Weltbevölkerung von rund 5 Millionen,1 also etwas weniger als die heutigen Einwohnerzahlen von Berlin und Hamburg zusammengenommen, wirkt dies wie ein monströses Massaker, das unsere Vorfahren anrichteten (neben den genannten Großspezies sollen auch fast 80 % aller kleineren Tierarten verschwunden sein). Die Waffen und auch die Jagdtaktiken eis- und steinzeitlicher Jäger waren durchaus in der Lage, Tiere von der Größe eines Mammuts zu erlegen. Die These der Überjagung, des »Overkill«, ist erwartungsgemäß heftig umstritten. Neben der unbeantworteten Frage, ob das Töten wirklich die natürliche Reproduktion all dieser Spezies hat verhindern können, bleibt ungeklärt, warum gerade in Afrika – aus dem die Menschheit bekanntlich stammt und das viel länger als jeder andere Kontinent von Hominiden bewohnt ist – viele Großtierarten überlebt haben. Die andere wesentliche Hypothese macht für das Massenaussterben Klimaveränderungen verantwortlich. Höhere Temperaturen könnten demnach für Spezies mit dichter Behaarung ungünstig gewesen sein: Der Rückzug der Tundra bedeutete den Verlust von Lebensraum. Allerdings waren nicht alle der ausgestorbenen Arten dicht behaart oder lebten in einer an Nordsibirien erinnernden Umwelt. Zwar geht der ausgeprägte Klimawandel des Übergangs vom Pleistozän zum Holozän vielerorts mit dem massenhaften Aussterben einher. In Australien aber, wo vor ca. 45000 Jahren unter anderem das Riesenkänguruh, der Beutellöwe und das Megalania, eine große Waranart, verschwanden, ereignete sich kein Klimawandel – wohl aber war dies der Beginn der Besiedlung des Kontinents durch den Menschen. Dies und auch die Tatsache, dass im Laufe der dokumentierten Geschichte die erstmalige Besiedlung von Inseln wie Neuseeland, Madagaskar und eben der Wrangelinsel mit einem Artensterben einherging, hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack.
Die ansteigenden Temperaturen im Holozän führten zu einem Anstieg der Meeresspiegel, vor allem zwischen 8000 und 5000 v. Chr., und gaben Europa sein heutiges geografisches Gesicht. Bis dahin war die größte britische Insel (England, Wales, Schottland) mit dem Kontinent als Teil eines Northsealand oder Doggerland verbunden. Die Straße von Dover hat sich um etwa 7600 v. Chr. herausgebildet und zur historisch so signifikanten Abtrennung Britanniens vom Rest Europas geführt. Ein stabiles und generell mildes bis warmes Klima begleitete die frühen Hochkulturen während der Bronzezeit (in Mitteleuropa ab etwa 2200 v. Chr.) und der Eisenzeit, die in Mitteleuropa mit dem neunten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung wesentlich später einsetzte als im Nahen Osten. Es entstanden die klassischen antiken Zivilisationen: in Indien und China, im Zweistromland und in Ägypten. Zwischen der zunehmenden Austrocknung der Sahara im fünften vorchristlichen Jahrtausend aufgrund regionaler Klimaveränderungen und der Entstehung einer ertragreichen und zu deutlichem Bevölkerungswachstum führenden Agrarwirtschaft entlang des Nils dürfte ein Zusammenhang bestanden haben. Hier wie auch anderenorts ermöglichte der von günstigem Klima geförderte landwirtschaftliche Ertrag die Anlage einer neuen, umfassenden Siedlungsform: der Stadt. Uruk im Zweistromland hat in einigen Publikationen den Titel der ältesten Stadt der Welt und wurde wahrscheinlich um ca. 4500 v. Chr. angelegt. Andere Städte, die ähnlich lange bestehen, sind unter anderem Aleppo, Damaskus und Jericho – dessen Mauerreste sogar auf die Zeit um 6800 v. Chr. zurückgehen sollen.
Der Aufstieg Roms verläuft parallel zu den Klimatendenzen der Epoche. Die Republik unterwarf zunächst schwächere, weniger gut organisierte – und auch: weniger aggressive – Völker entlang der Küsten des Mittelmeerraumes. Das klassische Griechenland, das seine Blütezeit hinter sich hatte, fiel Rom (146 v. Chr.) ebenso anheim wie die bereits in ihrer Bedeutung hervorgehobenen Provinzen in Nordafrika. »Vielleicht ist es aber signifikant«, schreibt Wolfgang Behringer in seinem maßgeblichen Werk zur Kulturgeschichte des Klimas, »dass Rom zunächst nach Süden expandierte und erst mit der Erwärmung nach Norden.«2 Das Optimum der Römer förderte nicht nur deren Expansions- und Unterwerfungsdrang, sondern auch das Bevölkerungswachstum quer durch Eurasia. Zwischen 400 vor und 200 nach Christus soll nach modernen Berechnungen die Zahl der Menschen in Europa, Nordafrika, China und Indien – ein Großraum, in dem etwa vier Fünftel der Weltbevölkerung lebten – um etwa 70 bis 80 % zugenommen haben, die Bevölkerung in anderen Teilen der Erde hingegen nur um etwa 40 %.3 Mit dem Eintritt des Optimums der Römerzeit war nicht nur die Eroberung klimatisch weniger attraktiver Landstriche wie Galliens, dem Germanien westlich des Rheins und Britanniens möglich, sondern vor allem auch die Ernährung der dort stationierten Legionen und römischen Siedler durch eine produktive, kaum von Wetterextremen beeinträchtigte Landwirtschaft gewährleistet. Die Versorgung der Legionen war eine Grundvoraussetzung für stabile Machtverhältnisse. Armeen marschieren gemäß dem berühmten Satz Napoleons nicht nur auf ihrem Magen, sondern werden durch diesen – wenn er denn leer ist – auch zur Meuterei animiert. Das Wirtschaftssystem, das die Römer mitbrachten, fasste aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen nun auch in Regionen Fuß, in denen die Nahrungsversorgung bislang auf einer anderen und oft störanfälligen Grundlage basierte: »Die warmen, trockenen Temperaturen des klassischen Optimums mögen dem römischen Reich buchstäblich den Weg nach Westeuropa geöffnet haben, denn es begünstigte eher die mediterrane Getreide- und Wein-Ökonomie als die an die Kälte adaptierte und auf Rinderzucht basierende keltische Eisenzeitwirtschaft. Umgekehrt brachte der Klimaumschwung, der ungefähr ab 300 n. Chr. einsetzte, kaltes und feuchtes Wetter südlich durch Europa und unterminierte die Agro-Ökonomie des Imperiums.«4
Der Ausbruch des Vesuvs im August 79 n. Chr.
Wie so oft in der Klimageschichte gilt auch hier, dass auch ein Optimum – wie jede andere Klimaphase – nicht durchgängig »optimal«, also nur durch warme und die Felder zum Erblühen bringende Witterungsverhältnisse geprägt ist, sondern Schwankungen innerhalb einer generellen Tendenz auftreten. Die Auswertungen der Gletscherbewegungen und der Jahresringe von Holz aus alpinen Regionen deuten zum Beispiel auf eine leichte Abkühlung zwischen 85 und 35 v. Chr. hin, gefolgt von neuerlicher Erwärmung. Einen weiteren Temperaturknick hat es offenbar zwischen 75 und 90 n. Chr. gegeben, was zu Spekulationen geführt hat, wonach es der Ausbruch des Vesuvs im August 79 gewesen war, der zu einer vorübergehenden und relativen Abkühlung beigetragen hat. Vulkanausbrüche haben immer wieder für eine gewisse Zeitspanne das Wetter nachhaltig verändert, und dies wahrlich nicht zum Besseren. In Schriftdokumenten sind die alljährlichen Nilschwemmen dokumentiert, die für den Getreideanbau in der römischen Provinz Ägypten und damit für die Versorgung der Einwohner Roms mit Brot entscheidend waren. Für fast 200 Jahre der römischen Zeit Ägyptens liegen Daten vor, aus denen errechnet wurde, dass in der Zeit zwischen 30 vor und 155 nach Christus die für eine ausreichende Bewässerung der Felder optimale Flut wesentlich öfter eintrat als im dritten nachchristlichen Jahrhundert – als sich das Klimaoptimum der Römer ebenso wie ihr Imperium schon im Niedergang befanden.
Die politische Stabilität des Imperium Romanum basierte unter anderem auf dem Ertrag der von Getreideanbau dominierten Landwirtschaft und war damit auch abhängig von einem günstigen Klima, von stabilen Grenzen und einer funktionierenden, loyalen Armee und Verwaltung. In einer monarchischen Staatsform, in der die Macht, wenn nicht ausschließlich so doch in hohem Maße in einer Person, dem Princeps, konzentriert war, spielte letztlich auch eine Rolle, ob dieser ein verantwortungsbewusster, fähiger Herrscher oder eine Fehlbesetzung war. Als das zweite nachchristliche Jahrhundert sich seinem Ende entgegenneigte, kam vieles zusammen. Die »guten Kaiser« wurden von einer Reihe von Herrschern abgelöst, unter denen mit Commodus (180–192), Caracalla (211–217) und Elagabal (218–222) und anderen auffallend viele psychisch alterierte Persönlichkeiten auftauchen. Andere Herrscher waren nur kurz im Amt – die Ermordung wurde bald zur typischen Form des Herrschaftsendes. Die Grenzen wurden zunehmend unsicher, es kam zu Migrationen in bislang kaum bekanntem Ausmaß: Goten, Franken, Alemannen und Vandalen drangen auf das Reichsgebiet vor, im vierten und fünften Jahrhundert kam es dann zum Ansturm der Hunnen. Die Gründe für die Völkerwanderung sind vielfältig: Doch einer von ihnen ist das sich deutlich verschlechternde Klima – dem Optimum der Römer folgte das Pessimum der Völkerwanderungszeit. Es war der Beginn eines als dark ages bezeichneten Zeitalters: ohne klare, dem schrumpfenden und schließlich untergehenden Imperium vergleichbare administrative Strukturen, mit einem Mangel an Schrifttum und anderen kulturellen Zeugnissen, mit einer dramatisch schrumpfenden Bevölkerung, mit dem Verschwinden landwirtschaftlich genutzter Flächen und voller ökonomischer, politischer und sozialer Unsicherheit, wenn nicht gar Entwurzelung. Es war in der Tat eine kalte, finstere Zeit. Eine Ausnahme, geradezu eine Insel der Bewahrung von Schrifttum und Wissen war das damals gerade christianisierte Irland, das im fünften und sechsten Jahrhundert geradezu ein Goldenes Zeitalter erlebte, das in Winston Churchills Worten »glänzte und brannte inmitten der Dunkelheit«.5
Eine deutliche Abkühlung hatte um etwa 250 n. Chr. eingesetzt; für das Jahr 536 wurde ein negativer Temperaturrekord verzeichnet, der eine sehr konkrete, wenngleich nicht eindeutig zu lokalisierende Ursache und verheerende demografische Folgen hatte, wie noch zu zeigen sein wird. Die Zahl der Niederschläge ließ nach und die Zeit der ertragreichen Felder und Weingärten war – vorerst – vorbei. Die Niederschlagsmenge stieg in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts vorübergehend wieder an, zeitgleich mit der kurzzeitigen Stabilisierung des Römischen Reiches unter Konstantin I. (306–337). Ab 395 war das einst so mächtige Imperium endgültig geteilt, in ein seinem Untergang entgegentaumelnden Weströmischen Reich und in ein Oströmisches Reich, das sich als langlebiger erweisen sollte. Im Westen indes kam es aufgrund der chaotischen Verhältnisse, von Kriegen und Seuchen, zu einem Bevölkerungsrückgang und zur Aufgabe von Agrarflächen – was vor einer Generation noch kultiviert wurde, holte sich die Natur jetzt zurück. Ganze Siedlungen wurden verlassen und gerieten in Vergessenheit.
Erst um etwa 800 kam es in West- und Mitteleuropa wieder zu klimatischen Verhältnissen, die – zumindest annähernd – jenen aus der großen Zeit Roms entsprachen. Zufall oder nicht: Eben in diesen Jahren erblühte ein neues Kaiserreich, das fränkische des Charlemagne, Karls des Großen, die Urform von Frankreich und Deutschland, in vielerlei Hinsicht vielleicht gar des modernen geeinten Europas der verschiedenen Sprachen und Kulturen. (Der Karlspreis von Charlemagnes Lieblingsresidenz Aachen würdigt Verdienste um die europäische Einigung.) Abermals kam es zu einer gesellschaftlichen Blüte zeitgleich – und auch kausal verknüpft? – mit einer Periode warmen, überwiegend stabilen Klimas.
Dem Oströmischen Reich, später Byzanz genannt, war es klimatisch wie politisch besser ergangen als dem westlichen Teil des Imperiums. Dank feuchter Sommer und guter Ernten prosperierte es gerade im fünften Jahrhundert, als der letzte weströmische Kaiser namens Romulus Augustus, ein überforderter 16-jähriger, von den längst nicht mehr römischen, sondern meist aus Zugewanderten bestehenden Streitkräften aus dem Amt gejagt wurde. Ostrom (das bis zur Eroberung durch die Türken 1453 bestehen sollte) hingegen integrierte jene Scharen, die im Rahmen der Völkerwanderung auf sein Territorium kamen, besser, prosperierte und eroberte gar einige früher weströmische Provinzen. Es war ein sehr distinktes Wetterereignis, das im sechsten Jahrhundert dieses Reich heimsuchte und die Voraussetzungen schuf für eine der größten Katastrophen der europäischen Geschichte. Doch noch vor Roms Aufstieg hatte das Wetter an einigen wenigen, aber epochal entscheidenden Tagen eine Rolle – vielleicht auch nur eine bedeutsame Nebenrolle – gespielt und damit zum Überleben und letztlich zum Sieg jener Regierungs- und Gesellschaftsform beigetragen, welche heute erfreulicherweise in fast ganz Europa herrscht. Eine Regierungsform, von der Winston Churchill sagte, dass sie die schlechteste sei – abgesehen von allen anderen, die man ausprobiert habe.
September 480 v. Chr.
Die Aura der Demokratie
Der Gottkönig führte eine Streitmacht an, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte. Zehn Jahre nachdem sein Vater Darius I. in der Schlacht bei Marathon gescheitert war, wollte Xerxes I. nichts dem Zufall überlassen. Das Heer, das sich über die beiden Brücken bewegte, die der Herrscher über den Hellespont hatte errichten lassen, war gewaltig, auch wenn der wichtigste Chronist der Ereignisse, Herodot, wie viele antike Schriftsteller zur Übertreibung neigte. Herodot, der ein Menschenalter später die Ereignisse zusammentrug, deutet – Hilfskräfte mitgezählt – ein Millionenheer an. Die heutige Forschung rechnet eher mit 50000, vielleicht gar mehr als 200000 Mann – immer noch ein gigantischer Zug von Menschen und Material, der durch Makedonien und Thessalien marschierte, um endlich die widerspenstigen Griechen zu disziplinieren und auch Hellas jenem Riesenreich hinzuzufügen, das Xerxes Vorfahren erobert hatten. Das Perserreich war das bei Weitem größte Herrschaftsgebilde, das Eurasien bis dahin erlebt hatte. Es erstreckte sich vom heutigen Pakistan und Afghanistan im Osten über seinen eigentlichen Kern im modernen Iran, durch das Zweistromland und die Türkei bis nach Bulgarien. Und auch in Ägypten musste der Groß- und Gottkönig verehrt werden.