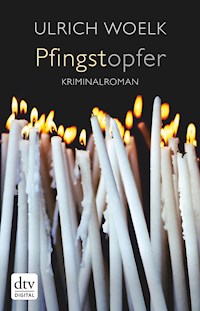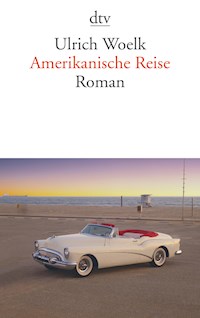
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ulrich Woelks Roman ist mehr als nur ein packendes Roadmovie: Er zeichnet das überzeugende Porträt einer Generation, die Freiheit nur noch als Verlorenheit kennt. Jan, 35 Jahre alt, liebt das unbeschwerte Leben, liebt die Frauen. Er fliegt nach New York, um seinen alten Freund Walter und dessen Frau Kristin zu besuchen. Das Ehepaar allerdings liegt im Streit. Kurz entschlossen nimmt Kirstin Jan auf eine Reise durch Amerika mit, und beide rollen in einem alten Buick ins Ungewisse. Als Walter jedoch der illegalen Spekulation mit Aktien beschuldigt wird, offenbaren sich die wahren Hintergründe dieser Reise. Ulrich Woelk zeichnet das überzeugende Porträt einer Generation, die Freiheit oft nur als Verlorenheit kennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ulrich Woelk
Amerikanische Reise
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte Ausgabe 2008© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40398-6 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13648-8Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
1 jet lag
2 black monday
3 bad lands
epilog
1 jet lag
Einsamkeit kann es nur geben, wo es Individuen gibt. Wo es Individuen gibt, aber gibt es beides: die Lust zur Individualität und damit den Drang in die Einsamkeit und das Leiden an der Individualität und damit den Drang aus der Einsamkeit. Dabei kommt es immer nicht auf das Individuum-Sein an, sondern darauf, ob einer sich als Individuum fühlt und weiß.
KARL JASPERS, Einsamkeit
Nach diesem ganzen Trara (und da war noch mehr) kam ich an einen Punkt, wo ich Einsamkeit brauchte, wo ich diese Maschine anhalten mußte, um nicht mehr zu »denken« und das, was sie »Leben« nennen, nicht mehr zu »genießen«, ich wollte mich einfach ins Gras legen und in die Wolken sehen.
JACK KEROUAC, Allein auf einem Berggipfel
Es gibt viele Gründe, eine Zigarette zu rauchen. Tatsache ist aber, daß die meisten Zigaretten völlig grundlos geraucht werden und sich vor den Augen des Rauchenden in Luft auflösen, ohne daß dieser sie wirklich bemerkt. Mehr noch: Man ist erst dann Raucher, wenn man Zigaretten nicht mehr wahrnimmt, wenn der Griff zur Schachtel, der zum Feuerzeug, das Anzünden und der erste Zug eine Bewegungseinheit bilden wie das Auskuppeln, Schalten und Einkuppeln beim Autofahren oder das Schließen der Haustür und das Drehen des Schlüssels im Schloß, das so unbewußt geschieht, daß man kurz nach Beginn einer Reise gelegentlich beunruhigt ist, man könne die Tür nicht verschlossen haben. Ebenso ist kein Raucher in der Lage, am Ende eines Tages zu sagen, wie viele Zigaretten er geraucht hat, er kann es nur schätzen, die Zigaretten selbst erreichen sein Bewußtsein nicht – nicht mehr.
Wer mit dem Rauchen beginnt, tut es nicht wegen des Rauchens, sondern wegen der damit verbundenen Rituale. Egal, ob in einer Arbeitspause oder auf einer Bergspitze – die Zigarette ist ursprünglich der Versuch, nach einer Phase der Konzentration auf anderes, zurück zu sich selbst zu finden, und sie gleicht darin mehr einer Hostie als einem Genußmittel. So vertraut auch die Werbung der Zigarettenhersteller auf den rituellen Charakter des Rauchens, und man muß zugeben, daß es in einer Zeit, die eher unter einem Zuwenig als unter einem Zuviel an Ritualen leidet, genügend Gründe gäbe, mit dem Rauchen zu beginnen. Allerdings gibt es mindestens ebenso viele, die dagegen sprechen, wobei die schwarzen Lungen verstorbener Raucher eher unbedeutend sind gegenüber der Tatsache, daß es keinen Sinn macht, zwanzig oder vierzig Hostien am Tag zu schlucken. Der einzige Ausweg aus dieser Zwickmühle kann nur sein, mit dem Rauchen anzufangen, um anschließend wieder damit aufzuhören. Das ist nicht leicht, aber kein vernünftiger Mensch käme auf den Gedanken zu verlangen, das Leben müsse immer leicht sein. Kaum ein Raucher, der nicht regelmäßig mit dem Gedanken spielte aufzuhören, denn niemand kann so tun, als gäbe es die Zeit nicht, die aus jedem Ritual irgendwann eine leere Gewohnheit macht. Es ist zwar möglich, auch Gewohnheiten bis ans Lebensende fortzuführen, aber vielleicht müßte man es erreichen, selbst wenn man dazu auf Dauer die Kraft gar nicht haben kann, stets aufs neue Rituale aufzubauen und sie anschließend wieder zu zerstören.
Vor einem halben Jahr hatte Jan mit dem Rauchen aufgehört. Das letzte mit einer Zigarette verbundene Ritual, das eine Spur in seinem Leben hinterlassen hatte, lag allerdings schon länger zurück, vier Jahre ungefähr, eine Abschiedszigarette: Kristin stand ihm auf dem Frankfurter Flughafen gegenüber, während Walter, ihr Mann, zu einem Kiosk ging, um ein paar Zeitschriften zu kaufen, seine Börsenblätter, einen Spiegel.
Die Anzeigetafel tickerte, und die Buchstaben und Flugnummern huschten über die schwarze Fläche wie die Bildchen eines Daumenkinos. Gelegentlich rieselte ein Aufruf von der Decke. Jan bot Kristin damals eine Zigarette an, obwohl sie nur selten rauchte – sie überlegte kurz und nahm dann eine. Er beugte sich vor und gab ihr Feuer. Er wurde damals von einer seltsamen Stimmung erfaßt, die zwar kaum zur Situation paßte, die ihn aber angenehm durchdrang: Es kam ihm vor, als müsse er sich nicht von ihr verabschieden, sondern als stehe sie ihm nach einem Fest gegenüber in einem Zimmer mit halb geleerten Gläsern, einer von Plaudereien verbrauchten Luft und unbeachteter Musik im Hintergrund. Es war, als müßten sie sich nur noch darüber verständigen, zu wem sie jetzt gehen sollten, zu ihm oder zu ihr.
Nach einer Weile kam Walter zurück und verkündete die Neuigkeiten irgendwelcher Schlagzeilen. Es war klar, wohin sie gingen: Jan nach Hause und Kristin ins Flugzeug, mit Walter, seinem ältesten Freund. Sie drückten die Zigaretten aus.
Jetzt steht Jan, sein Handgepäck zwischen den Füßen, unsicher in dem überbreiten Passagierbus und sieht auf die Maschinen, die schwer und träge auf dem Zement des Rollfelds stehen. Die Triebwerke unter den Flügeln sind kaum kleiner als der Bus, in dem er an ihnen vorbeischaukelt. Die Turbinenöffnungen mit den langsam rotierenden Lamellen ziehen vorüber, zwei Wolkenmühlen, die sich in Kürze durch sechstausend Kilometer Luft fressen sollen. Dann steht er auf der Gangway und wartet, ein fast altmodischer Augenblick. In der Maschine schiebt er sich mit kleinen Schritten an den Stewardessen vorbei, die jeden Fluggast begrüßen wie auf einer Cocktailparty. Jan kennt die Situation gut: der Stau im Gang, die Platzsuche und die Überlegung, wen man als Nachbarn erwischt, als Nachbarin – ein kurzer Polaroidblick, den man entwickelt, während man das Gepäck verstaut. Dann grüßt man unverbindlich wie alle. Vielleicht wird man sich in ein paar Stunden ebenso unverbindlich verabschieden. Oder man stirbt gemeinsam.
Jan setzt sich und überhört die Sicherheitshinweise. Er wartet beschäftigungslos auf den Moment, in dem sich die Rollbahn von den Reifen löst, um langsam in die Tiefe zu sinken und sich erst Stunden später in einem anderen Teil der Welt wieder zu nähern. Er wartet auf den Kampf um die Armlehne. Nach dem Start werden heiße Tücher verteilt, um den Schweiß von Händen und Nacken zu wischen. Als nächstes gibt es ein Schokolädchen wie zur Belohnung, weil keiner hysterisch geworden ist. Der Rumpf senkt sich langsam zurück in die Horizontale, und die Maschine erreicht ihre Reisehöhe. Jan hat acht Stunden vor sich, mit denen er nichts anzufangen weiß. Er nimmt sein kleines Aufnahmegerät aus der Jackentasche, einen Panasonic-Kassettenrekorder, den er seit Jahren mit sich trägt, um auf Reisen seine Beobachtungen auf Band zu sprechen. Im Moment allerdings gibt es nichts festzuhalten, und Jan sieht hinaus auf den Flügel, der die Maschine begleitet wie ein metallischer Schatten. Darüber wölbt sich das Violett des Dreißigtausend-Fuß-Himmels. Die Eiskristalle auf den Fenstern bilden einen neblig glitzernden Rahmen, der aussieht wie bei den eingepuderten Fernsehbildern zu Weihnachten.
Jan wird den Gedanken an Kristin nicht los, seit er sich ins Taxi gesetzt hat und zum Flughafen gefahren ist durch die noch ruhigen Straßen, in denen die Luft stand wie Wasser in einem unbenutzten Schwimmbecken. Die Baumkronen trieben auf der Oberfläche, angestrahlt von einer hinter Häuserfassaden verborgenen Sonne. Dann eine von Helligkeit geflutete Kreuzung, die Ampeln spielten mit Farbbällen. Der Wagen rollte vorbei an Kaufhäusern, Bankfilialen, Restaurants und Reisebüros. Dann endete die Häuserzeile, und die Straße verlief parallel zu einem Kanal, Paillettenteppiche kräuselten sich auf dem Wasser. Im Hintergrund bereits der Flughafen. Jan trug seine Tasche zum Eingang, die Automatiktür öffnete sich, das Gebäude schluckte ihn, und in ein paar Stunden wird es ihn wieder ausspucken, siebentausend Kilometer entfernt, ein großes Gebäude, ein weltumspannendes Gebäude, das Kristin lediglich durch eine andere Tür betritt.
Es ist erstaunlich, wie das Fliegen innerhalb von wenigen Jahrzehnten von einer ehrfurchtgebietenden zu einer gewöhnlichen Fortbewegungsart geworden ist. Es kommt einem vor, als sei die Menschheit, die über Jahrtausende vom Fliegen geträumt hat, gar nicht in der Lage, sich über die Verwirklichung dieses Traums angemessen zu freuen. Allerdings muß man zugeben, daß die Realität eines Langstreckenfluges in der Tat ernüchternd ist und aus nichts als einer Summe von dummen Beschäftigungen besteht: Mit der Rückenlehne spielen, vor und zurück, ein bißchen vor und ein bißchen zurück, ein Zeitvertreib, den man dem Vordermann nicht zugesteht. Die Frischluftdüsen, kleine aggressive Föne, denen man die Gurgel umdreht. Die Zeitung auffalten und wieder zusammenfalten und wieder auffalten und wieder zusammenfalten. Aufstehen, weil der Nebenmann pinkeln muß. Aufstehen, weil der Nebenmann vom Pinkeln kommt. Die Stewardessen anlächeln. Der Geruch Hunderter, wie auf Kommando entfalteter Erfrischungstücher. Pulvermilch in Kaffee rieseln lassen. Das Staubsaugerrauschen der Triebwerke. Die Durchsage des Captains über die aktuellen Flugdaten – verknistert, als melde er sich per Funk von zu Hause. Wieder das Lächeln der Stewardessen, alle sitzen im gleichen Boot. Man nimmt alles, was kommt. Vierhundert Menschen, die in einer Aluminiumröhre Truthahnlasagne essen…
Jans Angewohnheit, auf seinen Panasonic-Rekorder zu sprechen, stammt aus der Zeit, als er noch frei für Zeitschriften und Journale gearbeitet hat. Es war die einfachste und schnellste Möglichkeit, Beobachtungen und Situationen zu protokollieren, um aus diesen später seine Artikel zusammenzusetzen. Darüber hinaus gewöhnte er sich an, neben diesen Notizen auf Band regelmäßig Anmerkungen zu den Frauen zu machen, die er liebte oder geliebt hatte; er hielt ihr Aussehen fest und ihre Verhaltensweisen, ihre Blicke und Handbewegungen. Er beschrieb die Art, mit der sie seine Wohnung zum ersten Mal betraten, und ihre matte Wunschlosigkeit, wenn sie hinterher auf der Seite lagen, das Weinglas in der Hand, durch das ihre Brüste verzerrt und wie in weite Ferne gerückt erschienen. Mehr und mehr, stellte er fest, näherte er sich ihren Körpern wie fremden Landschaften, beobachtend und mit einer etwas abgenutzten Neugier – dieselbe Haltung, mit der er sich am Ende seiner Zeit als freier Journalist auf Reisen begeben hatte. Und wie man jedes neue Land, das man betritt, mit denen vergleicht, die man kennt, verglich er die Frauen miteinander, als bestehe die Chance, eine vollständige Geographie des weiblichen Kontinents zu entwerfen.
Vielleicht würden die Frauen, die er geliebt hatte, protestieren, wenn sie von den Aufzeichnungen wüßten, wenn sie wüßten, daß ihn einmal sehr kleine, beim Bräunen weiß gebliebene Brüste an eine Nickelbrille erinnert hatten, die ihn beim Geschlechtsakt ansah; daß er einmal auf einem Rücken eine Gruppe von Leberflecken entdeckt hatte und sich der Gedanke in ihm festsetzte, es müsse sich um das Sternbild der Jungfrau handeln; oder daß ihn unrasierte Achseln fast immer störten, weil sie ihm vorkamen wie ein unzivilisierter, tierischer Rest aus den Zeiten, als Sex eine dumpfe Sache von Sekunden war.
Jans Verhältnis zu Frauen war ein rituelles. Er eroberte sie, liebte sie und verließ sie nach kurzer Zeit wieder. Merkwürdigerweise war er allerdings in einem Punkt konservativ: Er bemühte sich, keine Verhältnisse parallel zu haben, und wenn er feststellte, daß ihn eine Frau betrog, verließ er sie; nicht mit Krach und Vorwürfen – er stellte einfach die Kontakte ein oder reduzierte sie wieder auf das frühere Maß, wenn es sich um eine ältere oder berufliche Bekanntschaft handelte. Er wollte nicht der einzige für ein ganzes Leben sein, aber doch für ein paar Wochen oder Monate. Er mochte keine gekreuzten oder gemischten Verhältnisse, und erotische Experimente in anderen Konstellationen als der zwischen einem Mann und einer Frau lehnte er ab. Und er bestand gegenüber hin und wieder erhobenen Vorwürfen darauf, daß er die Frauen nicht benutzte, sondern liebte – nur eben nicht für immer und ewig. Er hielt sich für fair, weil er nie das Gegenteil behauptete, um eine Eroberung zu machen, und Frauen, die möglicherweise mehr erwarteten, bedrängte er nicht. Er verurteilte Männer, die alles mögliche versprachen, um ein paar Nächte zu ergattern. Und auch wenn sich für ihn einmal längere Zeit nichts ergab, blieb er diesem Prinzip treu; lieber einsam, als unter Vorspiegelung falscher Tatsachen einen fremden Körper zum Instrument seines Triebs zu machen. Die Regeln seines Vagabundierens waren durchaus moralisch, und wenn es einen Bedarf für eine Enzyklika der Polygamie gegeben hätte, hätte er das eine oder andere Kapitel beisteuern können.
Eine leichte Veränderung der Triebwerksgeräusche kündigt den Beginn des Sinkflugs an. Die amerikanische Erde sieht nicht anders aus als die europäische, ein von Straßen durchschnittenes braun-grünes Mosaik, der Planet ist parzelliert. Die Autobahnkreuze liegen wie vierblättriger Klee in der Landschaft, daneben das Meer, gesäumt von einem schnurgeraden, weißen Band und fingerbreiten Haffseen im Hinterland. Das Wasser glänzt im Gegenlicht wie grobporiges Leder. Der Flügel, der stundenlang starr in den Himmel gezeigt hat, verändert sich jetzt, die Landeklappen schieben sich übereinander wie Schindeln. Die Erde kommt näher, wird zu einem Watt mit gewundenen Kanälen und Seen, unregelmäßig geformt wie verkleckertes Wachs. Dann das helle Grau der Landebahn. Vierhundert Menschen, die gleichzeitig aufstehen wie nach dem Segen beim Gottesdienst.
Eine Viertelstunde später folgt Jan den Schildern EXIT durch Korridore mit weißem Deckenlicht, Resopalpaneelen an den Wänden und graumeliertem, trittfestem Teppich auf dem Boden. Dann die Paßkontrolle: US Citizens with valid Passports oder Visitors.
Jan wirft noch einmal einen Blick auf das grüne Formular, das er gegen Ende des Fluges ausgefüllt hat: Welcome to the United States… I-94W Non-immigrant Visa Waiver/Departure Form… Do any of the following apply to you? (Answer Yes or No)… C.Have you ever been or are you now involved in espionage or sabotage; or in terrorist activities; or genocide; or were you involved, in any way, in persecutions associated with Nazi Germany or its allies between 1933 and 1945?
In ihrer Direktheit haben Jan die Fragen überrascht. Wer bejaht schon, ob er ein Naziverbrecher, Gewalttäter, Verrückter oder Drogenabhängiger ist? Also hat er alle Fragen verneint, in der Gewißheit, ein harmloser Mensch zu sein.
Er reicht dem Grenzbeamten den Visa Waiver und seinen Paß.
»You made a mistake here, many mistakes«, stellt der Beamte fest.
Jan sieht ihn fragend an, der Beamte weist auf die Kugelschreiberkreuzchen. Jan hat beim Eintragen seiner persönlichen Daten, Name, Geburtstag, alle Angaben versehentlich eine Zeile zu hoch gemacht, jetzt ist sein First Name Germany und sein Sex UA 372.
Er entschuldigt sich: »I’m sorry.«
Der Grenzbeamte schüttelt den Kopf. »No matter… you have to concentrate… do Yoga first.« Er macht ein paar Pfeilchen auf dem Visa Waiver und nimmt Jans Paß vom Scanner. »Alright, good bye.«
Jan schultert sein Handgepäck und geht weiter. Er entdeckt eine Toilette, die ist wie überall, weiße Kacheln und eng aufgereihte Pissoirs wie zusammengepferchte Küken im Nest, die die Schnäbel zur Fütterung aufsperren. Wieso nimmt man an, daß es Männern nichts ausmacht, sich beim Pinkeln zuzusehen? Er zieht den Reißverschluß seiner Hose wieder hoch. Der Geruch fällt ihm auf, kein europäischer Geruch, Harn ist Harn, aber die Desinfektionschemie ist eine andere, die Seife ist eine andere und verwandelt Jans Hände in fremde Hände. Lediglich in den Reklameleuchtkästen auf dem Gang präsentiert sich eine internationale Duftwelt, Parfums, für die mit pickelfreier Erotik geworben wird, Bilder, die keine Menschen zeigen, sondern Reißbrettphantasien von Humanarchitekten, in flüssigen Stickstoff getauchte Statuen, von denen man sich nicht vorstellen kann, daß sie überhaupt nach etwas riechen, wenn man ihnen ihre Flakons wegschließen würde.
Jan folgt den Hinweisschildern baggage claim und betritt die Halle mit den Förderbändern, auf denen Koffer wie umgefallene Dominosteine liegen. Ein träges Rennen ohne Überholmanöver, die Samsonites sind nicht schneller als die Rucksäcke. Gelegentlich wird ein Stück vom Band genommen, und die entstandene Lücke trottet weiter wie ein reiterloses Pferd. Hier und da lösen sich erste überladene Gepäckwagen aus dem Pulk und werden zum Ausgang geschoben wie satte Schweine.
Jan entdeckt seine Tasche. Nicht spritziger als alle anderen, aber treu wie ein Hündchen kommt sie ihm entgegen. Er nimmt sie vom Band und arbeitet sich durch den Saum aus Wartenden. Am besten wäre es, denkt er gelegentlich, ohne Gepäck zu verreisen und sich das Nötige zusammenzukaufen.
Er betritt die Haupthalle, und ihn befällt trotz seiner langjährigen Reiseroutine die eigentümliche Verwirrung am Ende eines Fluges: Bisher war alles so einfach, und jetzt muß wieder klein-klein gereist werden. Die andere Sprache, die andere Atmosphäre trotz des hautengen Überzugs aus Internationalität. Um ihn herum das gleiche Atoll aus Wiedersehensinseln wie auf allen Flughäfen, aber andere Gesichter: Japaner oder Koreaner, die keine Japaner oder Koreaner sind, sondern Amerikaner. Kein langsames Vorbeugen des Oberkörpers mit eingefrorenem Lächeln. Es sind Weiße, die orientierungslos herumstehen. Touristen.
Jan wartet. Irgendwo in der Menge müssen zwei Gesichter nach ihm Ausschau halten wie er nach ihnen. Stecknadeln in einem Stecknadelhaufen– Kristin und Walter. Als Jan vor fünf Jahren erfahren hat, daß die beiden heiraten wollten, war sein erster Gedanke, Kristin müsse schwanger sein, ein Gedanke, der ihm nicht gefiel, weil er sie sich mit Bauch nicht vorstellen konnte. Sie war gut einssiebzig groß und wog keine fünfundfünfzig Kilo. Ohne Bauch. Jan fand, daß die Hagerkeit zu ihrem Wesen paßte, während er in einer Schwangerschaft nur etwas Fremdes hätte sehen können. Eine Verunstaltung, die ihr biologische Mächte angezaubert hätten.
Die meisten Paare, die Jan kannte, hatten wegen der Kinder geheiratet. Genauer wegen der Embryonen– Materie, durchsichtig wie Spucke und ausgestattet mit der ungeheuren Macht, zu wachsen und zu wachsen. Und durch die medizinische Technik wurde es nicht leichter, sondern schwerer, dieses Wachstum zu beenden, weil die Fotos von den eingerollten Wesen mit zwei Ärmchen, Kopf und merkwürdig stechenden Augen nicht zu ignorieren waren, obwohl es sich dabei, zumindest anfänglich, auch um Affen handeln könnte oder um einen Fisch. Aber, dachte Jan, man kann nicht zurück hinter das, was man weiß, und man weiß, daß es ein Mensch ist, der dort wächst und sich schon längst auf ein paar Jahrzehnte eingestellt hat. Diese ungeheure Macht eines Krümels Materie, die Zukunft praktisch als Eigentum zu betrachten. Jan will nicht Vater werden.
Kristin war damals nicht schwanger, und als Jan von der geplanten Hochzeit erfuhr, ist er ins Kino gegangen. Eine amerikanische Komödie, mehr aus Zufall, um sich abzulenken. Letztlich, so erklärte er sich seine Irritation damals, ist man immer eifersüchtig, wenn ein anderer eine interessante Frau bekommt: Man will sie alle.
Walter kommt ihm entgegen. Er trägt ein buntbedrucktes Freizeithemd, helle Jeans und Turnschuhe. Amerika, denkt Jan, steht ihm nicht schlecht. Die Haare sind länger als vor vier Jahren, Walter hat sie hinter die Ohren gestrichen. Das Gesicht wird durch den Schnitt schmaler. Die oberen beiden Knöpfe seines Hemdes stehen offen, und auf Hals und Brustansatz hat sich ein glänzender Film gebildet, der nicht zur trockenen Luft im Flughafengebäude paßt. Seine Figur hat sich verändert, Oberkörper und Schultern sind im Vergleich zur Hüfte breiter geworden.
Dann stehen sie sich gegenüber, zum ersten Mal seit vier Jahren, und wissen für einen Moment nichts miteinander anzufangen. Sie haben nie viel von Begrüßungszeremonien gehalten, ein Handschlag hat immer gereicht – allerdings hatten sie nie vier Jahre zu überbrücken. Sie umarmen sich und erstarren einen Augenblick wie eine Uhr, die auf den nächsten Impuls wartet. Was ist mit Kristin? denkt Jan.
»Willkommen in New York«, sagt Walter gutgelaunt, und Jan bedankt sich. Er nimmt seine Tasche. Die Haupthalle hat sich geleert, und Jan dreht sich zum Ausgang. Walter geht voraus. Der Himmel, den Jan vom Flugzeug aus gesehen hat, ist von unten betrachtet eine milchige und strukturlose Fläche. Die Luft ist heiß und feucht wie beim Kartoffelabgießen.
»New York liegt auf der Höhe von Neapel, wußtest du das?« sagt Walter, und in seiner Stimme liegt ein deutlicher Stolz, daß er hier lebt, wovon – glaubt er – alle anderen träumen. Er wendet sich nach rechts. Autos rollen über hellen Beton mit eingesickerten Ölflecken, schwarzen Teernähten und abgeriebenen gelben Parkmarkierungen. Über allem rauscht der einförmige Chor aus- und warmlaufender Triebwerke.
Walter überquert die Straße. »Ende Mai, Anfang Juni schlägt das Wetter um. Vorher ist es angenehm. Heute ist es besonders drückend.«
Hitze und Feuchtigkeit, die durch Kragen und Ärmel kriechen, zwingen Jans Haut, sich Pore um Pore an der Kleidung festzusaugen. Er folgt Walter an einer langen Reihe gelber Taxis vorbei. Einsatz in Manhattan.
Walter geht nach links auf einen Parkplatz. »Man sagt, daß es in New York ohne die ganzen Klimaanlagen halb so heiß wäre. Einer schaufelt dem anderen die Hitze vor die Tür. Wie Schnee. Irgend etwas wird schon dran sein. Wir haben zu Hause eine Klimaanlage, benutzen sie aber kaum.«
Er bleibt vor einem hellblauen Mittelklassewagen stehen, einem Buick mit taubenblauem Innenraum und grünlich beschichteter Windschutzscheibe. Er öffnet die Beifahrertür, Jan setzt sich. Im Wagen ist es kühler als draußen, und als er die Tür zuschlägt, hat er das Gefühl, er sperre den Kontinent, den er soeben betreten hat, wieder aus.
Walter setzt rückwärts aus der Parklücke. »Kristin möchte nicht, daß die Klimaanlage läuft. Manchmal übertreiben sie es hier wirklich. Im Sommer gibt es die meisten Erkältungen«, sagt er und lacht. Er steuert den Wagen langsam über den Parkplatz und fingert eine Zigarettenschachtel aus der Hemdtasche.
»Du rauchst noch?« fragt Jan. »Ich dachte, das gehört sich hier nicht.«
»Stimmt auch.« Walter hält ihm die Packung hin.
»Ich habe aufgehört«, sagt Jan.
Walter nimmt ein Feuerzeug von der Ablage, zündet die Zigarette an und bläst den Rauch gegen die Frontscheibe. Die Dunstwirbel geraten in die Fänge der Air-condition und lösen sich auf. Nach der feuchten Hitze auf dem Parkplatz ist es im Wagen kühl. Frostige Luft aus verschiedenen Schlitzen verwandelt das Innere in einen Eisschrank. »Im Auto ist es ohne Air-condition wirklich nicht auszuhalten«, sagt Walter. »Im Stau würdest du verrückt werden. Hast du Falling Down gesehen? Michael Douglas spielt einen, der im Stau durchdreht und dann Amok läuft. Die Hitze war nicht wirklich der Grund. Er war ein typischer Verlierer, nicht sehr sympathisch, aber hier und da versteht man ihn. Irgendwann platzt jedem der Kragen.«
Sie biegen auf einen Highway. Jan spielt mit der ausklappbaren Halterung für Getränkedosen in der Mittelkonsole. Er wartet auf die Wolkenkratzer und ist enttäuscht: Nur Einfamilienhäuser säumen die Straße, Holzbauten mit rußverblaßten Farben, ehemals gestrichen in Gelb oder Himmelblau. Vor den Eingängen dösen kleine Veranden, eine fahlhäutige Vorstadtidylle mit sauerstoffarmen Gärtchen.
Es gefällt Walter, über das Leben in New York zu reden, das Jan nicht kennt. »Eigentlich braucht man hier kein Auto«, sagt er und zieht einen Aschenbecher aus den Armaturen. »Aber es ist praktisch, wenn man am Wochenende mal raus will. In der Stadt geht alles mit Taxis. Sie haben hier vernünftige Preise. Nicht dieser verordnete Nepp wie in Deutschland. Ich meine, wenn jeder nehmen kann, was er will, dann pendelt sich alles auf einem vernünftigen Niveau ein. Wenn alles normal läuft.«
Jan sieht aus dem Fenster. Die Skyline von Manhattan hat ihren Auftritt: eine Gebirgskette aus Legosteinen, eine auf- und absteigende Börsenstatistik, für die sich allerdings niemand interessiert. Der Verkehr rollt ruhig über die rissigen Betonplatten des Expressways, die Fahrer nehmen keine Notiz von ihrer Stadt, klopfen mit den Fingern irgendeinen Rhythmus aufs Lenkrad oder achten auf die grünen Straßenschilder mit weißer Schrift, als sei die nächste Abfahrt wichtiger als die grauen Zinnen unter dem weißen Himmel. Das Logo der Neuen Welt. Dann wieder versperren dreckige Backsteinbauten den Blick auf die Stadt. Links erstreckt sich eine verschachtelte Industrieanlage, ein Strickmuster aus Rohren, Gerüsten, Kabeln, Stahlträgern und Gleisen, auf und zwischen denen sich nichts bewegt, keine Loren, keine Lastwagen, keine Menschen. Wie abgeschaltet liegt das Areal neben der Schnellstraße, auf der die Energie vorbeiströmt, ohne daß ein gegenseitiger Anschluß zu erkennen wäre. Jan hat das Gefühl, nicht angeschlossen zu sein, New York streicht nicht über seine Haut und verfängt sich nicht in seinen Haaren. Er müßte das Fenster öffnen, um das Gefühl loszuwerden, die Welt aus einem klimatisierten U-Boot zu betrachten.
Walter ist noch bei den Taxipreisen. »Diesen Winter hatten wir einen Schneesturm«, erzählt er, »an sich nichts Ungewöhnliches, aber er hat die Metro lahmgelegt. Busse fuhren auch nicht, und die einzige Möglichkeit, vom Flughafen in die Stadt zu kommen, waren ein paar Taxis – für hundertfünfzig bis zweihundert Dollar, habe ich gehört. Viel Geld für ein paar Meilen, aber man konnte wenigstens in die Stadt kommen. Hätten die Fahrer den Preis nicht selbst bestimmen können, wären sie zu Hause geblieben.«
Friedhöfe fließen vorbei, aufgerichtete Marmorplatten, die Toten liegen dicht an dicht, eine Skyline aus Grabsteinen. Kaum anzunehmen, daß die Toten unter dem Rauschen des Expressways ihre Ruhe finden. Das Leben geht vor. Und immer wieder die Wegweiser – Last Exit Brooklyn. Wo liegt Brooklyn? Sie fahren vorbei an geschwärzten Fassaden aus Backsteinen und Fensterglas, sechs-, siebengeschossige Wohnhäuser mit rostigen Feuerleitern. Filmszenen schieben sich über die Wahrnehmung, Verfolgungsjagden in Vorabendserien. Amerika gleicht Amerika. Jan fragt sich, ob man sich in den Vierteln neben dem Highway überhaupt aufhalten dürfte. Wenn man etwas über New York zu wissen glaubt, dann daß man als Weißer in Harlem krankenhausreif geschlagen wird. Wo ist Harlem? Die Bronx?
Walter klopft Asche ab. »Normalerweise kann man die Metro problemlos benutzen. Man wird nicht sofort überfallen, auch nachts nicht. Die meisten Linien sind safe. Man sollte nicht unbedingt in die Bronx fahren, aber nach Harlem beispielsweise ist es kein Problem. Du kannst völlig normal in Harlem rumlaufen. Am Anfang ist es merkwürdig, wenn du nur Schwarzen begegnest. Ich meine, man sieht ja seine eigene Hautfarbe nicht und sieht also gar nicht, daß man ein Fremdkörper ist. Im ersten Moment bist du mißtrauisch, wenn einer auf dich zukommt, aber sie wollen dir nur irgendwelchen Kleinkram verkaufen wie überall. Kürzlich war Muttertag, und auf den Straßen waren lauter Familien, rausgeputzt, wie man das in weißen Bezirken nicht sieht.«
Die Stadt enthüllt sich nur langsam, Manhattan läßt sich nicht drängeln. Kindergeburtstag: Erst die kleinen Geschenke auspacken, bevor man das große aufreißen darf. Jan hat wirklich Geburtstag, ein Zufall. Er könnte sich also etwas wünschen: anhalten und aussteigen.
Walter wechselt die Spur. »Die Sicherheit in New York ist kein Problem. Ich gehe jeden Tag mit Anzug, Krawatte und Aktenkoffer durch den Central Park. Neulich haben sie Modeaufnahmen gemacht. Vielleicht für Harper’s Bazaar oder weiß der Teufel wofür. Sie haben zwei wirklich tolle Models abgelichtet. Die eine war Deutsche. Der Fotograf rief action, Monika, und sie tänzelte ein paar Sekunden herum und schnitt komische Grimassen. Kaum zu glauben, daß dabei vernünftige Aufnahmen herauskommen. Nach vier, fünf Filmen war das nächste Model an der Reihe. Die beiden sahen wirklich knackig aus.« Walter drückt seine Zigarette aus. »Neulich ist jemand auf dem zentralen Busbahnhof erschlagen worden. Aber das kann dir auch in Deutschland passieren. Überall auf der Welt.«
Jan versucht, die Eindrücke zu speichern. Das Bandgerät in seiner Hand fehlt ihm jetzt: Er hat keinen Behälter für seine Beobachtungen: Brückenpfeiler wachsen auf der grüngetönten Windschutzscheibe. Der Verkehr wird dichter und dichter, dann steht der Buick im Stau. Siebentausend Kilometer gereist, und siebenhundert Meter vor dem Ziel ist Schluß.
Daß Walter redet und redet, ist Jan angenehm und geht ihm zugleich auf die Nerven. Er fragt sich, warum Kristin nicht mitgekommen ist, ihn abzuholen? Er ist enttäuscht. Soviel er weiß, arbeitet sie nicht fest, sondern frei in einer Galerie, die sie mitbegründet hat. Walter gefiel es nicht, daß Kristin aufhörte, als Mathematikerin zu arbeiten. Es gab wegen dieses Schritts eine Reihe von Auseinandersetzungen zwischen den beiden, die ihre Ehe belasteten und zu keinem Ergebnis führten. Vor allem gefielen Walter die Freunde nicht, mit denen Kristin das Galerieprojekt ins Leben gerufen hatte, insbesondere Rick, ein Fotograf, in dem Walter den Prototypen eines ewig erfolglosen Künstlers sah. Rick war in Walters Augen gar nicht in der Lage, ein Ziel konsequent zu verfolgen, weil er sich immer verzettelte. Walter war überzeugt, daß Erfolg gleichbedeutend war damit, ein klares Ziel vor Augen zu haben, und er selbst hatte ein klares Ziel vor Augen: Er wollte ins Finanzmanagement. Er war nie der Mensch, der sich mit Zweifeln belastete. Wer zuviel Gepäck mitnimmt, pflegte er zu sagen, macht irgendwann schlapp. Darum hatte er von vornherein nur das Nötigste mitgenommen. Eigentlich hatte er gar nichts mitgenommen, keine Bedenken, keine komplizierten Fragen. Hin und wieder fand Jan ihn regelrecht naiv. Aber Kristin hatte sich, wie Jan wußte, was die Galerie betraf, gegen ihn durchgesetzt. Vielleicht, überlegt er jetzt, hat sie dort zu tun, aber seine Enttäuschung bleibt.
Er versucht, die Zeit zu schätzen. In Berlin müßte es jetzt zehn Uhr abends sein. Der Verkehrsstau und die Helligkeit irritieren ihn, als blicke er auf eine Uhr, die seit Stunden steht. In den Ritzen der brüchigen Zementplatten am Straßenrand sprießen mit bewundernswerter Zähigkeit ein paar Unkrauthälmchen.
»Wie geht es Kristin?« fragt er.
»Sie wollte irgend etwas in ihrer Galerie erledigen«, sagt Walter, und es ist nicht zu überhören, daß er kein Verständnis für diese Entscheidung hat. Er nimmt noch eine Zigarette und läßt den Buick ein Stück vorrollen. »Anfangs habe ich ja gedacht, sie würde sich hier etwas als Mathematikerin suchen.« Er läßt das Feuerzeug schnappen und zieht. Statt dessen habe sie Rick kennengelernt, diesen Fotografen aus der Nachbarwohnung, in der es stets nach Essig stinkt, weil er das Badezimmer als Dunkelkammer benutzt. Rick, sagt Walter, sitze völlig unorganisiert auf Bergen von Negativen, für die sich niemand interessiere, außer Rick selbst. Und Kristin irgendwann. Für Werbefotografie sei sich Rick zu schade, sehr unamerikanisch übrigens, behauptet Walter, Geldverdienst mit einem Anspruch zu verknüpfen. Und dann trifft er ausgerechnet Kristin, die ihm von Kafka erzählt, der seine Sachen habe verbrennen wollen, oder Mozart, den sie in einem Armengrab verscharrt haben. Kunstmärtyrer.
Irgendwann hat sie ihm die Sache mit der Galerie erklärt. Daß sie mit Rick und ein paar Freunden beschlossen habe, eine Galerie im East-village aufzumachen. Als Mathematikerin! hat Walter gedacht. Für ihn war klar, daß Kristin dabei war, in einen falschen Zug einzusteigen. Außerdem konnte er sich nicht vorstellen, daß Rick, der Kunstmoralist, einen sich finanziell tragenden, geschweige denn profitablen Laden zustande bringen würde. Walter hat nie verstanden, wo das Geld für die Galerie eigentlich hergekommen ist.
Nach ein paar Monaten, erzählt Walter, gab es die erste Vernissage, übrigens nicht mit Ricks Bildern, der wahrscheinlich an seiner Desorganisation und an seinem päpstlichen Absolutheitsanspruch gescheitert sei. Außerdem war er nicht der einzige Künstler unter den Galeriegründern. Eigentlich waren sie alle Künstler. Bis auf Kristin.
Walter konnte mit den ausgestellten Objekten nicht viel anfangen. In einer Ecke lag ein Haufen Sand mit ausgedrückten Zahnpastatuben. Er stand davor und dachte sofort: Wer kauft einen Haufen Sand mit Zahnpastatuben? Zumal Champagner ausgeschenkt wurde, und Champagner kostet Geld. Und dann stand der Sandkünstler neben ihm: What do you feel? Walter fühlte sich beschissen: Die einen arbeiten und sorgen dafür, daß es voran geht, und die anderen häufen Sand in eine Ecke. Er habe Lust, seinen Champagner in den Sand zu kippen, sagte er. That’s it, sagte der andere und kippte seinen Champagner in den Sand.
Ein Bild von Rick gab es übrigens doch. Eine Aufnahme von Kristin irgendwo in einem heruntergekommenen Teil der Stadt. So was Melancholisches. Walter beschwerte sich hinterher bei Kristin, weil sie ihm nicht erzählt hatte, daß sie sich von Rick habe fotografieren lassen. Sie behauptete, er interessiere sich schließlich nicht dafür, was sie mache. Er versuchte noch einmal, sie davon zu überzeugen, als Mathematikerin zu arbeiten: Als Mathematikerin sei sie die beste gewesen, aber sie erklärte nur, man müsse nicht unbedingt machen, was man am besten könne. Seitdem haben sie über das Thema nicht mehr geredet. Walter war überzeugt, daß seine Frau in einer Falle saß, in die andere mit zwanzig tappten. Künstlerdasein. Champagner in Sand kippen.
Hin und wieder rattert eine silberne U-Bahn in der Mitte der Brücke vorbei wie ein Achterbahnwagen ohne bunte Lackierung und blinkende Lämpchen. Über die Fahrbahn sind Netze gespannt, wie zum Schutz, als bröckele die Trägerkonstruktion.
Jan drückt auf ein Knöpfchen am Ende der Armlehne, die Scheibe fährt gleichmäßig wie bei einem Geldautomaten hinunter und gibt die Stadt zur Benutzung frei. Feuchte Luft strudelt in den Wagen.
Für Jan war Mathematik die Lehre einer etwas abseitigen Sekte. Er hatte Kristin einmal während eines Kongresses besucht und sich ihr zehnminütiges Referat über nicht ganzzahlige Dimensionen angehört. Ihn beschlich der Verdacht, daß viele ihrer Kollegen zwar Mathematik studierten, aber Theologie meinten. Außerdem kam es ihm vor, daß die meisten Zuhörer sich nicht auf Kristins Formeln, sondern auf Kristin als Frau konzentrierten. Als er ihr das sagte, behauptete sie, dies sei eine typische Journalistenwahrnehmung, in der aus ein paar starrenden Männeraugen gleich ein starrender Hörsaal wird. Wie er sie denn betrachtet habe? Als Mathematikerin oder als Frau?
Trotzdem blieb sie nicht lange in der mathematischen Forschung, was Jan darauf zurückführte, daß sie eben doch keine Lust hatte, ein exotisches Wesen in einem Nebengehege der Gesellschaft zu sein. Tatsächlich war es aber nicht diese Sonderrolle, die sie veranlaßte, sich aus der Forschung zurückzuziehen, sondern sie zweifelte, ob es sinnvoll war, sich mit nicht ganzzahligen Dimensionen zu beschäftigen. Kam hinzu, daß die Forschungsergebnisse, die sie zu präsentieren hatte, dünn waren, um nicht zu sagen marginal, und dementsprechend keine große Resonanz auslösten. Es kam ihr vor, als sei es so ziemlich der gesamten Menschheit egal, ob der von ihr enthüllte Zusammenhang nun Teil des kollektiven Wissens war oder nicht. Enttäuscht und zugleich erleichtert, kehrte sie der mathematischen Forschung schließlich den Rücken.
Der Buick erreicht das Ende der Brücke und ist jetzt Teil einer Blechinfusion, die in Manhattans Straßen tropft. Schmucklose Wohnhäuser türmen sich rechts und links, gut zehnstöckig, die allmählich näher an die Straße rücken. Der Fahrzeugstrom lockert sich auf, und jetzt reicht es nicht mehr, das Fenster zu öffnen, man müßte das Dach absprengen, um sich sämtliche Stockwerke in die Augen regnen zu lassen und zu sehen, wie die Wolkenkratzer an den Wolken kratzen. Bleistifte, die aus dem Boden ragen. In der wievielten Etage beginnt der Himmel? Jan würde es nicht bemerken, wenn sie am Empire State Building vorbeiführen, es wäre eine der Fassaden, die das Wagendach im fünften oder sechsten Stock abschneidet. Dann wieder Gebäude mit drei, manchmal nur zwei Geschossen, Baulücken oder kleinere Plätze. Meterhohe Reklametafeln mit Halogenbeleuchtung säumen die Straße. Jans Blick haftet einen Moment lang an einer Schwarzweißfotografie, groß wie eine Kinoleinwand: eine junge Frau hingestreckt auf dem Boden, den Kopf in die Hand gestützt, bekleidet nur mit einem dunklen Body, Calvin Klein underwear. Das Bild zieht vorbei.
Walter schweigt seit der Champagnergeschichte. Hier und da steigen Dampfschwaden auf, als köchelten kleinere Vulkane unter dem Pflaster. Der Asphalt ist feucht, und in den Abfallkörben auf dem Gehweg haben sich ausrangierte Schirme ineinander verhakt, verbogene Gestelle und zerrissene Stoffbahnen, die leicht im Wind flattern. Der Verkehr rollt durch den Schrift- und Signalwald im Erdgeschoß der Stadt. Kein Meter ohne eine Botschaft, ein Angebot, einen Hinweis: Pizza, Video, one way, car-park, check our prices, parking 9 am – 7 pm, 25¢ per 1 ⁄ 2 hr.
»Vor ein paar Wochen«, sagt Walter nach ein paar Minuten, »hat es in der Galerie einen Streit gegeben. Die Hintergründe haben mich nicht interessiert. Kristin kam wütend nach Hause und schimpfte auf alles mögliche. Ehrlich gesagt, mich hat allein die Tatsache gefreut, daß sie den ganzen Laden am liebsten in die Luft gejagt hätte. Ich hoffte damals, die Geschichte würde sie kurieren und ihr klarmachen, daß ihre Künstlerfreunde nichts als Dogmatiker sind, die ihre Entscheidungen nicht auf der Basis von Fakten fällen.«
Jan hat das Gefühl, Walter erzählt nicht die ganze Geschichte.
»Ich habe am nächsten Tag in der Bank nachgefragt, ob sie nicht eine Stelle für sie hätten«, fährt er fort. Er wechselt die Spur und nimmt sich noch eine Zigarette. »Sie waren tatsächlich interessiert. Ich habe es ihr allerdings nicht erzählt. Sie hätte sich geärgert.«
Er macht eine Pause und wechselt in einen unverbindlichen Tonfall. »Weißt du, sie hatte sich wohl in Rick, diesen Fotografen, verliebt. Aber ich habe keine große Angelegenheit daraus gemacht. Ich meine, solche Sachen kommen vor, man sollte sie nicht überbewerten.«
»Ach?« sagt Jan überrascht und gleichzeitig unangenehm berührt. Walters Bemerkung verweist ihn, was Kristin betrifft, vom zweiten Platz auf Platz drei oder in irgendein anonymes Verfolgerfeld.
»Die Sache hat sich dann gelegt«, fährt Walter fort. »Es war kein Drama.« Er schlägt Asche ab und reißt unvermittelt das Steuer herum, als sei ein Abgrund vor ihm aufgetaucht. Er schlägt auf die Hupe und klatscht sich mit der rechten Hand mehrfach auf die Stirn, um dem Vorausfahrenden, der sich, wie Jan findet, außer einem ruhigen Spurwechsel nichts hat zuschulden kommen lassen, klarzumachen, was er von dessen Intelligenz hält. Walter schert aus, gibt Gas, überholt den anderen, sieht auf seiner Höhe wütend zu ihm hinüber und wirft ihm ein paar Beschimpfungen zu. »Idiot«, befindet er abschließend und beruhigt sich wieder.
Jan denkt nach. Es kommt ihm vor, als habe Walter reden, als habe er alles einmal loswerden müssen, was bedeuten würde, daß er in den vier Jahren in New York niemanden kennengelernt hat, dem er wirklich vertraut. Jan wird klar, daß Kristin in einer Welt lebt, die mit ihm und seinen Erinnerungen nichts mehr zu tun hat.
Walter läßt den Buick von Kreuzung zu Kreuzung rollen. Gelegentlich ein Stop. Das Gespräch steht wie eine abgelaufene Uhr. Man kann nicht beliebig lange über einen Menschen reden, den man kurz darauf sieht; fast so, als würde der Geruch eines Gesprächs noch eine Zeit an einem haften, denkt Jan.
Er schwitzt. Sein Hemd klebt an der Wirbelsäule, von seinen Achseln kriechen Tropfen die Haut hinunter. Er überlegt, ob er das Fenster wieder schließen und es der Air-condition überlassen soll, die Luft auszuwringen. Ihm mißfällt das Prinzip, auf jede Plage mit einer technischen Erfindung zu antworten. Hitze, Kälte, Feuchtigkeit: alles wird abgeschafft. Jede Annehmlichkeit ist der Verlust einer Wahrnehmung.
Die Luft zwischen den Autos flimmert, strömt an Türen und Kotflügeln entlang aufwärts. Jan läßt das Fenster geöffnet. Wenn schon nicht mehr rauchen, dann wenigstens die Stadt ohne Filter.
Ein elektronischer Piepser reißt Jan aus seinen Gedanken. Walter holt ein Handy aus der Jackettasche und drückt ohne hinzusehen mit dem Daumen eine Taste. Hello!, sagt er, und Jan hört ihn zum ersten Mal englisch reden. Es kommt ihm vor, als fühle Walter sich in der fremden Sprache wohler, als sei alles, was er in der letzten halben Stunde erzählt hat, nur in der deutschen Sprache real, während im Englischen die Welt eine unbeschwerte Welt ist, die Welt der Aktien, Renditen und Anleihen, was Jan aus einzelnen Begriffen schließt, die wie Signalsilben aus dem Sprachsee ragen, zu weit voneinander entfernt, als daß er ein Verständnisnetz dazwischen knüpfen könnte.
Walter lacht über irgendeine Geschichte, in der that little Japanese restaurant eine Rolle spielt. Immer wenn er spricht, muß er das Telefon vom Ohr entfernen und die Sprechmuschel vor den Mund halten, weil der Hörer zu kurz ist. Das Problem ist nicht mehr, die Handys kleiner zu machen, sondern die Köpfe. Es geht jetzt um Jan, a friend from Germany, und dann um eine Verabredung. Hold on a second, sagt Walter und dreht den Kopf.