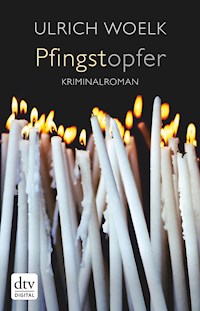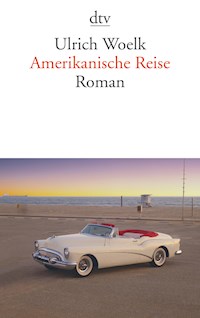8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein virtuoser Roman über das Lebensgefühl der Generation, die auf die Studentenbewegung folgte Ein virtuoser Roman über das Lebensgefühl der Generation, die auf die Studentenbewegung folgte Die Hochzeit endet mit einen Eklat: Auf seine »Jugendsünden« während der Studentenproteste Ende der sechziger Jahre angesprochen, beschimpft der Bräutigam seinen ehemaligen Lehrer als alten Nazi, der einen Schüler in den Tod getrieben habe. Ein politischer Generationskonflikt bricht auf, der wie Stirner, der jüngere Bruder des Bräutigams, weiß, - auch private Ursachen hat. Scheinbar unbeteiligt und nur aus Neugier, spürt Stirner den Gründen des Streits nach, der sowohl in der Zeit des Nationalsozialismus als auch in jenem legendären Jahr 1968 wurzelt. Seine Recherchen führen ihn nach Berlin, doch was er in den Wirren der deutschen Vereinigung aufdeckt, erweist sich als ein Liebesdrama, das auch ihn selbst betrifft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ulrich Woelk
Rückspiel
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte Ausgabe 2007© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40396-2 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13559-7Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Erste Woche
Klar bin ich auf ...
Ich habe Schluß gemacht ...
Die Rede meines Vaters ...
Die hundert Stunden sind ...
Lucca fährt auf den ...
Ich stand in der ...
Ich habe kaum geschlafen ...
Zweite Woche
Alles falsch, kein Wort ...
Johnny hat sich noch ...
Ich bin ausgeruht. Ich ...
Beim Aufwachen hatte ich ...
Ich könnte Lucca anrufen ...
Ich bin aufgewacht, als ...
Es ist fünf Uhr ...
Hinweis
Erste Woche
Klar bin ich auf der Flucht. Sind doch alle. Wer will denn heute bleiben, wo er ist? Die Zukunft ist alles, die Gegenwart ist nichts. Und wenn schon Gegenwart, dann muß es gleich die Überexplosion, das totale Alles sein, der absolute Augenblick, aber an den glaube ich sowieso nicht, nichts als mystische Tröstung! Ich lebe weder in einem Blitzschlag noch in der Ewigkeit, ich lebe für Minuten, Stunden, wenn ich Glück habe, einen ganzen Tag. Und außerdem bin ich wirklich auf der Flucht, real.
Also erzählen, die Minuten, die Stunden, die Tage, eine Geschichte, deren Ende ich nicht kenne, und ich sehe nicht, wie der Anfang einer Geschichte zu bestimmen ist, deren Ende man nicht kennt.
Egal. Irgend etwas gibt es immer zu erzählen, und wenn es nur ein Bild ist, die Sonne, die eine Handbreit über dem Horizont steht, durch die Heckscheibe in den Wagen scheint und einen Schatten vor uns ausrollt, den wir über die Autobahn schieben. Dann die Weite der Landschaft zu beiden Seiten, hindernislos, geographisch jedenfalls, zu sehen ist die Grenze nicht, die die Ebene lückenlos teilt. Dann Lucca mit ihrer Sonnenbrille.
Seit heute morgen sitze ich in ihrem Wagen, geredet haben wir kaum bisher, ich habe Zeit, über die Ereignisse des vergangenen Tages, der vergangenen Nacht nachzudenken, was bedeutet, daß ich versuche, eine Ursachenkette zu knüpfen, an deren Ende meine Flucht als halbwegs vernünftiger Schritt erscheint. Lediglich ihr Profil stört hin und wieder meine Konzentration, die glatt zurückgestrichenen, schwarzen Haare, hinter dem Kopf mit einem schmucklosen Gummi zu einem kurzen Büschel zusammengefaßt.
Ich muß mich konzentrieren, meine Gedanken punktgenau bündeln, auf ein Bedeutungsatom, eine unteilbare Tatsache. Ich habe nicht die geringste Vorstellung, wie weit das Band der Ereignisse, an dessen vorläufigem Ende meine Flucht steht, in die Vergangenheit zurückreicht. Die kontinuierliche und schlüssige Geschichte, die ich zu reihen versuche, bleibt lückenhaft, das Gleichgewicht zwischen der Geschichte und ihrem Schluß ist noch nicht hergestellt. Keine Katastrophe ereignet sich aus dem Nichts.
Ich benötige Erinnerungen, aber meistens bleibt es bei Momentaufnahmen: beispielsweise meine Mutter, mit der ich, nachdem ich den Führerschein hatte, ebenso durch die Abendlandschaft gerollt bin wie jetzt, weil ich Zeit hatte und weil sie Zeit hatte, Fahrten durch die Gegend, ein Wallfahrtskapellchen, eine gesegnete Quelle, die abschüssige Wiese, auf der wir als Kinder einmal Schlitten gefahren sind, früher, als noch Schnee gelegen hat, wie sie erzählte. Dann die Orte ihrer Kindheit, das Dorf mit dem katholischen Mädchenheim, in dem sie aufgewachsen ist, da ihre Mutter allein stand mit drei Kindern. Im Internat, erzählte sie, während ich langsam den Ort durchquerte, im Internat ist sie bis zum Ende des Krieges geblieben, der nicht so schlimm gewesen sei, keine Zerstörung, sondern lediglich Soldatenströme in unterschiedlichen Richtungen, zuerst in der einen, später in der entgegengesetzten, dann änderten sich unter Beibehaltung der Richtung die Uniformen, und schließlich erlahmte die Bewegung ganz. Nach dem Woher und Wohin gefragt, hatten die Nonnen den Kopf geschüttelt: Christliche Demut, hieß es, frage nicht nach dem Uhrwerk, sondern nach dem Glockenschlag. Und daran glaubt sie natürlich heute noch, meine Mutter, die damals neben mir im Wagen saß, weil wir beide, wie gesagt, unendlich viel Zeit hatten, ich hatte mein ganzes Leben vor mir, und sie ihres hinter sich, und so waren wir doppelt verwandt und fuhren und fuhren.
Lucca schaltet einen Gang zurück. Nur noch wenige Kilometer bis zur Grenze, der Verkehr wird dichter, immer langsamer nähern wir uns der Schleuse zwischen Ost und West, schließlich stehen wir ganz. Ich drehe mich um, die Sonne ist in einem schwach roten Band aus Dunst versunken. Lucca kurbelt das Fenster herunter, Sommerluft gemischt mit Abgasen, sie nimmt sich eine Zigarette, zündet sie an, mit dem Zigarettenanzünder!, selbstverständlich, als fahre sie nur Autos mit Anzündern. Sie stört meine Konzentration, ganz eindeutig, mit allem, was sie tut, obwohl sie praktisch gar nichts tut, ab und an eine Zigarette, der Anzünder eben, mehr nicht, was ich angenehm finde, weil ich weiterhin in dem Familienalbum, das mein Kopf ist, systemlos blättere: Kaffeetrinken auf nylonbespannten Gartenstühlen, irgendwann Ende der Sechziger, die erste Hitze, Mai vielleicht, mein Vater, der Wespen verscheucht und die Sache mit der Ehe erklärt, weil mein Bruder nichts davon wissen wollte, weil er mit anderen Theorien beschäftigt war, Theorien, die für meinen Vater ein Weltuntergang waren: Kommunismus, Revolution, was für ihn hieß, alles kurz und klein zu schlagen, sich tagelang nackt im Dreck zu suhlen und Schweinereien in aller Öffentlichkeit zu treiben – da ließ er seiner Fantasie freien Lauf. Im Grunde war seine Aufregung unverständlich, weil mein Bruder sich noch ein paar Monate zuvor bemüht hatte, Kirchenlieder aus dem Kopf zu können, also zum Thema Revolution lediglich frisch erlernten Text aufsagte, sowieso, mit sechzehn!, und welchen Sinn macht es, das Radio anzubrüllen, wenn einem das Programm nicht paßt.
Ein Stau allerdings, das gebe ich zu, gehört zu den Dingen, die auch mich dazu treiben, dem Schicksal eine Sechs zu geben. Diese Bremsleuchten im Rhythmus des Stop-and-go, die dunklen Tannenreihen rechts und links, das sanfte Blau des Himmels über den Wagendächern, eine makellose, gewölbte Leinwand, Beginn der Abendvorstellung, ein ganzes Firmament zur Projektion für die kleinen Familienfilme, die ich in meinem Kopf abfahre: Gang meines Bruders von der Terrassentür über den Rasen zum Wochenendkaffeetisch, in der Hand einen Zettel, den er meinem Vater neben den Kuchenteller legt und auf dem er klipp und klar seinen Standpunkt in Sachen Ehe festgehalten hat: Ich erkläre, daß die Ehe das Grab der Liebe ist und ich niemals heiraten werde, Datum, Unterschrift, sauber notariatsreif. Das habe ich mir gestern überlegt, daß, wenn mein Vater statt auf den Inhalt, auf die Form geachtet hätte, er sich beruhigt hätte zurücklehnen können, aber hinterher, das zur Gerechtigkeit, ist man immer klüger, denke ich und klopfe mir eine Zigarette aus der Schachtel. Lucca reicht mir den Anzünder, weil ich mein Feuerzeug nicht finde, das ich bisher benutzt habe, nicht, weil ich etwas gegen Anzünder hätte, im Gegenteil, echt schick, nur daß mir immer der halbe Tabak an den glühenden Heizlamellen festschmort, jetzt auch wieder, während wir uns einem die Straße überbrückenden Hinweisschild nähern, darauf Pfeile, um den Fahrzeugstrom zu sortieren, PKW, LKW und Alliierte. Lucca wirkt, als sei jede Aufregung über die Schleicherei unter ihrer Würde, was mich irritiert: Nicht daß ich eine Anklage gegen deutsch-deutsche Grenzgepflogenheiten erwartete, zu der sie immerhin ein Recht hätte als Spanierin, aber die eine oder andere Anmerkung könnte ihr die Situation ruhig wert sein, denke ich, zumal ich selbst Schlangestehen nur mit Mühe ertrage, nicht weil ich es prinzipiell eilig hätte, sondern weil es einem klarmacht, daß man sich nicht anders verhält als alle.
Ich glaube nicht, daß die Ereignisse der vergangenen Nacht ihre Ursache im Religiösen haben, wen interessiert das denn heute noch? Im Grunde erstaunt es mich, daß das vor zwanzig Jahren noch an der Tagesordnung war, daß es das wirklich gab, was ich da im Gedächtnis habe, beispielsweise Prozessionen durch den Ort, rot-weiß gekleidete Ministranten mit Kerzen und einem hochgehaltenen Bronzekreuz, Jungen in dunklen Kommunionsanzügen und Mädchen in weißen Kommunionskleidchen, ebenfalls mit Kerzen, verziert mit roten Wachsornamenten, dann die Kapelle, Männer in dunkelblauen Uniformen, die Blicke auf kleine Notenheftchen gerichtet, die an ihren Instrumenten klemmen, dahinter die Gemeinde, Frauen mit schwarzen Wollkostümen und Hüten mit Tüllschleier, Männer mit Anzügen und blankpolierten Schuhen, dann Vorbeter mit Megaphon, die zum Mitsprechen eines Psalmes auffordern: Und müßte ich gehn in dunkler Schlucht, ich fürchte kein Unheil: du bist bei mir. Das Knistern gleichzeitig umgeschlagener Gebetbuchseiten.
Ich frage mich, wie ist das heute? Wird da immer noch durch die Dörfer gelaufen, Pilgermythos, während rechts und links kein Parkplatz mehr zu finden ist. Mit sieben fand ich das alles sehr schön, man erzählt sich, ich hätte seinerzeit mit großem Ernst die Bewegungen des Priesters hinter dem Altar nachgemacht, Hände zum Segen heben, Kelch zu den Lippen führen. Ich kann dazu nichts sagen, möglich, daß es stimmt, wie dem auch sei, die Kirche ist eine Falle für Kinder. Einmal habe ich einen Plüschbär an den Fuß einer Madonnenstatue gesetzt, die am Wegrand aufgestellt war. Mit sieben habe ich geglaubt, eine Madonna freut sich über einen Teddy. Heute ist mir sowohl der Teddy als auch die Madonna egal, was mir gegenüber dem Teddy herzlos vorkommt.
Während wir mit laufendem Motor stehen, überlege ich mir, ob bundesrepublikanische Zöllner überhaupt Kontrollen durchführen dürfen, schließlich verlasse ich im verfassungsrechtlichen Sinne das Land gar nicht, wenn ich das alles richtig verstanden habe, jedenfalls wäre nur eine solche Kontrolle gefährlich, ich kann mir nicht vorstellen, daß die im Osten derzeit interessiert daran sind, dem Westen in irgendeiner Hinsicht zur Hand zu gehen, und sei es auch nur, um flüchtige Kleinkriminelle aufzuhalten, zumal sie es gerade mit einer ganz anderen Qualität von Flucht zu tun haben, Flucht als kollektives Phänomen, und hier sind alle dafür, empfangen mit hochgerissenen Armen ganze Bahnladungen voll, da werden die Zöllner gar nicht mehr gefragt, was uns, befürchte ich, nicht passieren wird.
Zwanzig Minuten noch, schätze ich, dann müßten wir die Zollhäuschen erreicht haben, dann wird sich für Lucca herausstellen, ob sie sich mit ihrem Mitfahrer Ärger eingehandelt hat, vermutlich würde man auch sie nicht ohne weiteres wieder fahren lassen, und wenn sie noch so glaubhaft beteuern sollte, daß ich per Mitfahrzentrale, also ganz und gar zufällig, in ihren Wagen geraten bin. Lucca schaltet das Radio ein, fährt die Frequenzen durch, braucht nicht mehr als einen Takt pro Sender, um zu entscheiden, daß die jeweilige Welle sich nicht lohnt, erreicht das Ende der Anzeige und schaltet ab. Ich asche aus dem Fenster, bemühe mich um Ruhe, möchte nicht, daß sie meine Nervosität spürt, ich stelle mir die Prozedur vor, die Entgegennahme der beiden Pässe, um sie auf die elektronische Erkennung zu legen, die, so habe ich festgestellt, großzügig ist, die meinen Paß immer akzeptiert hat, obwohl ich versehentlich an der falschen Stelle unterschrieben habe, dort, wo die Verlängerung abgezeichnet wird. Bisher allerdings war ich nie auf der Flucht.
Ich bin froh um den Betrug, mit dem ich mich in ihren Wagen gekämpft habe. Ich mache mir selten Feinde, aber heute morgen, nehme ich an, habe ich es mir mit einem verdorben, der darüber hinaus im Recht war. Andererseits wird er nicht hängengeblieben sein, es gehen jeden Tag genügend Wagen nach Berlin. Gerade diese Vielfalt war das Problem, daß sein Wagen um elf Uhr dreißig gehen sollte, meiner um elf Uhr fünfundvierzig und um elf Uhr fünfundvierzig der Wagen von elf Uhr dreißig kam, Lucca, mit einer Viertelstunde Verspätung, und ich bestand darauf, daß dies mein Wagen sei, wegen der Uhrzeit, und wegen Lucca, was ich nicht gesagt habe. Immerhin war auf seinem Zettel ein blauer Golf vermerkt, während ich einen roten hatte. Luccas Golf war blau. Uhrzeit gegen Farbe, sagte ich und schlug das Los vor, fair, wie ich fand. Der andere war dagegen, wollte, daß Lucca die Sache entscheidet, sie müsse schließlich wissen, für welche Uhrzeit sie sich angemeldet habe, elf Uhr dreißig oder elf Uhr fünfundvierzig. Lucca schüttelte den Kopf, wir sollten uns da irgendwie einigen. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als meinen Vorschlag zu akzeptieren, zumal ich ihm die Wahl der Waffen überließ: Münze oder Hölzchen. Wir warfen eine Münze. Erst jetzt frage ich sie, wer denn nun ihr Mitfahrer gewesen sei?
– Der andere, sagt sie.
Wir haben noch fünf oder sechs Wagen vor uns.
– Vielleicht bekommen wir Schwierigkeiten, sage ich. Sie nickt und kuppelt für die nächsten paar Meter. Wir rollen unter die Überdachung des Kontrollareals, hinter uns ein Streifen Himmel, dunkler jetzt, ein paar Sterne, silber auf blau, vor uns ein Mercedes, von dessen Kofferraumdeckel ein Aufkleber seine Botschaft in die Nacht phosphoresziert wie ein Katzenauge, eine von den genügsamen Wahrheiten, die die Leute so spazierenfahren. Die Sache dauert, vier Pässe sind zu kontrollieren, endlich streckt eine Zöllnerhand die Heftchen der Fahrerhand entgegen, dann sind wir an der Reihe. Ich hatte mir das ja bereits ausgemalt, allerdings ohne jeden Plan, was wenn, also für den Fall: Würden Sie mal bitte rechts ranfahren!, womit klar wäre, daß die Sache gelaufen ist. Der Rest ist Stammeln: Ich bin nicht ich.
Wir werden durchgewinkt, und im nachhinein ist es immer wieder überraschend, wie sang- und klanglos Momente vorüberziehen, denen man über Stunden seine ganze Aufmerksamkeit gewidmet hat, was mich wieder davon überzeugt, daß es nicht um den gelebten Augenblick geht, sondern um eine Geschichte, und ich habe mir vorgenommen, diese Geschichte zu erzählen, soweit ich sie kenne, wofür ich mir eine Woche gebe. Danach werde ich mich mit der Tatsache befassen, daß ich hier nicht nur zu protokollieren, sondern zu handeln habe, aber gerade da ist eine Besinnungswoche vernünftig, zumal es kausal gesehen um eine Zeit geht, die die reinste Historie ist, für mich Steinzeit, Mai achtundsechzig, wobei ich mich weder auf den Monat noch auf das Jahr festlegen lassen will, aber an die Hitze erinnere ich mich genau, und daß ich allein im Haus war, abends, als sich die Schwüle des Tages entlud. Ich hatte keine Angst vor Gewittern als Kind, die brandenden Luftmassen im Garten und der atembare Füllstoff der Räume waren Elemente ohne Gemeinsamkeit, kein Dialog der Mauern mit Wind und Regen, Prasseln draußen, Schweigen drinnen, das war meine Erfahrung, keine klappernden Läden, keine schlagenden Türen, die Geister blieben in ihren Gräbern, und wenn Blitz und Donner in die Zimmer drangen, waren sie Fremdkörper wie Schrifttafeln in einem Stummfilm. Wenn ich dennoch Angst hatte, als es regnete, blitzte und die Tropfen die Fensterscheibe herunterkrochen, wenn ich dennoch Angst hatte, war es nicht wegen des Unwetters, im Gegenteil, es war das Schweigen der Räume, die Stille, keine Geschäftigkeit aus der Küche, kein Gang auf der Treppe, kein Blättern in einer Zeitung, keine Diskussionen zwischen meinem Bruder und meinem Vater, nicht einmal die. Ich war allein mit dem Geruch der Möbelpolitur, der Couchgruppe, der glänzenden Tischplatte, darauf die Blumenvase auf einem bestickten runden Deckchen, den Bildchen und bemalten Tellern an den Wänden, diese Harmoniesucht, die in allem steckt, der Wunsch, genauso friedlich zu sein wie die Wohnzimmereinrichtung, Wechselwirkung zwischen Einrichtung und Bewohnern, durchaus mit Erfolg, selbst mir ist es bis heute nicht möglich, in unserem Wohnzimmer etwas anderes zu machen als fernzukucken.
Damals lag ich im Sessel, meinen Kopf auf der Armlehne, und sah den Zettel, das Blatt Papier mit der Erklärung meines Bruders zum Thema Ehe, das mein Vater zu einem kantigen Ball gepreßt und wütend auf den Boden geworfen hatte, wo es immer noch lag, unter die Couch gerollt. Ich habe es gelesen, was nicht leicht war, mit sieben, Addition von Buchstaben zu Wörtern und Wörtern zu einem Satz, der mir nichts sagte, Wörter wie ein falsch ausgelegtes Domino. Ich legte den Zettel auf das Fenstersims, strich darüber, strich und strich, leckte irgendwann die Rückseite an und klebte ihn gegen die Fensterscheibe. Ich vermute, daß mein Vater ihn dort fand. Andernfalls säße ich jetzt nicht in einem blauen Golf, neben Lucca.
Die Motoren sind meist abgestellt, und die Insassen schieben ihre Fahrzeuge, wenn mal wieder ein paar Meter zu machen sind. Auf dem Mittelstreifen ragt eine Betonstele mit rundem Hammer-und-Zirkel-Emblem an der Spitze in den Abendhimmel, rechts und links die Grenzanlagen, Lampen, Wachtürme, Zäune, das hatte ich ziemlich früh in der Schule gelernt, zweite Klasse oder so, große Landkarte von Deutschland, also mit allem, DDR und halb Polen, mithin dreigeteilt, und um die beiden östlichen Teile jeweils eine Kette mit Vorhängeschloß, didaktisch also ganz klug gemacht, und zu Hause habe ich Eroberungspläne ausgearbeitet, das war im Grunde das einzige, was ich noch nicht verstanden hatte, wieso da nicht längst ein Einmarsch passiert war, weil ja ganz klar war, daß die Bewohner dort alle auf unserer Seite sein würden.
– Zäune, sage ich jetzt, können Deutsche besonders gut. Lucca sieht mich an, und ich erzähle eine Anekdote aus meinem Bekanntenkreis, muß auch schon einige Jahre her sein, das übliche Nachbarschaftsgezänk, wegen einer Hecke, die von dem einen Vorgarten in den anderen Vorgarten rüberwucherte, jedes Jahr das gleiche Spiel, stete Eskalation bis zum Bau einer Mauer, der Heckengegner sah sich als das klassische Opfer, betrachtete seinen Mauerbau als einen Akt reinster Verteidigung: Dazu haben Sie mich gezwungen! sagte er und mußte sich daraufhin einen Vergleich mit Walter Ulbricht gefallen lassen, der einmal dasselbe gesagt hat.
Lucca will wissen, wer Walter Ulbricht ist. Ich sage es ihr, merke, daß es ihr die kleine Geschichte nicht näherbringt, vielleicht ist die Pointe einfach zu deutsch, überlege ich. Jedenfalls hat sie beobachtet, daß die Zäune in Deutschland immer sehr gepflegt sind. Außerdem sind ihr in keinem Land so viele Zaunarten aufgefallen wie hier, sagt sie und nennt drei Zaunarten her, die ihr spontan einfallen, ich sage zwei weitere, sie hat noch einen, ich schlage ein Spiel vor: Wer als erstes keinen Zaun mehr weiß, hat verloren. Am Ende wird es etwas vage: Reisigmatten-, Perlschnur-, Agavenzaun. Ich protestiere.
– Dicht gepflanzte Agaven, sagt sie, und ich erinnere mich, daß sie Spanierin ist.
Wir rollen ein paar Meter vor und nehmen das Spiel nicht wieder auf. Die zweireihige Schlange hat sich auf gut zehn Spuren aufgefächert, wir treiben irgendwo in der Mitte eines Autosees, nähern uns den Ausflußdüsen schrittweise, dann spült uns mal wieder eine mäßige Woge mehrere Autolängen vor, wir geraten neben den Aufklebermercedes, in dessen Reihe gerade nichts läuft, ein toter Flußarm, während es bei uns jetzt richtiggehend fließt, wir nähern uns den Kontrollbuden, den Amtsstübchen des Eisernen Vorhangs, zwei Wagen noch, ich reiche Lucca meinen Paß, sie legt ihren dazu, nur noch ein Wagen vor uns, der von dem Grenzer hinter Glas wirklich flott abgefertigt wird, und dann sind wir an der Reihe, nach anderthalb Stunden. Lucca gibt Gas, und natürlich ist ausgerechnet jetzt Schluß, Handzeichen, daß wir warten sollen, Vorfahrt erst nach Aufforderung, dann ist Pause, er sitzt in seinem Häuschen und wir in unserem Wagen und dürfen uns gegenseitig so unsere Gedanken machen. Mir beispielsweise fällt auf, daß unser Gegenüber ziemlich jung ist, gerademal volljährig, und schon eine Uniform. Wie ist das eigentlich, rein juristisch, was darf man eher: zeugen oder töten? Interessant wäre es auch, ob es da einen Unterschied zwischen Ost und West gibt oder ob man sich in den grundsätzlichen Dingen nicht doch einig ist. Ich dürfte jedenfalls nicht anders ausgesehen haben, seinerzeit vor gut zehn Jahren: Jüngelchen mit MG, allerdings habe ich dem Krieg nie was abgewinnen können, wobei es sich zugegebenermaßen nur um Simulationen handelte, aber durchaus realistisch: überhitzter, abgedunkelter Kommandostand, große Enge, Radardienst, Himmel überwachen mit gelegentlichem Feindbeschuß, das waren dann immer irgendwelche Verkehrsmaschinen, die auf dem nahegelegenen Frankfurter Flughafen gelandet sind, der wie ein Wespennest rechts oberhalb des Fadenkreuzes lag und so ungefähr fünf- bis sechsmal pro Minute vom Leuchtstrahl überstrichen wurde, wobei man den aufglimmenden Pünktchen nicht ansehen konnte, ob es sich um einen Jumbo oder eine Cesna handelte, und wir haben gründlich gezielt, und die Raketen wurden aufgerichtet, aber mehr ist in Friedenszeiten nicht drin. Insgesamt muß ich sagen, so nett, wie sich das alles anhört, es war ziemlich schnell grauenhaft langweilig, und dann diese dauernde Antreterei. Immerhin haben sie es damit geschafft, daß ich seitdem gegen die DDR bin, weil mir der Sozialismus mit seinen permanenten Ritualen einfach zu lästig wäre. Ich nehme an, unser Gegenüber wird auch gegen uns sein, der Westen als das institutionalisierte Gegeneinander, irgend so was wird er denken, jetzt, wo er winkt. Die Pause ist beendet.
Lucca läßt den Wagen vorrollen, reicht unsere Pässe aus dem Fenster und kuppelt für die zehn nächsten freien Meter vor uns. Es ist dunkel geworden über die Warterei, neben dem Wagen läuft das Förderband zum Transport der Pässe von einem Kontrollhäuschen ins nächste Kontrollhäuschen, zu sehen sind die Papiere nicht, weil das Band von nicht sonderlich paßgenau hingeschraubten Blechen eingefaßt und überdacht wird, Sozialismus aus dem Märklin-Baukasten.
Es geht jetzt regelrecht schnell, die Grenztruppen knien sich rein, alle dreißig Sekunden ein Auto, schätze ich, wir nähern uns dem nächsten Schalter, werden vorgewinkt, Lucca streckt die Hand aus dem Fenster, um die Pässe entgegenzunehmen. Sie sieht nach vorne, trotz des Beamten, der ihr Gesicht mit dem Paßfoto zu vergleichen hat. Ich sehe ihn an, Protest auf der untersten Ebene ist nutzlos.
– Kinder? fragt er.
– Nein, sagt Lucca.
Er gibt ihr die Pässe, sie fährt an, wir sind auf freier Strecke, nach gut zwei Stunden.
Es wird Zeit, daß ich jetzt mit dieser Geschichte vorankomme, für die ich mir sieben Tage gesetzt habe, um sie zu erzählen, beziehungsweise sie in die Schreibmaschine zu geben, vor der ich gerade sitze. Das Zimmer, in dem ich mich aufhalte, ist klein und kaum möbliert, gerade mal ein Bett und ein Tisch, eine Klause, im Grunde ideal für eine siebentägige Konzentrations- und Erinnerungsaufgabe. Die Zeitspanne, die ich zu bewältigen habe, reicht von diesem Kaffeetrinken im Mai achtundsechzig bis jetzt, genaugenommen bis vor etwa zwanzig Stunden, so lange ist es her, daß ich mit Lucca auf die Grenze zugerollt bin. Und vor gut fünfzig Stunden habe ich noch in der Kirche gestanden und mich darüber gewundert, daß die Atmosphäre dort immer gleich ist, egal, ob es sich bei der bevorstehenden Feier um eine Taufe oder um eine Beerdigung handelt, oder, wie gestern, um eine Trauung. Erst allmählich fielen mir die Unterschiede ins Auge, hier und da ein buntes Kleid, oder die beiden Stühle und das Bänkchen, extra aufgestellt noch vor der ersten Reihe, vis-à-vis dem Altar, die Plätze für das Brautpaar. Die Kirche war hell, zeitgenössische Architektur, Anfang siebzig schätzte ich, Grundriß ohne rechte Winkel, nach einer Seite hin ansteigende Decke, bunte, abstrakt ornamentierte Fenster bis zum Boden, über dem Altar ein großes Kreuz, kein leidender Christus, lediglich Andeutungen des Erlösers. In tiefe Frömmigkeit hat mich das Ganze nicht versetzt, was nichts mit prinzipieller Gottlosigkeit meinerseits zu tun hat. Es kann mir schon so gehen, daß ich ergriffen bin, beispielsweise damals, in Brügge, ich habe den Namen der Kirche vergessen, ein uraltes romanisches Ding jedenfalls, Dunkelheit, grobe Steinplatten auf dem Fußboden, angeleuchtet von ein paar Opferkerzen, der Geruch aus Weihrauch und muffiger Fäulnis, die Luft kühl und feucht, also das genaue Gegenteil der sommerlich warmen flandrischen Lichtfluten, ich bin dagestanden und beinahe fromm geworden, oder sagt man gottesfürchtig? Ich muß zugeben, wenn ich mich auch selbst nie mit der Innenarchitektur von Kirchen beschäftigt habe, daß die Moderne mit dieser Dunkelheit aus rohem Stein einfach nicht mitkommt. Aber wer heiratet schon aus Gottesfurcht?
Mein Bruder jedenfalls nicht, der sich nach dem Einzug auf seinen Stuhl setzte, während ich in der ersten Reihe kurz meine Mutter ansah. Ich nehme an, sie war glücklich. Gleichzeitig wird es für sie ein Sieg über meinen Vater gewesen sein, der, im Gegensatz zu ihr, nicht an meinen Bruder geglaubt hatte: sein Aussehen in den Siebzigern, also Haare und Jeans, die wilde Ehe in den Achtzigern, das Kind. Meine Mutter sah keinen Unterschied zwischen einer wilden Ehe und einer Ehe. Entweder es geht auseinander oder zum Altar, daran glaubte sie, und ich vermute, daß sie nach vierzehn Jahren eine Trennung bereits ausgeschlossen hatte.
Vierzehn Jahre, denke ich jetzt, die ich Karin kenne, ohne sie zu kennen, also regelmäßige Begrüßung, schon seit längerem mit Umarmung und Küßchen, dasselbe bei jeder Verabschiedung. Hin und wieder habe ich sie am Telefon, es gibt nicht viel zu reden, weil klar ist, daß ich nicht sie, sondern meinen Bruder sprechen will, was im übrigen nicht sehr häufig vorkommt, das letzte Mal vor zwei Wochen, als mich das Bedürfnis überfiel, mit ihm zu reden, ein Gefühl, fast eine Angst, die mich im Zusammenhang mit ihm oder mit meiner Mutter regelmäßig befällt, die Angst, daß wir nichts voneinander wissen, und wenn wir nicht auf der Stelle miteinander reden, auch nie mehr etwas voneinander erfahren werden. Mein Bruder war zu Hause und hatte Zeit. Ich habe mich ins Auto gesetzt, und eine halbe Stunde später saßen wir bei einer Flasche Wein in seinem Garten. Der Wunsch, mit ihm zu reden, hing mit der bevorstehenden Hochzeit zusammen, als sei er als Ehemann für mich endgültig nicht mehr erreichbar.
Jetzt saß er vor dem Altar wie ein Schuljunge mit Sakko und Krawatte, während der Pastor predigte und ihn und seine Frau immer wieder ansah: Karin und Kurt, Ihr habt Euch entschieden, Karin und Kurt, die Ehe ist.
Ich sah meinen Bruder von der Seite, er nickte immer wieder, weil er als direkt Angesprochener keine andere Möglichkeit hatte, als zu nicken, zumal die Predigt sehr freundlich gemeint war, sie lief im Grunde auf einen Punkt hinaus: Ehe nicht als Feuerwerk, sondern als Zweckbündnis gegen Lebensfallen. Der Veranstaltung fehlte die Leichtigkeit. Neben mir stand der Sohn meines Bruders, und möglicherweise war es für ihn beeindruckend, er dürfte noch nicht allzuoft in einer Kirche gewesen sein. Ich nehme an, daß sie versucht haben werden, ihm die Sache zu erklären: daß sich seine Eltern sehr lieb haben, daß sie deswegen heiraten, daß deswegen gefeiert wird, zuerst in der Kirche, dann im Restaurant, ungefähr so, vermute ich. Natürlich wird er die Zusammenhänge nicht verstanden haben, aber die Bilder werden ihm im Gedächtnis bleiben: der Pastor, der die Hände seiner Eltern ineinanderlegt und seine Schärpe darüberbreitet, der fragt, ob er, Kurt, und sie, Karin? Eine Stille hatte sich ausgebreitet, als sei die Antwort wirklich ungewiß. Hinterher dann die Gratulationen vor der Kirche: Ich gab Karin ein Küßchen und meinem Bruder die Hand.
Fünfzig Stunden also ist das jetzt ungefähr her, und noch kein Tag ist vergangen seit dem Passieren der deutsch-deutschen Grenze. Wir sind Teil einer lockeren Reihe roter Lichter, kaum Verkehr auf der Gegenseite, Ortsnamen wie aus dem Geschichtsbuch: Irxleben, Magdeburg.
Ich frage Lucca, seit wann sie in Deutschland lebt.
– Seit zwanzig Jahren, sagt sie. Das muß seinerzeit politische Gründe gehabt haben, daß meine Eltern aus Spanien weg sind, ich weiß das nicht so genau, ich habe nie gefragt, weil ich mich lange kaum für Spanien interessiert habe, das war zu weit weg.
Sie geht vom Gas, in einiger Entfernung schieben sich die Rückleuchten näher zusammen, Bremslichter laufen wie eine Kettenreaktion von Heck zu Heck, hier und da werden Warnblinkanlagen eingeschaltet, wenig später stehen wir mit laufendem Motor.
Berlin gefällt ihr, das Leben dort, dieser Widerspruch, daß man aus keiner Kneipe rausgeschmissen wird und morgens trotzdem arbeiten muß.
Ich kannte Berlin nur besuchsweise, hatte die Nächte in angenehmer Erinnerung. Einmal hatten wir nach einer halben Flasche Transit-Wodka um Mitternacht die Idee, ins Kino zu gehen, hatten eine Handvoll Filme zur Auswahl und machten uns auf den Weg. Im Kino schlief ich und war hinterher ausgeruht genug für ein paar Biere in einem weißgetünchten Schuppen mit Gartenbestuhlung, angenehm, wie gesagt, und morgens, so gegen zwei Uhr nachmittags, dann der Sprung in die U-Bahn, irgendwo was frühstücken, auf einem Bürgersteig unter Baumkronen, wo man dann das zwingende Gefühl hat, daß hier alle so leben, erst recht, wenn man zum Frühstück gleich ein Bier kippt, Brunch, diese tröstliche Besoffenheit, wenn der Sommer in den Städten herrscht und jede Frage erlischt.
Das also war Berlin in meinem Kopf, eine Postkarte des ungezwungenen Lebens, und ich kann nicht ausschließen, daß ich auch deswegen im Auto sitze, neben Lucca, mit ihren glatt zurückgestrichenen Haaren, den hohen Augenbrauen, die sie kaum bewegt, wenn sie redet, wenn sie, wie jetzt, vorschlägt, eine Pause zu machen, und auf das Intershop-und-Intertank-Schild zeigt.
– Vielleicht haben wir Glück, sagt sie, und der Stau löst sich auf.
Wir brauchen noch eine Viertelstunde, dann schert sie aus der Schlange und fährt auf den Parkplatz der Raststätte. Wir steigen aus, müssen die Autobahn auf einer Fußgängerbrücke überqueren, um zum Restaurant zu kommen, ein rußgeschwärzter Backsteinbau, der an ein Wohnhaus erinnert und nicht an eine Autobahngaststätte. Ich öffne die Tür, wir betreten die Eingangshalle, karg wie ein Wartesaal, links ein Kiosk, also eine Glasscheibe mit Spirituosen und Kleinkram dahinter. Der Gastraum ist im Keller, wir nehmen die Treppe, wieder ein Vorraum, rechts der Eingang, davor eine Schlange, fünf Paare etwa, die, denke ich, auf einen Platz im Restaurant warten, worauf sonst, sehr vernünftig, weswegen ich mich wundere, daß Lucca so einfach an denen vorbeigeht, Paar für Paar hinter sich läßt und die Restauranttür öffnet, wo sie dann gestoppt wird, ein Ober, wirklich korrekt gekleidet, weißes Hemd, schwarze Weste, der ihr den Durchgang verweigert, sie hätte sich schon anzustellen wie alle, und Lucca sagt, daß da das halbe Restaurant leer ist, was stimmt, soweit ich das aus der Entfernung beurteilen kann, was für den Ober natürlich kein Argument ist: Und wo kommt dann die Schlange her? fragt er, also eiserne Logik, jeder Widerstand nutzlos. Lucca will wissen, was mit den freien Plätzen ist, und er sagt, daß sie sich danach erkundigen könne, wenn sie an der Reihe sei, und jetzt wird auch die Schlange aufsässig: Hinten anstellen! sagt einer, und Lucca dreht sich herum zu der Schlange, die sich im reinsten Recht fühlt, und ich erwarte ein augenblickliches Wutgewitter, eine südländische Beschimpfungstirade, wie ich das durchaus schon erlebt habe, damals, während der ersten Italienreisen, also vor gut zehn Jahren, als so eine Fahrt nichts als Freiheit war und wir geglaubt haben, der Südländer sitze vor seiner Haustür in der Sonne, trinke roten Wein und heiße den Gast willkommen. Statt dessen wurden wir regelmäßig beschimpft, wegen nichts, weil man beim Überqueren der Straße gebummelt hat oder sonst was, und meine damalige Freundin war der Meinung, daß man denen nur richtig kommen müsse, notfalls auf deutsch, und so kam es zu einer ordentlichen Schreierei, als eine Barbesitzerin den Toilettenschlüssel nicht rausrücken wollte, nicht für einen Espresso, und sie schimpfte, nehme ich an, über die Touristen, die nur in die Bar kommen, um das Klo zu benutzen, und meine Freundin nannte sie ein blöde Spießerin, auf deutsch, wie geplant, und das ganze schaukelte sich hoch, bis die ganze Bar mithören konnte, und wie ich die Gäste so ansehe, gebe ich der Wirtin beinah recht, lauter Touristen, wie wir, und warum sollte sie diejenigen lieben, von denen sie lebt.
Und Lucca, jetzt, hat nun wirklich allen Grund, an die Decke zu gehen, das Vernichtungsurteil für diese Untertanenmentalität zu verkünden, die noch den Peiniger vor dem Revolutionär in Schutz nimmt, aber sie schreit nicht, sondern geht an den Paaren vorbei, die stehen wie Erstkläßler, die Lob für ihre Eins in Betragen erwarten, sie geht auch an mir vorbei, ich drehe mich um, folge ihr, sie stößt die Tür auf, wir treten ins Freie.
– Ich glaube es nicht, sagt sie, ich glaube es einfach nicht, daß Menschen so sein können, dieser Osten ist die Pest, wie ich das hasse. Und immer ist es so gewesen, so wie gerade, die sind doch alle krank im Kopf, ich habe das immer schon gehaßt.
Wir gehen wieder über die Brücke, durchqueren den Abgasvorhang des Staus unter uns, der nicht den Eindruck macht, als löse er sich auf, der immer noch vom rechten Horizont zum linken Horizont reicht, keine Aussicht auf eine ruhige Fahrt, während der rechts und links die Landschaft in die Augenwinkel fließt, wie gestern, nach der Trauung, als es durchs Bergische ging, Hügellinien, die von einem Fächer aus Sonnenstrahlen getroffen wurden, der durch die Wolken des Platzregens drang, der während der Kirche niedergegangen war, Wiesen, aus denen Dampf hervorkochte, der in einer dünnen Schicht über das Gras nebelte und die Kirchtürme flirren ließ, Holzzäune, die die Straße rechts und links begleiteten und vor Feuchtigkeit glänzten, alles in dieser klaren und gleichzeitig blassen Nachregentönung.
Ich hatte ein Paar im Wagen, Kollats, mit denen ich mich halbwegs zwanglos unterhielt, sie redeten über die Hochzeit, nicht speziell die Hochzeit meines Bruders, sondern heiraten überhaupt, damit hatten sie nach wie vor ihre Schwierigkeiten, obwohl sie selbst verheiratet waren. Im Grunde, analysierten sie gemeinsam, im Grunde seien es auch gar nicht die Hochzeiten, sondern der gesellschaftlichfamiliäre Zugriff auf dieses Fest, gegen den man nicht ankomme und der lockeres Feiern nahezu unmöglich mache, aber gerade die Spontaneität sei es, die den Hochzeiten fehle, gegen die ansonsten nichts einzuwenden sei, wirklich nicht, und sie erklärten mir, daß man irgendwann vom Herumziehen die Nase voll habe. Ich konzentrierte mich auf den Weg.
– Was machst du denn so? wollten sie wissen.
– Innenarchitekt, sagte ich, womit sie nicht viel anfangen konnten.
– Wer kommt denn da so als Kunde? fragten sie, und ich nehme an, sie stellten sich irgendwelche Reichen vor.
– Hotels, Cafés, Restaurants, sagte ich.
– Ach so, sagten sie.
Ich bin das gewohnt, daß die Leute sich unter meinem Beruf wenig vorstellen können, Möbel aussuchen, Wände dekorieren, was jeder glaubt, selbst zu können, muß ja nur gefallen. Als ob wir das, was uns gefällt, auch automatisch selbst herstellen könnten. Unsinn. Es schreibt schließlich auch nicht jeder die Bücher, die ihm gefallen, oder komponiert die Lieder. Und heraus kommt dann diese sogenannte Gemütlichkeit, also eine Atmosphäre, die mit maximaler Untätigkeit harmoniert: der Tod im Wohnzimmer.
Das würde, befürchtete ich, auch heute nicht anders sein, in dem Gasthaus, auf dessen Parkplatz ich jetzt bog, so etwas Ländliches, mit Pappeln drumrum, so daß ich mir den Innenraum bereits bestens vorstellen konnte: rustikal, Fachwerk, gefliester Flur, ausgetretener Boden, die Platten teilweise gebrochen und stumpf, mattes grün-braunes Muster, Wohngeschichte im Original, allerdings nur für den ersten Eindruck, zum Mantelabgeben, im Festraum dann Parkett, dunkel gebeizte Deckenbalken, in der Mitte ein Kronleuchter, an den Wänden Kerzenimitatlampen, Tischordnung in Hufeisenform, wobei ich mich frage, ob die Aufstellung Glück symbolisieren soll oder rein praktische Gründe hat. Aber ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, war es nicht, ein paar Dinge fand ich ganz ordentlich, die Stühle waren gut ausgesucht, hatten eine zurückhaltende, klare Form, lediglich die Sitzpolster hätte man anders beziehen müssen, weniger kräftig im Ton. Außerdem war die Beleuchtung gut gesetzt, mischte sich organisch mit dem wenigen Tageslicht, das durch die kleinen Fenster fiel, die man zum Glück nicht einfach vergrößert hatte. Sowieso hatte ich nichts gegen die Feier, Hochzeit ist Hochzeit, ich bin kein Revolutionär, aber ich bin überzeugt, daß mir das kurze Picknick mit Lucca auf dem Ost-Parkplatz länger im Gedächtnis bleiben wird.
Ich hatte vorgeschlagen, nach der Restaurantpleite wenigstens etwas Eßbares im Intershop zu besorgen und war neugierig auf dieses Stück Kapitalismus im Sozialismus, ein helles Warenlager mit moderner Kassenelektronik, Abteilungen mit Spirituosen, Tabak und Kaffee, dann ein Regal mit einem konzeptlosen Sortiment: Schinken in Aspik, Fruchtjoghurt, portionierte Marmelade, Gänseleberpastete, Dosenspargel.
– Wer soll das denn kaufen? sage ich.
– Wir! sagt Lucca und nimmt eine Büchse Schinken und den Spargel. Sie legt noch ein paar Dosen Bier dazu, eine Stange Zigaretten und eine Tafel Schokolade und schiebt den Wagen zur Kasse.
Später sitzen wir vor dem Auto auf dem Bordstein und versuchen Dosen zu öffnen. Der Schinken geht leicht, mit einem an dem Blech befestigten Schlüssel läßt sich ein Metallstreifen rundherum aufwickeln, Aspik quillt aus den Ritzen, und schließlich schwimmt das Stück Fleisch offen in der Dose. Der Spargel ist schwieriger, ich frage, ob sie Werkzeug im Wagen hat, Schraubenzieher, Hammer? Sie ist unsicher, wir öffnen den Kofferraum, außer unserem Gepäck finden wir lediglich den Ersatzkanister und, immerhin, den Wagenheber. Ich sehe noch unter den Taschen nach, beginne zu überlegen: Dose zwischen Wagenheber und Wagen, langsame Erhöhung des Drucks. Oder Wagen anheben, Dose unter den Reifen schieben und Wagen ablassen. Oder einfach auf der Dose rumhauen. Während ich die möglichen Szenarien im Kopf durchspiele, kommt Lucca mit der geöffneten Dose zurück.
Wir setzen uns wieder auf den Bordstein, sie fischt den Schinken aus der Büchse, bricht ihn in der Mitte durch und gibt mir die Hälfte, zieht einen Spargel aus der Dose und beißt ab.
– Es gibt zwei Arten von Menschen, sage ich. Die einen beginnen mit dem Stumpf, die anderen mit der Knospe.
Sie lacht.
– Und wozu gehörst du? will sie wissen.
– Ich versuche mich dazu zu erziehen, mit der Knospe zu beginnen, sage ich. Sie öffnet eine Bierdose und trinkt einen Schluck. Ihr erstes Picknick dieses Jahr, stellt sie fest, genaugenommen ihr erstes seit Jahren, weil es in Berlin bei schönem Wetter in der Natur voller ist als im Restaurant. Dann schon lieber Bier und Salat in einem Straßencafé.
– Das sind die Momente, sagt sie, wo die Großstadt zum Küssen ist.
Ich lade sie zu Bier und Salat ein.
– Warum nicht, sagt sie. Sie hat eine Packung Taschentücher, wir wischen uns den Aspik von den Fingern, beseitigen den Abfall und setzen uns wieder ins Auto. Immer noch Stau.
Ich habe Schluß gemacht gestern, schlicht Erschöpfung, was bedeutet, daß die Ereignisse wieder neun Stunden älter geworden sind, also unaufhaltsam Richtung vollendete Vergangenheit driften und dabei eine Deformation nach der anderen erfahren. Ich mache mir nichts vor, in jeder Sekunde verändert sich die Vergangenheit, unermüdliche Arbeit des Gehirns am Geschehenen, Verwandlung von Ereignissen in Erinnerungen, ich muß mich beeilen, wenn ich nicht hinterher feststellen will, daß alles bereits sauber sortiert ist, als Geschichte sortiert, weil nur Geschichten in mein Gehirn passen. Ich muß mich betäuben, das Denken durch Schreiben vollständig binden, vielleicht sollte ich mir auch die Erschöpfung nicht mehr erlauben, sollte regelmäßig lüften. Es ist kühl, ansonsten bekommt man nicht mit, was für ein Wetter eigentlich ist. Ich sehe auf einen Baumstamm, um dessen Fuß ein Strauß Triebe hervorgeschossen ist und dessen Wurzeln den Hofasphalt aufgebrochen haben. Die Krone sehe ich nicht, wenn ich hier sitze und schreibe, ich müßte aufstehen, aber jede Pause bedeutet Gefahr, ins Nachdenken zu kommen über alles, dem Gehirn also eine Chance zu geben, das Ganze in die ihm eigene Logik zu gießen.
Im Grunde, scheint mir, hat mein Bruder genau das mit seiner Vergangenheit getan, sie in ein System integriert, das nahtlos zu seinem jetzigen Leben paßt, einen Bruch hat es für ihn nicht gegeben.
Als ich ihn zwei Wochen vor der Hochzeit angerufen habe und eine halbe Stunde später bei ihm war, haben wir über die Vergangenheit geredet. Karin hing im Wohnzimmer über einer Bleistiftskizze und berechnete die Sitzordnung für die Festtafel. Entweder, sagte sie, gute Freunde sitzen sich direkt gegenüber oder sie sind deutlich getrennt, sonst wird kreuz und quer geredet. Das war so ihre Grundgleichung, ziemlich willkürlich, wie ich fand, aber immerhin eindeutig genug, um das Problem zu einer netten Logelei zu machen, auf die mein Bruder keine Lust hatte.
Wir gingen in den Garten und setzten uns unter die Weide, die ihre hängenden Äste nach uns ausstreckte, und er legte mit seinen Erinnerungen los, was damals so alles an der Tagesordnung gewesen sein soll und daß er auch heute noch für Kaufhausbrandstiftung ist, denn in puncto Konsum, da hätten sie verloren. Ob sich denn alle ins Flugzeug setzen müßten, um sonst wohin zu fliegen!, wo es ihm ausreichte, ins Elsaß zelten zu fahren. Aber vieles war durchgesetzt, behauptete er, beispielsweise Sexualität und Bildung.
Natürlich langweilten mich seine politischen Rechnungen. Für ihn ist das ein Dogma, daß die Zeit vor zwanzig Jahren noch eine Zeit war, eine echte Zeit, Einheit von Leben und politischem Kampf, der reinste Mythos. Was mich irritiert, ist, daß er diesem Kampf, und damit sich selbst, offenbar immer noch eine gesellschaftliche Relevanz zuordnet. Mein Eindruck ist ein anderer: Das interessiert heute keinen mehr. Die Parolen sind entweder Historie oder öffentliche Meinung. Wer ist denn heute nicht der Ansicht, daß der Konsum uns eines Tages alle umbringt? Dieses Bekenntnis kostet nichts, Pessimismus ist preiswert geworden, und mein Verdacht ist, daß mein Bruder sich nur deshalb jede Menge davon leistet.
Egal. Jedenfalls hat mich das nicht die Bohne interessiert, was er mir vorrechnete, als er mir gegenübersaß unter der Weide und wir uns kaum noch sehen konnten, weil der Tag den Garten verließ. Mir wäre lieber gewesen, er hätte mir erzählt, wie das war, als er sich mit Jeans und T-Shirt auf sein Motorrad gesetzt hat, losgefahren ist, nach zwei Wochen dann zurückkam und meine Eltern beschuldigte, sie gängelten ihn, weil sie eine Vermißtenanzeige aufgegeben hatten. Ich erinnere mich an die Tränen meiner Mutter, die überzeugt war, ihr Sohn sei tot. Ich habe meinen Bruder bis heute nicht gefragt, was er über die Wunden denkt, die damals geschlagen worden sind, ob die Narben für ihn noch eine Bedeutung haben oder ob die Kämpfe zu Anekdoten geworden sind, die bei passender Gelegenheit durchgenommen werden.
So jedenfalls, hatte ich den Eindruck, war es für Kollat, den Karins Sitzordnung neben mich gespült hatte, vielleicht weil er ein gesprächiger Mensch ist, was sie von mir nicht glaubt, im Grunde ein Irrtum, ich rede durchaus viel, wenn die Situation danach ist. Es kommt vor, da gehöre ich auf Festen zu den letzten, nachts und unter Alkohol bin ich bereit, mich zu verlieren, meistens allerdings rede ich wenig, weil es nur wenige Menschen gibt, bei denen ich am nächsten Morgen nicht das Gefühl habe, mich lächerlich gemacht zu haben. Bei Kollat brauchte ich mich nicht anzustrengen, er erzählte von selbst, während die restlichen Hochzeitsgäste den Raum betraten und die Platzkärtchen nach ihrem Namen absuchten. Er war recht schnell bei den alten Zeiten, erinnerte sich, daß er seine Frau über meinen Bruder kennengelernt hatte, dreiundsiebzig in Berlin. Wahrscheinlich verführte ihn die Heirat dazu, in Erinnerungen zu kramen.
Damals, in Berlin, erzählte er, das war wohl so ziemlich das steilste Auf und Ab, das er je erlebt hat. Er war bei einer Prüfung durchgefallen, unerwartet, es kommt ja vor, sagte er, da weiß man bereits vorher, daß das nichts wird, aber bei der betreffenden Prüfung bin ich mir sicher gewesen. Und dann haben sie ihn auseinandergenommen, Stück für Stück, Frage für Frage, er hat dagestanden wie der letzte Trottel. Hinterher hat er sich ins Auto gesetzt, nichts wie raus aus der Provinz, hat er sich gesagt, und auf die Gesellschaft und das System geflucht, die autoritären Strukturen, gegen die man nicht ankommt, vor denen man nur fliehen kann, und zum x-ten Mal kamen ihm Zweifel, ob das richtig sei mit dem Studium, mit der Universität überhaupt, wo eine reaktionäre Professorenschaft mit ihrem vernagelten Weltbild das Sagen hat, diese Zweifel, die seit Anfang an Thema gewesen waren zwischen ihm und meinem Bruder, den er in der Uni kennengelernt hatte.
Und wie er von diesem ganzen Unimilieu berichtete, fand ich, daß er damit halbwegs normal umging, wenig Ideologie, von wegen: wir damals!, und daß das heute alles der letzte Mist ist, weil die Studenten in arktischer Starre verharren, wenns darum geht, Stellung zu beziehen.
Ein Vorwurf, den mein Bruder gern an meine Generation, und damit natürlich an mich richtet. So auch damals, als wir uns im Garten gegenübersaßen. Ich ärgerte mich.
– Warum soll ich denn ein Wort über Stammheim verlieren, sagte ich, muß doch jeder wissen, wenn er Terrorist wird, wo das enden kann, so wie der Beamte auf dem Amt endet.
Mag sein, daß ich mit dieser Bemerkung etwas zu weit gegangen bin, weil er selbst seit mehreren Jahren beamtet war. Er war wütend, und ich war es auch.
– Du hast dich doch nie mit der Geschichte des Terrorismus und seinen Hintergründen beschäftigt! sagte er.
Das stimmte. Die Fernsehberichte über Terrorismus gehörten zu meiner Jugend wie Das Aktuelle Sportstudio und Raumschiff Enterprise. Einmal habe ich am Mittagstisch gesagt, man müßte die Terroristen alle an die Wand stellen, weil ich das irgendwo in der Schule gehört hatte, und mein Vater nickte.
Für Kollat war sein Haß Vergangenheit wie die Geschichte, die er erzählte, daß er auf dem Weg nach Berlin hin- und hergerissen war zwischen Wut und Euphorie, zwischen Selbstzweifeln und der Überzeugung, es allen zu zeigen. Am Ende setzte sich dann der Glaube an die eigenen Fähigkeiten durch, die Gewißheit, daß die Welt nur auf einen gewartet hat, das Gefühl, unverletzbar zu sein, diese Kraft, die einen ganz durchströmt, erst recht nach ein, zwei Flaschen Bier!, lachte Kollat, während die Kellner um Entschuldigung baten, Kaffee ausschenkten und mit Kuchentabletts das Hufeisen abschritten. In Hochstimmung kam er in Berlin an, fuhr auf nachtleeren dreispurigen Straßen mit Bäumen rechts und links, hier und da eine noch erleuchtete Kneipe, dann wechselten Schaufenster einander ab, Bekleidungs- und Lebensmittelgeschäfte, Banken und Post, eine U-Bahn-Haltestelle, anschließend wieder Wohngebiete.
– Zu Hause, sagte er, war das einfacher, die Orientierung. In der Provinz gibt es Außenbezirke und ein Zentrum, und zwar da, wo es hingehört, ein Zentrum im Zentrum.
Schließlich fand er den gesuchten Stadtteil, kreuzte die richtige Straße, parkte vor der Kneipe, deren Namen Johnny ihm genannt hatte, stieg aus und stand endlich vor der dreistelligen Hausnummer, der richtigen. Er erinnert sich noch heute an die schwere, zweiflüglige Holztür, dahinter ein dunkler Durchgang, links ein Treppenaufgang, erleuchtet durch eine trübe Glühbirne in einer halb aus dem Putz gerissenen Porzellanfassung, auf dem Fußboden Flugblätter und Werbebroschüren, Sozialismus und Sonderangebote, verbeulte Briefkästen, aufgebrochen teils, Namensschildchen auf grauen Blechtürchen, kaum lesbar, aufgeklebte Papierschnipsel mit mehreren Namen oder verblichene Schriftzüge auf vergilbtem Untergrund hinter blindgewordenen Glasscheibchen. Kollat stieg die Treppe hinauf, kein Licht im zweiten und dritten Stock. Er leuchtete mit seinem Feuerzeug nach Türschildern, hier und da angelaufene Messingplaketten mit eingravierter Schrift, kein Johnny Er sah auf die Uhr, etwas zwischen drei und vier, keine Zeit zum Denken, er wollte ein Bier. Er stieg die Treppen wieder hinunter, tastete durch die Lichtlosigkeit des zweiten Stocks, mit der Schuhspitze suchte er die Stufen zum ersten, dann das Schnappen eines Schlosses hinter ihm. Er erschrak und drehte sich um. In der geöffneten Tür stand eine fette Alte im Spitzennachthemd, in fahlen Schein getaucht durch eine Nachtleuchte in ihrem Wohnungsflur. Natürlich verteidigte er sich sofort, wegen der Uhrzeit, als sei er es, der hier etwas falsch gemacht habe, dabei war es ja nun wirklich die Höhe, daß die mitten in der Nacht das Treppenhaus kontrollierte, obwohl es im nachhinein komisch war, wie die da stand und ihre Perücke zurechtzupfte, dann die Arme vor der Brust verschränkte und ihn Junger Mann nannte, und ob er es denn schon mal im Hinterhaus versucht habe?
– Ich war ja das erste Mal in Berlin, sagte Kollat. Das mit den Hinterhöfen kannte ich einfach nicht, aber die Sache stimmte, das habe ich sofort gesehen, als ich die Tür zum Hof öffnete.