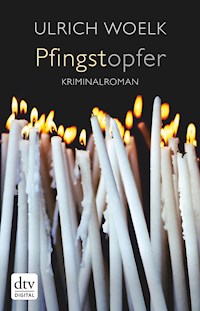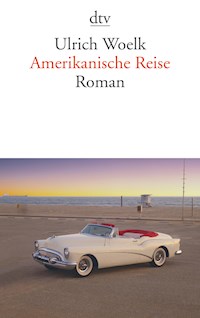19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eingebettet in die Geschichte von Niki und Lu erzählt Ulrich Woelk in diesem fesselnden, episodenreichen und weitgefächerten Roman nicht nur eine deutsche Geschichte der letzten fünfzig Jahre und die sehr unterschiedlicher Lebensentwürfe, er zeichnet auch ein atemberaubendes Bild von der geheimnisvollen Verschlungenheit des Lebens. Was ist die verborgene Spielregel unseres Lebenslaufes und wer sind wir, wenn wir lieben? Woelks Roman Für ein Leben ist ein grandioses Leseabenteuer. Als die junge Berliner Ärztin Niki Lamont kurz nach dem Mauerfall aufgrund einer Fehldiagnose einem jungen Mann beinahe schweren Schaden zufügt, ahnt sie nicht, dass sie ihn einmal heiraten wird. Auch die Umstände ihres Wiedersehens Jahre später sind mehr als ungewöhnlich, ebenso wie der Verlauf der Hochzeitsnacht. Niki, geboren in Afghanistan, aufgewachsen in Indien und Mexiko als Kind deutscher Hippies, lernt, ebenfalls im Krankenhaus, die etwas jüngere Lu kennen, deren Vater sich nach dem Tod der Mutter regelmäßig ins Koma trinkt. Die Begegnung der zwei Frauen, beide gewissermaßen elternlos, hat Folgen, die sie niemals erwartet hätten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ulrich Woelk
Für ein Leben
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Eingebettet in die Geschichte von Niki und Lu erzählt Ulrich Woelk in diesem fesselnden, episodenreichen und weitgefächerten Roman nicht nur eine deutsche Geschichte der letzten fünfzig Jahre und die sehr unterschiedlicher Lebensentwürfe, er zeichnet auch ein atemberaubendes Bild von der geheimnisvollen Verschlungenheit des Lebens. Was ist die verborgene Spielregel unseres Lebenslaufes und wer sind wir, wenn wir lieben? Woelks Roman «Für ein Leben» ist ein grandioses Leseabenteuer.
Als die junge Berliner Ärztin Niki Lamont kurz nach dem Mauerfall aufgrund einer Fehldiagnose einem jungen Mann beinahe schweren Schaden zufügt, ahnt sie nicht, dass sie ihn einmal heiraten wird. Auch die Umstände ihres Wiedersehens Jahre später sind mehr als ungewöhnlich, ebenso wie der Verlauf der Hochzeitsnacht. Niki, geboren in Afghanistan, aufgewachsen in Indien und Mexiko als Kind deutscher Hippies, lernt, ebenfalls im Krankenhaus, die etwas jüngere Lu kennen, deren Vater sich nach dem Tod der Mutter regelmäßig ins Koma trinkt. Die Begegnung der zwei Frauen, beide gewissermaßen elternlos, hat Folgen, die sie niemals erwartet hätten …
Über den Autor
Ulrich Woelk lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Er studierte Physik und Philosophie. Sein erster Roman «Freigang» erschien 1990. Zuletzt veröffentlichte er mit großem Erfolg den Roman «Der Sommer meiner Mutter» (C.H.Beck, 2019), der auf der Longlist des Deutschen Buchpreises stand und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Für «Für ein Leben» erhielt Ulrich Woelk den Alfred-Döblin-Preis.
Inhalt
1: Fehldiagnose
2: Der Ventilator
3: Susan und Mick
4: Abwärts
5: La Fura dels Baus
6: Die Datsche
7: Marien-Darshan
8: Der Roman als Hologramm
9: Die Töchter Egalias
10: Die Erfindung des Paradieses
11: Lesbenwoche
12: Super 8
13: White Wedding
14: Ein Mitternachtstraum
15: Das Vaginazimmer
16: Polaroid Warhol
17: Sex mit Salma
18: Unbefleckte Empfängnis
19: El Desierto Real
20: Come in Coma
Epilog
Dank
Für Tina
1
Fehldiagnose
Als Nikisha Lamont ihrem späteren Ehemann, Clemens Rubener, erstmals begegnete, hätte sie ihm um ein Haar die Fruchtbarkeit geraubt. Das war im Winter 1989/90, kurz nachdem die Mauer zwischen Ost- und Westberlin gefallen war, politisch aber noch zwei deutsche Staaten existierten. Die geteilte Stadt, die geschlossenen Grenzen kannte Niki nicht, sie war erst vor wenigen Wochen aus Guadalajara in Berlin angekommen und hatte eine Stelle als Ärztin in einem Krankenhaus im Bezirk Wedding angetreten – nicht unbedingt dem attraktivsten Viertel der Stadt. Aber das wusste sie nicht.
Das Krankenhaus lag in der Nähe der Grenzanlagen, und Niki hatte als Ärztin vom ersten Tag an fast pausenlos zu tun. Die Öffnung der Mauer hatte den Notaufnahmen, die auch vorher schon notorisch überfüllt gewesen waren, eine Menge weiterer Patienten beschert. Überhaupt konnten sich sämtliche Westberliner Institutionen und Geschäfte danach vor Publikum kaum retten – ganz gleich ob Banken, Supermärkte, Autohäuser oder Sexshops. Überall standen Neugierige und Schaulustige aus der Osthälfte der Stadt und des ganzen Landes Schlange, und so herrschte in den Straßen Westberlins ein paar herbst- und frühwinterliche Wochen lang eine ungewöhnliche Mischung aus alltäglicher Geschäftigkeit, vorweihnachtlichem Einkaufsgedränge und historischer Euphorie. Berlin hatte sich gleichsam verdoppelt, und ein Witzbold meinte, dass John F. Kennedy in diesem beispiellosen Winter 1989/90 hätte sagen müssen: «Ich bin zwei Berliner.»
Clemens Rubener kam mit akuten Schmerzen im linken Hoden in die Notaufnahme. Draußen hatte es begonnen zu schneien, und jedes Mal wenn die Automatiktür sich öffnete, wehte ein Schwall kalter Luft mit nervösen Flockenwirbeln in den Korridor. Durch ein Fenster im Anmeldungsraum konnte man den verwaschenen Schein der Bogenlampen sehen, die den nahen Grenzstreifen beleuchteten, keine fünfzehn Gehminuten vom Krankenhaus entfernt.
Die Patienten aus dem Ostteil der Stadt passierten die Mauer an einem provisorischen Durchbruch, den man wenige Tage nach dem 9. November 1989 geöffnet hatte, und folgten auf westlicher Seite einem Wegweiser mit einem roten Kreuz, der dort schon seit Jahren unbeachtet an einem Laternenpfahl hing und nun endlich seinen Dienst tun konnte. Neben Patienten, die mit akuten Beschwerden ins Krankenhaus kamen, gab es auch andere, die hofften, durch die, wie sie annahmen, besseren Möglichkeiten des medizinischen Systems im Westteil der Stadt von alten chronischen Leiden befreit zu werden. Und zu Beginn kamen manche wohl auch einfach nur aus Neugier.
Diese Patienten mischten sich im Warteraum mit jenen, die auch ohne die Grenzöffnung Hilfe in der Notaufnahme gesucht hätten. Die erste Aufgabe der Ärzte und des Pflegepersonals war es daher, die knappen Ressourcen der medizinischen Betreuung noch effizienter auf Bedürftige und weniger Bedürftige zu verteilen. Das aber fiel Niki schwer. Sie hatte den Hippokratischen Eid nicht abgelegt, um möglichst produktiv in einer überlasteten Gesundheitsfabrik zu funktionieren. Allerdings waren die Notaufnahmen in Mexiko auch keine Ruhezonen gewesen. Niki sah irgendwann ein, dass sich die ungewöhnliche Situation mit ihrer idealistischen Haltung nicht bewältigen ließ.
Um ihren Ansprüchen wenigstens teilweise gerecht zu werden, arbeitete sie so viel, wie es ihr nur irgend möglich war – und mit fünfundzwanzig Jahren war sie in dieser Hinsicht ziemlich belastbar. Außerdem machte sich für ein paar Wochen kaum jemand Gedanken um Arbeitszeitregelungen, tarifvertragliche Pausenzeiten oder Überstunden- und Gleitzeitkonten. Allerdings schlief Niki zu wenig, und manchmal hatte sie aus Übermüdung Halluzinationen, hörte Fragen von Kollegen, die in Wahrheit keinen Ton gesagt hatten, oder hatte optische Täuschungen wie knapp über der Matratze schwebende Patienten, schwach schimmernde goldene Aureolen über ihren Hinterköpfen und in einem Fall sogar blasse Engelsflügel, die aus den Schultern eines hereinkommenden Kindes wuchsen und sich schließlich in die wirbelnden Schneeflocken vor der Notaufnahme zurückverwandelten.
Vielleicht hätte Niki sich deswegen Sorgen machen sollen, aber bisher hatte sie sich noch keinen Behandlungsfehler zuschulden kommen lassen und leistete zuverlässig ihren entschlossenen Beitrag zum Wohle der Menschheit. Die zwischenzeitliche Müdigkeit bekämpfte sie mit zahllosen Bechern einer bitteren, ölig-schwarzen Automatenflüssigkeit, die den Namen Kaffee kaum noch verdiente. So auch jenen kurzen Schwindel, der sie erfasste, bevor sie Clemens Rubener gegenübertrat. Medizinisch gesprochen, behandelte sie ihre Übermüdung mit einer weiteren Dosis Koffein, danach fühlte sie sich wieder hinreichend sicher auf den Beinen, um sich den Schmerzen in seinem linken Hoden zuzuwenden.
Clemens sah elend aus. Die Beschwerden hätten, so sagte er, als sich die Tür des Behandlungszimmers hinter Niki schloss, am späten Nachmittag unvermittelt angefangen, als leichter Druck, der innerhalb von anderthalb Stunden immer stärker und inzwischen fast unerträglich geworden sei. Bald schon habe er sich auch fiebrig gefühlt, und dann sei ihm übel geworden. Daraufhin habe er zwei Aspirin und eine Vomex geschluckt und sich auf den Weg in die Notaufnahme gemacht.
Niki machte ein paar Notizen auf dem Aufnahmeformular und überlegte dabei einen Moment lang, ob es nicht besser wäre, diesen Fall einem männlichen Kollegen zu überlassen. Aber in Anbetracht des Krankenstaus im Wartezimmer war ihr schnell klar, dass sie auf ein mögliches Schamgefühl ihres Patienten keine Rücksicht nehmen konnte. Im Übrigen machte er, Niki schätzte ihn auf Ende zwanzig oder Anfang dreißig, auf sie nicht den Eindruck, als störe es ihn, wenn eine Frau seinen Hoden begutachtete.
Sicher war, dass es Clemens schlecht ging. Sein linker Hoden war geschwollen und gerötet und fühlte sich warm an. Niki vermutete, dass es sich entweder um eine Epididymitis, eine durch verschiedene Bakterien verursachte Entzündung des Nebenhodens, oder um eine Hodentorsion handelte – eine spontane oder durch äußere Einwirkung verursachte Verdrehung des Hodens, bei der sich der Samenleiter um die Blutgefäße im Skrotum wickelte und diese abschnürte, sodass die Versorgung mit Sauerstoff unterbrochen wurde.
Da aber weder das eine noch das andere zum Alltag in der Notaufnahme gehörte, musste Niki sich kurz besinnen. Während bei Kindern, so erinnerte sie sich, die Hodentorsion vorherrschte, wurde die Epididymitis mit zunehmendem Alter häufiger, vor allem bei Männern in den Zwanzigern sowie zwischen dem vierzigsten und sechzigsten Lebensjahr, da die meisten Nebenhodenentzündungen de facto durch sexuelle Kontakte übertragen wurden.
Als Niki mit ihren Überlegungen an diesem Punkt angekommen war – sie betastete, wenn auch eher mechanisch, immer noch Clemens Rubeners Hoden –, fragte sie sich, ob seine Beschwerden nicht auch eine indirekte Folge der politischen Ereignisse sein konnten. Schließlich hatten der Fall der Berliner Mauer und die politische Öffnung Osteuropas nicht nur für Menschen ein Hindernis aus dem Weg geräumt, sondern auch für Bakterien und Krankheitserreger.
Niki erinnerte sich an einen Artikel im International Journal of Epidemiology, der jüngst vor der Einwanderung neuer Chlamydienstämme aus Osteuropa gewarnt hatte. Allerdings konnten auch urinogene Bakterien – bestimmte Enterokokken – eine Entzündung des Nebenhodens verursachen. In diesem Fall wäre Ciprofloxacin oder Ofloxaxin angezeigt gewesen. Sexuell übertragbare Erreger wie Chlamydia trachomatis hingegen sprachen auf Doxyzyklin an. Um zu entscheiden, welche Medikation die richtige war, musste Niki Clemens fragen, ob er in den vergangenen achtundvierzig Stunden Geschlechtsverkehr gehabt hatte.
Üblicherweise haftete solchen Fragen zwischen Arzt und Patient nichts Anstößiges an, aber Niki war als junge Ärztin noch nicht sehr erfahren und neigte dazu, das wusste sie sehr gut, sich manchmal zu sehr mit den Patienten und ihren Sorgen zu identifizieren. Vor allem aber hielt sie immer noch Clemens Rubeners Hoden in der Hand. Wie sich allerdings herausstellen sollte, machte sie sich wieder einmal zu viele und zu komplizierte Gedanken. Die Frage, ob er in den vergangenen achtundvierzig Stunden Geschlechtsverkehr gehabt habe, störte Clemens nicht nur nicht, ihre Beantwortung schien sogar eine gewisse belebende Wirkung auf ihn auszuüben. Mit einem für seinen Zustand recht unbeschwerten Tonfall und ganz und gar geradeheraus sagte er: «Ein paar Mal.»
Niki ließ seinen Hoden los. Neben der Inaugenscheinnahme und der Tastuntersuchung wären als weitere diagnostische Tests bei einer Epididymitis eine Urin- und Blutuntersuchung sowie ein Harnröhrenabstrich üblich gewesen, da bestimmte Erreger, die zu Harnwegsinfektionen und Entzündungen der Harnröhrenschleimhaut führten, auch Nebenhodenentzündungen auslösen konnten. Aber Niki war aufgrund der sexuellen Aktivität ihres Patienten, von der sie soeben in Kenntnis gesetzt worden war, und wegen des Chlamydien-Artikels im International Journal of Epidemiology der Ansicht, es mit einer aus Osteuropa eingeschleppten, durch Chlamydia trachomatis verursachten Epididymitis zu tun zu haben. Sie verschrieb ihrem Patienten Doxyzyklin, hundert Milligramm pro Tag für zwei Wochen, und Paracetamol gegen die Schmerzen.
«Außerdem», sagte sie, «empfehle ich Ihnen Bettruhe. Sollten die Schmerzen zu stark werden, können wir Ihnen ein Lokalanästhetikum in den Samenstrang spritzen.»
Die Vorstellung, eine Spritze in den Samenstrang gesetzt zu bekommen, schien ihm einen größeren Schrecken einzujagen als die Aussicht, die Schmerzen im Hoden ein paar Tage lang ertragen zu müssen, und so sagte er: «Geht schon.»
Vorsichtig stand er auf und zog sich wieder an. Er trug, das hatte Niki durchaus registriert, Valentino-Boxershorts, und die Tatsache, dass er auf seine Unterwäsche offensichtlich Wert legte, brachte sie auf den Gedanken, er könnte homosexuell sein. Medizinisch war diese Information durchaus von Bedeutung. Während Niki die obligatorischen Eintragungen auf seinem Krankenblatt machte und als Diagnose eine akute Epididymitis vermerkte, war sie in Gedanken bereits einen Schritt weiter. Sie machte sich klar, dass sie ihn nicht entlassen konnte, ohne ihm gegenüber eine ärztliche Bemerkung über die anzunehmende Quelle seiner Infektion gemacht zu haben. Mit anderen Worten, sie musste ihn auf seine Sexualpartnerin ansprechen – oder eben auf seinen Sexualpartner.
Während sie noch schrieb, suchte sie in Gedanken nach dem richtigen Ton, einer geeigneten Formulierung, um die Sache anzusprechen. Ansteckungswege waren medizinische Sachverhalte, was aber nichts daran änderte, dass es immer, und nicht erst seit Aids, ein wenig heikel war, über Geschlechtsverkehr als Infektionsquelle zu sprechen. Doch auch das, fand Niki, gelang ihr dafür, dass sie erst seit kurzer Zeit auf Deutsch praktizierte, in einer angemessen nüchternen Art.
«Ich müsste Sie auch bitten, Ihrem Partner zu raten, sich auf Chlamydien oder andere Erreger untersuchen zu lassen.»
«Das ist, offen gestanden, nicht so … einfach», antwortete Clemens daraufhin, jetzt allerdings etwas zögerlich. «Könnte ich meine Freundin denn anstecken?»
Er war also heterosexuell, beziehungsweise auch heterosexuell – ob er es ausschließlich war, stand mit der Tatsache, dass er eine Freundin hatte, immer noch nicht fest. Seine Frage war lediglich ein Hinweis darauf, dass er neben einer offenbar festen heterosexuellen Beziehung noch andere sexuelle Kontakte pflegte – welcher Art auch immer.
«Das ist durchaus möglich. Denken Sie denn, dass Sie sich nicht bei Ihrer Partnerin infiziert haben?»
«Ehrlich gesagt, könnte das sein», antwortete er, «und es wäre mir natürlich unangenehm …»
«Ich verstehe …», antwortete Niki und brach dann ab, weil ihr eine ziemlich unpassende Bemerkung auf der Zunge lag, etwas wie: Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen! Und sie empfand eine gewisse Genugtuung, als sie aus rein medizinischen Gründen hinzufügen musste: «Diese Information ist für Ihre Partnerin wirklich äußerst wichtig. Chlamydien werden beim Geschlechtsverkehr über die Schleimhäute übertragen. Bei Frauen führen sie zu chronischen Entzündungen der Eileiter, die dadurch verkleben können und eine natürliche Empfängnis in der Folge unmöglich machen. Es ist zwar kaum bekannt, aber Infektionen mit Chlamydien gehören bei Frauen zu den häufigsten Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch. Ihre Partnerin sollte sich also dringend untersuchen und gegebenenfalls behandeln lassen. Chlamydien sprechen auf Antibiotika sehr gut an. Wenn eine Infektion vorliegt, lässt sich also problemlos etwas dagegen unternehmen.»
Mit diesen Worten entließ sie ihren Patienten, der das Behandlungszimmer bedrückt mit sehr kleinen, vorsichtigen Schritten verließ. Niki folgte ihm nicht gleich. Sie setzte sich und überließ sich für ein paar Augenblicke der Erschöpfung, die ihren Körper und ihr Bewusstsein erfasste. Sie war todmüde und doch innerlich aufgewühlt. Als Ärztin war sie zum Schweigen verpflichtet, aber eigentlich hätte sie seine Freundin, wenn sie sie denn gekannt hätte, am liebsten gleich angerufen. Stattdessen musste sie sich auf seinen Anstand und sein Verantwortungsgefühl dieser Frau gegenüber, und nicht nur ihr, sondern Frauen gegenüber allgemein, verlassen. Chlamydieninfektionen blieben oft unentdeckt, und wenn ihr Patient gegenüber seiner Freundin schwieg, würde sie vielleicht nie erfahren, dass sie sich bei ihm angesteckt hatte.
Niki fehlte die Konzentrationsfähigkeit, um sich weiter mit dieser moralischen Dimension des Problems zu beschäftigen und den Charakter ihres Patienten einzuschätzen. Was seine sexuelle Orientierung anging, kam sie lediglich noch zu dem Schluss, dass er ausschließlich hetero- und nicht bisexuell war. Obwohl sie sich bei der Aufklärung über Infektionsrisiken zunächst neutral nach seinem Partner erkundigt hatte, hatte er keinen Moment gezögert, von seiner Freundin zu sprechen. Offensichtlich war er nicht eine Sekunde lang auf den Gedanken gekommen, Niki könnte ihn für homosexuell halten. Und obwohl sie aus eigener Erfahrung keine Belege dafür hatte, glaubte Niki, dass heterosexuelle Männer dazu neigten, von der Eindeutigkeit ihrer sexuellen Ausstrahlung überzeugt zu sein.
Schließlich befahl sie sich, aufzustehen und das Behandlungszimmer zu verlassen. Sie würde mit ihren Überlegungen niemandem helfen, doch der Wartebereich war nach wie vor überfüllt. Drei Stunden lang funktionierte sie perfekt, diagnostizierte Abszesse und Furunkel, einen Duodenalulcus und Pseudokrupp und sah dem Ende der Nacht und ihrem warmen Bett sehnsüchtig entgegen, als Clemens Rubener in die Notaufnahme zurückkehrte. Er sah schockierend schlecht aus und sagte, dass das Paracetamol keine Wirkung zeige. Inzwischen wäre der Druck unerträglich geworden, und Niki erschrak beim Anblick seines feuerroten Hodens.
Sie ging zu Doktor Lothar, um sich Rat zu holen. Der Oberarzt, ein stämmiger Mittvierziger mit nur noch wenigen, einstmals rötlichen Haaren, zog die Augenbrauen hoch. Er fragte Niki, ob denn das Prehn-Zeichen positiv oder negativ gewesen sei? Zur Bestimmung des Prehn-Zeichens hob man den betroffenen Hoden an. Ließen die Schmerzen nach, war das Prehn-Zeichen positiv, was auf eine Epididymitis hinwies. Nahmen die Schmerzen dagegen zu oder blieben unverändert, sprach man von einem negativen Prehn-Zeichen, was auf eine Hodentorsion hindeutete. In diesem Fall waren weitere diagnostische Maßnahmen notwendig, eine Dopplersonografie oder in sehr unklaren Fällen auch die operative Freilegung des Hodens. Insgesamt hatte man es bei einer Hodentorsion mit einem sehr engen Zeitfenster für die Behandlung zu tun. Bereits wenige Stunden nach den ersten Beschwerden drohte ein vollständiger Organverlust.
Niki hatte vom Prehn-Zeichen noch nie etwas gehört. Aber sie erinnerte sich jetzt daran, dass Clemens Rubener beim Anheben seines Hodens tief durchgeatmet hatte, was ihr als Ausdruck eines Verlagerungsschmerzes erschienen war. Das war vor drei Stunden gewesen. Als Dr. Lothar den Hoden jetzt anhob, stöhnte Clemens laut vernehmlich auf.
«Und Sie haben den Patienten ohne genauere Untersuchungen wieder gehen lassen?»
«Wir sind völlig überlastet», sagte Niki. «Ich musste entscheiden, ob er einer von den schwereren oder von den leichteren Fällen war.»
«Offensichtlich haben Sie falsch entschieden», bemerkte Dr. Lothar und schickte Nikis Patienten sofort in den OP. «Der Grad der Organschädigung bei einer Hodentorsion», erklärte er Niki danach, «hängt von der Art der Verdrehung ab. Das Risiko ist höher, wenn die Samenstränge ungewöhnlich lang sind. Deswegen ist eine möglichst frühe Diagnose so wichtig. Nachdem man die Strangulation des Hodens operativ aufgehoben hat, normalisiert sich die Durchblutung wieder, aber nur, wenn die Operation rechtzeitig erfolgt. Es war ein Fehler, den Patienten mit einem Antibiotikum nach Hause zu schicken. Hoffen wir das beste für seine Zeugungsfähigkeit.»
Niki fragte sich in den Jahren danach manchmal, ob ihre Fehldiagnose nicht auch mit ihrer distanzierten Haltung Clemens gegenüber zu tun gehabt haben könnte. Bei jedem anderen Patienten hätte sie vielleicht statt einer Epididymitis eine Hodentorsion als zumindest gleich wahrscheinlich in Erwägung gezogen, aber die Art seines Auftretens hatte sie wohl nur an eine sexuelle Ursache für seine Erkrankung denken lassen. Und womöglich hatte etwas in ihr seine Schmerzen sogar unterschwellig gebilligt.
Nachdem ihr das Ausmaß ihres Fehlers bewusst geworden war, konnte sie trotz ihrer Übermüdung ihren Dienst nicht beenden, ohne die Operation abzuwarten und sich danach in der Chirurgie nach dem Zustand ihres Patienten zu erkundigen. Sie atmete ein paarmal tief durch, als sie erfuhr, dass der Eingriff erfolgreich gewesen war. Man hatte die Verdrehung des Hodens rückgängig machen und die Durchblutung des Organs vollständig wiederherstellen können.
«Das war knapp», sagte Dr. Lothar.
«Und es ist alles in Ordnung, ja?»
«Die Sache ist bereinigt.» Er hatte Niki eingestellt und winkte ab. «Nehmen Sie die Erfahrung als Ärztin mit, aber schließen Sie den Fall innerlich ab.»
«Na klar, mache ich.»
«Und vor allem: Gehen Sie nach Hause und schlafen sich aus!»
«Okay …», sagte sie und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: «Der Patient … hat also keinen bleibenden Schaden genommen? Was seine Fruchtbarkeit angeht, meine ich …»
Dr. Lothar seufzte. «Dazu kann ich Ihnen keine Prognose geben. Um das herauszufinden, müssten Sie ihn schon heiraten. Aber ich schätze mal, so weit würden selbst Sie nicht gehen.» Damit ließ er sie stehen, um ihr, ohne sich umzudrehen, nach ein paar Schritten, noch einmal zuzurufen: «Schlafen Sie sich aus!»
Niki hatte noch keine Zeit gefunden, sich um eine Wohnung zu kümmern, und war für den Anfang im Schwestern- und Gästewohnheim des Krankenhauses in einem möblierten Zimmer mit Bad untergekommen. Die Wohnheimsituation war ihr vertraut, und da sie sich im Studentenwohnheim in Guadalajara ein Zimmer mit einer Kommilitonin hatte teilen müssen, war es sogar eine Verbesserung.
In der Nacht schlief sie, wie oft nach vollkommener Übermüdung, sehr schlecht und träumte wirres Zeug. Sie musste einem Patienten nach einer unerfreulichen Genitalkomplikation mitteilen, dass sein Penis verschwunden sei und er stattdessen nun eine Vagina habe. Der Patient fühlte sich nach eigener Aussage aber prächtig und ahnte nicht das Geringste davon. Aus irgendeinem Grund wollte Niki ihm nicht die Illusion rauben, nach wie vor ein Mann zu sein. Sie sah sich hektisch im Zimmer um, ob es nicht irgendetwas gäbe, das sie an ihm als Ersatzpenis befestigen könnte – eine Stück Seife, die Flasche mit dem Desinfektionsmittel, ihren Kugelschreiber, eine Rolle Verbandsmull. In ihrer Not klemmte sie schließlich ihr Stethoskop im Schritt des Patienten fest, sodass der Schlauch für die Geräuschübertragung zwischen seinen Beinen baumelte. Als der Patient seinen neuen Penis sah, war er ganz begeistert, und fing sofort an, damit zu spielen.
Am nächsten Morgen hatte Niki rasende Kopfschmerzen und das Gefühl, überhaupt nicht geschlafen zu haben. Als sie Clemens nach dem Frühstück besuchte, um sich nach seinem Zustand zu erkundigen und dafür zu entschuldigen, dass sie ihn mit einer falschen Diagnose nach Hause geschickt hatte, konnte sie im ersten Moment gar nicht anders, als in ihm den Patienten aus ihrem Traum zu sehen.
Clemens war guter Dinge und sagte: «Machen Sie sich nichts draus. Ehrlich gesagt, wäre ich auch nie darauf gekommen, dass ich jemals Schwierigkeiten mit meinen Eiern bekommen könnte.»
«Tut mir leid, dass ich falsch gelegen habe.»
«Mir wären Pillen ja auch lieber gewesen als gleich eine OP. Aber wenigstens ist eine Hodentorsion nicht ansteckend.»
Niki wurde ärgerlich. Ja, das war sein größtes Problem gewesen, und da dieses sich nun in Luft aufgelöst hatte, war er so entspannt.
«Eine Hodentorsion ist von einer Entzündung nicht so leicht zu unterscheiden», sagte sie kühl. «Die Schmerzen sind ähnlich.»
«Woher wollen Sie das wissen?», sagte er mit einem etwas hintersinnigen Lächeln. «Es sind Schmerzen im Hoden.»
«Sie meinen, mir fehlt da unten was?»
«Auf gar keinen Fall», sagte er.
«Ach ja? Erwarten Sie, dass ich jetzt erleichtert bin?»
Er schwieg einen Moment und sagte dann: «Sie sind sauer auf mich wegen meiner Freundin, stimmt’s?»
Sie schüttelte den Kopf und spürte dabei das Stethoskop an ihrem Hals. Einen Moment lang dachte sie an ihren Traum, in dem sie aber doch nur ein gesichtsloses männliches Wesen gesehen hatte.
«Ich bin als Ihre Ärztin hier. Und als solche bin ich erleichtert, dass es Ihnen besser geht. Nur das war für mich wichtig.»
Er winkte ab. «Für mich ist es kein Problem, dass Sie sich geirrt haben.»
Sie wandte sich zum Gehen. «Ruhen Sie sich aus.»
«Schauen Sie mal wieder vorbei», rief er ihr nach.
Aber das würde Niki nicht tun. Die kurze Unterhaltung sollte sie auch so noch viel zu lange beschäftigen. In ihrem Bewusstsein setzten sich danach zwei Dinge fest: Männer glaubten, mit ihren «Eiern» etwas ganz und gar Unvergleichliches zu besitzen, ein Mysterium, das Frauen nie zur Gänze würden ergründen können. Und Männer – jedenfalls Clemens Rubener, der aber wohl kein untypischer Mann war – nahmen für sich das Recht in Anspruch, sie, Nikisha Sri Lamont, zu begnadigen. Und nicht nur sie, sondern vermutlich jede Frau.
Und Niki machte sich nichts vor: Sie hatte diese Rolle angenommen. Sie hatte auf Clemens’ Selbstgefälligkeit nicht mit ironischer Gelassenheit reagiert, kühlem Zynismus oder heiligem Zorn. Wahrscheinlich hatte sie alle seine Erwartungen erfüllt, und sie war hin- und hergerissen, noch einmal zu ihm zu gehen und irgendetwas klarzustellen. Was, wusste sie aber nicht so genau.
Das Dilemma erledigte sich von selbst. Als Niki nach ein paar Tagen wegen eines anderen Patienten auf die Urologie kam, hatte man Clemens Rubener bereits entlassen.
2
Der Ventilator
Im Jahr 1983 starb Lus Mutter Draga an Lungenkrebs. Kurz zuvor war Lu – sie hieß Ljubina, aber alle nannten sie Lu – dreizehn Jahre alt geworden. Draga stammte aus Kroatien, und Ljubina war der Name ihrer Großmutter gewesen. Herbert Sellen, Lus Vater, hatte Draga in einem Ferienhotel in der Nähe von Split kennen gelernt, wo sie an der Rezeption arbeitete und ihm wegen ihrer blonden Haare sofort auffiel. Herbert liebte blonde Frauen, insbesondere solche im Fünfzigerjahre-Stil, wie er sie als Junge auf den großen, gemalten Kinoplakaten in den vom Weltkrieg noch halb zerbombten Straßen Berlins bewundert hatte.
Er heiratete Draga in ihrem Heimatdorf im Hinterland von Zagreb nach traditionellem kroatischen Ritus, was unter anderem bedeutete, dass er ihr kurz vor Mitternacht mit den Zähnen das blaue Spitzenstrumpfband vom Oberschenkel streifen musste, um es danach einer Gruppe von feixenden Junggesellen zur Bestimmung des nächsten Hochzeitskandidaten zuzuwerfen. Das laut beklatschte Spektakel dauerte zur Freude aller ziemlich lang, weil Herbert schon eine Menge von dem dorfeigenen Slibowitz getrunken hatte. Selbst in nüchternem Zustand wäre es ein Kunststück gewesen, unter Dragas angewinkeltem, auf einen Stuhl gestützten Bein kniend, sowohl das Gleichgewicht zu halten als auch mit den Schneidezähnen nach dem gerüschten Seidenband zu knabbern. Draga trug es schon beinahe frivol hoch. Ein paar Zentimeter weiter, und Herbert hätte ihr mit den Zähnen ein noch aufregenderes Kleidungsstück vom Leib streifen können. Dragas Höschen war ein atemberaubend knappes Modell, aus dem sich zu beiden Seiten des höchstens zwei oder drei Zentimeter breiten Stegs die Schamhaare herauslockten, im Farbton sehr dunkel – Draga war eigentlich nicht blond. Offenbar war der Sinn des Rituals, den frischgebackenen Ehemann einen ersten Blick auf die Pforte jenes Paradieses werfen zu lassen, in das er am Ende der Hochzeitsfeierlichkeiten, die sich allerdings als sehr lang und ausufernd herausstellen sollten, würde eintreten dürfen.
In Berlin wohnten Herbert und Draga im Bezirk Wedding in einem Mietshaus, das eine für die Gegend typische Mischung aus Sozialfällen, Alkoholikern, türkischen Einwanderern, erfolglosen Künstlern und schrägen Vögeln beherbergte. Der Wedding, wie der Stadtteil im Berliner Jargon genannt wurde, war in den 1980er-Jahren ziemlich heruntergekommen. Wenn man auf die Straße ging, kam es mit großer Gewissheit zu einem der folgenden drei Ereignisse: Entweder man bekam von einem Passanten ordinäre Beschimpfungen nachgeworfen – «Die Ampel ist rot, du Arschloch!» –, wurde von einem Jugendlichen um eine Mark angeschnorrt oder man trat in Hundescheiße.
Eine von Lus frühesten Erinnerungen an den Alltag auf den Weddinger Straßen war die an eine Blutlache. Ein alter Mann hatte auf dem Gehweg gelegen, offenbar hatte niemand ihn fallen sehen und auffangen können. Aus einer Platzwunde am Kopf rann Blut auf die grauen Betonplatten. Lu gruselte sich vor dem ausgemergelten Schädel des Mannes, den haarigen Nasenlöchern und den blauen Händen mit den bleichen Nägeln, die riesig wirkten. Sie war damals fünf Jahre alt.
Nachdem sich eine Gruppe aus Schaulustigen gebildet hatte, machte jemand den Vorschlag, den Mann auf die Seite zu drehen. Andere rieten davon ab, ihn in irgendeiner Weise zu berühren. Schließlich erkundigte sich jemand, ob die Feuerwehr verständigt worden sei, in deren Zuständigkeitsbereich medizinische Notfälle in Berlin fielen.
Der alte Mann trug einen dicken, schäbigen Mantel, obwohl es warm war. Die Feuerwehrleute – es dauerte lange, bis der Rettungswagen kam – gingen grob mit ihm um, vielleicht so wie mit einem prall gefüllten, unter Pumpendruck stehenden Wasserschlauch. Der Kopf des Mannes, fleckig und fast kahl, baumelte hin und her und schlug beim ungelenken, schlecht koordinierten Umgreifen und Nachfassen der Feuerwehrleute hart aufs Pflaster. Lu sollte sich für immer an den dumpfen Ton erinnern, mit dem der Schädelknochen, von keinem Haarpolster mehr geschützt, auf die Gehwegplatten prallte. Es klang, als wäre der alte Mann schon tot. Vielleicht war er das ja.
Herbert Sellen überprüfte und reparierte Aufzuganlagen in Hotels, Kaufhäusern und Bürogebäuden. Einer seiner Hauptarbeitsplätze waren die Dächer von Fahrstuhlkabinen, wo er Umlenkrollen wartete und fettete oder die mechanischen Führungen von Türen wieder gängig machte. Dass er sich dabei oft in einer Höhe bewegte, die vielen ein Übelkeitsgefühl in die Magengrube gejagt hätte, war ihm schon lange nicht mehr bewusst. Das änderte sich erst wieder, als er einmal mitansehen musste, wie einer seiner Kollegen in die Tiefe eines sechsstöckigen Schachts stürzte, weil er sich bei einem Dreierlift in der Tür geirrt hatte, nachdem er noch einmal – Herbert kannte ihn doch längst! – seinen Lieblingsfahrstuhlwitz zum Besten gegeben hatte: Stecken ein Mann und eine Frau bei Stromausfall in einem Fahrstuhl fest. Reißt sich die Frau die Klamotten vom Leib, schmeißt sie auf den Boden und sagt zu dem Mann: «Mach, dass ich mich wie eine echte Frau fühle!» Reißt sich der Mann die Klamotten vom Leib, schmeißt sie auf den Boden und sagt: «Einmal waschen und bügeln, bitte!»
Und dann wurde aus dem Lachen des Kollegen ein furchtbarer Schrei, bis er mit einem dumpfen, eher leisen Geräusch auf dem Boden des Schachts aufschlug und dort regungslos liegen blieb. Danach konnte Herbert keinen Fahrstuhl mehr betreten und erst recht nicht mehr auf dem Metallgerüst mit den Seilwinden und dem Antriebssystem herumklettern, um dort jene Wartungsaufgaben zu erfüllen, mit denen er sich seinen Lebensunterhalt verdiente.
Er war arbeitsunfähig geworden, und in einem psychiatrischen Gutachten wurde bei ihm eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, ein noch recht neues Krankheitsbild, das seit ein paar Jahren medizinisch anerkannt war. Herberts Fall entsprach der Ausbildung einer PTBS nach einer «an einer fremden Person» erlebten Katastrophe. Er hatte Ein- und Durchschlafstörungen, chronische Schuldgefühle und litt unter Selbstvorwürfen und einer – wie es in dem Gutachten hieß – ausgeprägten kognitiven und psychovegetativen Übererregbarkeit, verbunden mit einer Mischung aus panischer Angst und emotionaler Taubheit.
Die Arbeitsunfähigkeit wurde zunächst für sechs Monate erklärt, um die Symptomatik zu beobachten und ihre weitere Entwicklung abzuwarten, da – so das vorläufige Resümee – jede weitergehende Prognose mit großer Unsicherheit behaftet sei. De facto konnten posttraumatische Belastungsstörungen über Jahre und Jahrzehnte anhalten, abhängig vom Schweregrad des auslösenden Stressors. Bei mehr als einem Drittel aller Traumapatienten blieben die Symptome unverändert bestehen, unabhängig davon, ob die Patienten sich nun psychiatrisch betreuen ließen oder nicht – eine Kategorie, in die auch Herbert zu fallen schien. Er brach die Therapie nach wenigen Sitzungen ab. In Bezug auf die Schlaflosigkeit war sie wirkungslos, was aber wohl auch mit dem Umstand zusammenhing, dass zur gleichen Zeit bei Draga Lungenkrebs diagnostiziert wurde.
Draga arbeitete halbtags als Kassiererin in einem Supermarkt. Bevor sie aus dem Haus ging, widmete sie sich jeden Morgen ausgiebig ihrer Frisur, um sie mit Lockenwicklern und Haarfestiger aus der Sprühdose in jene stabile, blonde Form zu bringen, die Herbert so sehr liebte. Sie saß an der Kasse wie eine Königin. Der Eindruck von altersloser Attraktivität, den sie mit der Frisur aufrechterhalten wollte, verblasste mit den Jahren allerdings schnell. Ihre Haut wurde trocken, und ihre Erscheinung verlor an Glanz, denn sie und Herbert rauchten entschieden zu viel.
Lu erinnerte sich in späteren Jahren häufig daran, dass ihre Eltern sich jeden Morgen beim Aufstehen und anschließenden Gang ins Badezimmer einen bizarren Wettkampf zu leisten schienen und darin überboten, wer am lautesten zu husten verstand. Doch anstatt sich dabei zu schwören, nie wieder eine Zigarette anzurühren oder wenigstens nicht mehr so viel zu rauchen, saßen sie kurz darauf vor ihren Kaffeetassen in der kleinen Küche und rauchten wieder. Das konnte rein statistisch nicht gut gehen, und im Falle von Draga ging es auch nicht gut.
Im Frühjahr 1983 suchte sie wegen der Hustenanfälle und zunehmender Kurzatmigkeit einen Arzt auf, aber da war es schon zu spät. Auf dem Röntgenbild war ihre Lunge eine Anhäufung von Schatten und Nebeln, die sich so dicht und dramatisch überlagerten wie Regenwolken bei der Darstellung eines Sturmtiefs in der Fernsehwettervorhersage. Der behandelnde Arzt hob nur die Augenbrauen und sagte ohne viel Einfühlungsvermögen: «Einen Lungenflügel kann man operativ entfernen, aber beide – das geht nun mal nicht.» Ein halbes Jahr danach starb sie.
Die Monate vor Dragas Tod behielt Lu als einzigen Albtraum in Erinnerung, weil das familiäre Leben im buchstäblichen Sinne gespenstisch wurde. Durch die nicht mehr geputzten Fenster und die ungewaschenen grauen, vom Nikotin gefärbten Stores drang kaum noch Licht, und ihre Eltern schlichen von morgens bis abends untätig durch die Wohnung. Weder Herbert noch Draga hörten mit dem Rauchen auf. Im Falle von Draga war das verständlich, sie wusste, dass ihr Schicksal sowieso besiegelt war. Aber auch Herbert schaffte es nicht aufzuhören, obwohl die Zigaretten seine Frau ins Grab bringen würden. Weil sie nichts mehr tun konnten, rauchten sie vielleicht sogar noch mehr. Das durchscheinende Gewebe des Zigarettenrauchs durchzog alle Zimmer.
Mit ihren dreizehn Jahren begriff Lu noch nicht in allen Konsequenzen, was geschah und noch geschehen würde. Sie konnte sich den seelischen Schmerz, der mit dem Tod ihrer Mutter auf sie zukam, nicht vorstellen, und weder Herbert noch Draga waren in der Lage, mit ihr darüber zu sprechen und sie auf das Kommende vorzubereiten. Die beiden saßen den ganzen Tag über beinahe wortlos da, husteten und rauchten und warteten auf irgendetwas oder starrten auf den Fernseher, der lief, ohne dass sie sich für seine Botschaften wirklich interessierten. Die zahllosen Medikamente, die im Vorabendprogramm beworben wurden, würden Draga nicht helfen. Die ständige Wiederholung jenes unnatürlich schnell gesprochenen, verpflichtenden Hinweises zu Risiken und Nebenwirkungen klang wie bitterer Hohn.
Nachts konnten Draga und Herbert nicht schlafen, und ihre Unruhe übertrug sich auf Lu. Einmal kamen sie, während Lu sowieso wach lag, zu ihr, um sie zu wecken, weil sie ein bestimmtes Geräusch, das sie seit Stunden ununterbrochen zu hören meinten, nicht mehr ertrugen und sich von Lu irgendeine Hilfe erhofften. Sie gingen mit ihr ins Schlafzimmer und forderten sie auf, die Luft anzuhalten, um besser hören zu können.
«Bässe», behauptete Herbert mit glasigen Augen. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. «Die kommen von unten. Da unten wummert es in irgendeinem Rhythmus. Das müssen Bässe sein.»
Draga sah aus, als wäre sie schon tot. Sie hatte seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen, da die «Bässe» sie mit ihrer unerträglichen Gleichmäßigkeit wach hielten. Lu konnte nichts hören, konzentrierte sich aber darauf, irgendetwas zu vernehmen. War da etwas? War da nichts? Sie wusste es nicht, und das machte ihr Angst. Vielleicht bedeutete es ja, dass ihre Eltern verrückt wurden und Dinge wahrnahmen, die es nicht gab.
Auf demselben Stockwerk nebenan wohnte Hans Krol, ein hagerer junger Mann mit fettigen Haaren, der von sich behauptete, Musiker zu sein, und sich im Treppenhaus, wenn man ihn dort überhaupt zu sehen bekam, immer nur mit gesenktem Blick an einem vorbeidrückte. In seiner Wohnung herrschte – soweit sich das bei einem flüchtigen Blick durch die geöffnete Tür beurteilen ließ – ein sagenhaftes Durcheinander aus Regalen und Ablagen, auf denen sich Bücher und Futternäpfe stapelten. Er hauste mit fünf Katzen in zweieinhalb Zimmern. Alles war von schwachen Glühbirnen nur fahl beleuchtet, offenbar fiel niemals natürliches Licht in seine Wohnung.
Zwei Dinge bewogen Lu, in jener Nacht zu Hans Krol zu gehen: Erstens, dachte sie, würde er sich als Musiker mit Bässen vielleicht auskennen, und zweitens glaubte sie, dass man bei einem Musiker mitten in der Nacht klingeln durfte. Und sie hatte mit beidem recht: Hans öffnete recht schnell, war noch angezogen und erklärte sich bereit, herüberzukommen und dem Problem mit seinem geschulten Ohr auf den Grund zu gehen, zumal es nicht seine Bässe waren, wie er der hinter Lu stehenden Draga sogleich versicherte.
«Das macht einen absolut verrückt», sagte Herbert, der mit seinen Nerven am Ende war.
Im Schlafzimmer breitete Hans Krol die Arme aus wie ein Dirigent, der sein Orchester auf den kommenden Einsatz vorbereitet. Dann ließ er die Hände auf Brusthöhe schweben und spreizte seine Finger, als wären es kleine Antennen.
«Man nimmt tiefe Frequenzen nicht mit den Ohren wahr, sondern mit dem ganzen Körper, mit der Haut, mit dem Zwerchfell», erklärte er und schloss langsam die Augen. Vielleicht gefiel ihm die Rolle des Experten sogar.
Alle hielten in diesem Moment den Atem an. Lus Vater stierte wie irre ins Leere. Durch die Vorhänge fiel ein violetter Lichtschimmer, und in diesem Moment sahen sie alle aus wie Gespenster. Lu hatte Angst. Es war eine Beschwörungsszene, und sie fürchtete, irgendetwas könnte von ihr Besitz ergreifen. Die ausgestreckten Hände des Musikers begannen leicht zu zittern.
Schließlich nickte Hans: Da war etwas. Er hatte eine Art an- und abschwellendes Rauschen registriert. Keinen Ton, sondern ein unmerkliches, niederfrequentes und durchaus bassartiges Beben des Bodens. Etwas Künstliches jedenfalls, das von unten kam. Aber das Phänomen, was auch immer dahinterstecken mochte, war seiner Meinung nach nicht musikalischen Ursprungs.
«Es gibt eintönige Musik», erklärte Hans, «aber nicht so eintönig.»
Von dem Mieter, der ein Stockwerk tiefer wohnte, hieß es im Haus, er sei vermutlich Student oder Stricher oder beides, auf jeden Fall war nicht klar, wovon er eigentlich lebte – ob überhaupt von irgendeiner Tätigkeit. Offenbar hatte ihn niemand je zu üblichen Zeiten das Haus verlassen oder betreten sehen. Als Mieter fiel er in die Kategorie jener unsichtbaren Mitbewohner, die es in einem Haus wie diesem immer gab.
«Das Geräusch kommt von unten», wiederholte Hans Krol.
Draga zündete sich eine Zigarette an. Ihre Gesichtshaut, die einmal kupferfarben gewesen war, schimmerte bleich in der Dunkelheit.
«Würden Sie runtergehen und fragen?», flüsterte sie. «Würden Sie das für uns tun?»
Hans hatte Angst vor Konflikten, aber er war von zahlreichen spirituellen Ideen durchdrungen und in seinen Ambitionen als Musiker – er verehrte die Choräle, Oratorien und Passionen von Johann Sebastian Bach – auch von christlichen. Und so fühlte er sich aufgerufen, Draga in ihrem Leiden beizustehen. Er verließ die Wohnung – allerdings mit einem mulmigen Gefühl im Bauch. Lu folgte ihm ins Treppenhaus, in dem eine Glühbirne hätte ausgetauscht werden müssen, weswegen der Treppenabsatz ein Stockwerk tiefer im Halbdunkel dalag.
Der geheimnisvolle Mieter hieß Victor Belkow – das stand jedenfalls auf dem provisorischen Klebezettelchen über der Klingel. Später war er für Lu immer nur Vic. Er öffnete die Tür, gehüllt in einen schneeweißen, flauschigen Bademantel. Seine Füße steckten in Stofflatschen, und seine Haare, die er schulterlang trug, wirkten zerzaust, als hätte man ihn aus dem Schlaf geklingelt. Er betrachtete den nächtlichen Besuch irritiert, aber als er Lu sah, die schräg hinter Hans stand, ließ er die beiden herein.
Victor war Mitte zwanzig. Seine Wohnung war kaum eingerichtet und daher in Lus Augen überraschend weitläufig und offen, sodass sie ihr beinahe wie ein Palast vorkam, was umso verwunderlicher war, als die einzelnen Räume hier und die dunkle, dicht möblierte Strukturtapeten- und Plüschsofawelt ihrer Eltern ein Stockwerk darüber ja ein- und denselben Grundriss hatten.
Aber die hellen, unverstellten Wände in Victor Belkows Version dieser Wohnung erzeugten die Illusion, die Anzahl der Zimmer und ihre Grundfläche hätten sich verdoppelt, wenn nicht verdreifacht. Und so etwas wie die glänzende Fototapete von einer schnurgeraden, durch die immense Weite einer Wüste verlaufenden Straße, an deren Ende die roten Felsen des Monument Valley unter einem scheinbar endlosen Himmel aufragten, hatte Lu noch nie gesehen.
Im Schlafzimmer gab es lediglich ein offenes Regal mit nicht besonders vielen hineingestopften Kleidungsstücken und einen aus hellem Holz gezimmerten Sockel für die Matratze. Victor hatte wohl noch nicht geschlafen, neben einer zur Hälfte ausgetrunkenen Flasche Bier am Kopfende lagen drei oder vier Bücher, eins davon aufgeschlagen. Über dem Bett drehte sich am Ende einer Haltestange aus Messing ein großer Ventilator mit Bambusflügeln. Es war die Jahreszeit der heißen Nächte, die, erst recht in den Straßen einer Großstadt, kaum Abkühlung brachten, und der Ventilator ließ einen angenehmen Luftzug durchs Schlafzimmer wehen.
Hans Krol betrachtete ihn ein paar Umdrehungen lang und erkannte die Zusammenhänge sofort: Das Haus – es war zur Gründerzeit vor rund achtzig Jahren erbaut worden – hatte Holzbalkendecken.
Hans wies mit dem ausgestreckten Finger nach oben und sagte: «Sehen Sie!, offenbar hat man den Ventilator nicht fachgerecht montiert. Er pendelt leicht, und Holzbalkendecken sind ein idealer Resonanzraum für niederfrequente Schwingungen. Früher hat man sich das in Konzertsälen zunutze gemacht, um die Akustik zu verbessern. Ohne eine Dämpfung in der Aufhängung zupft der Ventilator sozusagen bei jeder Umdrehung an der Membran einer riesigen Pauke.»
Aus seiner Sicht war die Ursache des eintönigen Wummerns, das Lus Eltern so sehr quälte, damit zweifelsfrei identifiziert. Er bat Victor darum, zum Beweis für seine Theorie den Ventilator abzustellen. Danach verließ er die Wohnung, um ein Stockwerk darüber in Herberts und Dragas Schlafzimmer zu überprüfen, ob nun Stille herrschte.
Lu blieb in Victors Wohnung zurück. Der Anblick der weiten, luftigen Räume lähmte sie. Vielleicht hätte sie sich Hans angeschlossen, wenn sie von ihm dazu aufgefordert worden wäre, aber über die Analyse des akustischen Phänomens hatte er sie vergessen. Und auch Victor nahm im Moment keine Notiz von ihr. Er schlüpfte aus seinen Latschen und stieg auf seinen Bettsockel und dann auf die Matratze, um den Ventilator abzustellen. Dazu musste er sich dem Zugkettchen des Elektromotors entgegenstrecken, und um auf der Matratze einigermaßen sicher stehen zu können, spreizte er die Beine. Dabei konnte Lu für einen Moment seinen Penis sehen.
Lu hatte noch nie den Penis eines erwachsenen Mannes gesehen. Ihr Vater hatte es ab einem bestimmten Zeitpunkt, der vor ihren ersten bewussten Erinnerungen lag, stets vermieden, ihr nackt gegenüberzutreten. Als Lu Victor Belkows Penis sah, überlegte sie, ob sie die Augen nicht besser schließen sollte. Sie ließ sie offen.
Nachdem Victor den Ventilator abgestellt hatte, stieg er von der Matratze. Er nahm an, dass Lu ihn nur deshalb so sonderbar anstarrte, weil sie unsicher war, sich auf einmal allein mit einem Mann in einem Zimmer zu befinden, den sie nicht kannte und der ungefähr zehn Jahre älter war als sie.
«Ich bin Vic», sagte er freundlich. «Und du?»
«L-lu», sagte sie.
Er streckte ihr die Hand entgegen. «Freut mich, Lu.»
«Ich muss wieder hoch zu meinen Eltern», sagte sie.
«Tut mir leid das mit dem Ventilator.»
«Ich hab ihn gar nicht gehört.»
«Sag deinen Eltern, ich kümmere mich um die Aufhängung.»
«Mach ich.»
Sie blieben einen Moment voreinander stehen, als gäbe es noch irgendetwas hinzuzufügen, aber Lu fiel nichts ein. Sie konnte Victor Belkow ja nicht einfach sagen, was sie gesehen hatte. Aber das war es, was ihre Gedanken ganz und gar beanspruchte.
«Also dann», sagte Victor Belkow und lächelte sie noch einmal kurz an. «War schön, dich kennenzulernen, Lu. Wenn du mal reden willst oder so, kannst du jederzeit klingeln.»
In dieser Nacht, einer der letzten, die Draga in ihrem eigenen Bett verbringen und in der sie nach dem Abstellen des Ventilators schließlich auch einschlafen sollte, lag Lu noch lange wach und versuchte, ihre Gefühle zu entwirren und herauszufinden, welches bei dem flüchtigen Blick auf Victor Belkows Penis überwogen hatte: eine Form von Scham, als hätte sie selbst die Situation herbeigeführt und damit etwas Unzulässiges getan, oder eine gewisse Verwunderung über die Unbekümmertheit, mit der er sich ihr, wenn auch sicher unbeabsichtigt, zur Schau gestellt hatte, oder doch eher Neugier bei diesem Anblick, der für sie neu war, oder – und das war die verwirrendste Variante – eine innere, ganz körperliche Erregung, die über bloße Neugier hinausging?
Draga starb an einem lichtarmen Herbstmorgen. In ihren letzten Wochen lag sie in demselben Krankenhaus, in dem Niki Jahre später, kurz nach dem Mauerfall, beginnen sollte, als Ärztin zu arbeiten. Herbert und Lu saßen bis zu Dragas letztem schweren, rasselnden Atemzug an ihrem Bett. Danach wurde es still im Zimmer, in dem man, wohl weil man wusste, dass es mit Draga zu Ende ging, für ein paar Tage keine anderen Patienten untergebracht hatte.
Schließlich stand Herbert auf und sagte dem Pflegepersonal, dass es geschehen war. Kurz darauf wurde das Bett mit Dragas Leichnam aus dem Zimmer geschoben. Lu und Herbert blieben noch eine Weile darin zurück, ohne etwas zu sagen. Lu weinte, und Herbert stand wie gelähmt da. Schließlich fuhren sie mit dem Bus nach Hause, sich wortlos mitbewegend im Getriebe der Großstadt, in dem solche Ereignisse nicht mehr sind als Tropfen in einem Meer der Geschichten – etwas Gleiches, das im Gleichen unsichtbar verschwindet.
Als Hans Krol von Dragas Tod erfuhr, ergriff er sofort einen Stapel Noten, mit dem er zum Krematorium am Nettelbeckplatz ging, um dort jene Musikstücke vorzubereiten, mit denen er Draga seine letzte Ehre erweisen wollte. Er wurde aber wieder nach Hause geschickt, weil es im Trauersaal keine Orgel gab, weder eine echte, womit Hans auch nicht gerechnet hatte, aber auch keine elektronische, mit der er sich in diesem Fall abgefunden hätte. Die Musik kam dort ausschließlich vom Band, eine gedämpfte Endlosfolge von Quinten und kleinen Terzen, die mit gelegentlichen Septimendurchgängen quälend langsam und eintönig über den PVC-Fußboden und durch die Stuhlreihen im Trauersaal kroch.
Herbert engagierte einen Beerdigungsredner aus dem Branchenverzeichnis, der sich dort als Experte für einen persönlichen und würdevollen Abschied angepriesen hatte. In der Annahme, dass jugoslawische Namen irgendwie anders ausgesprochen werden müssten, als man sie schrieb, sprach er das g in Draga immer wie eine Art s-c-h aus, etwa so wie in Dragee, wenn er der Verstorbenen, deren Überreste sich in einer mattschwarzen Urne auf einem Marmorpodest befanden, seine pathetischen Stereotypen hinterherrief. «Drascha, wir werden dich vermissen! Drascha, dein Licht wird in dieser Welt fehlen!»
Die Trauernden waren nicht besonders zahlreich. Neben zwei Kassiererinnenkollegen aus dem Supermarkt und Hans Krol, dessen Haare ungekämmt im Licht der elektrischen Wandkerzen schimmerten, war auch Victor Belkow gekommen, den Lu nach der Geschichte mit dem Ventilator – er hatte die Aufhängung gleich am nächsten Tag repariert – manchmal im Treppenhaus wiedergesehen hatte. Er lächelte immer sehr freundlich, aber sie huschte jedes Mal schnell an ihm vorbei, möglichst ohne ihn anzusehen.
Als der kurze Trauerzug mit der Urne zur Grabstelle aufbrach, begann es zu regnen. Der Grabschacht hatte die Dimension einer Sickergrube, und als die Urne hinabgesenkt wurde, stand der Trauerredner, der auch mit einer musikalischen Begleitung der Trauerfeier geworben hatte, daneben und sang Imagine.
Lu bekam kaum Luft, als die Urne verschwand. Vielleicht begriff sie in diesem Moment zum ersten Mal, dass es keine Möglichkeit gab, die riesige Maschinerie des Lebens anzuhalten oder in eine weniger unerbittliche Richtung zu lenken. Sie begann zu weinen, und ihr Vater legte schweigend seine Hand auf ihre Schulter. Sie wischte sich über die Wangen und warf eine Blume ins Grab.
3
Susan und Mick
In den kurzen Nächten ihres ersten Winters in Berlin dachte Niki oft an Susanne und Michael, ihre Eltern, die in Mexiko lebten und sich schwer damit taten, dass Niki nach Deutschland, und sogar ausgerechnet nach Berlin gegangen war, um dort als Ärztin zu arbeiten.
«Wohin denn sonst?», sagte Niki immer wieder zu Susanne, wenn sie miteinander telefonierten – kostspielige Ferngespräche, die fast immer bei Niki abgebucht wurden, weil sie die Anrufende war –, und verwies dabei auf die Bilder von den auf der Berliner Mauer feiernden Menschen, Bilder, die auch in Mexiko gezeigt worden waren.
Aber Susanne und Michael misstrauten Deutschland und erst recht der sich anbahnenden Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Schließlich hatten sie Deutschland nicht von ungefähr vor etwa dreißig Jahren verlassen. Wären Susanne und Michael in Deutschland geblieben, wäre Niki vielleicht in Ilshofen oder auch München zur Welt gekommen. So aber kam sie irgendwo zwischen Kabul und Kathmandu auf dem später sogenannten Hippietrail zur Welt.
Das war im Herbst 1964, genauer gesagt Mitte September – und damit zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, was bedeutete, wie Susanne hin und wieder mit einem gewissen Erstaunen feststellte, dass Niki als Jungfrau geboren wurde und nicht als Waage, wie es bei einer regulären Schwangerschaftsdauer der Fall gewesen wäre. Susanne, die im Sternzeichen der Waage eine gute Voraussetzung dafür sah, im Leben zu einer harmonischen Balance zwischen dem Ich mit seinen oftmals engherzigen Interessen und dem Großen und Ganzen der kosmischen Kräfte zu finden, sollte sich über Nikis vorzeitige Geburt immer wundern. Wieso bevorzugte ihre Tochter ein Sternzeichen, dem ein – wie sie es in späteren Jahren ausdrücken würde – repressiver, patriarchalischer Genderkodex zugrunde lag?
Susanne stammte aus Ilshofen, das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs von amerikanischen Truppen bombardiert und zu zwei Dritteln zerstört worden war. Eine ihrer frühesten Erinnerungen war die an eine Fliegerbombe, die das Hausdach durchschlug, ein Loch in die Decke des Wohnzimmers riss, die gewachsten Bodendielen zertrümmerte und zwischen den hölzernen Trägerbalken der Kellerdecke stecken blieb, ohne zu explodieren. Die Familie, die im Keller Schutz gesucht hatte, hätte die Detonation der Bombe direkt über ihren Köpfen nicht überlebt. Susanne verdankte ihr Leben also der Tatsache, dass es sich bei jener Bombe um einen Blindgänger gehandelt hatte, worin sie später ein Zeichen sehen sollte. Eine höhere Macht hatte gewollt, dass sie überlebte. Sie musste nur noch herausfinden, wozu.
Es hatte in Susannes Familie schon immer eine gewisse Neigung zu metaphysischen Erklärungen gegeben, wenn auch sehr unterschiedlicher Natur. Nikis Urgroßvater, ein überzeugter Nazi, glaubte in der Tatsache, dass es sich bei jener Bombe um einen Blindgänger gehandelt hatte, ein Zeichen der Hoffnung zu erkennen, einen schicksalhaften Vor- und Sendboten des kommenden Endsiegs Hitlerdeutschlands gegen die bolschewistische Weltverschwörung, womit er sich sogar in den Augen seiner Frau lächerlich machte. Nur ein paar Tage nach dem Blindgängereinschlag marschierten amerikanische Truppen in Ilshofen ein, womit für den Ort der Zweite Weltkrieg beendet war.
Abgesehen von jener Fliegerbombe und der Zerstörung der Innenstadt Ilshofens hatten der Krieg und sein Ende keinen großen Einfluss auf Susannes Leben. Sie war zu jung, um zu begreifen, was geschehen war. Ein Jahr nach der Kapitulation, im Sommer 1946, wurde sie eingeschult, wie es auch ohne den Krieg der Fall gewesen wäre. Ihre Grundschullehrerin, ein Fräulein Kaiser – sie war Mitte fünfzig und ging aus Gründen, die niemandem bekannt waren, am Stock, wodurch sie aber eigenartigerweise eine besondere Autorität genoss –, überredete Susannes Eltern, ihre Tochter ein Gymnasium besuchen zu lassen. Das war für ein Mädchen in einer ländlich geprägten Region keineswegs selbstverständlich, um nicht zu sagen eigentlich undenkbar. Susanne würde nie den Slogan vergessen, mit dem eine Ausbildungsversicherung für den Sohn und eine Aussteuerversicherung für die Tochter beworben wurde: «Aus Söhnen werden Leute, und aus Mädchen werden Bräute».
Als Susanne mit dreizehn Jahren ihre erste Regelblutung bekam, wusste sie nicht, wie mit ihr geschah, weil niemand es für nötig befunden oder gewagt hatte, sie aufzuklären. Sie rief ihre Mutter verängstigt auf die Toilette, woraufhin diese ihr wortlos eine Binde in die Hand drückte. Susanne musste weinen und wollte die Toilette nicht mehr verlassen, weil sie das Gefühl hatte, mit der dicken Binde zwischen den Beinen nicht einen einzigen Schritt machen zu können.
Mit fünfzehn übersprang sie auf Anraten der Schuldirektorin eine Klasse und schrieb sich nach dem Abitur als beste ihres Jahrgangs zum Wintersemester 1958 gegen den Willen ihrer Eltern, die sie letztlich aber ziehen ließen, auch wenn ihr Vater darin den endgültigen Beweis sah, dass das Gymnasium ein Fehler gewesen war, an der Universität in Frankfurt für Philosophie ein. Sie las Eros und Kultur von Herbert Marcuse, der die Grundlage für das Funktionieren der modernen Leistungsgesellschaft in der Unterdrückung der erotischen Bedürfnisse des Einzelnen sah und in einer noch zu erschaffenden, humaneren Gesellschaft eine Resexualisierung des Menschen für möglich hielt. Susanne entdeckte Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir, sie las Freud, Sartre und Camus, und ihr suchendes Wesen sog die Botschaften dieser Werke und der aufkommenden Sexualtheorien jener Jahre auf wie ein trockener Schwamm. Es stimmte alles! Es kam ihr so vor, als wäre ihr Leben der beste Beweis dafür, dass eine sittenstrenge Erziehung zwangsläufig zu seelischen Deformationen führen musste.
Ihr Sexualverhalten, das wurde ihr in ihrem Frankfurter Semester bewusst, war in sich erschreckend widersprüchlich: Einerseits wehrte sie die Eroberungsversuche junger Männer – sie gefiel mit ihren schulterlangen, mittelblonden Haaren und dem herzförmigen Gesicht vielen – stets ab, weil sie deren Gehabe meist als zudringlich empfand, als selbstgefällige Annäherungen ohne das geringste Einfühlungsvermögen in die Wünsche einer jungen Frau. Andererseits sehnte sie sich danach, sich zu verlieben und ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, die ihr inzwischen ein nutzloses Ideal zu sein schien. Daran, ihre Unberührtheit als kostbare Beigabe für eine zukünftige Ehe bewahren zu müssen, glaubte sie nicht mehr. Doch weder das eine noch das andere geschah. Weder verliebte sie sich ernsthaft noch wagte sie es, sich ohne Umschweife von irgendeinem ihrer Verehrer entjungfern zu lassen.
Sie empfand sich als sexuell und eigentlich in jeder Hinsicht unfrei, und die Schuld daran gab sie ihrer Mutter. Als sie nach dem ersten Semester aus Frankfurt zurück nach Ilshofen kam, sprach sie sich mit ihr eine Nacht lang aus. Sie saßen in der Küche an dem mit einem blass gemusterten Wachstuch bedeckten Tisch, draußen schneite es. Susanne rauchte und erklärte ihrer Mutter, was Übertragung war – oder was sie sich nach ihren Studien selbst dazu überlegt hatte: dass die Defizite, Unfreiheiten und Lügen der Eltern von ihren Kindern wiederholt und in eigene Verhaltensmuster transformiert wurden. Dass es einen psychologischen Teufelskreis aus Schuld, Verdrängung und Depression gab, der sich von Generation zu Generation fortpflanzte. Und dass sie, ihre Mutter, die aus der Verleugnung ihrer Bedürfnisse als Frau resultierende Frustration an sie, ihre Tochter, weitergegeben habe. «Ich sage dir, wie die Dinge sind», sagte Susanne und blies Rauch aus: «Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht!»
Beide weinten sehr viel bei dieser Aussprache. Susannes Mutter war der Redegewandtheit ihrer Tochter nicht gewachsen und schon gar nicht einem Simone de Beauvoir-Zitat. Sie hatte überhaupt keine Übung darin, über sich selbst zu reden. Doch da sie nur selten Alkohol trank, sprach sie irgendwann über tief in ihr verschlossene Dinge, und das vielleicht nicht nur, weil der Alkohol ihr die Zunge löste, sondern weil sie wenigstens einmal im Leben mit irgendjemandem darüber reden musste. Sie gestand Susanne, beim Geschlechtsverkehr niemals etwas empfunden zu haben. Die traurige Wahrheit, die sie an diesem Abend zum ersten Mal in Worte fasste, war: Sie hatte die Empfängnis ihrer Tochter nur über sich ergehen lassen.
Und so ehrlich das auch war, es war das Schlimmste, was sie Susanne jemals hätte sagen können. Das Wissen, das Produkt eines mechanischen Aktes ohne jede emotionale Beteiligung zu sein – seitens ihrer Mutter, wie es bei ihrem Vater gewesen war, wusste sie nicht, aber sie machte sich in dem Punkt keine Illusionen –, verdichtete sich schnell zu einer schwärenden Wunde in Susannes Bewusstsein. Es war so, als hätte man ihr mitgeteilt, sie habe keine Seele eingehaucht bekommen, und ein freieres Leben zu führen als ihre Mutter erschien ihr notwendiger denn je. Sie schwor sich, die Lustferne ihrer Empfängnis gleichsam rückgängig zu machen. Ihr Leben sollte beweisen, dass Lust – weibliche Lust – möglich war.
Das Gespräch mit ihrer Mutter hatte sie eigentlich nur begonnen, um ihr mitzuteilen, dass sie beschlossen hatte, das Studium in Frankfurt abzubrechen und nach Paris zu gehen, um sich dort den Existenzialisten anzuschließen. Mehr noch als Freud und Marcuse hatten sie Sartre und Camus beeindruckt. Deren Gedanken kamen ihr konkreter vor als die Philosophie in Frankfurt – sie waren zwar düster, aber doch auch irgendwie lebenshungrig. Susanne war elektrisiert von dem, was sie über das Viertel St. Germain des Prés gehört und gelesen hatte. Sie wollte, schwarz gekleidet wie Juliette Gréco, im Café Les Deux Magots Pastis trinken, bei den legendären, für ihre undurchdringlich verqualmte Luft, die laute Jazzmusik und die intellektuellen Gäste berühmten Partys im Kellergewölbe des Tabou dabei sein und sich endlich der Liebe und der Melancholie hingeben. Allerdings war St. Germain des Prés, wie sie feststellen musste, als sie im Frühjahr 1959 nach Paris zog, bereits zu einem Modeort und Anziehungspunkt für Touristen geworden. Die großen literarischen und philosophischen Intellektuellen traf man dort nicht mehr, doch gab es die Cafés noch und auch eine gewisse Magie des Ortes.
Susanne färbte sich die Haare schwarz, zog in eine winzige Mansarde im 6. Arrondissement und arbeitete als Kellnerin in einem Bistro. Irgendwann lernte sie dort Pierre Hausman kennen, einen jungen Filmkritiker und Freund François Truffauts, der gelegentlich für die Cahiers du Cinéma schrieb – so etwas wie das Sprachrohr einer jungen Generation von Filmschaffenden, die für das Kino eine neue, wirklichkeitsnahe Ästhetik forderten. Neben François Truffaut gehörten Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette und Jean-Luc Godard zur Redaktion der Cahiers – nahezu alle namhaften Regisseure der Nouvelle Vague. Pierre Hausman konnte stundenlang über das konventionelle Kino schimpfen, und Susanne lernte dabei ausgezeichnet Französisch. Schließlich überredete er sie, sich als Schauspielerin zu versuchen, weil er der Meinung war, dass sie Talent besaß.
Pierre sollte zum ersten Mann in Susannes Leben werden. Im Gegensatz zu den Studenten in Deutschland empfand sie ihn als sehr gewandt im Umgang mit Frauen. Er hielt ihr konsequent die Tür auf, machte ihr viele kleine, hübsche Komplimente und oft ließ er sie sogar ausreden, selbst wenn sie etwas gesagt hatte, das er im Nachhinein spielend widerlegte. Sie verstand noch nichts vom Kino, und er erwies sich als ihr geduldiger Lehrer. Und das wollte er auch im Bett sein, und sie ließ es zu. Doch obwohl es auf eine bestimmte Weise aufregend und das war, wonach sie sich gesehnt hatte, blieb bei ihr hinterher oft ein unterschwelliges Gefühl der Enttäuschung zurück, dass sie sich nicht recht zu erklären wusste. Und irgendwann hatte sie einen Gedanken, den sie, weil er ihr eigentlich altmodisch vorkam, nur widerstrebend dachte: Möglicherweise liebte sie Pierre Hausman nicht.
Eigentlich war Pierre Theoretiker, aber es gab ein paar Faktoren, die es begünstigten, dass ihm seine abstrakten filmästhetischen Ideen Kontakte zu vielen wichtigen, jungen Regisseuren verschafften. Der französische Film befand sich mit seinen Konzepten aus den Vierzigerjahren, die hauptsächlich üppig bebilderte Literaturverfilmungen hervorgebracht hatten, in einer tiefen Krise. Die aufwendigen, aber alltagsfernen Studioproduktionen erreichten das nach Leben und Freiheit gierende Nachkriegspublikum nicht mehr. Daher fanden sich einige Produzenten bereit, neue Ideen zu unterstützen und zu finanzieren, wenn sie nur einigermaßen billig waren. Und außerdem waren viele idealistische Jungfilmer bereit, geerbtes oder geliehenes Geld für ihr erstes revolutionäres Projekt auf den Kopf zu hauen. Den meisten ihrer Filme sah man an, dass sie unter eingeschränkten finanziellen Bedingungen entstanden waren. Viele von ihnen wurden mit mobiler Handkamera in Lokalen und Straßen gedreht, und ein paar davon, wie Außer Atem von Jean-Luc Godard oder Hiroshima mon amour von Alain Resnais, wurden zu Erfolgen.
Susanne lernte Alain Resnais über Pierre Hausman bei einem Muschelessen im La Coupole kennen. Er war von ihrer Juliette-Gréco-artigen Schönheit auf der Stelle hingerissen und suchte gerade Statisten und Kleindarsteller für seinen Film Letztes Jahr in Marienbad, den er zusammen mit dem Avantgarde-Schriftsteller Alain Robbe-Grillet konzipiert hatte.
Auf dem Feld des Romans, so erklärte Alain Resnais Susanne an jenem Abend im La Coupole, lehne Robbe-Grillet alle traditionellen Erzählstrukturen ab und propagiere mit dem Nouveau Roman eine Ästhetik der permanenten Gegenwart und des unmittelbaren Erlebens – ein ästhetisches Konzept, das er auch zur Grundlage seines Drehbuchs machen wolle. Daher sei es schwierig, den Inhalt von Letztes Jahr in Marienbad in nachvollziehbarer Weise zusammenzufassen. Vieles in der Handlung bleibe bewusst vage, so Resnais, eine Geschichte im herkömmlichen Sinne gebe es nicht.
Man konnte Letztes Jahr in Marienbad als Dreiecksgeschichte deuten. In einem pompösen, schlossartigen Kurhotel versucht ein Mann eine Frau, gespielt von Delphine Seyrig, deren strenge, undurchschaubare Schönheit dem Film ein unverwechselbares Gesicht geben sollte, davon zu überzeugen, dass sie sich ein Jahr zuvor schon einmal begegnet seien. Es bleibt bis zum Schluss offen, aber als Zuschauer darf man annehmen, dass es sich bei dieser Begegnung, falls sie denn stattgefunden hat, um eine Liebesbeziehung gehandelt haben könnte. Doch jene von Delphine Seyrig gespielte Frau kann sich nicht mehr daran erinnern, und sie hat sehr häufig Sätze zu sagen wie: «Aber nein, lassen Sie mich!» oder «Aber nein, bedrängen Sie mich nicht!» Außerdem ist sie – doch auch das nur andeutungsweise, natürlich könnte alles auch ganz anders sein – mit einem anderen Mann, vielleicht ihrem Ehemann, vielleicht einem weiteren Liebhaber, in Marienbad. Unterlegt von unheimlicher Orgelmusik irrt sie verloren und verängstigt durch die mal gähnend leeren, mal bevölkerten Hotelkorridore oder durch den perfekt gepflegten Schlosspark. Sie scheint selbst nicht zu wissen, wer sie ist – und das war der inhaltliche Anker, der Susanne für das Drehbuch begeisterte. Bei jenem Muschelessen im La Coupole überzeugte Alain Resnais sie davon, dass in dem Film genau das thematisiert wurde, was ihr so sehr am Herzen lag: die erotische Verunsicherung und Unterdrückung der Frau.
Da es in dem Film aber nur drei Hauptrollen und keine erwähnenswerten Nebenrollen gab und die namenlos bleibende Frau mit Delphine Seyrig, der die Rolle zum Durchbruch verhelfen sollte, bereits besetzt war, konnte Alain Resnais, obwohl er nach eigener Aussage von Susannes Talent «zutiefst überzeugt» war, ihr nicht mehr als eine Statistenrolle anbieten. Im fertigen Film sieht man sie als Kurgast einmal sehr klein am Rande des Bildes und ein paarmal unscharf als Teil einer Abendgesellschaft im Bildhintergrund.
Letztes Jahr in Marienbad wurde größtenteils in deutschen Schlössern und Parks gedreht, unter anderem im Schloss Nymphenburg in München, und dort lernte Susanne bei den Dreharbeiten Michael Lamont kennen, der ebenfalls als Kurgast-Kleindarsteller engagiert war. Er trug für die Aufnahmen einen Smoking und sah darin großartig aus. Irgendwann, nachdem er Susanne eine Weile aus der Distanz betrachtet hatte, kam er auf sie zu und begrüßte sie mit den Worten: «Sind wir uns hier nicht schon einmal letztes Jahr begegnet?» Das war der erste spontane Annäherungsversuch, der hinreichend charmant und geistreich war, um bei Susanne Gehör zu finden.
Michael hatte französische Wurzeln, über die er selbst nicht so genau Bescheid wusste. Sein Vater war Deutscher gewesen, hatte mit ihm aber immer Französisch gesprochen. Doch bevor Michael ihn über den Grund dafür befragen konnte, kam sein Vater als Soldat im Zweiten Weltkrieg um. Michael kam nach dem Krieg nie auf die Idee, seine Mutter nach den Familienzusammenhängen zu fragen.
Susanne war überzeugt, dass Michael der französischen Herkunft nicht nur seinen Nachnamen, sondern auch seinen Charme verdankte. Er studierte in München Chemie, war damit aber unzufrieden und wollte etwas anderes ausprobieren, etwas Kreatives – so war er zu der Marienbad-Statistenrolle gekommen, ohne allerdings ernsthaft mit dem Gedanken zu spielen, Schauspieler zu werden. Es war das Kino selbst, das ihn reizte, das Medium des filmischen Erzählens. Er wollte ein Ausdrucksmittel für die Albträume finden, die ihn so häufig quälten: das unaufhaltsame Gleiten in einen Abgrund, das Tauchen in einem Gewässer mit undurchdringlicher, versiegelter Oberfläche, oder die unsichtbare Anwesenheit bei der eigenen Beerdigung.
Nach dem Ende der Marienbad