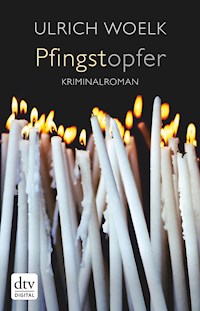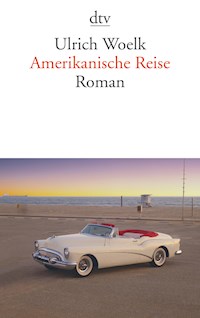9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Menschen, zwei Lebensentwürfe – eine Generation Er glaubt, sie zu kennen, und dann weiß er es: Die Frau im Rückspiegel heißt Jule. Vincent erinnert sich wieder: Jule und er haben einmal eine intensive Nacht miteinander verbracht – doch das ist fünfundzwanzig Jahre her. Es war am Tag der großen Demonstrationen gegen den ersten Golfkrieg, und sie waren so unfassbar jung. Und nun sitzt Jule in seinem Berliner Taxi; sie ist gerade mit einer Maschine aus München gelandet, auf dem Weg zu einem Wirtschaftskongress. Es scheint ihr gut zu gehen. Doch wie geht es ihm? Und was ist mit der Liebe von damals? ›Nacht ohne Engel‹ ist die präzise Momentaufnahme zweier Lebensentwürfe, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier der berufl iche Erfolg, dort die individuelle Freiheit. Doch wie frei kann man sein? Wie viel Glück bedeutet Erfolg? Ulrich Woelk erzählt von jener Generation, die mit dem Mauerfall erwachsen wurde und mehr Freiheit hatte, ihr Leben zu gestalten, als jede andere zuvor. Und die doch das Gefühl nicht loslässt, nie angekommen zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ulrich Woelk
Nacht ohne Engel
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
EINS
EIGENTLICH WÜRDE VINCENT bei einer Fahrt vom südlichen Stadtrand in die Innenstadt mehr verdienen, aber er mag das alte Tegeler Terminal mit seiner Siebzigerjahre-Architektur und den Schleiern aus verwaschenem Grau auf dem Beton. Das Aufheulen der Triebwerke einer startenden Maschine dringt gedämpft ins Wageninnere, als er an den nummerierten Eingängen zu den Gates vorbeifährt. Ursprünglich sollte der Flugbetrieb hier schon eingestellt sein, aber die Fertigstellung des neuen Berliner Flughafens in Schönefeld zieht sich aufgrund von Problemen, von denen es immer wieder heißt, man habe sie im Griff, seit Jahren hin. Offenbar ist es doch nicht so leicht, das Alte so mir nichts, dir nichts durch etwas Neues zu ersetzen. Zugegebenermaßen, auch wenn ihn das manchmal nachdenklich stimmt, weil er befürchtet, es könnte mit seinem eigenen Alter zusammenhängen – er wird in ein paar Monaten fünfzig –, freut ihn das in diesem Fall.
Vincent lässt den Wagen am Taxistand an den Bordstein rollen und schaltet den Motor ab. Es ist acht Uhr morgens, seine übliche Zeit. Die Zahl der Reisenden, die aus dem Hauptgebäude kommen, schwankt im Rhythmus der landenden Maschinen. Als er einen Blick auf den nächstgelegenen Ausgang wirft, verlässt dort eine Frau das Gebäude. Ihre Augen brauchen ein paar Momente, um sich an die Helligkeit im Freien zu gewöhnen. In der kühlen und klaren Märzluft sind alle Farben sehr satt. Die Frau muss sich kurz orientieren, dann überquert sie die Straße und geht auf den Stand mit den wartenden Taxis zu. Dort verteilen sich die Ankommenden auf die Wagen, oder sie gehen weiter zu den privaten Parkplätzen im Zentrum des Terminals.
Mit den Jahren entwickelt man ein Gespür dafür, ob jemand ein Fahrgast ist oder nicht, und schließlich weiß Vincent, dass die Frau, die auf seinen Wagen zukommt, bei ihm einsteigen wird, da die Reihe nun an ihm ist. Er öffnet die Tür und steigt aus, um den Kofferraum zu öffnen. Die Sonne schwebt knapp über dem Beton des Hauptgebäudes. Ihre Strahlen hinterlassen auf der Haut, der Stirn und den Händen den Eindruck einer ersten leichten Wärme, eine Spur von Frühling.
Die Frau ist schlank und trägt eine sandfarbene, sehr gut geschnittene Wolljacke mit großem Kragen und großen marmorierten Knöpfen. Sie ist beruflich in Berlin, das weiß Vincent sofort. Sie zieht einen kleinen Trolley hinter sich her, und neben ihrer Handtasche hängt eine schmale schwarze Tasche im Format eines Netbooks von ihrer Schulter. Als sie ein paar Meter entfernt ist, nickt sie ihm zu.
Er erwidert den Gruß und nimmt ihren Koffer entgegen. Aus der Nähe sieht er noch einmal deutlich, dass sie stilsicher gekleidet ist – eine Geschäftsreisende. Ihr dunkelblauer, gerade geschnittener Rock reicht über die Knie bis zum Schaft ihrer Stiefel. Der Trolley ist leicht, Gepäck für eine Nacht, schätzt Vincent. Er hebt den Koffer in den Wagen und schließt die Heckklappe. Die Frau ist schon eingestiegen, hinten rechts, wie nahezu alle einzelnen Fahrgäste.
Vincent zieht die Wagentür zu und sieht in den Rückspiegel. Die Frau nennt ihm die Adresse, ein gehobenes Hotel in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße. Das ist eine passable Fahrt. Wie alle Taxifahrer hat Vincent es nach einer Stunde Wartezeit schon erlebt, dass Kunden nicht weiter als zwei oder drei Kilometer gefahren werden wollen. Eine Fahrt wegen zu geringer Länge abzulehnen widerspricht den Statuten der Taxiinnung, und auch wenn es manchmal ärgerlich ist, hat er sich bisher immer daran gehalten.
Er reiht sich in den Verkehr auf dem Innenring ein. Dabei fällt sein Blick im Rückspiegel noch einmal auf das Gesicht der Frau. Er betrachtet sie etwas länger als üblich. Sie ist in Gedanken, sie bekommt nicht mit, dass er sie ansieht. Er schätzt ihr Alter auf Mitte vierzig, ein wenig jünger als er, wenn auch unerheblich. Ihr Lippenstift ist dezent, fast die natürliche Lippenfarbe. Sie ist leicht geschminkt, sie bewegt sich nicht, und für einen Moment wirkt sie im Rückspiegel wie eine Werbefotografie für ein edles kosmetisches Produkt.
Sie sieht aus dem Seitenfenster. Die Dinge ziehen an ihr vorüber, ohne ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Vincent hat Erfahrung darin einzuschätzen, ob seine Fahrgäste in der Stimmung für eine Unterhaltung sind oder eher den Wunsch haben, in Ruhe gelassen zu werden. Die Frau in seinem Wagen ist mit ihren Gedanken bei dem, was vor ihr liegt, was auch immer das sein mag: eine Konferenz, ein Meeting, eine Präsentation. Ihre Augenbrauen sind etwas dunkler als ihre Haare, die, das nimmt er an, gefärbt oder zumindest getönt sind. Ihre Augenfarbe kann er von der Seite nicht erkennen, aber auf einmal denkt er, dass sie braun sind, ein mittleres Braun, das Braun von Laub – und dann wird ihm etwas bewusst: Er glaubt, diese Frau zu kennen.
Er weiß nicht, woher dieser Eindruck stammt. Tag für Tag sitzen Menschen in seinem Wagen, die er nicht kennt. Manche Fahrgäste sehen einem Freund oder Bekannten ähnlich, es gibt verblüffende Übereinstimmungen sowohl im Aussehen als auch im Verhalten bis hin zu einzelnen Gesten. Aber ebenso gibt es immer auch Unterschiede, Individuelles, das den Einzelnen von allen anderen unterscheidet.
Das Gefühl, einen Fahrgast zu kennen, ihm in irgendeinem Zusammenhang schon einmal begegnet zu sein, wie er es jetzt hat, ist neu und ungewohnt. Er weiß nicht, ob er diesem Eindruck, den er nicht recht einschätzen kann, nachgehen soll. Dazu müsste er die Frau genauer ansehen, sich zum Beispiel an einer Ampel zu ihr umdrehen, was man üblicherweise nicht tut. Oder vielleicht wäre es bei einer Unterhaltung möglich herauszufinden, ob sie sich tatsächlich schon einmal begegnet sind oder ob sie ihn nur an jemanden erinnert und an wen.
Er steuert den Wagen vom Flughafengelände auf die Brücke hinter dem Rollbahntunnel, biegt an der folgenden Ampel links ab und fährt an der schnurgeraden ruhigen Wasserstraße des Spandauer Kanals entlang. Die Wasseroberfläche war vor etwas mehr als einem Monat noch gefroren und bedeckt mit silbergrauen Eisschollen, deren Bruchkanten sich wie Schuppen übereinanderschoben.
»Vor zwei Tagen ist noch Schnee gefallen«, sagt er.
»Ach ja?«
Sie wendet ihm das Gesicht zu, sodass er sie im Rückspiegel aus einer neuen Perspektive sieht. Ihre Augenfarbe ist wirklich so, wie er sie sich vorgestellt hat, ein mittleres warmes Braun. Das Gefühl, ihr schon einmal begegnet zu sein, intensiviert sich, aber er weiß immer noch nicht, wo und in welchem Zusammenhang das gewesen sein könnte.
»Das ist hier um diese Jahreszeit oft so. Es ist Winter, und dann, über Nacht, wird es warm.«
»Bei uns war der Winter nicht sehr lang«, sagt sie.
»Woher kommen Sie?«
»Aus München.«
Er glaubt nicht, dass er sie daher kennt. Er ist zu selten dort gewesen, drei- oder viermal vielleicht. Eigentlich kennt er nur Berlin. Und die Freunde, die er in München besucht hat, passen nicht zu der Frau in seinem Wagen. Doch das könnte täuschen, wer passt heute schon zu wem?
Den wenigen Worten nach, die sie bisher gewechselt haben, spricht sie Hochdeutsch ohne Einfärbung durch einen Dialekt. Bei uns war der Winter nicht sehr lang … Er fragt sich, ob er ihre Stimme schon einmal gehört hat. Im Gegensatz zum Aussehen, verändern sich Stimmen im Laufe von Jahren nur wenig. Es kann sein, dass er ihre Stimme kennt, aber er ist sich nicht sicher. Das Wort Winter irritiert ihn oder löst irgendetwas in ihm aus, das er aber noch nicht greifen kann.
Am Ende des Saatwinkler Damms hat sich vor der Brücke über die Autobahn eine Schlange gebildet. Das ist um diese Zeit immer so. Die Sonne scheint von vorne in den Wagen. Sie steht so niedrig über dem glänzenden Horizont aus Autodächern, dass er die Frontblende herunterklappen muss. Nach dem Winter ist die Märzhelligkeit jedes Mal eine Überraschung.
»München kenne ich nicht«, sagt er.
»Mir ist wichtig, dass Sie Berlin kennen«, sagt sie.
Aber sie lächelt dabei.
»Berlin ist zu groß, um jeden Winkel zu kennen.«
»Sie denken, in München geht das?«
»Leben Sie dort?«, fragt er.
»Haben Sie Angst, etwas Falsches zu sagen?«
»Könnte ja sein.«
»Ich käme damit klar.«
»Sind Sie häufig hier?«
»Ab und an. Eher selten.«
»Die Stadt verändert sich schnell«, sagt er.
Sie nickt und schweigt dann. Ihm fällt nichts ein, was er hinzufügen könnte. Er will sich nicht aufdrängen, das tut er nie. Er langweilt sich nicht beim Fahren, irgendetwas geht ihm immer durch den Kopf. Manchmal reicht es ihm, beim Warten nach rechts oder links zu sehen. Dann fällt ihm eine ungewöhnlich dicke schwarze Brille in einem zu kleinen hellen Gesicht auf oder eine auf dem Steuerrad liegende Hand mit qualmender Zigarette und einer verblüffenden Last von goldenen Ringen oder ein stummes Figürchen, das als Glücksbringer oder Talisman am Rückspiegel baumelt.
Bei manchen katholischen Taxifahrern sind ihm kleine silberne Plaketten als Spiegel- oder Schlüsselanhänger aufgefallen. Darauf abgebildet war ein alter, zumeist gebeugter Mann, der einen lockigen Knaben auf den Schultern trug. Der Mann, Christophorus, ist für Katholiken, so hat er sich erklären lassen, ein Heiliger – der Schutzheilige der Reisenden. Er hat es sich angehört, aber er glaubt nicht an Heilige oder Schutzengel. Er ist nicht katholisch. Er hat einmal einen Unfall gehabt, doch das war vor seiner Zeit als Taxifahrer und ist mehr als zwanzig Jahre her. Und er glaubt, dass er diesen Unfall auch gehabt hätte, wenn er katholisch gewesen wäre und Christophorus vertraut hätte.
»Ich finde Berlin sehr unübersichtlich. Es gibt kein Zentrum, wo man hingeht.«
Es freut ihn, dass sie wieder etwas sagt.
»Man muss hier nicht überall hingehen«, sagt er. »Jeder hat sein Viertel.«
»Sind Sie Berliner?«
»Gebürtig? Nein. Aber wenn man eine Weile hier lebt, ist man Berliner – denke ich jedenfalls. Es ist ein Kommen und Gehen.«
»Im Moment mehr ein Kommen, liest man.«
Er lässt den Wagen anrollen.
»Ja, Berlin wächst. Überall wird gebaut.«
»Aber das mit dem neuen Flughafen klappt nicht.«
Sie lächelt wieder.
»Es ist ein Desaster«, sagt er.
Ihr Lächeln im Rückspiegel macht deutlich, dass sie die Bemerkung nicht abfällig gemeint hat, sondern mehr als Spitze, die dem Gespräch eine fast schon private Wendung gibt. Er sieht es auch in ihren Augen, die durch das Lächeln etwas schmaler, schalkhafter werden. Sie streicht ihre Haare auf der linken Seite hinters Ohr. Vincent weiß jetzt, dass er sie kennt, und der Wunsch, bevor sie seinen Wagen wieder verlässt, herauszufinden, wer sie ist, wird immer stärker. Es ist ein Rätsel, das er lösen muss, weil es ihm sonst keine Ruhe lassen würde.
»Wer weiß, ob der neue Flughafen überhaupt je fertig wird«, sagt er. »Seien Sie froh darüber. Die Fahrt vom südlichen Stadtrand in die Innenstadt wäre länger und weniger attraktiv als von hier aus. Wenn Sie wollen, kann ich Sie am Reichstag und am Brandenburger Tor vorbeifahren. Das wäre kaum ein Umweg.«
»Ein anderes Mal vielleicht.«
Sie fahren an Wohnhäusern vorbei, fünf- oder sechsstöckig, im Erdgeschoss Läden, manche geöffnet, andere noch nicht. Billigläden und Automatencasinos, eine sehr einfache Einkaufsstraße, nicht gerade das, was man Gästen vorzeigen würde, wenn man die Wahl hätte. Nach ein paar Minuten dehnt sich vor ihnen die Spree in einem weiten Bogen nach Osten. Links der Neubau des Hauptbahnhofs mit seinem langen geschwungenen Glasdach, das im Sonnenlicht glänzt wie ein Fluss ohne Bett, rechts das Bundeskanzleramt – schon eher Gebäude, auf die man hinweisen würde.
Als Vincent nach Berlin gekommen ist, gab es den Bahnhof und die Regierungsgebäude noch nicht. Die Stadt war in Ost- und West-Berlin geteilt, und das Spree-Ufer bestand aus Sand, Wachtürmen und Stacheldraht. Im Winter roch es nach Kohlefeuerungen und Smog, und man kam sich eigenartig wichtig vor, in dieser Stadt zu leben, in der die deutsche Geschichte und der Kalte Krieg so deutlich sichtbar waren. Die Erinnerung daran kann beim Fahren an irgendeiner Straßenecke aufblitzen.
Auf der nördlichen Uferstraße, die es damals noch nicht gab, hat sich ein Stau gebildet. Über den Autodächern schieben sich am Ende der Schlange Transparente von links nach rechts. Eine Demonstration. Das ist nicht ungewöhnlich, erst recht nicht hier in Sichtweite des Kanzleramts. Im Hintergrund schwebt die Kuppel des Reichstagsgebäudes über der Kundgebung.
»Wie lange kann das dauern?«
»Ich nehme an, dass die Demonstranten über die Spree zum Bundeskanzleramt ziehen«, sagt Vincent. »Manchmal sind es nur ein paar Hundert, manchmal hunderttausend. Aber dann hätte ich das vorher mitbekommen.«
»Können wir die Demonstration umfahren?«
»Haben Sie es eilig?«
Sie sieht auf die Uhr.
»Ich werde um halb zehn im Hotel abgeholt.«
»Ich denke, das sollte klappen. Ich glaube nicht, dass der Demonstrationszug sehr lang ist, sonst hätte die Polizei schon die Einfahrt in die Uferstraße gesperrt, um einen Rückstau zu verhindern. Sobald wir durch sind, ist es nicht mehr weit.«
Die Demonstration richtet sich, wenig überraschend zurzeit, gegen die USA und das massenhafte Mithören, Speichern und Analysieren von Telekommunikationsdaten. Auf einem der Transparente steht »Stop Watching Us!«, auf einem anderen »United Stasi America«, wobei die Anfangsbuchstaben der drei Wörter – U, S, A – rot hervorgehoben sind. Dort, in den USA, würde man das Transparent vermutlich nicht verstehen, weil man mit dem Wortspiel States-Stasi nichts anfangen könnte.
»Gibt es hier viele Demonstrationen?«, erkundigt sie sich.
»Pro Tag etwa zehn.«
»Tatsächlich? Stört das nicht beim Fahren?«
»Man gewöhnt sich dran.«
Sie betrachtet die Transparente.
»Ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt.«
»Ich war noch nie dort«, sagt er. »Wie ist es?«
»Wie in einer Diktatur habe ich mich nicht gefühlt.«
»Sie meinen, es ist unpassend, die USA mit dem Überwachungsregime der DDR zu vergleichen?«
»Ehrlich gesagt, ja.«
»Wann waren Sie dort?«
»In den Neunzigern. Das ist natürlich eine Weile her.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Studiert.«
»Studiert …« Und dann fügt er, ohne darüber nachgedacht zu haben, hinzu: »… an der Ostküste, nicht wahr, da wollten Sie jedenfalls hin, glaube ich …«
Sie schweigt verblüfft und sagt dann: »Woher …?«
Er dreht sich um und sieht sie zum ersten Mal direkt an. Er weiß es jetzt. »Ich glaube, wir kennen uns …« Und auf einmal ist ein Name da: »Jule …?«
Es dauert ein paar Sekunden, bis sie sich auf die unerwartete Situation eingestellt hat. Sie sieht ihn verunsichert und fragend an. Sie sucht in seinem Gesicht nach der Lösung dieses Rätsels und findet sie schließlich.
»Vincent …?«
Er hat sich also nicht geirrt.
»Nicht zu fassen«, sagt er.
Sie schüttelt den Kopf.
»Das ist Ewigkeiten her. Wann war das?«
»Kurz nach dem Mauerfall.«
Eine junge Frau, die in einem Korbsessel in einem Wintergarten sitzt und liest. Sie trägt eine graue Strickjacke, und ihr Blick ist auf die Buchseiten gerichtet. Sie kaut beim Lesen auf einer Haarsträhne herum. Sie sieht ein wenig brav aus. Ihre Füße sind auf einen dunklen Holzhocker gestützt. Sie trägt eine hautfarbene Strumpfhose, ihr Rock ist hellgrün. Als sie aufsieht, weil er hereinkommt, treffen sich ihre Blicke. Ihre Augen werfen ihn um …
Der Ton einer Hupe reißt Vincent aus der Erinnerung. Es geht weiter, der Stau löst sich auf. Er dreht sich nach vorn und lässt den Wagen anrollen. Auf der Brücke bewegt sich das Ende des Demonstrationszugs weiter Richtung Regierungsviertel. Die Polizisten, die den Demonstranten die Straße freigehalten haben, ziehen ab, um die nächste Kreuzung zu sichern. In ihrer Mehrzahl sind Demonstrationen zu einer kultivierten Angelegenheit geworden. Vincent hat sich schon lange nicht mehr an einer beteiligt. Immerhin weiß er jetzt wieder, dass er Jule nach einer Demonstration an einem kalten Wintertag kennengelernt hat. Vielleicht wäre er ohne die Anti-NSA-Kundgebung nicht dahintergekommen.
Er biegt nach links in die Reinhardtstraße. Von hier aus sind es nur noch zwei Minuten bis zum Hotel.
»Wie geht es …«, er zögert eine Sekunde und entscheidet sich dann für Du, »… dir denn?«, sagt er.
»Gut«, sagt sie. »Gut.«
»Ja, natürlich. Sieht man.«
Eine dumme Bemerkung.
»Und dir?«, fragt sie.
»Es läuft … doch … ja … «
»Na klar … sehe ich … Bei mir auch …«
Was für ein Gespräch.
»Familie, Kinder …?«, fragt er.
»Ja … natürlich … und du? Hast du Kinder?«
»Eine Tochter.«
»Das ist toll. Eine Tochter passt zu dir. Finde ich …«
»Ach ja?«
»Also stimmt, das war jetzt keine so fundierte Bemerkung«, lacht sie.
»Doch … Du hast recht. Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Da wusste ich allerdings noch nicht, was es bedeutet, eine zu haben. Hast du eine Tochter?«
»Zwei Söhne.«
»Zwei, gut … Ein Kind verwöhnt man zu sehr …«
»Zwei auch …«
Der Wagen nähert sich dem Hotel. Es geht jetzt alles schnell, zu schnell für das, was es vielleicht zu sagen gäbe. Sie haben sich mehr als zwanzig Jahre – genau genommen sind es schon fünfundzwanzig, stellt er fest – nicht gesehen, und gerade weil das so ist und die Zeit dazwischen für sie keine Bedeutung hat, scheint es ihm, als wäre ihre Begegnung erst gestern gewesen, als hätte es die seither vergangenen Jahre nicht gegeben, nicht für sie, nicht für die Erinnerung, an die sie beide anknüpfen. Es ist frappierend. Gestern noch sind sie jung gewesen.
»Wir sind da«, sagt er und hält an. »Dir bleibt noch genug Zeit, bevor du abgeholt wirst.«
Sie nickt und greift in ihre Handtasche.
»Was bekommst du?«
Das kann er auf keinen Fall zulassen, er wird kein Geld von ihr nehmen. »Ich bitte dich.«
»Das geht nicht«, sagt sie.
»Wieso nicht?«
»Du kannst mich nicht umsonst durch die Stadt fahren«, protestiert sie.
»War schön, mit dir zu reden.«
Sie schüttelt entschieden den Kopf. »Ich zahle nicht selbst. Es ist mein Arbeitgeber, den du beschenken würdest. Wozu?«
»Ist das wahr?« Das ändert die Sache, aber angenehm ist es ihm nicht, denn trotzdem wird sie es sein, die ihm das Geld gibt.
»Wie viel bekommst du?«
Er stellt die Quittung aus und nimmt das Geld. Alles andere wäre Unsinn, das ist ihm klar, sie sind keine zwanzig mehr. Dann, nachdem er ihren Trolley aus dem Kofferraum genommen hat, stehen sie voreinander. Einen Moment lang versucht er, ihr Gesicht mit dem in seiner Erinnerung, die aber undeutlich ist, in Übereinstimmung zu bringen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich noch einmal wiedersehen werden. Es ist die zweite Begegnung in ihrem Leben, zu der es ja immer kommen soll, wie es heißt, aber damit wohl auch die letzte.
»Wann fliegst du zurück?«
»Morgen.«
»Hättest du Zeit für einen Kaffee?«
»Eigentlich … Zwischen drei und vier. Geht das?«
»Hier?«
Sie nickt, umfasst den Griff des Trolleys und geht ins Hotel. Vincent sieht ihr nach, und nachdem sie im Hotel verschwunden ist, steigt er wieder in seinen Wagen. Das ist einer der Vorzüge des Taxifahrens: Er ist in seinem Tagesablauf frei. Er braucht sich keine Gedanken über Termine oder sonstige Verpflichtungen zu machen. Er kann sich, wann immer er möchte, zu einer Tasse Kaffee verabreden. Das kann nicht jeder in seinem Alter von sich behaupten. Auf eine bestimmte Weise gehören die Tage alle ihm.
ZWEI
ES LÄUFT GUT an diesem frühlingshaften Tag. Die Standzeiten sind kurz, und fast immer ergeben sich Anschlussfahrten. Scharfe Schatten und helle Schneisen voller Sonne wechseln einander ab. Beim Fahren vergegenwärtigt Vincent sich die Zeit seiner Begegnung mit Jule, die Zeit kurz nach dem Fall der Mauer in Berlin. Er erinnert sich wieder daran, dass die euphorische Stimmung nach dem Sturz des Regimes in Ostdeutschland erstaunlich schnell verflog, weil sich der Prozess der Vereinigung der beiden deutschen Staaten als ziemlich langwierige und zähe Verhandlungssache erweisen sollte, bei der viele in Ostdeutschland am Ende das Gefühl hatten, zu kurz gekommen zu sein. Und darüber hinaus schien die an sich ja erfreuliche Tatsache, dass die Grenzen in Europa durchlässig geworden waren und man den Kalten Krieg ad acta gelegt hatte, nur dazu zu führen, dass neue Konflikte mit neuen Protagonisten aufbrachen. Despoten und religiöse Fanatiker machten Schlagzeilen, die offenbar schon lange darauf gewartet hatten, endlich auf der Bühne der Weltpolitik in Erscheinung zu treten.
Jedenfalls war neben der Vereinigung der beiden deutschen Staaten die Besetzung Kuwaits durch irakische Truppen eines der großen weltpolitischen Themen im Sommer und Herbst des Jahres 1990. Unter dem Namen Operation Wüstenschild (bei dem Vincent im ersten Moment an einen neuen Asterix-Band denken musste) verlegten die Vereinigten Staaten unter ihrem damaligen Präsidenten Georg Bush senior – von junior war noch keine Rede – Flugzeugträger und Panzereinheiten an den Persischen Golf und ließen keine Zweifel an ihrer Bereitschaft aufkommen, die irakische Armee, falls nötig mit Gewalt, wieder aus Kuwait zu vertreiben. Sie erwirkten in der UNO ein Ultimatum, das Saddam Hussein eine Frist ließ, Kuwait bis Mitte Januar 1991 zu räumen, doch dieses Datum rückte näher und näher, ohne dass etwas geschah. Weder die USA noch Saddam waren bereit, von ihren jeweiligen Positionen abzurücken, und so sah es immer mehr danach aus, dass es am Persischen Golf zum Krieg kommen würde.
Vincent studierte damals eine Reihe von Fächern, die ihn alle gleichermaßen interessierten – Germanistik, Philosophie, Geschichte, aber er besuchte auch soziologische Vorlesungen, und einmal belegte er sogar ein Seminar über Dreiwertige Logik, in dem man sich ein Semester lang mit der kniffligen Frage herumschlug, welche Bedeutung man einem dritten Wahrheitswert irgendwo in der Mitte zwischen wahr und falsch sinnvollerweise zuweisen müsse: möglich, unbekannt, weder wahr noch falsch, sowohl wahr als auch falsch oder aber nicht bewiesen, aber auch nicht widerlegt.
Außerdem las und schrieb er viel und hatte eine diffuse Vorstellung davon, irgendwann einmal einen Roman zu beginnen, aber das wollte er auf keinen Fall überstürzen, zumal es fürs Erste ja genug zu tun gab, wie er und seine Freunde sich in endlos langen nächtlichen Debatten immer wieder versicherten. Genau genommen – das war ihrer aller Lebens- und Zeitgefühl in diesen späten Achtziger- und frühen Neunzigerjahren – war es nicht nur am Persischen Golf, sondern überall fünf vor oder eher nach zwölf: Man musste verhindern, dass das Ozonloch wuchs, Ölplattformen waren zu besetzen und Waffenexporte zu verbieten, die Atomkraft musste abgeschafft werden, die Biosphäre ging vor die Hunde, die Abholzung der Regenwälder war ein Verbrechen gegen die Natur, und das Abschlachten von Robben und Walen bewies, dass kein Lebewesen auf diesem Planeten dem Menschen an Brutalität und Raffgier gleichkam.
Vincents engster Freund in dieser Zeit war der Sohn eines Hamburger Buntmetallimporteurs. Er hieß Roger Anstett und wohnte in einer ziemlich beeindruckenden Villa in Dahlem. Dort trafen sie sich zweimal die Woche, um an einem der baumgesäumten Seen am Rand des Grunewalds zu joggen und bei dieser Gelegenheit den Zustand der Welt unter die Lupe zu nehmen. Roger stammte aus einem großbürgerlichen Viertel am Elbufer in Blankenese, während Vincent in einer schmucklosen Fünfzigerjahre-Siedlung am Stadtrand von Essen zwischen noch bewirtschafteten und schon stillgelegten Zechen und allmählich entstehenden Ausländervierteln groß geworden war.
An jenem Samstag im Januar 1991, der dem Ablauf des UNO-Ultimatums zur Räumung Kuwaits vorausging, fanden auf der ganzen Welt Demonstrationen und Proteste gegen den drohenden Krieg statt. Und es war vollkommen klar, dass Roger und Vincent sich mit ihren Freunden daran beteiligen würden. Es war ein kalter grauer Tag, an dessen Vormittag die beiden eine ihrer Joggingrunden im Grunewald drehten, um die Sache inhaltlich vorzubereiten. Aber dann erzählte Vincent Roger eine Geschichte aus seiner Jugend in Essen, vielleicht weil das finstere, dunkelhäutige Schnurrbartgesicht Saddams ihn an die türkischen Familienväter von damals erinnerte und daran, dass die in Deutschland geborenen Kinder der ersten Generation von eingewanderten Türken seinerzeit ungefähr im gleichen Alter gewesen waren wie er.
»Wir wohnten damals nicht weit von einer ihrer Siedlungen entfernt«, sagte er mit dampfendem Atem, »und irgendwie habe ich einen von diesen jungen Türken kennengelernt. Er konnte ziemlich gut Deutsch, und wir mochten uns, wenn auch vorsichtig oder etwas abwartend.«
Die türkischen Kinder traten damals immer in einer Art Bande auf, erinnerte er sich, zu der man als deutscher Junge eigentlich keinen Zugang hatte. Aber da es sich bei seinem türkischen Freund (wahrscheinlich traf der Begriff Freundschaft es nicht exakt) um einen ihrer Anführer handelte, bewegte Vincent sich einen Sommer lang relativ unbefangen und arglos unter ihnen. Sowieso waren sie von heute aus gesehen alle brave unbewaffnete Jugendliche, Deutsche wie Türken, aber es gab eine bleibende Fremdheit zwischen ihnen, etwas Unberechenbares.
Und wahrscheinlich hätte sich Vincent an seinen kurzen Ausflug in die Welt der (damals noch sogenannten) Gastarbeiter auch nicht mehr erinnert, wenn in jenem Sommer nicht ein Volks- beziehungsweise Stadtteilfest stattgefunden hätte, bei dem es auch ein Jugendprogramm gab, was damals aber nur bedeutete, dass man ein paar unschuldige Wettkämpfe organisiert hatte, unter anderem einen Drei- oder Vierhundertmeterlauf um ein verfallenes Fabrikgelände. Und dabei ergab es sich irgendwie – die Details hatte Vincent schon lange vergessen –, dass er gegen diesen jungen Türken lief, an dessen Namen er sich nicht mehr erinnern konnte.
Aber weil sie sich auf diese eigenartige, unberechenbare Weise mochten, beschlossen sie auf der Rückseite des Fabrikgeländes, wo niemand sie sehen konnte, nicht weiter gegeneinander zu laufen. Das Wettrennen kam ihnen auf einmal anstrengend, unnötig und kindisch vor. Sie verlangsamten ihre Schritte, gingen ohne Eile an der baufälligen Fabrikmauer entlang und nahmen sich vor, Kopf an Kopf nebeneinanderher zu traben, sobald sie wieder in Sichtweite der Zuschauer sein würden, um dann am Schluss millimetergenau im gleichen Augenblick über die Ziellinie zu gehen.
Es war ein guter und einfacher Plan, und trotzdem kamen Vincent auf den letzten fünfzig Metern gewisse Zweifel daran. Er und der junge Türke kannten sich im Grunde ja überhaupt nicht, und es wäre ein Leichtes gewesen, den jeweils anderen durch einen überraschenden Spurt kurz vor dem Ziel zu übervorteilen und zu schlagen. Ihre Absprache basierte auf Vertrauen, aber wie konnte er wissen, ob er zu diesem türkischen Jungen mit dem dunklen Bürstenschnitt Vertrauen haben konnte? Und Vincent dachte in diesen Sekunden auch darüber nach, wie es wäre, wenn er selbst die Abmachung brechen würde, um sich auf den letzten Metern uneinholbar abzusetzen. Immer wieder sah er verstohlen zur Seite, aber sie liefen auf gleicher Höhe, millimetergenau, wie geplant, sie liefen nicht schnell, und er hörte ihre parallelen und gleichförmig trabenden Schritte, bis sie tatsächlich zusammen durchs Ziel gingen.
Roger hatte schweigend zugehört und dachte einen Moment über die Geschichte nach, die ihm aus irgendeinem Grund zu missfallen schien.
»Ihr seid wirklich zusammen durchs Ziel?«
»So zusammen, wie das geht. Es war jedenfalls ein eindeutiges Unentschieden.«
»Und das wolltest du?«
»Ich denke, ja.«
In Rogers dunklen Koteletten glänzte Schweiß. Er beobachtete eine Weile die Enten auf dem See, wie sie scheinbar antriebslos über die eisige Wasseroberfläche glitten und dabei eine keilförmige Welle hinter sich herzogen. Schließlich sagte er: »Wovor hattest du mehr Angst: zu gewinnen oder zu verlieren?«
Vincent konnte die Frage spontan nicht beantworten, weil er über diesen Aspekt der Geschichte noch nie nachgedacht hatte. Er war immer der Meinung gewesen, dass sie keine Fragen offenließ. Hatte er überhaupt Angst gehabt – wovor auch immer? Hätte es ihn geärgert zu verlieren? Hätte er den Triumph eines Sieges – eines Sieges durch Vertrauensbruch – überhaupt auskosten können? Er hatte sich mit diesen Fragen nie beschäftigt, weil sie ihm nicht von Bedeutung zu sein schienen. Die Geschichte bewies seiner Meinung nach, dass es möglich war, den von außen in Gang gesetzten Mechanismus des Misstrauens zwischen den Kulturen erfolgreich zu unterlaufen. Insofern war es eine gute Geschichte, eine Geschichte, die Hoffnung machte, wie Vincent fand, gerade in der gegenwärtigen Situation, und deswegen hatte er angenommen, dass Roger sie ebenfalls mögen würde, doch in dem Punkt hatte er sich offenbar geirrt.
Sie redeten nicht weiter darüber, und als sie sich nachmittags mit ihren Freunden im Tiergarten trafen, drängte die Weltpolitik sowieso alles Private in den Hintergrund. Die internationale Diplomatie hatte sich – wie nicht anders erwartet – als unfähig beziehungsweise unwillig erwiesen, den Konflikt um Kuwait mit friedlichen Mitteln zu entschärfen und beizulegen. Und so zogen sie mit Tausenden von Golfkriegsgegnern und all jenen, die davon überzeugt waren, dass die politischen Systeme versagt hatten und die Welt dabei war, ihrem Untergang entgegenzutaumeln, protestierend zum Großen Stern, jenem vier- oder fünfspurigen Kreisverkehr im Tiergarten mit der Siegessäule im Zentrum, auf dem die Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Kein Blut für Öl stand auf ihren Transparenten, und das Gefühl, mit allen anderen moralisch auf der richtigen Seite zu stehen, auf der von Humanität und Gerechtigkeit, war ziemlich überwältigend und verbindend. Im Demonstrationszug wurden Trommeln geschlagen, deren dunkler, mahnender Rhythmus über die Straße und durch die kahlen Äste der Bäume des Tiergartens hallte. Zum Schutz gegen die Kälte trugen sie Lederjacken, graue Mäntel oder wattierte Anoraks, über deren Krägen ihre Hälse mit dicken, schier endlosen Wollschals umwickelt waren. Und während der Demonstrationszug sich langsam vorwärtsschob, analysierte Roger – er war in der Lage, zu jedem Thema aus dem Stegreif ein druckreifes Referat von sich zu geben – die politischen Zusammenhänge: »Die Sache ist sonnenklar!«, erklärte er der versammelten Clique, in deren Mitte er sich mit dem Demonstrationszug vorwärtsschob. »Es waren die Amerikaner, die den Irak dazu verleitet haben, Kuwait zu besetzen. Sie haben Saddam in eine Falle gelockt, indem sie Kuwait gedrängt haben, durch eine Ausweitung der Ölfördermenge für einen Preisverfall auf den globalen Ölmärkten zu sorgen. Geostrategisch, das muss man zugeben, war das geschickt gemacht. Es kam der ölhungrigen US-Wirtschaft entgegen und hat den von Öleinnahmen abhängigen Irak an den Rand der Pleite getrieben. Und Saddam war auch noch dämlich genug, die Sache nicht zu durchschauen. Er hat nicht geahnt, dass in Wirklichkeit die Amerikaner hinter dem Preisverfall steckten, sondern dachte, der Emir von Kuwait wollte ihm ans Bein pinkeln. Die Bush-Regierung ließ ihm gegenüber sogar durchblicken, dass sie eine Besetzung Kuwaits durch den Irak tolerieren würde. Ich sage euch, das ist die Wahrheit. Die amerikanische Botschafterin hat das im Sommer Saddam persönlich signalisiert, und er hat ihr das wirklich abgekauft. Tja, aber kaum hatten seine Truppen die kuwaitische Grenze überschritten, änderten die Amerikaner ihre Position. Überraschung! Sie organisierten mit nie gekannter Geschwindigkeit sowohl diplomatisch als auch militärisch eine sogenannte Befreiung