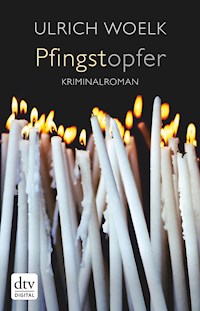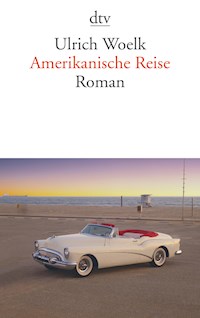9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Studie über die Gesetze der Naturwissenschaften, die Psychologie und Schrödingers Zimmer, in dem eine Katze zugleich tot und lebendig sein kann. Eine Studie über die Gesetze der Naturwissenschaften, die Psychologie und Schrödingers Zimmer, in dem eine Katze zugleich tot und lebendig sein kann. Erwin Schrödinger, der Vater der Quantenmechanik, war ein Bohemien und hielt sich stets eine Reihe von Freundinnen. Als daher ein gewisser Balthasar Schrödinger in der Nachbarschaft einzieht und behauptet, ein Enkel des großen Physikers zu sein, ist Oliver Schwarz auf unbestimmte Art beunruhigt. Sein Misstrauen verstärkt sich, als der Nachbar sich als berufsmäßiger "Zauberer" vorstellt und als erstes Gatliebs Frau und dessen Kinder mit seinem Charme und seinen Geschenken bezaubert. Dennoch folgen die Gatliebs einer Einladung in Schrödingers Haus, wo ihnen der Nachbar sämtliche Räume zeigt – mit Ausnahme des Schlafzimmers. Dies sei seine Zauberwerkstatt, erklärt er, die dürfe niemand betreten außer ihm selbst. Genau daran aber beginnt Gatlieb zu zweifeln. Er glaubt zu wissen, dass sich alle jungen Mütter der Gegend immer wieder in diesem Schlafzimmer einfinden – auch seine eigene Frau. Seine Eifersucht treibt ihn zu einem fatalen Vorstoß … Eine Studie über die Gesetze der Naturwissenschaften, die Psychologie und Schrödingers Zimmer, in dem eine Katze zugleich tot und lebendig sein kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Ulrich Woelk
Schrödingers Schlafzimmer
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2006 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40020-6 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-24561-6
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Websitewww.dtv.de
Inhaltsübersicht
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Es kann durchaus nützlich sein, etwas zu untersuchen, das am Ende gar nicht existiert.
BERNHARD J.CARR, STEVEN B.GIDDINGS
Quantum Black Holes
Scientific American, Mai 2005
ESTRAGON: Wir finden doch immer was, um uns einzureden, daß wir existieren, nicht wahr, Didi.
WLADIMIR: Ja, ja. Wir sind Zauberer.
SAMUEL BECKETT
Warten auf Godot
1
»Hier ist gerade nichts los…«, sagte Oliver Schwarz, und seine Stimme im Hörer nahm einen dunkleren, anzüglichen Klang an, als er nach einer kurzen Pause hinzufügte: »…und ich stelle mir vor, daß du nackt bist.«
Do blieb stehen und sah sich um. Der Klang des Wortes nackt erschien ihr unerwartet hart und unpassend. Sie stand in ihrer Geschenkboutique mit den sorgfältig arrangierten Waren und der Aura der Kultiviertheit. Während der ersten Minuten des Gesprächs hatte sie ein paar Batistservietten zu kleinen gekerbten Fächern aufgefaltet. Doch bei nackt rutschte ihr der zwischen Kopf und Schultern eingeklemmte Hörer weg, und sie mußte ihn in die Hand nehmen, um ihn wieder ans Ohr zu führen.
Da sie nichts sagte, fühlte Oliver sich ermuntert, einen Schritt weiter zu gehen, und er fuhr fort: »Ich stelle mir vor, daß ich die Ladentür abschließe und nach hinten in die Werkstatt gehe…«, er sprach jetzt ein wenig überhastet und flüsterte fast, »…wo du nackt auf mich wartest, auf dem alten grünen Sofa, du weißt schon, mit geschlossenen Augen und breitbeinig, und ich…«
Was er sagte, rief ihr in Erinnerung, daß es einmal so gewesen war: Sie hatte dort gesessen und auf ihn gewartet. Aber es gelang ihr nicht, sich mit dem Hörer in der Hand auf die erotische Echtheit seiner Fantasie einzulassen. Sie bedauerte es selbst, aber es ließ sich nicht ändern. Und um ihn nicht in die etwas gedämpfte Leere ihrer Stimmung an diesem Nachmittag laufen zu lassen, unterbrach sie ihn: »Oliver, es kann jederzeit jemand ins Geschäft kommen, sowohl bei mir als auch bei dir.«
»Heute ist Mittwoch«, erwiderte er mit normaler Stimme und ein wenig so, als sei er ungerecht behandelt worden. »Es ist absolut ruhig hier in der Straße.«
Ach ja, Mittwoch!, dachte Do. Das bedeutete, sie würde bis drei arbeiten und dann von Ruth abgelöst werden, um sodann Jenny zum Ballett und Jonas zum Fechten zu fahren. Danach bliebe ihr eine Dreiviertelstunde zum Einkaufen, bevor Jonas wieder abgeholt werden mußte. Wenigstens würde Jenny von Helma mitgenommen werden, um bis sechs mit Maja zu spielen. Dann wäre allerdings auch sie abzuholen, und um halb sieben würde Oliver aus dem Geschäft kommen und reden wollen über diesen aus seiner Sicht so ereignisarmen Mittwoch. Es stimmte schon, was Helma immer sagte: Tage sind Reißverschlüsse, und wenn es beim Verzahnen der Minuten irgendwo klemmt, bist du geliefert.
»Bist du noch dran?«, fragte Oliver.
»Ja, mir ist nur eingefallen, daß ich nicht vergessen darf, Crunchy-Honigflocken zu kaufen. Heute morgen waren keine mehr da.«
»Zu dumm«, sagte er ernüchtert und selbstmitleidig. »Ich denke an Sex und du ans Einkaufen.«
»Ich würde auch gerne an Sex denken, Oliver.«
»Warum tust du’s dann nicht?«
»Was glaubst du denn, warum?«
Oliver war Optiker. Manchmal stellte Do – sie hieß Doris, aber Oliver hatte sie von Anfang an Do genannt – sich vor, wie er von all den leeren augenlosen Brillengestellen angestiert wurde, die in seinem Laden an den Wänden hingen. Er hatte sie angerufen, weil er sich nach ihr sehnte, und das konnte sie ihm nicht zum Vorwurf machen. Sie gab ihm ja recht: Sie schliefen zu selten miteinander. Versöhnlich, wenn auch mit einem bestimmten Schuß Ironie, der ihr unwillentlich entschlüpfte, sagte sie: »Vielleicht sollten wir einen bestimmten Tag dafür festlegen.«
Grimmig antwortete er: »Einen in der Woche oder einen im Monat?«
»Oliver«, beschwichtigte sie ihn. Sie nahm den Hörer ans andere Ohr und verschob mit der rechten Hand eine Duftkerze. »Es ist nicht so, als würdest nur du in dieser Hinsicht zu kurz kommen.«
»Sehr präzise ausgedrückt«, seufzte er resigniert. »Vielleicht sollten wir’s einfach mal wieder tun.«
»Du hast recht«, sagte sie und fügte entgegenkommend hinzu, allerdings mehr um das Gespräch jetzt zu beenden: »Wie wäre es denn mit heute abend?«
Geradezu gierig ging er darauf ein: »Ja, laß uns das unbedingt festhalten. Vergiß es nicht. Ich werde solange bohren, bis du dich wieder dran erinnerst.«
»Sei nicht ganz so präzise. Im übrigen warst du schon mal witziger«, sagte sie und senkte ihre Stimme, als hätte soeben ein Kunde das Geschäft betreten: »Ich muß Schluß machen, es kommt jemand.«
»Na bestens. Wenigstens einer, der kommt«, knurrte er mißgelaunt. Sie spürte, daß er die Unehrlichkeit ihres Manövers durchschaute. Trotzdem blieb sie bei ihrer Lüge und schickte den imitierten Hauch eines verstohlenen Kusses durch die Leitung. Als sie den Hörer zurück zum Kassentresen brachte, fiel ihr Blick auf einen schaukelnden Metallhasen im Schaufenster. Es war kurz vor Ostern. Angetrieben von einer hin- und herpendelnden Gußeisenkugel, schob der Hase unermüdlich eine Schubkarre voller buntbemalter Eier vor und zurück. Die Geschenkboutique hatte Do vor vier Jahren zusammen mit ihrer Freundin Ruth Weiß eröffnet. Die Gelegenheit war günstig gewesen, weil damals infolge der abstürzenden Börsenkurse die Ladenmieten ins Rutschen gerieten. Außerdem kannte sich Oliver mit Geschäftsräumen gut aus und wußte, worauf zu achten war. Sie nannten die Boutique Schwarz & Weiß.
Licht und Dunkelheit. Sehen und nicht sehen. Es entsprach einem Gefühl von ihr. Als sie Oliver kennengelernt hatte, war sie fasziniert gewesen von seiner Lichtsucht. Er hatte sich schon Anfang der neunziger Jahre als Optiker selbständig gemacht. Sein Geschäft lag in einer Zeile alteingesessener Schuh-, Wäsche- und Papiergeschäfte, die damals kaum mehr gewesen waren als Überreste einer steinzeitlichen Ladenkultur, die in der Epoche von Einkaufszentren und Erlebnisshopping drohte unterzugehen. Er hatte frischen Marketingwind in den Straßenzug gebracht. Er war Künstler. Er zeichnete viel und manisch, und seine Schaufensterdekorationen wiesen ihn als jungen Wilden aus: Er befestigte seine Brillengestelle rittlings auf grellfarbigen Neonröhren oder skizzierte auf einem langen Stück Rauhfasertapete mit wenigen breiten Filzstiftstrichen die Silhouette einer großen nackten Frau, setzte ihr durch zwei Löcher im Kopf eine Designer-Sonnenbrille auf und ließ sie selbstbewußt (oder verächtlich) auf den Gehsteig hinabsehen.
Er selbst war nicht besonders groß, nur wenig über einssiebzig. Als Do ihm zum ersten Mal in seinem Laden gegenüberstand, inmitten seiner Brillenarmee, mußte sie an Napoleon denken. Ein Feldherr im Kampf gegen die Dunkelheit. Hornhautverkrümmungen, Astigmatismen, Altersweitsicht: Es gab eine Menge Fehlsichtigkeiten – wie sie im Laufe der Jahre erfuhr–, gegen die er seine Gestellsoldaten in den Kampf schickte. Sein Blick war präzise beobachtend (er war ja Zeichner), und er wirkte sehr selbstsicher, fast ein wenig arrogant. Bei den Verkaufsgesprächen, die sie hatten – Do wollte eigentlich nur eine Sonnenbrille kaufen, aber sie ließ sich viel Zeit damit–, verliebte sie sich in ihn. Es gefiel ihr, daß er diese Künstleraura hatte, aber noch etwas anderes spielte eine Rolle. Es forderte sie gewissermaßen heraus, ihn, den Ingenieur des Fernsinns, für bestimmte Vorzüge der Nahsinne zu begeistern. Was diese Dinge betraf, war er nämlich keineswegs ein Draufgänger, wie sie schnell herausfand. Im Innersten eher schüchtern, verbarg er sich hinter der Maske des avantgardistischen Optikers. Ihn, den Herrn des Sehens, zu verführen hatte einen sehr romantischen Reiz gehabt. Denn damals dachte Do (und sie dachte es heute noch), daß zu lieben zuinnerst bedeutete, die Augen zu schließen.
Am Abend nach Olivers Anruf bemühte Do sich, seinen Ausflug ins Reich des Telefonsexes als Kommunikationskapriole zu sehen, die den heißhungrigen Atem ihrer frühen Liebesjahre verströmte. Sie ging noch einmal ins Kinderzimmer, um sich zu vergewissern, daß Jenny und Jonas schliefen. Dann wandte sie sich zum Schlafzimmer. Auf dem Weg gaben die alten gewachsten Fichtenbohlen im Flur unter ihren Fußsohlen warm und samten nach und knarrten vertraut. Die Schlafzimmertür wurde durch eine Straßenlaterne schimmernd beleuchtet.
Als Do die Tür öffnete, fiel ein blasser Lichtkeil in den Raum, der sich zum Bett hin weitete. Kopfkissen und Decken wurden sichtbar, noch zerwühlt vom morgendlichen Aufstehen. In dem schwachen indirekten Licht sahen sie menschenähnlich und gespenstisch aus, und obwohl Do nicht an Übersinnliches glaubte (oder nur maßvoll, sie wünschte sich etwas, wenn sie eine Wimper fand, oder sah in Träumen ernstzunehmende Botschaften), war sie froh, das Licht einschalten zu können. Mit ihrem Eintreten zwang sie die Dinge aus dem Reich spiritistischer Möglichkeiten zurück in die diesseitige Ordnung ihrer Ehepaarwirklichkeit. Im besonderen stand der Umsetzung jener nachmittäglichen, telefonischen und für ein Ehepaar nicht eben ehrgeizigen Verabredung zum Sex jetzt nichts mehr im Weg.
Do ging zum Fenster und suchte in sich nach einer Empfindung, die einigermaßen zu der erotischen Erwartungshaltung paßte, mit der Oliver in ein paar Minuten das Zimmer betreten würde. Sie horchte in ihren Körper hinein und fand dort neben einer schwelenden abendlichen Müdigkeit eine Art Unvollständigkeit ihres Wesens, ein fadenscheiniges Ich. Außerdem (so stellte sie im weiteren fest) fröstelte sie. Es war, als zirkulierte eine unterschwellige, bald ausbrechende Infektion in ihren Adern. Durch die Fensterscheibe meinte sie sogar zu spüren, wie deutlich sich die tagsüber von der Sonne erwärmte Luft wieder abgekühlt hatte. Klare Nächte bedeuteten Frost. Im Westen verabschiedete sich der Märztag mit einem beinahe romantischen Dämmerungsfinale. Das Blau über den Dächern war malerisch: angesiedelt irgendwo zwischen dem einer Delfter Kachel und dem Farbton einer bestimmten Art von Blumenvasen, vor kurzem neu ins Sortiment aufgenommenen Art-déco-Nachbildungen, die sich erfreulich gut verkauften.
Do glaubte in der glasklaren Transparenz der Luft noch die Nähe zum Winter zu spüren und legte die Hand auf den Heizkörper; er war kalt. Oliver und sie vertrugen die trockene Zentralheizungsluft nachts nicht. Sie bekamen dumpfe, hartnäckige Kopfschmerzen davon. Zu einer Zeit, als diese noch ziemlich teuer und exotisch gewesen waren, hatten sie hypoallergene Mikrofaserdecken und Antimilben-Matratzenschoner angeschafft. Oliver sagte immer (und er hatte gewiß recht damit), Heizkörper seien Startrampen für Viren und Bakterien aller Art. Andererseits (dachte Do) konnte man sich nicht in einem Kühlschrank lieben. Mit ihrer Doppelfunktion als Stätten sowohl der Nachtruhe als auch des Liebesmiteinanders waren Schlafzimmer Räume mit eigenartig unklarer Bestimmung. Entspannt zu schlafen und befriedigenden Sex zu haben war jedenfalls nicht dasselbe.
Do gab es auf, in sich hineinzuhorchen, um ein Fünkchen Lust auf Sex in sich aufzuspüren. Oliver putzte sich die Zähne, und sie lauschte auf das helle, mechanische Hin und Her der Zahnbürste und das anschließende Spülen und Gurgeln. Oliver gurgelte auf eine kurze eruptive Art, als müßte er aus der Tiefe seines Rachens einen Fremdkörper hervorholen, eine Gräte oder ein Haar. Do zog die Fensterrollos herab und schaltete ihre Nachttischleuchte ein. Meistens liebten Oliver und sie sich im schwachen Schimmern der Gaslaternen, das durch die Vorhänge drang. Die unfaßliche phosphoreszierende Helligkeit verlieh ihren Liebesgebärden substanzlose Flüchtigkeit, etwas Verwischtes und Traumhaftes. In Dos Träumen war die Liebe eine Verdichtung von Gefühlen, nicht von Materie. Sie begann, sich auszuziehen, und hoffte, lesend (mit Brille) im Bett zu liegen, bevor Oliver fertig wäre. Doch in diesem Moment öffnete sich die Badezimmertür. Gehüllt in seinen knielangen flaschengrünen Frotteebademantel kam er hinein und brachte den Geruch von warmem Wasserdampf und Shampoo mit ins Zimmer.
»Wir hätten die Heizung andrehen sollen«, stellte er fest und setzte sich auf die Bettkante. »Was meinst du, sollte ich vielleicht den kleinen Heizlüfter aus dem Keller holen. Er müßte irgendwo beim Werkzeug stehen.«
»Besser nicht«, sagte sie, »es ist zu staubig dort unten. Wir bekämen auf der Stelle Asthma.«
»Du übertreibst. Gasthermen arbeiten staubfrei.« Mit Daumen und Zeigefinger zwirbelte er sich ein mitgebrachtes Wattestäbchen ins Ohr. »Ich bin jeden Tag froh, daß wir den alten Ölbrenner rausgeschmissen haben, auch wenn einen die Gasversorger mit ihren Fantasiepreisen gnadenlos über den Tisch ziehen. Wird Zeit, daß diesen Monopolgangstern endlich jemand das Handwerk legt.«
Die Erinnerung an den Kauf und die Renovierung des Hauses vor fünf Jahren rief Do etwas ins Gedächtnis, das sie Oliver schon den ganzen Abend über hatte erzählen wollen. Es war eine Neuigkeit, die möglicherweise geeignet war, ihn von dem Gedanken an Sex abzubringen. Sie sagte: »Ach weißt du übrigens, was Helma zu berichten wußte?«
»Wie sollte ich?« Er fuhr mit dem Handtuch, das er sich wie ein Boxer um den Nacken gelegt hatte, über die Haare am Hinterkopf, der einzigen Stelle, wo man sie mit einigem Wohlwollen noch als dicht bezeichnen konnte.
»Das Haus am Ende der Märkischen Straße«, fuhr Do fort, »du weißt schon, dieses Le-Corbusier-artige Gebäude, das schon seit mehr als einem Jahr leer steht und aus irgendeinem Grund nicht zu verkaufen war, hat endlich einen neuen Besitzer.«
»Hm, na schön.«
»Helma hat ihn abgefangen, als er mit ein paar Handwerkern auf dem Grundstück herumgelaufen ist. Offenbar müssen neue Rohre verlegt werden. Er will schon in sechs Wochen einziehen, hat er gesagt, und innen wird zur Zeit mit Hochdruck gearbeitet.«
»Ist mir noch gar nicht aufgefallen.« Oliver hatte sich den Bademantel nur locker umgegürtet. Zwischen den dunkelgrünen Revers wurde ein Streifen seiner unbehaarten Brust sichtbar, noch gerötet vom intensiven Frottieren. Do wußte, daß er wußte, daß sie es nicht mochte, wenn sein Körper feucht dabei war. Und die Tatsache, daß er sich offenbar gründlichst abgetrocknet hatte, machte ihr klar, daß er alles dransetzte, um für das Geplante die denkbar besten Voraussetzungen zu schaffen. Sie fühlte sich durch dieses demonstrative Erfüllen ihres Willens aber unter Druck gesetzt, und ihre Bereitschaft, mit ihm zu schlafen, nahm weiter ab.
»Stell dir vor«, fuhr sie fort, »das Haus soll wieder so schneeweiß gestrichen werden, wie es auf alten Bildern wohl einmal gewesen ist. Allerdings ist es für Außenarbeiten noch zu früh. Man muß warten, haben die Maler zu Helma gesagt, bis die Frostgefahr vorbei ist. Auf jeden Fall glaubt Helma, daß die Renovierung unser Viertel aufwerten wird. Man kann ja sagen, daß es sich bei dem Haus beinahe um ein Baudenkmal handelt.«
»Das Ding auf Vordermann zu bringen dürfte nicht billig sein«, überlegte Oliver. Er hob den linken Fuß auf die Bettkante und klemmte den Gürtel des Bademantels zwischen den großen Zeh und dessen dünnen, gekrümmten Zehennachbarn, um auch den engen Zwischenraum zwischen diesen beiden Außenposten seines Körpers von allen eventuellen Feuchtigkeitsresten zu befreien. »Da kommt schnell was zusammen. Wer ist denn der neue Besitzer? Irgend so ein Bankdirektor oder Notar mit einer perfekten Frau und zwei verzogenen Blagen?«
»Warum bist du denn so negativ eingestellt?«, sagte Do. Das akribische Reinigen seiner Zehenzwischenräume zwang sie dazu, ständig auf seine Füße und das Vor und Zurück der Frotteewulst zu starren. »Ich finde, es ist eine großartige Nachricht. Außerdem liegst du mit deiner Vermutung in Bezug auf den neuen Besitzer vollkommen falsch. Das ist nämlich der eigentliche Clou bei der ganzen Geschichte. Du wirst niemals darauf kommen, wer dort einzieht.«
»Ich bin sicher, du wirst es mir gleich sagen.«
Do streifte sich den Pullover über den Kopf. »Sei doch kein Spielverderber. Bist du denn kein bißchen neugierig?«
Er war jetzt bei der Ritze vor dem kleinen Zeh angekommen, in die sich der Bademantelgürtel aber kaum noch hineinpressen ließ. »Doch, bin ich. Wer ist es?«
Sie zog den Reißverschluß ihrer Jeans herunter. »Es ist wirklich eine Sensation! Der neue Besitzer ist ein… Zauberer!!«
Er unterbrach seine Reinigungszeremonie. »Wie bitte? Ein Zauberer?«
Sie nickte. »Ja. Ein Zauberer.«
»Jeder kann behaupten, ein Zauberer zu sein.«
Sie zog ihre Hose aus und legte sie auf den Klapphocker neben der Spiegelkommode. »Es kann auch jeder behaupten, Optiker zu sein.«
»Das ist nicht das Gleiche. Ich meine, wie läuft das? Macht er sich ein Schild ans Haus: Karl Mustermann, Diplom-Zauberer, oder wie hat man sich das vorzustellen?«
»Ich weiß gar nicht, was dich daran stört. Es gibt doch Zauberer. Ich meine, sie treten auf.«
»Schon. Aber wo tritt er auf? Wie heißt er überhaupt?«
»Wo er auftritt, weiß ich nicht. Aber er hat einen verrückten Namen. Einen echten Zauberer-Namen.«
»Ja?«
»Er hat sich Helma vorgestellt. Er heißt Balthasar Schrödinger.«
Sie öffnete die Schranktür und entzog sich dadurch seinem Blick. Rasch streifte sie das Unterhemd ab und hakte den BH-V erschluß auf. Doch dann mußte sie feststellen, daß sie die zuletzt gewaschenen Nachthemden nur unordentlich in den Schrank gestopft hatte, gemixt mit ein paar schlichten Baumwoll-T-Shirts, die mit den Nachthemden die helle Musterung und das Schicksal teilten, als Sechzig-Grad-Wäsche in ein und derselben Trommel gelandet zu sein.
Sie hörte Oliver vom Bett her sagen: »Das ist Unsinn. Niemand heißt Balthasar Schrödinger.«
»Und wieso nicht? Die Menschen heißen auch Boris Becker und Oskar Lafontaine.«
»Was machst du denn da so lange?«, fragte Oliver.
»Ich suche ein wärmeres Nachthemd. Du sagst ja selbst, daß es kühl im Zimmer ist.«
»Nicht im Bett, Schatz.«
Sie wollte ihm jetzt nicht nackt gegenübertreten und blieb hinter der Schranktür stehen. »Ich frage mich, was mit dir los ist? Wir bekommen einen neuen Nachbarn, das ist alles, was ich dir sagen wollte, und du machst eine komische Geschichte daraus.«
»Was für eine Geschichte denn? Einen Nachbarn zu bekommen, der sich Balthasar Schrödinger nennt und behauptet, Zauberer zu sein, ist ja nicht alltäglich. Aber ich bin sicher, Helma und du, ihr werdet ihm schon auf den Zahn fühlen. Tut mit leid, wenn meine Äußerungen negativ geklungen haben sollten. Ich bin ein wenig ungeduldig, Schatz. Wir haben ja noch etwas vor.«
Sie zog sich eins der T-Shirts über, das aber nur bis zur Taille reichte, und schloß die Schranktür. Oliver saß mit weit gespreizten Beinen auf dem Bett. Er würde in jedem Fall mit ihr schlafen wollen. Und er würde ihr entgegenhalten, daß es ihr eigener Vorschlag gewesen war.
Sie sagte: »Ich bin nicht besonders entspannt. Vielleicht hätten wir ein Glas Wein trinken sollen.«
»Können wir«, sagte er. »Wie wär’s mit diesem samtigen Languedoc?«
»Besser nicht. Ich habe morgen früh ein Gespräch mit Jennys Mathelehrer.«
Er sah sie an. »Was soll das, Do? Du sagst, du brauchst Wein, um in Stimmung zu kommen. Nun gut. Und dann sagst du, daß du keinen Wein trinken kannst. Das erinnert mich fatal an dieses Regel-eins-Regel-zwei-Spiel. Regel eins: kein Sex. Regel zwei: Wenn Sie scharf sind, tritt automatisch Regel eins in Kraft.«
»Es sind meine Empfindungen. Du solltest nicht in diesem Ton darüber reden«, sagte sie.
»Was soll ich denn tun, Do? So wie ich die Sache sehe, gibst du mir keine Chance.«
In diesem Moment klingelte das Telefon auf ihrem Nachttisch. Do versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, daß sie erleichtert darüber war, so ungewöhnlich das Klingeln um diese Zeit auch sein mochte. Aber sie spürte, daß Oliver nicht bereit war, den Gedanken an Sex schon aufzugeben. Sein Blick signalisierte ihr, daß er erwartete, daß sie das Gespräch nicht entgegennehmen würde. Sie sollte abwarten, bis der Anrufbeantworter ansprang – üblicherweise nach fünf oder sechs Klingelzeichen. Instinktiv ging ihr noch etwas anderes durch den Kopf: Vielleicht würde Jonas von dem Klingeln wach, und sie fragte sich, ob sie es nicht darauf ankommen lassen sollte. Wenn Jonas einmal wach war, würde er nur noch an ihrer Seite einschlafen, das wußte auch Oliver, und jeder Gedanke an Sex wäre vom Tisch. Doch drittens (all das ging ihr in den zwei oder drei Sekunden nach dem ersten Klingelzeichen durch den Kopf) würde niemand nach zehn Uhr anrufen, es sei denn aus einem wichtigen Grund.
Oliver spürte, daß sie das Gespräch entgegennehmen wollte und sagte: »Verflucht, Do, wahrscheinlich ist es deine Mutter, die sich langweilt.«
Sie sagte: »Ich mache es kurz«, und hob ab. Es war ihr Vater. »Oh… hallo«, sagte sie. Sie brauchte ein paar Sekunden, um sich darauf einzustellen. »Wie geht es dir?«
»Nicht besonders«, sagte ihr Vater mit müder Stimme, er erwartete Zuwendung. »Das weißt du ja.«
»Ja… ich meine, nein. Ist denn etwas geschehen? Nimmst du deine Tabletten?«
»Wieso fragst du mich, ob ich meine Tabletten nehme? Ist das alles, was dir einfällt, wenn ich sage, daß ich mich nicht wohl fühle? Das kenne ich nur von deiner Mutter. Habe ich euch gestört?«
»Nein, nein. Wir haben gelesen.«
Oliver stand auf und schloß den Bademantel. Im Hinausgehen sagte er halblaut, aber so, daß sie es deutlich verstehen konnte: »Zum Teufel, Do, warum kannst du denn nicht einfach mal unkompliziert scharf sein?«
Ihr Vater fragte: »War das Oliver? Was hat er gesagt?«
»Ich soll dich von ihm grüßen«, sagte Do.
»Wie läuft es bei euch?«
»Gut, Papa.«
»Deine Mutter hat eine völlig unrealistische Vorstellung von Medikamenten. Seit wir uns kennen, liegt sie mir damit in den Ohren«, sagte er. »Medikamente können Menschen nicht ändern, selbst Drogen können das nicht. Wenn sich jemand mit Medikamenten auskennt, dann ja wohl ich. Ich weiß seit dreißig Jahren, daß mein Serotoninspiegel bestimmten Schwankungen unterliegt. Das ist ein funktionelles Problem, dem man Rechnung tragen muß, so wie man beim Auto regelmäßig den Ölstand zu kontrollieren hat. Ich weiß damit umzugehen und komme mit meinen MAO-Hemmern bestens klar.«
»Papa, hast du angerufen, um mir das zu sagen?«
Nach einer Pause sagte er: »Entschuldige. Heute war so ein schöner Tag. Es wird Frühling, die Luft war wunderbar. Ich bin über die Felder bis zu der Stelle am See spaziert, wo wir früher immer gesessen haben. Es ist alles noch so wie damals. Das ist erstaunlich, nicht wahr. Die Sonne steht schon sehr hoch am Himmel. Sogar jetzt ist es noch ganz mild, wenn ich das Fenster öffne.«
Offenbar schwelgten die beiden wichtigsten Männer in ihrem Leben heute in Erinnerungen an gemeinsame Stunden mit ihr, dachte Do. »Hier war es auch schön«, sagte sie. »Aber jetzt ist es wieder kalt geworden. In der Nacht soll es Frost geben.«
»Bei euch im Osten sind die Nächte zu kalt«, sagte ihr Vater mit Bestimmtheit. Aber woher wollte er das wissen.
Nachdem sie aufgelegt hatte, starrte Do auf die gewachsten Holzdielen unter ihren Füßen. Oliver saß vor dem Fernseher. Er wollte, daß sie dachte, daß ihre sexuelle Kompliziertheit oder Kälte ihn in die Ödnis eines mitternächtlichen Mattscheibenuniversums aus fünften Krimiwiederholungen, moralisierenden Minderheitenreportagen und preisgekrönten Filmkunstdramen in Originalsprache mit Untertiteln aus Taiwan oder Uruguay verstoßen hatte. Sie sollte sich schuldig fühlen.
Einmal (es war aber schon einige Jahre her) hatte sie an einem Strand in Lotushaltung neben ihm gesessen. Mit ausgestreckter Hand befreite sie seinen salzwasserschrumpeligen Schwanz aus den Badeshorts (unter einem wie zufällig in seinen Schoß gerutschten Handtuch) und behandelte ihn so lange in geeigneter Weise, bis sich auf dem Frotteestoff dunkle Flecken bildeten. Viele der jungen Frauen an diesem Strand trugen kein Bikinioberteil, und Do befriedigte sich mit der anderen Hand selbst. Sie war nicht sexuell kompliziert. Aber es wäre sinnlos gewesen, ihn jetzt daran zu erinnern.
Sie rollte sich in ihre Decke. Oliver hatte das Licht brennen lassen, und sie schaltete es aus. Dann stand sie noch einmal auf und öffnete eins der Rollos. Das Laternenlicht hob die noch blattlosen Äste der Straßenlinden aus der Nacht. Als sie die Augen schloß, fluktuierte die Dunkelheit. Als Kind hatte sie in der Dunkelheit hinter ihren geschlossenen Lidern immer ein Geheimnis vermutet, etwas, das ihr aufgegeben war zu entdecken. Sie spürte etwas Unsichtbares in dem Schwarz, ganz nah und doch unfaßbar. Doch bevor es ihr gelang – auch jetzt wieder–, weiter vorzudringen in diesen geheimnisvollen lichtlosen Innenraum, löste ihr Bewußtsein sich auf. Seit siebenunddreißig Jahren war es Abend für Abend das gleiche, auch wenn sie es gelegentlich für unmöglich hielt: Sie schlief ein.
2
Oliver Schwarz war am Meer aufgewachsen, an der Nordsee in der Nähe von Wilhelmshaven. Offizielle Wetterstatistiken weisen für diese Gegend jährlich rund achthundertfünfzig Liter Regenwasser pro Quadratmeter aus und hundertdreiundzwanzig Sonnentage. Rein rechnerisch kommen auf einen Sonnentag somit ungefähr zwei Regentage. Oliver war vier Jahre alt, als sich sein Vater diesem ernüchternden Verhältnis entzog und mit einer jungen Kroatin durchbrannte, die er als Leichtmatrose bei einem Landgang kennengelernt hatte. Er ging mit ihr nach Spanien und ließ danach nichts mehr von sich hören.
Er hatte wohl viele Affären gehabt, aber Oliver wußte nur wenig darüber. Von seinen tuschelnden Schwestern, die sieben beziehungsweise sechs Jahre älter waren als er, erfuhr er das eine oder andere, aber insgesamt nicht viel. Irgendwann stellte er sich vor, wie sein Vater die wellenartigen Linien des weiblichen Körpers, diese geheimnisvolle Dünung, an das Ufer seiner Männlichkeit hatte branden lassen zur Erzeugung jener weißen Gischt, von deren Existenz und Bestimmung er noch kaum etwas wußte. Die heimliche Bewunderung für seinen abwesenden Vater quälte ihn lange mit Gewissensbissen gegenüber seiner tüchtigen soliden Mutter, die ihn und seine Schwestern allein durchbringen mußte.
Da er in einem rein weiblichen Haushalt aufwuchs, manifestierte sich die Übermacht des Femininen in seinem Leben nicht nur moralisch, sondern auch zahlenmäßig Tag für Tag. Und so wuchs sich die offensichtlich verwerfliche und mutterbeleidigende Neigung, das Leben seines Vaters erotisch zu verklären, in der Pubertät zu einer unterschwelligen Manie aus, einer uneingestandenen Obsession. Er wünschte zu sein, was sein Vater offenbar gewesen war: ein Frauenheld. Doch sagte ihm eine innere Stimme, daß es damit niemals etwas werden würde. Denn offensichtlich hatte er nicht die stattliche strahlende Natur seines Vaters geerbt (an die er sich noch zu erinnern meinte), sondern die etwas geduckte, o-beinige, kompakte Körperlichkeit seiner Mutter. Der Mann in ihm, so glaubte er irgendwann zu begreifen, hatte vom anderen Geschlecht genetische Fesseln angelegt bekommen, auf daß verhindert werde, daß er eines Tages unter vollen Segeln auf das Meer der erotischen Möglichkeiten hinaus- und davonsegelte.
Von seiner Mutter erbte er aber auch eine gewisse Beharrlichkeit. Gezwungen, den Lebensunterhalt für ihre drei Kinder allein zu verdienen, hatte sie schon früh damit begonnen, Nordseekrabben zu schälen, beziehungsweise zu pulen, wie es in der Region um Wilhelmshaven hieß. Das Krabbenpulen war eine Fingerfertigkeit, die sich nicht durch Konzentration oder analytische Vergegenwärtigung des zu Tuenden erwerben ließ, sondern einfach nur durch (ganz und gar im Wortsinne zu verstehende) millionenfache Übung. Jeden Morgen wurden die winzigen rötlichgrauen, frisch gefangenen und gekochten Krabbentierchen kanisterweise angeliefert und waren bis zum Abend zu schälen. Danach wurden sie in diversen Restaurants, Feinkostgeschäften oder heimischen Küchen mit Mayonnaise vermischt oder mit dem damals in Mode gekommenen Thousand-Island-Dressing.
Olivers Mutter war so beharrlich, daß es ihr gelang, im Laufe ihres Lebens ein Eigenheim zusammenzupulen. Zu Beginn der siebziger Jahre zog sie mit ihren Kindern dort ein. Wenn man davon ausging, daß für das Kilo Krabbenfleisch als Handelsware in den sechziger Jahren etwa vier Mark bezahlt wurden, und man ferner zugrundelegte, daß eine einzelne gepulte Krabbe etwa ein halbes Gramm wog, dann verdiente man pro Krabbe etwa zwei Zehntel Pfennig, was bedeutete, daß für das Eigenheim, das damals ungefähr achtzigtausend D-Mark gekostet hatte, etwa vierzig Millionen Krabben zu pulen gewesen waren, was wiederum bei einer Pulzeit von drei bis vier Sekunden pro Krabbe und auf der Basis einer Vierzig-Stunden-Woche zu einer Eigenheimfinanzierungspuldauer von gut zwanzig Jahren führte, Zinsbelastungen nicht eingerechnet. Da gleichzeitig aber noch drei Kinder und Olivers Mutter selbst zu ernähren und die Kreditzinsen zu bedienen waren, läßt sich sofort einsehen, daß das erforderliche Pulprogramm die Kräfte und Möglichkeiten einer einzelnen Krabbenpulerin überstieg, weshalb Oliver und seine Schwestern von Anfang an in das Eigenheimpulprojekt mit einbezogen wurden. Aus dieser Zeit stammte Olivers Begeisterung für optische Vergrößerungsinstrumente, für Brillen, Linsen und Lupen aller Art.
Immer wenn er als Junge in der vom Meerwassergeruch der Krabben erfüllten Küche saß, überkam ihn ein nahezu zwanghaftes Bedürfnis, die grauen, von Ferne nur wie gekrümmte Larven aussehenden Gebilde durch die vergrößernden Sehhilfen seiner vom ständigen Pulen weitsichtig gewordnen Mutter zu betrachten. Die Brillen offenbarten eine erstaunliche Fülle von anatomischen Details. Sie machten aus den kleinen Krabbentierchen wahre Monster; winzige Scherchen wurden sichtbar und haarfeine Fühler, schuppig gegliederte Schwänze und kurze gekrümmte Beinchen. Der Vergrößerungseffekt kam Oliver wie Zauberei vor, wie eine wundersame Vermehrung von Realität. Die Brillenwirklichkeit schien reichhaltiger zu sein als die unbebrillt wahrgenommene, abenteuerlicher und gefährlicher.
Später, als junger Mann, stellte er sich vor, es müßte etwas Besonderes sein, Frauen durch Brillen zu betrachten. Er selbst brauchte keine, jedenfalls damals nicht. Seine ersten sexuellen Erfahrungen waren hungrige, aber wenig draufgängerische Liebeserlebnisse, die ihm das Gefühl vermittelten, nichts oder viel zu wenig über die Liebe zu wissen. Vielleicht stand die zu entdeckende Wahrheit in einem Buch, sagte er sich. Oder ihre Kenntnis ließ sich nur als Erfahrung auf der Straße erwerben, dort, wo die Jungen die Mädchen verachteten, die trotzdem, wie zur Belohnung, mit ihnen schliefen. Aber es gelang Oliver nicht, Frauen zu verachten, obwohl er sich ihnen immer unterlegen gefühlt hatte (und auf eine unbestimmte Weise noch fühlte). Immer wenn er mit einer Frau zusammen war, kam es ihm vor, als würde er irgend etwas übersehen. Aber er kam nie dahinter, was es war. Und eine Brille, die ihm diese Wahrheit gezeigt hätte, fand er nie.
Als seine Mutter starb, verkauften seine beiden Schwestern und er das zusammengepulte Haus einvernehmlich und zügig und drittelten den Erlös. Einst in einem bäuerlich geprägten Vorort gelegen, war das Grundstück (das Haus selbst war mehr oder weniger wertlos) als Immobilie inzwischen fast auf das Zehnfache seines ursprünglichen Wertes gestiegen. Es wurde für Oliver zu einem Eigenkapitalgrundstock, den er zur Finanzierung seines Hauses nutzte. Er staunte darüber, daß die von ihm einst im zarten Alter von sieben oder acht Jahren gepulten Krabben jetzt, in seinen mittleren Jahren, derart üppige Zinsen abwarfen. Genaugenommen hatte er also bereits als Junge damit begonnen, unter der beharrlichen Regie seiner Mutter ein Eigenheim zu erwirtschaften. Als sie nur noch Asche war, fühlte er sich zutiefst schuldig, weil er ihr niemals die Liebe gegeben hatte, auf die sie ein Anrecht gehabt hätte. Wahrscheinlich würde es ihm nicht gelingen, jemals zu ergründen, was Frauen im Innersten von ihm erwarteten; aber für seine krabbenpulende Mutter war die männliche Seele kein Mysterium, sondern das Mark eines Groschenromans gewesen: Frauen hatten es mit unverbesserlichen Herumtreibern zu tun.
An einem Tag im April saß Oliver im Wagen und fuhr von seinem Geschäft nach Hause. Kurz nach dem Tod seiner Mutter waren Do und er diese Strecke zum ersten Mal gefahren, ausgestattet mit einem Makler-Exposé, um das Haus zu besichtigen, das sie vielleicht kaufen wollten, da er nun Geld hatte. Das war fünf Jahre her; Oliver hing seinen Erinnerungen nach und sah nachdenklich aus dem Fenster. Die Ahornbäume an der S-Bahnstation verschatteten sanft die Straße, bei den Eichen vor dem Postamt konnte man die Blattsprossen erahnen, aber die Äste der knorrigen Robinien griffen noch so nackt und klauenhaft in den Himmel, als sei der Frühling ein bloßes Gerücht – eine Austriebsvorsicht, die an diesem lauen Abend unpassend wirkte, geizig oder sogar ungastlich, weil die Vögel damit begonnen hatten, ihre Nester zu bauen, und auf dem Präsentierteller eines kahlen Geästes würden sie sich nicht niederlassen. Oliver dachte: Wer sich zulange ziert, geht am Ende leer aus.
Vor drei Wochen hatte Do ihm erzählt, daß ein Zauberer das seit einem Jahr leerstehende »Le-Corbusier-Haus«, wie sie es nannte, gekauft hatte. Oliver steuerte den Wagen gemächlich vom Weißdorndamm in die Märkische Straße, und das Kopfsteinpflaster ließ die Armaturen vibrieren. Üblicherweise nahm er nach Geschäftsschluß einen schnelleren Weg, aber an einem Abend wie diesem gefiel es ihm, durch das alte Viertel mit seiner hundertjährigen Vegetationspatina zu zuckeln. Ein paar mit kleinen Säulenportalen versehene Häuser stammten noch aus der ersten Besiedlungswelle zur Kaiserzeit; in den zwanziger und dreißiger Jahren waren andere, einfachere hinzugekommen, eingebettet in das vielfältige Grün der Gärten und Baumkronen, als wäre das ganze Viertel weich bemoost.
Oliver war neugierig auf dieses »Le-Corbusier-Haus«. Die intensiven Strahlen der niedrig stehenden Sonne trafen die frisch gestrichene Fassade dramatisch, und es leuchtete im dunklen Moosgrün des Viertels auf wie ein Barren Gold. Oliver ließ den Wagen langsamer werden. Das Gebäude war rechteckig mit einer links aufgesetzten tellerrunden Dachterrasse, deren Ränder über den ersten Stock hinausragten. Dahinter erhoben sich dunkle, majestätische Tannen in den Himmel, allem Anschein nach war die Gartenbepflanzung ebenso alt wie das Gebäude selbst, so daß sich ein auffälliger Kontrast zwischen dessen klassischer Modernität und einer Art Caspar-David-Friedrich-Naturkulisse ergab. Es überraschte Oliver, wie scheinbar unsichtbar das Haus für ihn gewesen war, solange es noch sandgrau und mit abblätterndem Putz im Schatten der Bäume vor sich hingedämmert hatte.
Er ließ den Wagen an den Straßenrand rollen. Dabei dachte er an das von Helma Kienapfel vor einem Monat in die Welt gesetzte Gerücht, der neue Besitzer sei Zauberer. Er stieg aus und betrat das Grundstück. Der Sockel vor dem Hauseingang war aus dunklem Basalt und übersprenkelt mit Farb- und Putzspritzern. Weil er sich beobachtet fühlte, huschte Oliver um die rechte Gebäudeecke und tauchte zwischen zwei Rhododendronbüschen durch, die wie zwei alte, mehr als mannshohe Wächter den hinteren Teil des Gartens zur Straße hin abriegelten. Der frische weiße Fassadenanstrich, der auf der Gebäudevorderseite sonnenhaft geleuchtet hatte, verbreitete im Reich der alten Tannen die Lichtstimmung ständiger bläulicher Dämmerung.
Die gläserne Terrassentür war nur angelehnt. Oliver glaubte nicht, daß innen noch gearbeitet wurde, er nahm an, daß man vergessen hatte, die Tür zu schließen. Als Nachbar, dachte er, könnte er es wagen einzutreten. Innen roch es säuerlich nach frischem Putz und den Ausdünstungen trocknender Wandfarbe. Er betrat eine Art Salon mit L-förmigem Grundriß, der Raum hatte fünf hochformatige, bis zum Boden reichende Fenster, deren mittleres zugleich die Glastür war. Auf dem Boden war Pappe ausgerollt, und das allgegenwärtige Renovierungsgrau verbreitete ein gespenstisches Licht. Oliver hatte das Gefühl, sich in einen Schatten zu verwandeln. Rohranschlüsse verschwanden dunkel in den Wänden, und Elektrokabel hingen schlaff von den Decken. In der Mitte des Hauses führte eine Treppe hinauf, von dort fiel ein farbiger Lichtrest, eine Sonnenandeutung ins Erdgeschoß.
Und es klangen Stimmen herunter. Oliver fragte sich, was besser wäre: zu verschwinden oder sich als Nachbar vorzustellen. Unentschlossen blieb er auf dem Treppenabsatz stehen. Genaugenommen war es nur eine Stimme, die dort oben mehr oder weniger monologisierte, kehlig und tief, lässig und einnehmend und ohne erkennbaren Dialekt. Dies, verkündete sie soeben, solle das Schlafzimmer werden! Hier sei etwas Besonderes zu finden, etwas ganz und gar Einzigartiges, eine Farbsensation, die den Raum gleichsam verschwinden lasse, die seine steinerne Materialität in Licht, in ein lebendiges Spiel von Schwingungen auflöse.
»Als Maler«, sagte die Stimme, »sollte Ihnen das, was ich sage, nicht vollkommen fremd sein.« Oliver hörte das Schnappen eines Feuerzeugs und das gedehnte Ausblasen von Rauch. »Was hier in diesem Raum geschehen soll, sind Verwandlungen! Ich beschäftige mich beruflich mit dem Senden und Empfangen von geistiger Energie. Was halten Sie von Lavendelblau? Oder dem vollen sämigen Farbton von Akazienhonig. Ich könnte mir auch das rötliche Schimmern des Mars vorstellen, also eine Art inneres Rubinleuchten. Oder aber das transparente präzise Grün mit mal bläulichem mal gelblichem Einschlag, wie man es in den Augen von Katzen findet…«
Die über Farbnuancen räsonierende Stimme kam näher, und Oliver beschloß, lieber zu verschwinden. Indem er die Füße langsam aufsetzte und eilig abrollte, ging er durch den Flur zurück ins Wohnzimmer und huschte durch die Terrassentür in den Garten. Im Schutz der beiden gewaltigen Rhododendren schlich er zur Grundstücksgrenze, und da niemand ihm etwas nachrief, nahm er an, daß er unentdeckt geblieben war. Aber als er sich auf dem Gehweg seinem Wagen näherte, kribbelte sein Rücken, als sende ihm Balthasar Schrödinger, auf seiner Dachterrasse stehend, mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger einen jener magischen Bannstrahlen nach, die in Zeichentrickfilmen durch glitzernde gezackte Linien dargestellt werden.
Zu erregt, um sogleich nach Hause zu fahren und Do in seinem nervösen Zustand gegenüberzutreten, gondelte Oliver noch ein wenig durchs Viertel. Die Natur beruhigte ihn. Die Äste der Kastanien hatten sich unter dem Gewicht ihrer jungen Blätter der Straße entgegengesenkt und formten dämmrige Tunnel. Seitlich sprenkelten helle Nadelbaumtriebe die Vorgärten. Endlich war die Natur wieder größer als die Zäune. Heckenschößlinge schlängelten sich durch Drahtmaschen, bis sie wieder gekappt werden würden. Dieses ständige Ringen um Vorherrschaft, die Natur als eigentlicher Zauberer: Kaum sieht man nicht hin, ist auch schon etwas da, wo vorher nichts war. Das große Varieté des Frühlings: Blüten in allen Knopflöchern der Vegetation. Büsche, die mit Hunderten von Knospen jonglieren. Die Hochseilakte der Eichhörnchen, der Cancan der Tulpen in den Brisen. Und Pusteblumen, die auf den Wiesen schaukeln wie Schaumblasen. Die Natur ein Theater der Illusionen, eine Zauberei aus dem Nichts, ein großes glamouröses Prahlen zum Zweck der Fortpflanzung. Oliver dachte: Das Geheimnis bei jedem Zauber ist die Ablenkung, und vermutlich ist es bei der Liebe genauso. Zum ersten mal seit langer Zeit dachte er wieder an seinen Vater und dessen Liebesabenteuer. Na schön, dachte er, vielleicht bin ich der Sohn eines Zauberers. Na schön, warum auch nicht. Aber wie geht es nun weiter?
3
Es war – wenig verwunderlich – Helma Kienapfel, Dos beste Freundin, die es in die Hand nahm, Balthasar Schrödinger gesellschaftlich in seine zukünftige Nachbarschaft einzuführen. Von Anfang an war Helma stets aufs präziseste informiert gewesen über den Umbau des »Le-Corbusier-Hauses«, wie auch sie die von Schrödinger erworbene Immobilie zu nennen pflegte. Sie entlockte den Handwerkern, diesen ewig wortkargen Seelen, wichtige Renovierungsdetails, und es gelang ihr als »unmittelbar betroffene Anwohnerin« beim zuständigen Bauamt (nicht ganz legal) Einsicht in die Flurkarten zu nehmen. Sie analysierte die architektonischen Entwurfszeichnungen aus den zwanziger Jahren, die als vergilbte Originale in irgendeinem Archiv die Zeiten überdauert hatten, und ihre Recherchen förderten in etwa folgende Geschichte zutage: Das »Le-Corbusier-Haus« war von einem gewissen Ulf von Schwielow in den späten neunzehnhundertzwanziger Jahren entworfen worden. Von Schwielow (fand Helma auf irgendeiner Internetseite) hatte in der Gruppe um Walter Gropius kurzzeitig eine aufstrebende Rolle gespielt, bis er auf geheimnisvolle Weise verschwand. Sein damaliger Auftraggeber, ein mittelständischer Handschuhfabrikant aus Vorpommern, lebte mit seiner Familie nur zwei oder drei Jahre in dem avantgardistisch konzipierten Haus. Danach verkaufte er es nach einer Reihe von offenbar glücklosen Spekulationen. Helma kannte ein altes Ehepaar, das bereits seit siebzig Jahren im Viertel ansässig war. Die beiden erzählten ihr bei Kaffee und Kuchen, daß der ambitionierte Bau ungewöhnlich häufig den Besitzer gewechselt hatte. In den siebziger Jahren ließ ein ungarischer Nachtclubbesitzer einen Swimmingpool mit einer direkt aus dem Schlafzimmer im ersten Stock hinausführenden Wendeltreppe als Direkteinstieg anbauen. Doch kaum war der Swimmingpool fertig, wurde der Ungar bei einer Auseinandersetzung im Rotlichtmilieu erschossen. Ein junger Architekt und Stilpurist ließ den Pool in den späten Achtzigern wieder zuschütten und die Treppe entfernen, kurz bevor seine kinderlose Ehe zerbrach und das Haus erneut den Besitzer wechselte. Es wurde vermietet und verkam zusehends. Die Bäume begannen die Fassade zu überwuchern, der Putz blätterte ab, und schließlich wollte niemand mehr darin wohnen. Unter den Anwohnern im Viertel setzte sich die Meinung durch, daß irgendwann eine junge Familie die Immobilie erwerben und das Haus vermutlich abreißen würde. Nun war es zur Überraschung aller anders gekommen. Helma Kienapfel befand, daß das Haus für eine einzelne Person im Grunde viel zu groß sei. Aber natürlich konnte man nicht wissen, wie viele Räume ein Zauberer wirklich brauchte und ob es beispielsweise einen Bedarf für Laboratorien und Werkstätten gab. Sonderbarerweise ging niemand – weder Helma noch Do noch eine ihre Freundinnen, Bi Odenthal oder Heike Degen oder irgendwer – je davon aus, Balthasar Schrödinger könnte verheiratet sein und Familie haben. Daraus läßt sich vielleicht schließen, daß der spirituelle Ruf von Zauberern dem vom Priestern oder Asketen gleicht. Man nimmt an, daß ihnen bestimmte menschliche Aktivitäten wie Familiengründung oder Fortpflanzung nicht viel bedeuten, weil sie wissen, daß die materielle Welt nur ein großangelegtes religiöses oder philosophisches oder psychologisches Täuschungsmanöver ist. Doch wie auch immer: Es stellte sich schließlich heraus, daß Balthasar Schrödinger tatsächlich unverheiratet war. Und damit ergab sich als eine der ersten Fragen, die in nächster Zeit von den Bewohnern des Viertels zu beantworten sein würden (beispielsweise bei solchen Abenddiners in intimer Runde, wie Helma Kienapfel sie mit großer organisatorischer Perfektion zu veranstalten wußte), wozu der frisch hinzugezogene Zauberer die sieben Zimmer des »Le-Corbusier-Hauses« im einzelnen eigentlich brauchte.
Do stand mit einen Blumenstrauß und einer Flasche Wein als Gastgeschenk in der Hand in Helmas Vorgarten und wartete auf Oliver, der das Gartentor schloß. Der Weg zur Haustür war malerisch angelegt. Unregelmäßig gebrochene gelbe Natursteinplatten führten an einem mückenumschwirrten Ginster und zwei üppig austreibenden Rosenstöcken vorbei. Die Abendsonne flimmerte golden durch die noch lichten, frisch belaubten Kronen der Birken im Garten. Über allem lag (wie sollte es auch anders sein) ein sehr frühlingshafter Zauber.