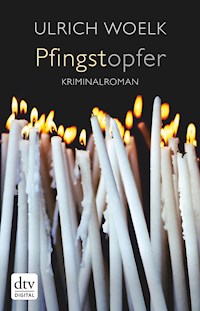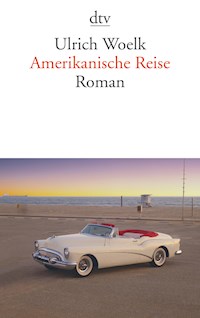9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
»Alles, was mit uns geschieht, ist eine Mischung aus Zufall und Notwendigkeit, aber Verlass ist nur auf den Zufall.« Ein Berliner Mathematikprofessor praktiziert die Chaostheorie im eigenen Leben. Als ein bekannter Feuilletonredakteur in ihm den Sensationsschriftsteller Leon Zern zu erkennen glaubt, lässt er sich von seiner Agentin dazu überreden, das falsche Spiel mitzumachen. Statt als bescheidener Verfasser eines kleinen mathematischen Fachbuchs gilt er hinfort als Urheber eines grausamen Bestsellers, in dem nach angeblich mathematischen Prinzipien (die sich für sein geschultes Auge als völliger Humbug erweisen) reihenweise junge Frauen geschlachtet werden. Und dann erklärt ihm auch noch die äußerst selbstbewusste Liebesdienerin »Joana«, der er jeden Freitagnachmittag seine ganze Person anvertraut, dass sie jetzt ebenfalls Autorin geworden sei. Er möge ihr Manuskript doch unter seinem Namen veröffentlichen. Wundert es irgendjemand, dass der autobiographische kleine Roman ein Erfolg und die schöne Joana zur Hauptdarstellerin wird auf der Bühne des Lebens? Eine böse Satire auf den Literaturbetrieb, ein Kompliment an die Mathematik und eine Huldigung an die Stärke der Frauen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Ähnliche
Ulrich Woelk
Joana Mandelbrot und ich
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2008© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40394-8 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-24664-4Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen…und seine Zahl ist sechshundertsechsundsechzig.
Offenbarung des Johannes
In vielen Fällen geht der Zufall über das gewünschte Ziel hinaus. Mit anderen Worten, die Kraft des Zufalls wird gemeinhin unterschätzt.
Benoît MandelbrotDie fraktale Geometrie der Natur
2
»Paul«, sagte Joana zu mir, »ich sehe dir an, daß du nicht glücklich bist. Laß uns etwas dagegen unternehmen.«
»Wie sollte ich auch glücklich sein?« entgegnete ich. »Meine Ehe existiert nur noch auf dem Papier, und meine Tochter hat eine Rechenschwäche.«
Wir saßen in der kleinen schummrigen Bar, in der hier die Gäste empfangen wurden. Joanas Kolleginnen kannte ich nur vom Sehen, das aber ziemlich gründlich – so war es Sitte hier. Wir alle trugen nicht viel am Leib; ich ein Frotteehandtuch und Joana ein kurzes, transparentes Stück Stoff, wie Frauen es sich am Strand um die Taille schlingen. Wir schmiegten uns auf einer roten Plüschcouch aneinander und lauschten der Musik, die sanftrhythmisch dahinstrich. Ich trank einen leichten Weißwein und Joana Wasser. Der Rand ihres Glases war mit einer aufgesteckten Limettenscheibe verziert. Über die Phase, in der ich mir ihre Gesellschaft mit einer Flasche Champagner verdienen mußte, waren wir hinweg. Seit wir uns kannten, hatte ich fünfzig oder sechzig Mal mit ihr geschlafen, so häufig wie mit keiner anderen Frau außer Liv.
Beim ersten Mal, vor etwas mehr als einem Jahr, hatte ich – bar jeder Erfahrung auf dem Feld der käuflichen Liebe – nicht gewußt, was mich erwartete. Joana führte mich damals recht bald in eins der Séparées, und dort sollte ich mich aufs Bett legen und entspannen. Dann tat sie, wovon sie annahm, daß ich es wollte. Ich konnte dabei aber kaum etwas von ihr sehen, vor allem ihr Gesicht nicht, sondern nur eine Art Zelt aus Haaren. Sie hatte allerdings sehr schöne Haare, lang und lockig und schwarz. Sie stammte aus Ecuador (jedenfalls behauptete sie das). Es war aber durchaus möglich, daß sie südamerikanische Wurzeln hatte. Sie erzählte mir sogar die Geschichte, wie sie angeblich nach Europa und schließlich nach Berlin gekommen war, einem von Amors Pfeilen folgend. Es war eine erotische Geschichte, die mich erregen sollte, aber sie machte mich eher eifersüchtig. Die meisten ihrer Kolleginnen stammten aus den ehemaligen Ostblockstaaten – aus Polen, Rußland oder der Ukraine. In ihrer Mitte wirkte Joana mit ihrer dunkel schimmernden Haut tatsächlich ein wenig exotisch. Augen, Nase und Mund füllten ihr Gesichtsrund großzügig und harmonisch aus. Ihre Stirn verschwand fast vollständig unter den Haaren, und wenn die Arbeitstemperatur in den Séparées, die nahe bei dreißig Grad lag, sie zu sehr erhitzte, klebte die eine oder andere gelockte Strähne an ihren weichen Wangen.
Wir hatten eine halbe Stunde bei jenem ersten Mal, und es drängte mich nicht, schnell ans Ziel zu kommen. Wir lagen nebeneinander und unterhielten uns. Sie erkundigte sich nach meinem Beruf, aber es war unmöglich, ihr mit wenigen Worten zu erklären, womit ich mich beschäftigte. Ich sagte, vieles in meiner Wissenschaft sei wie ihre Haare, und das stimmte. Ihre Locken erinnerten mich an ein Bild von Leonardo da Vinci, das ›Die Sintflut‹ hieß und einen verwirbelten Wasserstrom darstellte. Solche Muster untersuchte ich. Allerdings wußte Joana nicht genau, ob sie sich durch den Vergleich mit der Zeichnung da Vincis geschmeichelt fühlen sollte oder nicht. Die Sintflut, sagte sie, sei immerhin eine Strafe Gottes gewesen. Das klang für mich so, als wäre sie katholisch – und aus irgendeinem Grund glaubte ich, daß das für ihren Beruf von Vorteil war.
Ich bat sie, ihren Namen mit dem Zeigefinger auf meinen Rücken zu schreiben. Ich hatte dabei den Eindruck, daß sie begann, mißtrauisch zu werden, denn uns blieben nur noch zehn Minuten. Es war in ihrem Gewerbe wohl immer Vorsicht angebracht bei der Bitte um etwas anderes als sexuelle Befriedigung. Sie erklärte sich aber bereit, mir meinen Wunsch zu erfüllen. Ich drehte mich auf den Bauch und sie schrieb mit dem Zeigefinger ihren Namen auf meine Haut. Ich genoß das sanfte Kitzeln am Rückgrat und erklärte ihr, daß ihr Namenszug mit seinen o- und a-Wirbeln und seinen n-Wellen ebenfalls eine Art Flut sei – wie ihre Haare und wie Leonardos Zeichnung. Auf allen Ebenen und Größenordnungen der Dinge stoße man auf die gleichen Formen. Ich sagte all das mit einer etwas unangemessenen Ehrfurcht angesichts der Tatsache, wo ich war.
Doch Joana erfaßte meine Stimmung, und mein Ernst erschien auf ihrem Gesicht wie auf einem Spiegel. Es war ein Teil ihres Berufes, jedem meiner Worte Verständnis und Wertschätzung entgegenzubringen. Und ich lebte gerne in der Illusion, daß es so war. Ich genoß es, in Gegenwart einer Frau über mich reden zu können, ohne schon nach wenigen Sätzen unterbrochen und daran erinnert zu werden, daß ich nicht der einzige Mensch auf der Welt sei.
Daß ich von Wirbeln und Fluten sprach, nutzte sie, um wieder auf den Zweck meines Besuches zurückzukommen. Unsere Zeit lief ab. In diesem Moment wurde mir bewußt, daß ich mich vor dem Erreichen der sexuellen Befriedigung fürchtete. Ich hatte den Umschlag von Ekstase in Ernüchterung in den zurückliegenden Jahren ausschließlich mit Liv erlebt. So sehr wir einander auch haßten, dafür hatte es oft noch gereicht. Doch jetzt wäre es nicht Liv, die mich dabei sehen würde, und das beunruhigte mich. Zugleich fühlte ich mich Joana gegenüber aber verpflichtet, meiner Rolle als Freier gerecht zu werden. Ich hatte so lange geredet, und nun einfach zu gehen, wäre mir wie eine Taktlosigkeit vorgekommen, eine Mißachtung ihres Lebens und ihrer Person. Zwar wußte ich nicht, ob ich an ihrer Seite überhaupt zum Mann werden konnte, doch stellte sich schnell heraus, wie unbegründet diese Sorge war. Ihre Erfahrung als Hure war meinem verkorksten Seelenleben haushoch überlegen. Und so überließ ich mich ihr mit einem unerwarteten Ergebnis: Als wir uns voneinander verabschiedeten, war ich auch schon in sie verliebt.
Das war nun mehr als ein Jahr her. Mittlerweile wußte sie viel von mir, ich aber fast nichts über sie, abgesehen vielleicht von ihrem Musikgeschmack und den Duftnoten, die sie bevorzugte. Ich wußte beispielsweise nicht, wie viele Stammkunden sie hatte – und ich wollte es auch nicht wissen. Bei dem Gedanken, wie viele Männer es in unserer Stadt vermutlich gab, die in derselben Lage waren wie ich, wurde mir schwindlig. Und ich fragte mich, wie Joana in ihrem Kopf Ordnung hielt, wie sie die vielen Lebensbeichten, die sie wohl Nacht für Nacht zu hören bekam, in ihrem Gedächtnis trennte und abspeicherte. Zweifellos waren diese Beichten einander sehr ähnlich. Doch seit ich Joana kannte, hatte sie meine Geschichte noch nie mit der eines anderen Kunden verwechselt und Liv versehentlich Helga, Irmgard oder Susanne genannt. Sie prägte sich jedes Detail sicher ein, und so sagte sie auch jetzt: »Meintest du nicht, das mit der Rechenschwäche deiner Tochter wäre eine Erfindung deiner Frau? Liv will dich damit verletzen.«
Ich hatte ihr recht bald von Liv erzählt – und warum auch nicht? Ich nahm an, daß Joana ein gewisses Gespür für die weibliche Seite meines Problems hatte. Jedenfalls dachte sie nicht lange über meine Lage nach, sondern erklärte mir recht bald das Folgende: Vermutlich war Liv von ihrer Mutter nicht genügend geliebt worden und hatte sich vorgenommen, bei ihrer Tochter nicht den gleichen Fehler zu begehen. Daher investiere sie ihre gesamte emotionale Energie in ihre Mutterrolle, so daß für mich, ihren Mann, nichts mehr übrigblieb.
Ich fand, das klang sehr vernünftig. Außerdem hatte diese Theorie zwei sehr nützliche Aspekte: Erstens konnte ich nämlich gegen die Tatsache, daß Liv mich nicht mehr liebte, nur wenig, beziehungsweise überhaupt nichts ausrichten, denn an ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter und an der Vergangenheit war ich nicht schuld. Und diese Dinge waren auch nicht mehr zu ändern. Und zweitens gab mir Joanas Theorie das Recht, das Defizit an Liebe, unter dem ich unverschuldet zu leiden hatte, irgendwo auszugleichen, denn niemand konnte auf Dauer ohne Zärtlichkeit und menschliche Nähe existieren.