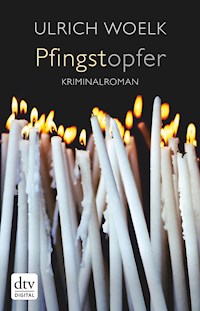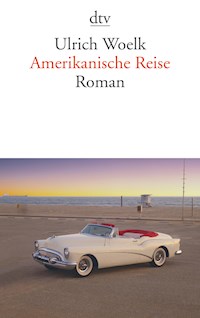8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Was Ulrich Woelk schreibt, ist eine großartige Prosa, ganz auf der Höhe der Zeit.« Süddeutsche Zeitung »Was Ulrich Woelk schreibt, ist eine großartige Prosa, ganz auf der Höhe der Zeit.« Süddeutsche Zeitung Freigang‹ erzählt die Geschichte des jungen Physikers Zweig, der seine Vergangenheit zu rekonstruieren versucht. Zwischenstationen auf dieser Reise durch seine Erinnerungen sind ein baufälliger Palast in Italien, ein mindestens ebenso geheimnisvoller Turm in Deutschland, der Besuch in einem fingierten Spielcasino, der Abstecher in ein reales Rotlicht-Kino, bierselige Gespräche in einer Kneipe und ein Vatermord.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Ulrich Woelk
Freigang
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte Ausgabe
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
© 2005 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40163-0 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13397-5
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de
Wenn es keinen Gegner gäbe,
müßte man einen erfinden.
Inhalt
Ich habe meinen Vater ...
Meine Prüfungsvorbereitungen vor zwei ...
In den Tagen nach ...
Das ›Karo‹ war meine ...
Ich gebe Früger zuviel ...
Nina hatte entschieden, das ...
Die Situation hier macht ...
Ich stehe am Fenster.
Schwester Leonie hat mich ...
Ich robbte und kroch ...
Früger hat sich seit ...
Die ersten Tage des ...
Es regnet sich ein.
Was ich beabsichtigt habe ...
Schwester Leonie war im ...
Fahrt durch begrünte Hügel ...
Ich stehe am Fenster ...
Ich habe meinen Vater umgebracht.
Die Idee kam im Suff. (Ich schwöre es.)
Schreiben als Funktion des Gedächtnisses: Ich schreibe,
um Nina noch einmal zu erleben.
Seit meiner Einlieferung werde ich nicht müde zu gestehen. Ich gestehe den Ärzten, insbesondere Doktor Früger, den Pflegerinnen und Pflegern, insbesondere Schwester Leonie.
Seit der Nacht: Neonlicht, die Glastür, die Friedenstaube, die Treppen, Nina in der Dunkelheit.
Seit der Nacht gestehe ich, hartnäckig, verlange ein ordentliches Verfahren.
Was schreckt die Gerichte ab, sich für meinen Fall zu interessieren? Warum überlassen sie mich bereitwillig Doktor Früger?
Allein die Umstände meines Geständnisses: Nina, die vor mir zurückweicht, unbekleidet; allein die Umstände müßten für eine Strafverfolgung ausreichen.
Mein Geständnis: Alle zeigen sich interessiert, doch die Art, mit der sie darüber hinweggehen, befremdet mich, macht mich von Zeit zu Zeit mutlos.
Früger mit seinem weißen Kittel. Die Hornbrille, mit der er nicht spielt, während er redet: er nimmt sie nicht ab, zeigt nicht mit ihr auf imaginäre Punkte, betrachtet sie nicht nachdenklich oder putzt sie gar, um einer belanglosen Rede Bedeutung zu verleihen. Hat er mich begrüßt, versenkt er die Hände meist in den Taschen des weißen Kittels, nimmt sie nur heraus, sich gelegentlich zu kratzen.
Was erwartet man von mir? Was kann man mehr von mir verlangen, als daß ich geständig bin?
Nina trifft keine Schuld.
Einmal zu Früger: Die Justiz ist hochmütig geworden. Sie fühlt sich durch ein Geständnis beleidigt, empfindet es als Zweifel an ihrer Fähigkeit, einen Fall auch ohne die bereitwillige Mithilfe des Angeklagten zu klären. Nur in einem Indizienprozeß können Staatsanwalt und Verteidiger glänzen. Und die Richter? Sie fühlen sich durch ein Geständnis zur Nutzlosigkeit verdammt: ein Richter, der nichts zu richten hat.
Das Geständnis macht den Angeklagten zum Herrn des Prozesses, was ihm nicht verziehen wird; er wird ignoriert und dem überlassen, der ihn haben will, zum Beispiel Ihnen, Früger. Einen Leugnenden würde man Ihnen niemals so widerstandslos aushändigen. Sie sind der Müllschlucker der Justiz.
Ich erwarte keine große Verhandlung; ein, zwei Tage genügen. Ich bin bereit, die Urteilsbegründung selber zu verfassen.
Es kommt vor, da bilde ich mir ein, Früger habe nicht nur ein medizinisches, sondern ein menschliches Interesse an mir, aber es trifft wohl zu, daß diese Unterscheidung für ihn keine ist. Menschsein ist für ihn etwas Pathologisches an sich, der kranke Mensch eine Tautologie. Menschen handeln, um etwas zu erreichen, Handlung und Motiv sind im Wesen dasselbe. So Früger einmal.
Morgens fragt er mich regelmäßig, ob ich Zeitung gelesen hätte. Ich antworte immer gleich: Warum sollte ich?
Bereits seit längerem verlange ich meine Abenteuergeschichten. Früger mag es lächerlich vorkommen, daß ich an zu Kinderzeiten Geschriebenem hänge. Die Ursachen haben ihn nichts anzugehen: ich bin nicht wegen meiner Marotten hier, sondern wegen meines Mordes. Im übrigen kann ich ihm die Geschichten durchaus empfehlen: Ich erdachte Welten aus Ruinen und geheimen Gängen, in denen es mir besser gefiel als in der Wirklichkeit. Das müßte doch etwas für ihn sein: Bereits in der Kindheit angelegter Kampf zwischen Realität und eigener Scheinwelt, möglicherweise Untrennbarkeit beider, dadurch Realitätsverlust.
Früger einmal: Warum lesen Sie keine Zeitung? Es passiert viel in der Welt, Katastrophen, wobei ich nicht an die großen Unglücke denke, Flugzeugabstürze, Hotelbrände, wer sind die Opfer? Tote ohne Vergangenheit; gestorben wird überall.
Vergessen Sie die erste Seite der Zeitungen und blättern Sie weiter. Auch heute, Seite acht oder neun, hinter Blick-in-die-Welt und um Längen geschlagen vom Sport, eingepfercht in Lokales und auch dort erdrückt von einem übermächtigen Schützenfest, dort habe sich eine wahre Katastrophe ereignet: Ein Mann, extrem kurzsichtig, praktisch blind ohne Brille, habe im Gebirge gerade diese Brille verloren, möglicherweise durch eine ungeschickte Bewegung, was nicht mehr rekonstruierbar. Chancenlos habe er dem Rückweg durch das unwegsame, steile Gelände gegenübergestanden, drei Tage auf Hilfe gewartet, aber niemand habe ihn vermißt. Dann sei er ohne Brille los. Man fand ihn am Grund eines Felsabhanges, tot selbstverständlich.
Früger ist eine typische Zeiterscheinung: Ihn interessieren nur Dinge, die den Keim einer Katastrophe in sich tragen. Daß er mit der Art der Unglücke wählerisch ist, ändert nichts daran.
Ich habe ihn jetzt ultimativ aufgefordert, meine Geschichten zu besorgen.
Frügers Rhetorik: Er flickt immer wieder bestimmte Worte wie Leitmotive in seine Rede. Das psychologische Netzwerk, nach dem das geschieht, habe ich noch nicht auflösen können. So vergeht kein Gespräch, in dem er nicht das Gutachten erwähnt. In der von ihm aufgestellten Begründungshierarchie meines Hierseins nimmt das Gutachten einen der obersten Plätze ein, soviel ist klar. Dennoch ringt er ihm die unterschiedlichsten Aspekte ab. Mal ist es Aufmunterung; es sei bald fertig. Das klingt wie: bald ist alles vorbei, bald haben wir es hinter uns. Wenn ich will, kann ich hoffen, daß es demnächst zum Prozeß kommt, aber das muß nicht so sein. Es liegt bei mir.
Manchmal macht das Gutachten Schwierigkeiten. Die Schuld dafür kann ich bei mir suchen; ich muß mich mehr anstrengen, als gelte es, eine Prüfung zu bestehen, ein Examen zu einem unbekannten Fachgebiet. Möglicherweise liegen die Schwierigkeiten aber auch bei ihm, er kommt nicht weiter, er appelliert an meine Kooperationsbereitschaft.
Manchmal jedoch verweist er lediglich auf die Existenz des Gutachtens, ohne Erläuterung. Er steht lange schweigend und murmelt dann wie laut gedacht: Das Gutachten…, und versinkt erneut in tiefes Schweigen. Hier erscheint das Gutachten als das Bewegende überhaupt; das Ding-An-Sich meines, seines, unseres gemeinsamen Seins.
Es kommt vor, da halte ich es nicht aus. Ich stehe auf und brülle ihn an, daß ich gestanden habe.
– Wann bekomme ich endlich meine Geschichten. Ihre Geringschätzung rechtfertigt nicht Ihre Nachlässigkeit in dieser Hinsicht.
Er habe in der Sache telefoniert.
Die Unsicherheit, ob ich ihm glauben soll: Er ist Arzt; von Ärzten erfährt man die Wahrheit grundsätzlich nur auf Raten.
– Um was für Geschichten handelt es sich eigentlich? Ich wußte nicht, daß Sie schreiben.
– Schreiben, sagte ich, ist auf Dauer keine sinnvolle Beschäftigung für einen Physiker, weil sich die Präzision der Sprache nicht beliebig steigern läßt. Einfache Vorgänge können Sie noch mit einem vertretbaren Aufwand an Sprache hinreichend exakt beschreiben, aber wenn die mitzuteilenden Sachverhalte einen gewissen Komplexitätsgrad überschreiten, stehen Aufwand und Effekt in keinem Verhältnis mehr. Das heißt, Literatur ist etwas für Leute, die Zeit zuviel haben.
Manchmal hat er Lust auf Diskussion.
Wenn schon Kunst, dann Literatur. Er sehe einen großen Vorteil darin, daß sich die Dichter des Wortes bedienten, was sie kritisierbar, widerlegbar mache, was man von anderen Künsten nicht gerade sagen könne, er jedenfalls sehe keine Möglichkeit, eine Statue oder eine Sinfonie zu widerlegen. Sicher, auch Sprache könne kryptisch sein, und wer entscheidet, was gut ist, und warum ist jemand gut? Hierarchie der Befähigung, ein als naturgesetzlich hingenommenes Begabungsgefälle, Abdruck des politischen Machtgefüges; wer den Kaiser hat, braucht auch den Dichterfürsten. Aber welcher Künstler zaubert aus der hohlen Hand? Künstlerverehrung ist, als lobe man die Schöpfkelle anstatt der Suppe.
– Gut? Schlecht? entgegnete ich. Es gibt Unterscheidungen, die für einen Physiker keine sind, weil die Differenz zwischen beiden Zuständen keiner objektiven Messung zugänglich ist. Das Fehlen des Meßwertes ist gleichbedeutend mit dem Fehlen der Sache.
Er sah mich an: Und trotzdem schreiben Sie?
Früger stand am Fenster, vergrub seine Hände tief in den Taschen, dadurch entstanden zwei Ausbeulungen, groß wie Tennisbälle.
– Wir brauchen genauere Informationen.
– Sie haben mein Geständnis.
– Ich glaube nicht, daß es Mord war.
– Was denn?
– Totschlag, Mord im Affekt. Ich bin kein Jurist.
– Spitzfindigkeiten.
Ich bin fest entschlossen, mich seinem Dialogkalkül zu widersetzen.
Vor drei Wochen die Erkenntnis: Ich bin ihm nicht gewachsen. Der Grund: Es ist mir noch nicht gelungen, sein System, sein psychologisches Netzwerk zu entschlüsseln. Ich bin Physiker. Als solchem ist mir bewußt, daß Zusammenhänge in dem Moment beherrschbar werden, da sie enträtselt sind; ich zweifelte nicht daran, daß mir dies gelingen würde, nur Zeit brauchte ich und einen Schutz für die Dauer meiner Suche. Jedes Gespräch erhöhte die Dringlichkeit, er wurde von Mal zu Mal aggressiver, glaubte sich seinem Ziel bereits nah, bis ich ihn eines Morgens mit meinem Zettelkasten überraschte.
Er improvisierte wie ein Musiker mit seinen Leitmotiven; das ›Gutachten‹ erklang, ferner ›Mord‹ und ›Nervenzusammenbruch ‹. Er probierte verschiedene Kombinationen in der Hoffnung, endlich den Tristanakkord zu finden. Zu spät. Ich ging zum Tisch, wo seit gestern – Schwester Leonie hatte ihn mir nichtsahnend gebracht – ein alter Schuhkarton stand, angefüllt mit kleinen, aus Schreibmaschinenpapier geschnittenen Zettelchen. Ich notierte: Gutachten. Ich notierte: Mord. Ich notierte: Nervenzusammenbruch.
Was meine Zettel betrifft: Ich zweifele nicht daran, daß sie Früger ärgerten, aber er war zu stolz, einfach zu fragen, was ich da schriebe. Ich war Patient und er Chefarzt, als solcher hatte er mein Handeln ohne Erklärungen meinerseits zu verstehen.
Der zusätzliche Nutzen meiner Zettelchen: die Möglichkeit systematischer Forschungen. Auf ihrer Rückseite notierte ich den Dunstkreis, in dem das Motiv erklungen war. Nachts war ich oft stundenlang damit beschäftigt, die Blättchen auf dem Zimmerboden hin und her zu schieben, ein schlüssiges Beziehungsgeflecht herzustellen, das Spinnennetz zu entwirren, das Früger für mich gespannt hatte.
Ausgangs- und Mittelpunkt war stets das Gutachten, das ich mit verwandten Begriffen versuchte einzukreisen, wobei ich berücksichtigte, daß nur solche Worte im Kreis aneinandergrenzten, die ebenfalls oft in einem Atemzug genannt worden waren. Dieser erste Ring ging meist auf. Keine lästigen Querverbindungen störten die Symmetrie. Der Ansatz schien erfolgversprechend, doch regelmäßiges Scheitern beim zweiten Ring. Nie wollte er sich schließen, immer wieder Nahtstellen, an denen Begriffe, die sich wie zwei Gegenpole abstießen, nebeneinander zu liegen kamen.
Der Versuch, diese Widersprüchlichkeiten zu beseitigen: Ich sortierte um. Nächtelang. Umsonst. Immer zerbarst der Ring durch divergierende Kräfte, die manche Begriffe aufeinander ausübten.
Ich gebe nicht auf: Die Tatsache, daß ein Naturgesetz noch nicht gefunden ist, bedeutet nicht, daß es nicht existiert.
Frügers Machtlosigkeit angesichts meines Karteikastens: er beginnt von Nebensächlichem zu reden.
– Haben Sie schon etwas veröffentlicht?
– Was?
– Geschriebenes. Romane.
– Ich schreibe nicht mehr.
Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen und fülle meine Karten aus.
– Warum haben Sie aufgehört zu schreiben?
– Ich bin Physiker.
– Schreiben Sie als Physiker. Wider den Machbarkeitswahn!
– Die politische Wirkung von Kunst ist Kausalkonstrukt einiger Gesellschaftsromantiker.
– Dann schreiben Sie wieder Abenteuer.
Mein Zettelkasten brachte ihn sichtbar aus dem Konzept. Ich ließ mich nicht stören.
– Auf jeden Fall sollten Sie schreiben.
Dann ging er hinaus.
Kaum eine Stunde später klopft Schwester Leonie. Sie bringe eine Schreibmaschine.
Er will mich von meinen Zetteln ablenken, meine Konzentration auf sein System zerstreuen.
Schwester Leonie: der angehängte Name hat üblicherweise die Funktion, die verschiedenen Mitglieder des Pflegepersonals auseinanderzuhalten. Nummern würden es auch tun; reine Gewohnheit, Lebendiges durch Namen zu unterscheiden.
Dann der weiße Kittel; Berufsbekleidungseffekt, die Individualität verschwindet.
Immerhin geht es ihr nicht genau darum, für ein paar Stunden nicht Individuum, nicht verantwortlich sein zu müssen; das Soldatische fehlt ihr, was mich freut. Es ging nicht soweit, daß ich sagen könnte, sie war nicht im Dienst. Sie war es. Sie verhielt sich in allen Situationen, wie es von einer Schwester zu erwarten ist, durch Praxis geschult.
Trotzdem einmal zu Früger: Sie tut niemals nur die Pflicht, die nichts ist.
Wir unterhielten uns allgemein. Detaillierteren Fragen wich sie geschickt aus, antwortete diffus, nichtssagend, weitergehende Informationen zu geben, lag nicht in ihrer Kompetenz. Es war eines meiner Hauptziele, ihr Verwertbares in bezug auf meine Lage zu entlocken, doch ähnlich meinem Kampf gegen Früger scheiterte ich auch hier regelmäßig.
– Hat Früger Ihnen gesagt, warum Sie mir eine Schreibmaschine bringen sollen?
– Er sagte nur, Sie könnten protestieren.
Sie setzte sich in den Sessel, wie sie es manchmal tat, wenn auf der Station alles ruhig war, um sich zu unterhalten, meistens sehr allgemein, doch wurde ich das Gefühl nicht los, daß es sie interessiert hätte, auch Persönliches zu erfahren.
Vorstöße, etwas aus ihr herauszubringen, leitete ich meist mit einem Hinweis auf mein Geständnis ein, doch lernte ich bald, daß auf diese Weise nichts zu erreichen war; Früger hatte sie zu gut vorbereitet. Bereits das erste Mal, als ich ihr gegenüber die Tatsache ein Mörder zu sein erwähnte, schien sie nach einem erlernten Verhaltensmuster zu reagieren, spielte die grausige Aussage auf raffinierte Art herunter, als handele es sich um ein Verkehrsdelikt. Weise ich auf die Abscheulichkeit meiner Tat hin, so zuckt sie mit den Schultern, als werde es schon nicht so schlimm gewesen sein.
Hin und wieder nutze ich ihr Schweigen für Monologe, die mir hinterher unangenehm sind.
– Wissen Sie, was hier vorgeht? Früger betrachtet sich nicht als Arzt, sondern als Regisseur. Das ganze hier ist seine Bühne, wir sind seine Schauspieler. Er möchte meinen Mord inszenieren. Er hat eine Idee dieses Verbrechens im Kopf, ich habe noch nicht begriffen, welche, doch diese Idee, seine Version meiner Tat, möchte er unter allen Umständen durchsetzen. Ist er soweit, so soll das Stück vor Gericht Premiere haben. Richter, Staatsanwalt und Verteidiger sind für ihn nur Publikum, doch Zuschauer sind launisch, weshalb die Inszenierung so zwingend, atemberaubend sein muß, daß keine Fragen offen bleiben. Früger will keinen Flop.
Zur Zeit probt er, allerdings dürfen wir als seine Schauspieler im Unterschied zur herkömmlichen Bühne nicht wissen, daß wir Schauspieler sind, er kann keinen Text verteilen, den es zu lernen gilt, er kann vor Gericht nicht soufflieren. Um dennoch sein Stück zur Aufführung zu bringen, muß er unsere inneren Zustände derart manipulieren, daß wir selbst den von ihm gewünschten Text erfinden und sprechen; wir werden zu einem Sprachrohr, das schallt, ohne daß er hineinspricht.
Vielleicht halten Sie das alles für Hirngespinste, Nachwehen meines Nervenzusammenbruchs, aber ich sage Ihnen, das ist es nicht. Gerade Sie spielen eine wichtige Rolle in Frügers Stück. Geben Sie zu, daß er immer wieder mit Ihnen über mich spricht, daß er Ihnen mein Verhalten deutet, Reaktionen präjudiziert.
Das einzige, was anhand Astrologie erlernbar ist, ist die Arbeitsweise der Wahrsager; Dinge werden so vieldeutig und allgemein vorausgesagt, daß jede Zukunft auf das Orakel paßt, womit sich die Wahrsagerei als eigentliche Wurzel der Psychologie entpuppt, was bedeutet, daß Früger diese Methode in- und auswendig beherrscht, benutzt, meine Reaktionen vorherzusagen. Was hat er Ihnen eben gesagt? Wie hat er sich ausgedrückt? Er sagte, ich könne protestieren, also Widerstand leisten, wenn Sie so wollen. Und was tue ich gerade? Ich halte Sie auf, doziere über Früger. Er hat also scheinbar ins Schwarze getroffen. Scheinbar! Denn jede meiner Reaktionen stellt im Grunde Widerstand dar. Ist Krankheit selbst ihrem Wesen nach nicht Widerstand?
– Wenn Früger ein Schauspiel plant, so muß es auch Rollen geben. Welche Rolle ist denn für mich vorgesehen, Ihrer Meinung nach?
– Mitleid, sagte ich, Sie sollen Mitleid mit mir haben. Das ist Ihre Rolle.
– Ich habe kein Mitleid mit Ihnen.
– Was denn sonst?
– Sie sind ein Patient wie jeder andere auch. Der gestandene Mord ist Frügers Sache und geht mich nichts an. Woher also Mitleid?
– Ich sagte bereits: Früger probt noch mit uns. Wäre er fertig, hätten Sie Mitleid. Dann lädt er zur Uraufführung. Als Programm dazu verteilt er sein Gutachten.
Sie sah auf die Uhr und stand auf.
– Sie überschätzen Früger.
Dann ging sie hinaus.
Schwester Leonie ist ein Glücksfall. Zu dieser Überzeugung komme ich immer mehr.
Früger will, daß ich schreibe, also schreibe ich. Den Text für sein Stück werde ich ihm nicht liefern.
Sie hat Mitleid, auch wenn es ihr nicht bewußt ist. Warum sonst sollte sie sich Zeit für mich nehmen?
Ich notierte in den folgenden Tagen wahllos Gedanken, Reflexionen, die mir durch den Kopf gingen; die meisten kreisten um meine Lage. Ich machte Anmerkungen zu Früger, zu Schwester Leonie, über das Zimmer. Einmal bemühte ich mich, den immer gleichen Tagesablauf detailgenau zu schildern, um Sachlichkeit zu trainieren. Sachlichkeit, die ich für die Dinge, die ich zu beschreiben beabsichtigte, für dringend geboten hielt, zumal die Notizen nicht für mich allein bestimmt waren.
Frügers Preis für die Schreibmaschine ist meine Geschichte, dort glaubt er fündig zu werden. Er irrt. Die Gründe für meinen Mord werden nicht in dem zu finden sein, was er von mir erhalten wird. Er erwartet ein Fressen für seinen psychologischen Interpretationshunger, aber er wird Unverdauliches erhalten.
Wo seine Regeln nicht anwendbar sind: An der sachlichen Schilderung einer Geschichte, an einem Bericht, einem Abbild geschehener Realität.
Realität kann man nicht analysieren, sie ist. Einsteins Gleichungen entziehen sich psychologischer Interpretationskunst.
Ich werde Früger einen Strich durch die Rechnung machen. Er wird bekommen, was er erwartet: Geschriebenes. Doch es wird ihn enttäuschen. Es wird eine Geschichte sein, die sich so oder ähnlich bereits millionenfach ereignet hat, eine Geschichte wie ein Naturgesetz.
Während der folgenden Tage ließ sich Früger nicht blicken.
Meine Prüfungsvorbereitungen vor zwei Jahren.
Es kommt vor, da werde ich über meinen Gleichungen betrunken; oder ich stehe auf und versuche es mit einer Kneipe, die Ereignislosigkeit dort, am Ende gehe ich, wie ich eingetreten bin, lediglich alkoholisierter.
Entscheidung für das ›Karo‹, dessen Einrichtung seinem Namen alle Ehre machte; von der kleinkarierten Getränkekarte, über mittelgroß karierte Tischplatten und großkarierten Fußboden, die im Karree aufgestellten Tische, die sich wiederum in quadratischen, durch raumteilend eingesetzte Pflanzenbänke abgegrenzten Sektionen befanden. Räumliche Objekte waren, soweit es ging, von Würfelform inspiriert, so Lampen, Aschenbecher, Lautsprecherboxen.
Ich bestellte Bier und las in einem mitgebrachten Buch, mußte bald einige Seiten zurückblättern, da ich den Faden verloren hatte, und als auch der zweite Versuch scheiterte, klappte ich das Buch zu und legte es vor mich auf den Tisch.
Mein Blick fiel auf die Uhr über dem Tresen, ich hatte meine Formeln früher verlassen als üblich, einige wollten mir nicht aus dem Kopf, ich trank Bier, mit jedem Schluck fielen Gleichungen von mir ab.
Eine Stimme, die nach den freien Plätzen fragte, ließ mich aufblicken, vor mir stand ein hagerer Brillenträger, wartete auf Antwort, ich nickte, er drehte sich um und winkte zur Tür, durch die eine größere Gruppe in den Raum quoll. Ich räumte meine Jacke zur Seite, die ich auf dem Stuhl neben mir deponiert hatte, zwei weitere Sitzgelegenheiten wurden herbeigeschafft. Der Tisch war viel zu klein, es wurde eng.
Ich war bemüht, wenigstens Arm- und Beinfreiheit zu sichern. Es kam, wie es kommen mußte: Bei der zweiten Bestellung saß ich abstandslos zwischen einem Blonden und einer Dunkelgelockten.
Der Versuch, mit dem Buch meine Anwesenheit zu rechtfertigen. Wiederum keine Konzentration für das Geschriebene, weswegen es mir nicht gelang, den neben mir gesprochenen Text auszublenden, immer wieder drängten sich einzelne Begriffe oder Satzfragmente auf, es ging um Politisches, speziell Hochschulpolitik, über die in einigen Punkten offenbar Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Blonden und dem Brillenträger herrschten, Differenzen, die im Grunde nicht auf Tatsachen, sondern auf Ideologien fußten, wie ich aus den Bruchstücken schloß. Auffällig bei den Einwürfen von links, der Dunkelgelockten: die Stimme. Ich blickte auf, flüchtig, interessiert an einem Bild zu der Stimme, die zusehends verstummte. Ihre Locken; dann wieder Buchstaben. Der Versuch, mit Gewalt meinen Text zu verstehen. Je weniger dies gelang, um so hilfloser war ich ihrem Dialog ausgeliefert. Keine Zeile kam mehr über die Netzhaut hinaus, Buchstaben und Seitenzahlen verschwammen zu Ornamenten, ich wurde zum akustischen Voyeur.
Die Ornamente flossen ineinander, mein Blickfeld wurde mehr und mehr aller Konturen beraubt, verkam schließlich zu einem abstrakten Gemälde aus Farbklecksen, in dem mich eine abrupte Bewegung erschreckte. Eine Kerze war auf mich zugeschoben worden, weil der Platz im Zentrum des Tisches für das Anfertigen einer von allen Seiten einzusehenden Skizze benötigt wurde. Es ging um den Aufbau eines demnächst zu veröffentlichenden Flugblattes, dessen Inhalt ich nicht kannte und zu dem meine Meinung nicht gefragt war.
Ich zog die Kerze ganz zu mir herüber und knetete an ihrer erwärmten Spitze herum, als dächte ich über etwas Wichtiges nach. Statt dessen Informationen über innere Organisation der Fachschaft.
Ich ließ ein Streichholz in der Flammenhitze zünden, bohrte es brennend in den weichen Rand, so daß der kleine See, der sich unter dem Docht gebildet hatte, abfließen konnte. Ein ädriges Gebilde an der Kerzenwandung entstand, das von einer tropfenförmigen Verdickung nach unten hin abgeschlossen wurde. Von oben gab es beständig Nachschub, der bis zu diesem Tropfen rann, dort erkaltete und seine Durchsichtigkeit einbüßte, was ihn einer knolligen Nase ähnlich werden ließ.
Beschlußunfähigkeit mangels Anwesenden als größtes Problem.
Die Nase begann zu laufen. Ein Tröpfchen an ihrer Unterseite ließ an Schnupfen denken, doch bald war auch das vorbei, denn ein ausgewachsener Stalaktit war entstanden, während sich die Nase in einen formlosen Klumpen verwandelt hatte.
In den Resolutionen stecke harte Kleinarbeit, und die Leute benutzen sie zum Abwischen der Mensatische.
Mein Abfluß war durch das Herunterbrennen der Kerze wieder verschwunden, doch hatte sich nicht wieder der anfängliche Tiegel gebildet, sondern eine schiefe Ebene war entstanden, die dem Wachs nunmehr auf breiter Front Austritt ermöglichte. An Bildung geordneter Muster war nicht mehr zu denken. Krampfadern wucherten, der ständige Entzug des Brennmaterials ließ die Spitze schneller sinken als üblich, wodurch der Docht bald zu lang war, was den Effekt noch verstärkte.
Behinderung seitens der Univerwaltung.
Um den Verfall der Kerze zu stoppen, knetete ich so lange an den Rändern herum, bis wieder ein Grübchen entstanden war, in dem das flüssige Wachs sich sammeln konnte. Langsam stieg der Pegelstand, doch bereits nach wenigen Minuten wurde deutlich, daß statt dessen nun eine Überschwemmung drohte. Der überlange Docht und die damit verbundene unmäßige Hitze an seiner Wurzel entfachten eine Wachssintflut, ein Dammbruch war nicht zu vermeiden. Die Flüssigkeitsoberfläche begann bald, sich nach oben zu wölben, ich rechnete nur mit Sekunden.
Die Kerze wurde wieder zurückgezogen, Wachs schwappte über und ein Tropfen schlug auf meinem Buch ein.
Die Dunkelgelockte entschuldigte sich. Sie hatte lediglich die Kerze wieder in die Mitte schieben wollen, da man sich über die Form des Flugblattes einig geworden war, eine Reflexhandlung, sie hatte nicht darüber nachgedacht.
Ich wölbte den Einband leicht und konnte das zackige Wachsplättchen als ganzes abziehen, im Grunde war also nichts passiert.
Sie wandte sich wieder ihren Bekannten zu.
Die Bedienung war gerufen worden, um eine neue Bestellung aufzunehmen, sah fragend in die Runde, der Brillenträger und die Dunkelgelockte nickten, der Blonde verwies auf sein halbgefülltes Glas. Auch ich hatte halbvoll, bestellte trotzdem.
Die Journale fielen mir ein, die am rechten Ende der Schanktheke zur allgemeinen Verfügung standen, bei denen ich mich hin und wieder bedient hatte und deren Lektüre in der gegebenen Situation mehr Aussicht auf Erfolg versprach als mein Buch.
Statt den Stapel Zeitschriften durchzusehen, stellte ich fest: Mein Tisch wirkte auch aus Entfernung überfüllt, alle hatten nur wenig Platz zur Verfügung, allerdings kam mir die Enge zwischen dem Brillenträger und der Dunkelgelockten künstlich vor. Der Blonde hatte mir den Rücken zugekehrt, während ich ihr ins Gesicht sehen konnte, ohne Gefahr, entdeckt zu werden. Hin und wieder drehte sie sich ins Profil, um den Brillenträger anzusehen, der sich seinerseits von Zeit zu Zeit zu ihr drehte und dabei seine Hand auf ihren Unterarm legte, als wolle er damit die Bedeutung des soeben Gesagten unterstreichen. Ich mag dieses grundlose Berühren nicht, weswegen ich in dieser Weise nicht berühre und nicht berührt werden möchte.
Sie trug eine schwarze Lederjacke, auf deren Kragen die Haare leicht auflagen und die sie trotz der Überhitzung des Raumes offenbar nicht bereit war, abzulegen.
Ganz war sie nicht bei dem Gespräch; hin und wieder senkte sie die Augen, ließ den Blick über den Tisch wandern, entdeckte mein Buch, drehte es, um den Titel zu lesen, schob es zurück, sah wieder abwechselnd den Blonden oder ihren Nebenmann an, die mit ihrer Diskussion eine akustische Mauer errichtet hatten, die sie von den Gesprächen der restlichen Gruppe abschnitt.
Ich kehrte zum Tisch zurück, mußte wieder mehrfach wegen der zu eng stehenden Bestuhlung um Entschuldigung bitten, setzte mich, während immer noch diskutiert wurde.
Mit der Zeitung ging es mir nicht anders als mit dem Buch; ich ließ sie nur pro forma aufgeschlagen vor mir liegen.
Bisweilen berührten sich mein Knie und das des Blonden unter der Tischplatte. Später stellte ich eine beständige Anspannung meiner Wadenmuskulatur fest, um diese Kontakte zu vermeiden.
Keine Berührung mit der Dunkelgelockten.
Ich zwinge mich dazu, aus dem Inhaltsverzeichnis einen mich interessierenden Artikel auszuwählen, schlage die entsprechende Seite auf und konzentriere mich auf die ersten Sätze.
Die Unmöglichkeit, ihre Anwesenheit aus meinem Bewußtsein auszublenden.
Und immer wieder die Diskussion. Wie der Blonde aus einer Prämisse einen Schluß zieht, sein Gegenüber zwar die Prämisse akzeptiert, jedoch genau den entgegengesetzten Schluß aus ihr zieht. Als Physiker bin ich es gewohnt, daß dieselbe Voraussetzung zu demselben Ergebnis führt. Sicher: physikalische und politische Diskussion nicht vergleichbar, aber ich vermisse das Bedürfnis, das Konzept der Widerspruchsfreiheit auch hier fruchtbar werden zu lassen; im Gegenteil: es kam mir vor, als werde mutwillig aus Gleichem Verschiedenes konstruiert.
Die Dunkelgelockte heißt Nina.
Der Gedanke, daß die Diskussion sie womöglich langweilt, weil sie so selten etwas sagt, daß ihr ein anderes Gespräch durchaus recht wäre und daß ich ihr gegenüber akustisch nicht isoliert bin.
Immerhin hat sie sich für mein Buch interessiert.
Ich beginne, zügig zu trinken.
Einmal das Gefühl, daß sie mich beobachtet, weswegen ich wieder langsamer trinke, weil mir allzu große Schlücke unangenehm wären.
Der Brillenträger und der Blonde diskutieren weiter. Ich registriere eine neue rhetorische Finesse, als der Blonde aus einem Schluß des Brillenträgers seinerseits etwas schließt, was geradezu absurd, also auf keinen Fall wünschenswert ist. Wie dem auch sei, beide Schlüsse waren im Wesen Unsinn, rhetorische Mogelei, vom Standpunkt eines Naturwissenschaftlers sogar verwerflich, weil unlauter. Es ging nicht darum, die Welt zu verstehen, sondern die eigene Sicht der Dinge als Wahrheit an den Mann zu bringen. Marktschreier gehören an den Gemüsestand und nicht aufs Rednerpult.
Ab und zu zwingt sie der Brillenträger durch Anfassen zu einer Reaktion.
Währenddessen die Diskussion: Studentischer Streik als notwendige politische Artikulation. Einigkeit über diesen Punkt.
Ihr Profil: Nicht zierlich.
Fachschaftsdiskussion über Streik: Argumentation gegen alle linken Gepflogenheiten seitens eines Naturwissenschaftlers.
Die Schlußfolgerung: Es gibt nichts Gefährlicheres als unpolitische Naturwissenschaftler.
Nina, die nichts mehr sagt.
Ob man nicht gegen Streik sein könne, ohne gleich als Gefahr für die Menschheit bezeichnet zu werden? Möglicherweise wäre es besser gewesen, ein weniger kontroverses Thema als Anknüpfungspunkt für ein Gespräch zu wählen.
Der Brillenträger, Hans-Jörg Plank, wie er sich später vorstellte, reagierte als erster.
In einer Ablehnung des Streiks sehe er tatsächlich eine Gefahr, wenn auch nicht für die Menschheit, so doch für die Kultur demokratischen, gewaltfreien Widerstands.
Meine Einstellung zu Streik: Ich finde Streik von Studenten unlogisch. Sie produzieren nichts, durch den Streik wird also niemandem etwas vorenthalten, somit taugt er nicht als Druckmittel.
Plank warf mir Kurzsichtigkeit vor.
Ich berichtete: Während des Streiks vor zwei Jahren, eine bestreikte Vorlesung, Besetzung des Rednerpults durch Streikführer und Aufforderung an den Professor, sich solidarisch zu verhalten und die Stunde abzusagen. Dessen Antwort: Wieso? Streik bedeute doch, daß er die Vorlesung halte und die Studenten nicht erscheinen. Dagegen war nichts zu sagen.
– So’n Scheißer.
Obwohl Nina den Professor einen Scheißer fand, konnte ich mich seinem Bonmot nicht entziehen.
Studenten sind prinzipiell machtlos, weil abhängig, und ein Streik wecke immerhin das öffentliche Interesse, so Nina.
Der Hang zum Privatieren sei bei Naturwissenschaftlern am ausgeprägtesten, so Plank.
Der besagte Professor sei ihm bekannt und er halte ihn für unangenehm arrogant, so der Blonde.
Immerhin bestätigt mir Plank ein Körnchen Wahrheit, Streik sei in der Tat ein ungeeignetes Druckmittel, man müsse härter vorgehen.
Wie er manches sagt, ist davon auszugehen, daß Nina es kennt, es bereits mehrfach in verschiedenen Zusammenhängen gehört hat, was auch ihre Reaktion nahelegt: Man hat nicht das Gefühl, als werde ihr etwas Unbekanntes mitgeteilt.
Meine Meinung wird nicht weiter diskutiert, da am anderen Ende erneut ein Vorschlag mittels Skizze präzisiert werden soll, so daß die Kerze wiederum in meine Richtung geschoben wird und Plank und der Blonde sich dem Blatt Papier zuwenden.
Nina nimmt eine Zigarette, angelt eine Streichholzschachtel, zieht das Köpfchen über die Schmirgelfläche, zu ungeduldig, erst beim dritten Versuch mahnt sie sich zur Ruhe, nutzt die ganze Länge des Zündstreifens, führt den zischenden Lichtblitz zur Zigarettenspitze und schlägt das Hölzchen, kaum daß die Flamme zur Ruhe gekommen ist, wieder aus.
Ich mache eine Bemerkung über die Kerze. Sie entschuldigt sich noch einmal, weil doch ein dunkler Fleck auf dem Buch zurückgeblieben ist. Ich beeile mich mit der Versicherung, daß ich es so nicht gemeint hätte.
Eigentlich mag sie keine Kerzen, da sie Kerzen in der Hauptsache als Ersatz für nicht vorhandene Feststimmung kennt. Gemütlicherabendkerzen, Reliefe und Plastiken aus Wachs, Heiligenszenen auf armdicken Kerzen, Häschen mit Docht.
Sie will wissen, was ich für ein Physiker bin. Für sie gibt es zwei Arten von Physikern: Die meisten, das sind die, die nur in Formeln nachdenken, die wenigsten, das sind die, die in Ordnung sind.
Ich kann mich entscheiden.
Ich führe meine Liebe zur Musik an, Klavierspiel, Liebe zu Mussorgskys ›Bilder einer Ausstellung‹, russische Musik überhaupt, Tschaikowsky, Rimsky-Korsakow, Borodin, diese von keinem Volk erreichte Mischung aus Schwermut und Lebendigkeit.
Ich fand, ich redete zuviel.
Sie legte den Kopf in den Nacken, ihre Haare strichen über den Kragen der Jacke.
Das Gefühl, daß Plank uns beobachtet.
Von klassischer Musik versteht sie wenig, was sie bedauert: