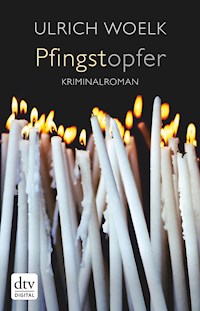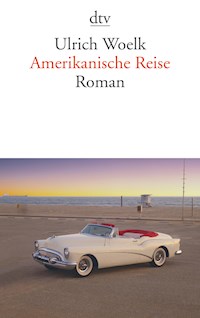18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ruth Lember, Professorin in Berlin, soll in den Deutschen Ethikrat berufen werden. Sie scheint am Gipfel ihrer bisherigen Laufbahn. Aber ein Zwischenfall bei ihrer morgendlichen Joggingrunde erweist sich als Auftakt einer ganzen Reihe irritierender Ereignisse. Innerhalb von einer Woche in der sommerlich heißen Stadt gerät Ruths Leben völlig aus dem Takt. Ulrich Woelk erzählt in "Mittsommertage" die spannende Geschichte einer Frau, die sich neu erfinden muss. Ruth Lember, Ethikprofessorin in Berlin, steht kurz vor der Krönung ihres bislang so erfolgreichen Berufslebens: Sie soll Mitglied des Deutschen Ethikrats werden. Nichts scheint in diesem Sommer 2022 ihre Zukunft zu trüben: Ben, ihr Mann, gewinnt einen Architekturwettbewerb, ihre Ziehtochter Jenny studiert Kommunikation in Leipzig, und die Corona-Pandemie flaut endlich ab. Dass Ruth bei ihrer morgendlichen Joggingrunde von einem nicht angeleinten Hund gebissen wird, scheint da nur ein störendes Missgeschick zu sein. Aber tatsächlich schwelt die Wunde weiter, und das Ärgernis wird unerwartet zum Auftakt einer ganzen Reihe von Ereignissen, die Ruths Leben zunehmend in Frage stellen. Ein Freund aus der Vergangenheit taucht auf und erinnert sie nicht nur an ihre einstige Liebe, sondern auch an einen nie geahndeten Anschlag der früheren Umweltaktivistin. Niemand sonst, auch nicht Ben und Jenny, weiß von Ruths politischer Vergangenheit, die, sollte sie bekannt werden, sowohl ihre Karriere als auch ihre Ehe aus der Bahn zu werfen droht. Doch genau darauf scheint der Lauf der Dinge jetzt beinahe zwingend zuzusteuern ... Dicht, anschaulich und spannend erzählt Ulrich Woelk in seinem neuen Roman von einer einzigen Woche im Mittsommer in Berlin, die ein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen vermag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Sammlungen
Ähnliche
Ulrich Woelk
Mittsommertage
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Ruth Lember, Ethikprofessorin in Berlin, steht kurz vor der Krönung ihres bislang so erfolgreichen Berufslebens: Sie soll Mitglied des Deutschen Ethikrats werden. Nichts scheint in diesem Sommer 2022 ihre Zukunft zu trüben: Ben, ihr Mann, gewinnt einen Architekturwettbewerb, ihre Ziehtochter Jenny studiert Kommunikation in Leipzig, und die Corona-Pandemie flaut endlich ab. Dass Ruth bei ihrer morgendlichen Joggingrunde von einem nicht angeleinten Hund gebissen wird, scheint da nur ein störendes Missgeschick zu sein. Aber tatsächlich schwelt die Wunde weiter, und das Ärgernis wird unerwartet zum Auftakt einer ganzen Reihe von Ereignissen, die Ruths Leben zunehmend in Frage stellen.
Ein Freund aus der Vergangenheit taucht auf und erinnert sie nicht nur an ihre einstige Liebe, sondern auch an einen nie geahndeten Anschlag der früheren Umweltaktivistin. Niemand sonst, auch nicht Ben und Jenny, weiß von Ruths politischer Vergangenheit, die, sollte sie bekannt werden, sowohl ihre Karriere als auch ihre Ehe aus der Bahn zu werfen droht. Doch genau darauf scheint der Lauf der Dinge jetzt beinahe zwingend zu zusteuern …
Dicht, anschaulich und spannend erzählt Ulrich Woelk in seinem neuen Roman von einer einzigen Woche im Mittsommer in Berlin, die ein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen vermag.
Über den Autor
Ulrich Woelk lebt als freier Schriftsteller in Berlin. Er studierte Physik und Philosophie. Sein erster Roman «Freigang» erschien 1990. Zuletzt veröffentlichte er mit großem Erfolg den Roman «Der Sommer meiner Mutter», der auf der Longlist des deutschen Buchpreises stand und in mehrere Sprachen übersetzt wurde sowie den Roman «Für ein Leben», für den er den Alfred-Döblin-Preis erhielt.
Inhalt
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Für Tina
Montag
NACH EINEM SCHLAF ohne Unterbrechungen oder beunruhigende Träume wacht Ruth Lember eine halbe Stunde vor dem Klingeln des Weckers ausgeruht auf. An dem blassen Licht, das zu beiden Seiten des herabgezogenen Rollos durch die Schlitze zwischen Stoff und Fensterrahmen ins Zimmer dringt, erkennt sie, dass der Sommertag draußen bereits begonnen hat. Bens Atem geht regelmäßig, er schläft noch. Einen Moment lang erwägt Ruth, noch einmal die Augen zu schließen und die Zeit bis zum Weckerklingeln im Halbschlaf zu verdösen. Aber dann lässt sie die Augen doch offen. Sie ist wach, und die Kräfte ihres Körpers und ihres Geistes wollen sich nicht mehr in die Müdigkeit zurückdrängen lassen. Und sie selbst will das auch nicht. Sie hat Lust auf diesen Tag und die vor ihr liegende Woche.
Langsam streckt sie einen Fuß in die Luft. Sie will Ben nicht wecken. Durch langjährige Übung weiß sie, wie sie ihr Bett und das gemeinsame Schlafzimmer nahezu lautlos verlassen kann. Sie hebt die Decke kaum an und schiebt ihre Beine und ihren Körper unter dem Stoff des Bezugs seitlich ins Freie. Sie setzt ihre Füße mit dem Ballen zuerst auf den Boden, richtet sich auf, öffnet die Tür, die Ben und sie nachts nie ganz schließen, gerade eben so weit, dass es für sie ausreicht, hindurchzuschlüpfen, und zieht sie leise hinter sich zu. Dann geht sie ins Bad, wo sie ihr Gesicht mit angenehm kühlem Leitungswasser wäscht.
Kurz darauf betritt sie Jennys Zimmer. Der Morgen überzieht die Gegenstände mit hellen Farben. Der schmale, rote Metallschirm der Nachttischleuchte wird von einem Sonnenstrahl getroffen. Die unberührte Bettwäsche tönt den Raum mit ihrem schönen Korngelb. Obwohl Jenny seit einem knappen Jahr nicht mehr in diesem Zimmer wohnt, hängen noch ihre Poster an der Wand. Auf einem offenen Kleiderständer sind ausgemusterte Jacken zurückgeblieben. Nach ihrem Auszug hat sich das Zimmer nur wenig verändert, aber in seiner Funktion gewandelt. Peu à peu ist es zu einem Bügel-, Wäschefalt-, Strümpferoll-, Nicht-winterharte-Pflanzen-von-der-Dachterrasse-Abstell- und angenehm geräumigen Ankleideraum geworden. Wenn Jenny zu Besuch kommt, werden diese Nutzungsänderungen kurzzeitig rückgängig gemacht, bis auf die schweren Tontöpfe mit den beiden Olivenbäumen, die im Winter geblieben sind.
Die Frage, was mit einstigen Kinderzimmern geschehen sollte, ist in Ruths und Bens Freundes- und Bekanntenkreis noch kein zentrales Thema, wird allmählich aber doch häufiger gestellt. Manche überlegen, Homeoffice-Büros, Trainingsräume mit Ergometer und Rudermaschine oder Gästezimmer aus ihnen zu machen. Erweist man den Kindern, die ja inzwischen keine Kinder mehr sind, überhaupt einen Gefallen, ihre Zimmer gleichsam zu musealisieren und vier- oder fünfmal im Jahr so zu tun, als sei die Zeit stehengeblieben? Vielleicht sollte man offen ansprechen, dass es bessere Nutzungsmöglichkeiten für diese Räume gibt als das Konservieren von Kindheitserinnerungen. Oder wäre es brutal, diese Zimmer, die im Falle von Liebeskummer, Studienzweifeln oder jugendlichem Weltschmerz Rückzugsorte in eine Zeit der behüteten Sorglosigkeit sein können, für immer zu zerstören?
Dass Ruth und Ben sich mit der Umwidmung des Raumes noch nicht festgelegt haben, liegt weniger an einer Unentschiedenheit in dieser Frage, die es auch gibt, als vielmehr an der fehlenden Zeit neben ihren beruflichen Verpflichtungen. Das Zimmer umzugestalten wäre mit einer Menge Arbeit und einigen Besuchen in Möbel-, Sport- oder Einrichtungshäusern verbunden. Da sie den Raum nicht zwingend brauchen, haben sie die Sache dem Voranschreiten der Zeit, der Veränderung von Gewohnheiten und der Neigung des Menschen zur Bequemlichkeit überlassen. Es ist ja schön, wenn Jenny für ein paar Tage kommt und es ein wenig ist wie früher.
Ruth setzt sich auf die Bettkante und nimmt ihre Trainingskleidung zur Hand, die auf dem Kopfkissen bereitliegt. Nach dem ersten Corona-Lockdown haben Ben und sie in puncto Freizeit aufgerüstet und einiges für eine perfekte Sportausstattung ausgegeben. Aber Geld war in diesen Tagen und auch vorher für sie kein großes Thema. Allerdings war es erstaunlich schwierig, als Fitnesskleidung für Frauen etwas anderes zu erstehen als hautenge Stretchleggins und nicht weniger enge, allerhöchstens bis zum Bauchnabel reichende Bustiers. Alternativ waren noch diverse Schlabberlooks im Angebot, die auch nicht infrage kamen. Ruth entschied sich schließlich für eine luftige, hellgraue Sweathose mit weißen Seitenstreifen und weichen Gummizugbündchen. Zusammen mit einem dunkleren, ebenfalls grauen Baumwollhoodie fühlt sie sich als Joggerin einigermaßen altersgerecht gekleidet. Die Sportschuhe heißen Jogging-Schuhe oder Sneakers oder auch Trainers oder Runners, aber in Gedanken bleiben es für Ruth Turnschuhe. Vor Kurzem hat sie sich gefragt, ob das ein Hinweis darauf ist, dass sie in wenigen Wochen fünfundfünfzig wird.
In ihrer Trainingskleidung fährt Ruth mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und tritt auf die Straße. Auf der einen Seite wird sie von Gründerzeitfassaden mit stuckumrahmten Fenstern, Putten und säulengestützten Balkonen gesäumt, auf der anderen von den Bäumen des Lietzenseeparks. Ruth überquert den Fahrstreifen und lässt zwischen den ersten Sträuchern und Efeurabatten ihr zügiges Ausschreiten zunächst in ein leichtes Traben übergehen, bevor sie nach etwa hundert Metern allmählich ihren gewohnten Laufrhythmus aufnimmt.
Sie ist früher unterwegs als sonst und empfindet das in einer Stadt wie Berlin seltene Gefühl, allein mit sich selbst, ihren Gedanken, dem Ein- und Ausströmen ihrer Atemzüge und dem weichen Laufgeräusch ihrer Schritte zu sein. Trotz der frühen Tageszeit ist es schon warm. Für die kommenden Tage ist eine Hitzewelle vorhergesagt. Die Oberfläche des Lietzensees zeigt kaum eine Kräuselung. Der Uferbewuchs spiegelt sich an manchen Stellen im Wasser. Auch nach den beinahe zehn Jahren, die sie mit Ben hier wohnt, überrascht es Ruth manchmal noch, mitten in Berlin, kaum mehr als einen Kilometer vom Kurfürstendamm entfernt, ein Gefühl von Naturnähe erleben zu können.
Beim Laufen spürt sie wieder, wie schon beim Aufstehen, diese besondere Energie in ihrem Körper, als wäre sie über Nacht leichter geworden. Ihre Beine bewegen sich ohne jeden inneren Widerstand, ihre Arme schwingen wie von selbst mit. In der Pandemie ist ihr das morgendliche Laufritual noch wichtiger geworden. Das Luftgewölbe über dem See – ganz gleich zu welcher Jahreszeit – schien der letzte virenfreie Raum in dieser Welt zu sein. Und nun ist noch der Krieg in der Ukraine hinzugekommen. Hier am See kann Ruth sich der Vorstellung hingeben, dass sich überhaupt nichts geändert hat.
Den Kopf leicht angehoben, versenkt sie ihren Blick in die von der noch niedrig stehenden Sonne golden angeleuchteten Baumkronen am gegenüberliegenden Ufer. Es wird ein schöner, noch nicht zu heißer Sommertag werden. Am Parkrand biegt ein Hund auf den Uferweg, bleibt am Fuß der Bäume stehen und sieht sich um. Als er Ruth entdeckt, verfällt er in eine beobachtende Starre. Sein Blick kommt Ruth misstrauisch oder wachsam oder vielleicht sogar feindselig vor. Aber eigentlich ist die Entfernung zu groß, um im Schatten der Bäume die Augen des Tieres erkennen zu können. Es muss etwas in seiner Körperhaltung sein, etwas Rudimentäres, aber doch so Grundlegendes, dass auch Ruth es als womöglich angriffsbereit wahrnehmen kann, obwohl sie keine Erfahrung mit Hunden hat.
Nachdem der Hund sie ein paar Sekunden fixiert hat, rennt er los. Auf halbem Weg beginnt er zu bellen, aufgeregt und laut, hochtönend, heiser und aggressiv. Ruth läuft weiter. Der Schrittmotor in ihr arbeitet wie ein von ihren Gedanken und Wahrnehmungen abgekoppelter Automat. Am Fuß der Bäume taucht jetzt ein Mensch auf, eine Frau. Sie braucht einen Moment, um die Situation zu erfassen. Dann fängt sie an, dem Hund etwas hinterherzurufen, für das er sich aber nicht interessiert. Nach allem, was Ruth zu wissen glaubt, ist das näher kommende Tier im Jagdmodus: gespitzte Ohren und steif nach hinten gestreckter Schwanz.
Intuitiv verlangsamt sie ihren Lauf nun doch und bleibt schließlich stehen. Der Hund erreicht sie, stoppt einen Meter vor ihr, fängt an, nervös hin und her zu tänzeln, und bellt sie an. Plötzlich verharrt er mit angehobenem Kopf und leicht eingeknickten Hinterläufen, bleckt seine Reißzähne und beginnt zu knurren. Er ist mittelgroß, wie ein Terrier vielleicht, Ruth kennt sich mit Hunderassen nicht aus. Unter Joggern heißt es, man solle an bellenden Hunden ruhig, mit nicht angewinkelten Armen, und ohne sie groß zu beachten, vorbeigehen und erst in einer gewissen Entfernung wieder mit dem Laufen beginnen. Als Ruth einen leichten Bogen um den Hund macht, springt er auf, schnappt nach ihrer rechten Wade und beißt einmal schnell zu.
Im ersten Moment ist es nicht der Schmerz, der Ruth innehalten lässt, sondern die Überraschung darüber, dass es wirklich geschehen, dass sie soeben gebissen worden ist. Sie bleibt stehen und dreht sich zu dem Hund um, der nach dem Zubeißen zurückgesprungen ist und nun wieder etwa einen Meter von ihr entfernt dasteht. Er hat aufgehört zu bellen, als wäre er ebenso überrascht wie sie, tatsächlich zugebissen zu haben.
In diesem Moment erreicht die Halterin Ruth. Sie hat es jetzt aufgegeben, den Namen ihres Hundes zu rufen. Dass das Tier zugebissen hat, muss sie gesehen haben. Der Hund fängt wieder an zu bellen, als wollte er demonstrieren, wie eifrig er sie beschützt.
«Kira! … aus! … aus! …», ruft die Frau. Als sie sich vorbeugt, um das Halsband zu fassen zu bekommen, schnappt das Tier nach ihrer Hand. Es scheint nicht mehr zu wissen, wen es eigentlich zu beschützen hat. «Ich verstehe das nicht, das macht sie sonst nie», sagt die Frau und sieht Ruth ratlos an, als erwarte sie ausgerechnet von ihr eine Erklärung dafür.
«Er hat mich gebissen», sagt sie. Die Überraschung darüber weicht einem Schock. Sie beginnt zu schwitzen.
«Wirklich … oh Gott, wirklich …?»
Ruth sieht an sich hinab. Dort, wo das Tier zugeschnappt hat, ist der helle Stoff ihrer Jogginghose dunkel vom Hundespeichel, und es sind zwei Risse im Gewebe zu erkennen. Mit einem Seitenblick auf den Hund, der sich entfernt hat, beugt sie sich hinab. Sie fasst den Hosenstoff am Knie und zieht ihn vorsichtig hoch. Zwei rote Punkte kommen zum Vorschein, wo die Reißzähne die Haut getroffen haben. Die beiden Wunden füllen sich hellrot mit Blut, das aus tieferen Hautschichten in sie hineinsickert.
«Oh nein, oh nein!», ruft die junge Frau aus. Sie scheint einen Hang zur Hysterie zu haben. «Was machen wir denn jetzt?» Sie sieht Ruth beinahe flehentlich an.
«Wie können Sie ihn frei laufen lassen!», sagt Ruth empört. Sie ist wütend, aber sie weiß nicht, wohin mit ihrer Wut. Sie mag es nicht, laut zu werden.
Die glatten aschblonden Haare der Frau sind feucht, vielleicht vom Duschen, kleben an ihrer Stirn und fallen zu beiden Seiten ohne Fülle als schmale Strähnen auf die Schultern. Dadurch wirkt das helle, von nichts umrahmte Oval ihres Gesichts besonders schutzlos, so als bestünde es nur mehr aus ihren panisch geweiteten Augen, als sie bettelt: «Das ist noch nie vorgekommen … Bitte, zeigen Sie das nicht an … bitte ja … Ich verstehe das nicht.»
Ruth hat noch nie etwas angezeigt.
«Leinen Sie ihn endlich an!», sagt sie barsch.
«Ja, ja … sofort … sofort …»
Die Unterwürfigkeit der jungen Frau stößt Ruth ab. Dass die beiden miteinander reden, scheint die Angriffslust des Hundes zu dämpfen. Die Spannung ist aus seinem Schwanz gewichen, die Lefzen schließen sich, und er hört auf zu knurren. Er senkt den Blick, richtet seine Aufmerksamkeit auf den Boden und beschnüffelt einen weggeworfenen Kaffeebecher im Gebüsch. Der Frau gelingt es endlich, den Haken der Leine am Halsband zu befestigen. Sie richtet sich auf.
«Bitte, es tut mir so wahnsinnig leid. Kann ich irgendetwas tun? Ich tue alles, um es wiedergutzumachen.»
«Was denn schon?», sagt Ruth schroff. «Ich muss das desinfizieren. Leinenpflicht ist keine Empfehlung!»
«Nein, nein … das kommt nie wieder vor. Niemals …»
«Hoffentlich!»
Ruth dreht sich abrupt um und geht. Sie fühlt sich in jeder Hinsicht unwohl. Sie gefällt sich nicht als Drohende, aber ebenso wenig als diejenige, die die Dinge auf sich beruhen lässt. Sie hat keine Lösung für die Situation. Die junge Frau hat sie in eine Lage gebracht, in der es für ihr Empfinden kein richtiges Verhalten gibt. Weder als Streitende noch als Anklagende oder Beschwichtigende sieht sie sich in einer akzeptablen Rolle.
Als sie in die Wohnung kommt, ist Ben wach. Er steht barfuß, in T-Shirt und Boxershorts vor dem Kaffeeautomaten und lässt gerade einen Cappuccino in die Tasse blubbern. Offenbar sagt eine innere Uhr ihm, dass Ruth kürzer unterwegs gewesen ist als üblich.
«Guten Morgen. Schon wieder da? Du kannst den Kaffee haben, ich mache mir noch einen.»
Er kommt mit dem Cappuccino zu Ruth, die am Ende des Eingangsflurs steht, begrüßt sie mit einem flüchtigen Morgenkuss und reicht ihr die Tasse.
«Danke.»
Ruth geht in den Wohnzimmerbereich und setzt sich auf einen der Stühle am Esstisch. Hinter der Fensterfront leuchten die Baumkronen des Parks und das sie überragende, silbern verkleidete RBB-Fernsehzentrum am Theodor-Heuss-Platz in der Sonne. Normalerweise setzt Ruth sich an den Küchentresen mit seinen hohen Hockerstühlen, wenn sie morgens ihren Kaffee trinkt. Ben spürt, dass irgendetwas geschehen ist.
«Alles in Ordnung?»
«Ich bin von einem Hund gebissen worden.»
«Wie bitte? Du bist …»
«Er kam auf mich zugerannt, aggressiv bellend. Bei manchen Hunden lösen Jogger einen Jagdreflex aus. Manchmal tauscht man sich unter Joggern darüber aus. Soll man stehen bleiben, sie ignorieren, ihnen aus dem Weg gehen? Ich habe Tempo rausgenommen und wollte ruhig an ihm vorbeigehen. Da hat er zugeschnappt. Es ist die rechte Wade.»
«Das gibt’s doch nicht!» Er kommt zu ihr. «Soll ich mir das mal ansehen?»
«Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Der Stoff hat den Biss abgeschwächt.»
Sie zieht das Hosenbein hoch. Die beiden Bisspunkte glänzen wie vorhin rötlich feucht, bluten aber nicht. Ben geht in die Hocke und betrachtet die Wunde. Als medizinischer Laie kann er nicht mehr darüber sagen als Ruth. Sie ist froh, dass er für sie da ist.
«Du musst das desinfizieren.»
«Ja natürlich. Ich gehe gleich ins Bad.»
«Vor dem Duschen vielleicht. Und dann ein wasserdichtes Pflaster.»
«Ich glaube, fließendes Leitungswasser ist bei Wunden in Ordnung. Da sind bestimmt weniger Keime drin als in Hundespeichel.»
«Vielleicht solltest du dir eine Tetanusspritze geben lassen.»
Ruth betrachtet die Wunde noch einmal. Sie sieht wirklich nicht so schlimm aus, findet sie. Aber vielleicht denkt sie das nur, damit ihre Entscheidung, die Hundehalterin ziehen zu lassen, im Nachhinein kein Fehler gewesen ist. Jeder versehentliche Schnitt in einen Finger kommt ihr als Verletzung tiefgreifender vor.
«Ich desinfiziere die Stelle und warte ab. Ich habe einen vollen Tag und möchte das Proseminar nicht absagen. In der Notaufnahme wartet man Stunden.»
Ben richtet sich auf. «Aber du versprichst mir, die Stelle zu beobachten. Das Seminar ist nicht so wichtig. Du solltest in diesem Fall nicht so streng zu dir sein.»
«Ich passe auf», sagt sie, lässt das Hosenbein über die Wunde rutschen und trinkt ihren ersten Schluck Kaffee, der ihr guttut. «Du findest mich zu pflichtbewusst?»
Er geht zur Kaffeemaschine und lässt seinen Cappuccino in die Tasse. «Ich finde, manchmal muss man dich bremsen. Wieso ist dieser Hund überhaupt frei rumgelaufen?»
Ruth wartet die mechanische Abfolge von Mahl- und Brühgeräuschen ab. Sie fühlt auf einmal eine Schwäche, als wäre bei dem Biss doch etwas in sie eingedrungen. Aber vielleicht normalisiert sich nur ihr Adrenalinspiegel. Die Wunde schmerzt nicht. Wenn sie nicht an sie denkt, spürt sie sie kaum. Die aufwühlendsten Empfindungen in der vergangenen Stunde waren seelischer Natur: ihre Machtlosigkeit gegenüber dem Tier, der Schock über den Biss, die Wut auf die junge Frau, die Tatsache, dass sie bei alldem keine überzeugenden Handlungsoptionen hatte, und ihr Unmut darüber. Vielleicht sollte sie nicht weiter darüber nachdenken. Es ist geschehen und nicht mehr zu ändern und sollte die Freude auf die vor ihr liegende Woche nicht trüben.
Besonders für Ben ist es eine bedeutende Woche. Am Wochenende hat Ruth seine Nervosität gespürt, auch wenn er sich nichts anmerken lassen wollte. Er fing nicht ständig von dem Wettbewerb zur Neugestaltung der Siemensstadt an, an dem er sich mit seinem Architekturbüro beteiligt hat. Das historisch gewachsene Industriegebiet im Westen Berlins soll zu einem «Smart Campus» weiterentwickelt werden – ein städtebauliches Vorzeigeprojekt, das mit viel öffentlichem Fördergeld unterstützt wird. Ben hat den Entwurf für ein Einkaufszentrum eingereicht. Sollte er an dem Projekt beteiligt werden, würde das sein Architekturbüro über die Grenzen Berlins hinaus bekannt machen. Die Entscheidung wird morgen, am Dienstag, bekanntgegeben werden. Im Vergleich zu seinen Hoffnungen kommt Ruth die Bisswunde nicht so wichtig vor.
«Eine junge Frau hat ihn laufen lassen. Sie hat natürlich gedacht, so was würde nie passieren. Aber weißt du was – lass uns nicht weiter darüber sprechen.» Vielleicht will sie auch nicht zugeben, dass sie einen Fehler gemacht hat. «Ich habe Glück gehabt. Ich glaube, es ist nichts Schlimmes passiert.»
Die meisten Philosophie-Proseminare an der Berliner Humboldt-Universität finden in kleineren Räumen im Neubau am Hegelplatz statt, aber nach der Rückkehr zum Präsenzunterricht und weil sich sehr viele Erstsemester zu Ruths Seminar Anthropozentrische versus ganzheitliche Umweltethik angemeldet haben, ist die Veranstaltung in einen Hörsaal des Hauptgebäudes verlegt worden. Ob die Pandemie vorbei ist, weiß in diesem Juni 2022 niemand genau. Die Infektionszahlen mit einer neuen oder veränderten oder doppelt veränderten – man merkt es sich kaum noch – Virusvariante sind immer noch hoch. Und so führen die nach wie vor geltenden Abstandsregeln dazu, dass Ruth in ein gut gefülltes und dennoch ungewohnt löchriges Auditorium blickt.
Kurz nach Beginn des Seminars fällt ihr ein Mann auf, der in der letzten Reihe sitzt. Er ist ungefähr in ihrem Alter, genauer kann sie das in dem großen Hörsaal nicht beurteilen, zumal er eine Maske trägt wie etwa die Hälfte der Anwesenden – es ist nicht mehr vorgeschrieben, sondern nur noch empfohlen. Als Dozentin muss Ruth sich auf das Gespräch konzentrieren, das im Moment allerdings ein eingleisiges Monologisieren ihrerseits ist.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich auch ältere Menschen für ein Philosophiestudium einschreiben, zu dem es keine Zugangsbeschränkungen gibt. Ruth weiß selbst nicht so genau, warum sie beim Reden immer wieder flüchtig zu jenem Mann sieht, der sie, soweit sie das erkennen kann, mit einem irgendwie forschenden Blick anschaut. Und schließlich wird ihr klar, was es ist, das sie daran so irritiert. Sie hat den Eindruck, dass es ihm nicht darum geht, zu hören, was sie zu lehren hat. Er betrachtet sie nicht als Dr. Ruth Lember, Professorin für Theoretische und Praktische Ethik an der Abteilung 1 des Instituts für Philosophie der Humboldt-Universität Berlin, sondern als Frau. Er beobachtet sie.
Gelegentlich spürt Ruth die Bissstelle an ihrer rechten Wade. Sie empfindet dort jetzt einen leichten Dauerdruck, verbunden mit einem schwachen Brennen, das sich sehr langsam, aber kontinuierlich unter ihrer Haut auszubreiten scheint. Das beunruhigt sie.
Auch nach zwei Jahren Pandemie hat sie sich nicht daran gewöhnen können, bei ihren Vorlesungen und Seminaren in Gesichter mit Mundschutz zu schauen. Zu ihrer Studentenzeit in Marburg wurde in manchen Philosophieseminaren sogar noch geraucht. Wütende Proteste gegen die Maskenpflicht aus diesem Grund hätte Ruth aus Sentimentalität vielleicht sogar gelten lassen. Sie hat selbst auch geraucht, doch leider kann eine hohe Nikotinkonzentration in der Luft Coronaviren auch nichts anhaben.
Als sie jetzt über Descartes spricht, muss sie einen Moment lang an den kleinen, überhitzten, verqualmten Marburger Seminarraum denken, in dem sie damals über Ernst Bloch diskutiert haben: Das Prinzip Hoffnung – ein zunehmend wieder aktueller Titel im Hinblick auf die gegenwärtige Weltlage.
Nachdem sie das Seminar mit ein paar Anmerkungen eingeleitet hat, versucht Ruth, ihren Studenten die cartesianische Differenz zwischen Mensch und Tier zu verdeutlichen. Sie möchte erreichen, dass sie eigenständig darüber nachdenken. Die Texte darüber waren Teil des aufgegebenen Lesepensums. Dennoch scheinen ihnen Begriffe wie res extensa und res cogitans so fremd wie aus einer ihnen unbekannten, exotischen Kultur. Dabei ist es ihre eigene, abendländische Kultur, die aus der strikten Trennung der Welt in eine geistige und eine materielle Realität ganz wesentlich hervorgegangen ist – ja, die ohne diese Trennung in ihrer jetzigen Form gar nicht denkbar wäre. Von Jahr zu Jahr wundert sich Ruth mehr darüber, wie jung ihre Studenten sind und wie wenig sie wissen. Aber sie sind hier, sie wollen dazulernen.
«Mit res extensa», erläutert sie, «bezeichnet Descartes das, was wir mit anderen Worten die materielle Realität nennen können, die Welt der ausgedehnten Dinge. Stühle und Tische gehören dazu, Häuser, Pflanzen, Bücher, aber auch die Körper von Lebewesen, von Tieren und ebenso unsere eigenen Körper als Menschen. Mit res cogitans hingegen meint er die Welt des Geistigen, der Gedanken und Überlegungen, das Reich der Vernunft. Und obwohl es in diesem Reich keine Ausdehnung gibt, keine Materialität, ist die res cogitans für Descartes als Substanz nicht weniger real als die res extensa. Man könnte sogar sagen, sie ist für ihn realer, weil nur die res cogitans das Vermögen in sich trägt, die Welt ihrem Wesen nach zu verändern. Alle anderen Veränderungen – und da liegt die Verbindung zu unserem heutigen Thema –, Veränderungen wie die Bewegungen von Tieren beispielsweise, sind für Descartes nur die Aktionen von sehr komplexen Automaten, erstaunlich in ihrer Vielfalt, aber im Innersten nichts anderes als das seelenlose Ablaufen einer naturgesetzlich berechenbaren Mechanik wie der eines Uhrwerks.» Sie macht eine kurze Pause und stellt nun eine erste Frage: «Welche Konsequenzen hätte diese Haltung für das, was wir heute mit dem Begriff Tierwohl bezeichnen?»
Ruth lässt den Blick durch den Raum gleiten und bleibt wieder bei jenem Hörer in der letzten Reihe hängen. Sie ist unschlüssig, ob sie darüber beunruhigt sein soll, wie er sie ansieht, oder nicht. Im Moment kann sie sich damit nicht befassen. Wenn es sich nicht um ein akademisches Proseminar handeln würde, sondern um eine Schulstunde, könnte sie den Mann ansprechen. Sie könnte ihn auffordern, der Klasse seine Gedanken zu ihrer Frage mitzuteilen.
Eine junge Frau in der zweiten Reihe links hebt die Hand. Das ist ein bei vielen Erstsemestern noch vorhandener Reflex aus Schulzeiten. Sie sagt dann aber, ohne eine Aufforderung zum Sprechen abzuwarten: «Es wäre unmenschlich.»
«Inwiefern?»
«Ein Automat hat ja keine Gefühle.»
«Dann setzen Sie voraus, dass Tiere Gefühle haben?»
«Das ist doch selbstverständlich», wirft ein junger Mann auf der anderen Seite des Auditoriums ein.
Ruth schüttelt den Kopf, ganz leicht nur. Sie will nicht belehren. «In der Philosophie ist nichts selbstverständlich», sagt sie. «Jeden Standpunkt, den wir einnehmen, müssen wir begründen.»
«Man muss ein Tier nur ansehen, dann weiß man, dass es Gefühle hat. Man spürt das. Es überträgt sich.»
Spüren, übertragen … Es ist Ruths Aufgabe, gleich zu Beginn des Studiums zu vermitteln, wie elementar es in der Philosophie ist, präzise und nicht nach Gefühl zu argumentieren. Klar definierte Begriffe zu verwenden. Etwas zu spüren ist kein tragfähiges Argument. Aber nach der Szene am Lietzensee kommt sie sich beinahe wie eine Betrügerin vor. Sie hat es ja selbst geglaubt zu spüren: die Aggression des Tieres und wie sie sich auf sie übertragen hat. Auf einen Automaten kann man nicht wütend sein – oder man kann schon, aber es ist sinnlos.
Eine andere Studentin wendet ein: «Wie konnte Descartes Tiere für Automaten halten? Die wussten doch auch damals schon, dass unter der Haut keine Zahnrädchen sitzen.»
«Historisch ist es so, dass die Feinmechanik seinerzeit große Fortschritte gemacht hat. Aus dem frühen 17. Jahrhundert stammen zum Beispiel die ersten Beschreibungen von Kuckucksuhren. Heute erscheinen sie uns vielleicht eher skurril oder kitschig, aber damals waren sie Hightech. War jemand von Ihnen schon einmal in Prag? Am Rathaus dort gibt es eine alte astronomische Uhr mit mechanischen Figuren, die sich zu jeder vollen Stunde bewegen. Natürlich wusste Descartes, dass Tiere nicht aus Feder- und Räderwerken bestehen, aber er hat mitbekommen, dass die Mechanik sich ständig verfeinert. Vielleicht hat jemand von Ihnen Der Sandmann von E. T. A. Hoffmann gelesen? Nehmen Sie sich Zeit dafür und denken Sie die Geschichte weiter. Heute stehen wir an der Schwelle der Möglichkeit, künstliche Wesen zu erschaffen, die wir nicht mehr von natürlichen Lebewesen unterscheiden können. Was diesen Punkt angeht, können wir Descartes also keinen Vorwurf machen, er war da eher ein Visionär.» Um den Gesprächsfluss nicht zum Erliegen zu bringen, fügt sie hinzu: «Damit komme ich noch einmal zurück auf meine ursprüngliche Frage: Wie wollen wir sicher wissen, dass Tiere keine Automaten sind, sondern tatsächlich empfindungsfähig? Und wie löst Descartes das Problem, dass wir Menschen auch nur Automaten sein könnten? Unserer inneren Beschaffenheit nach unterscheiden wir uns ja nur unwesentlich von anderen Warmblütern.»
«Wir Menschen wissen ja, dass wir etwas empfinden», sagt die erste Studentin.
«Könnte das nicht auch Einbildung sein?»
Die junge Frau denkt darüber nach. «Ja, aber irgendetwas bleibt in uns doch immer übrig: Denken, eingebildetes Denken, eingebildete Einbildung, irgendwie so …»
«Sehr gut», sagt Ruth. «Und wie nennt Descartes diesen Rest in uns, der, wie Sie sagen, immer übrig bleibt?»
«Res cogitans?»
Ruth nickt. «Wir Menschen bestehen nach Descartes aus zwei Substanzen: der res extensa und der res cogitans. Tiere hingegen sind für ihn nur materielle Wesen der res extensa. Er geht in diesem Punkt sehr weit. Wenn ein Tier geschlagen werde und schreie, sagt er, so sei das im Prinzip so etwas wie das Quietschen einer ungeölten Tür. Wenn er recht hätte, müssten wir uns über die ethische Legitimität von Massentierhaltung gar keine Gedanken machen. Descartes wurde dafür auch zu seiner Zeit schon stark kritisiert. Aber wie finden wir heraus, ob wir ihm zustimmen können beziehungsweise dass wir es nicht tun sollten?»
Aus allen Überlegungen, Ideen und Gedanken, die nun geäußert werden, geht hervor, wie wichtig es dieser jungen Generation ist, Tiere zu fühlenden Mitwesen zu erklären, die das gleiche Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit haben wie jeder einzelne von ihnen. Doch alle Versuche, die Tierseele zu retten, laufen auf eine Vermenschlichung der Kreatur, auf anthropomorphe Verhaltensdeutungen oder auf den schlichten Glauben an eine solche Seele hinaus. Und an etwas zu glauben reicht in der Philosophie nicht aus.
Nach einer lebhaften Diskussion sagt Ruth am Ende des Seminars mit einem kurzen Blick auf ihre Uhr: «Meine Antwort wird Sie vielleicht enttäuschen. Philosophisch beweisen, dass Tiere eine Seele haben, ist tatsächlich unmöglich. Es geht nicht, wie sehr auch immer dies unseren Gefühlen widerspricht. Wenn wir Tiere nicht willkürlich mit menschlichen Eigenschaften ausstatten wollen, dann bleibt uns nur der Weg über die Axiomatik. Wir müssen etwas wie die Einheit alles Lebendigen als philosophisches Grundpostulat etablieren. Ein mechanistisches oder behavioristisches Weltbild kann dies nicht leisten. Und damit komme ich zum Lektürestoff für die nächste Woche. Wir werden uns mit Gottfried Wilhelm Leibniz beschäftigen und der Frage, inwieweit seine Monadenlehre einen nicht mechanistischen Blick auf die Tier- und auch Pflanzenwelt ermöglicht und uns in die Lage versetzt, eine Einheit alles Lebendigen aus einem philosophischen Prinzip ohne Rückgriff auf Ad-hoc-Vermenschlichungen abzuleiten. Die Lektüreliste dazu finden Sie wie üblich im Internet. Vielen Dank.»
Zum Geraschel von Papier, Rucksäcken und Jacken sieht Ruth noch einmal dorthin, wo jener ältere Hörer gesessen hat, dessen Blick für sie so irritierend war. Aber der Platz am Ende des Saals ist leer.
Am Nachmittag kommt Heinrich Nosak in Ruths Büro. Er hat den Lehrstuhl für Philosophiegeschichte inne und ist Hegelspezialist. Vor zwei Jahren, zum 250sten Geburtstag des Begründers des dialektischen Denkens und ehemaligen Rektors der Berliner Universität, hat Heinrich Nosak eine Hegelbiographie vorgelegt, die für alle Beteiligten, insbesondere für ihn selbst, überraschend zu einem soliden Verkaufserfolg geworden ist. Niemand hat damit gerechnet, dass Hegels Wirken, seine abstrakten Begriffskonstruktionen und der schwäbische Ursprung seiner langen, verschlungenen Sätze ein über die engsten Kreise philosophisch interessierter Leser hinausgehendes Publikum ansprechen könnte. Vielleicht passte Hegels Grundgedanke, dass alles irgendwann in sein Gegenteil umschlägt, in die Zeit des ersten Corona-Lockdowns: Freiheit – Zwang, Gesundheit – Krankheit, Glück – Unglück.
Heinrich ist in der DDR aufgewachsen und hat dort Philosophie, also Marxismus-Leninismus, studiert. In seiner «Promotion B», einer ostdeutschen Qualifikation, die seinerzeit ungefähr der traditionellen Habilitation entsprach, beschäftigte er sich mit der marxistischen Kritik an Hegels Herleitung der Welt aus Ideen. Marx’ Einwand gegen Hegel, dass in der Dialektik abstrakte Begriffe die Grundlage der materiellen Wirklichkeit bildeten und nicht umgekehrt, laufe logisch ins Leere, weil ja auch Marx seine Ideen letztendlich in sprachliche Begriffe fassen müsse, argumentierte er. Ein purer Materialismus ohne jede Transzendenz sei mithin nicht möglich. Damit fiel Heinrich politisch in Ungnade. Er erhielt keine Lehrbefugnis, zog seine Schrift aber nicht zurück und arbeitete eine Weile als Dramaturg am Maxim-Gorki-Theater. Nach dem Ende der DDR und der anschließenden Entlassung von mehr als 3000 politisch belasteten Wissenschaftlern der Humboldt-Universität berief man ihn auf den vakant gewordenen Lehrstuhl Geschichte der Philosophie.
Heinrich setzt sich. «Ich habe dir noch gar nicht zu deiner Berufung in den Deutschen Ethikrat gratuliert.»
«Ach, nun ja …»
«Keine falsche Bescheidenheit. Das ist großartig. Wer, wenn nicht wir Philosophen, soll die Probleme der Welt lösen?»
Heinrich hatte immer schon ein gesundes Selbstvertrauen, denkt Ruth. Dass er sich über ihre Berufung freut, ist dennoch nicht selbstverständlich. Eigentlich gehört er zum konservativen Flügel der philosophischen Fakultät, während Ruth allgemein als Vertreterin linksliberaler Ideen gilt. Einer alten philosophischen Unterteilung folgend, könnte man sagen, dass Heinrich für Hegels Rechte steht und Ruth für Hegels Linke. Dennoch hat sich zwischen ihnen im Laufe der Zeit eine Freundschaft eingestellt, die man, wiederum im Hegel’schen Sinne, als die Aufhebung der Widersprüche auf einer höheren Ebene betrachten kann.
«Na klar», lacht Ruth, «Weltrettung! Ist dafür nicht James Bond zuständig oder Indiana Jones oder so?»
«Ich glaube, bei dir ist die Welt in besseren Händen. Noch einmal: gratuliere!»
«Danke.»
Heinrich Nosak ist ein gut aussehender Mann Mitte sechzig, ein Typ, wie man ihn in einer Rolexwerbung erwarten würde: volles, elegant ergrautes Haar, kräftige, aber schlanke Statur auf sportlich langen Beinen, stets leicht gebräunte Gesichtshaut, genau das richtige Maß zwischen kränklich winterbleich und künstlich sommerbraun. Zwischen Ruth und ihm hat es immer eine Spannung gegeben, die über die Lust am intellektuellen Sparringsgefecht hinausging. Aber Ruth hat nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, diese zweite Ebene zu erforschen, um herauszufinden, ob Heinrich sie begehrte. Vermutlich hat er es sogar in den Jahren nach dem frühen Tod seiner Frau. Die Möglichkeit ließ Ruth damals an ihre Studienzeit denken, an den Reiz, sich in einen Dozenten zu verlieben.
Jetzt steht Heinrich kurz vor der Emeritierung, dieses ist sein letztes aktives Semester. Er geht zur Kaffeemaschine und gießt sich eine Tasse ein.
«Auf jeden Fall hattest du, was deine Forschungsthemen angeht, den richtigen Riecher.»
Sie muss lachen. «So würdest du es ausdrücken? Wie wäre es mit: Dass du deinen Grundsätzen treu geblieben bist, zahlt sich jetzt aus.»
«Meinen Grundsätzen bin ich auch immer treu geblieben.»
«Und hast mit Hegel Erfolg gehabt», sagt sie. «Aber du hast ja recht. Natürlich stehen Umweltthemen politisch im Fokus.»
«Hat die Fraktion der Grünen dich vorgeschlagen?»
Sie nickt. «Die Heinrich-Böll-Stiftung hat mich ein paarmal als Referentin zu Kongressen eingeladen. Massentierhaltung und Klima, Revolution oder Evolution … Wusstest du, dass die … nun ja … Blähungen und Rülpser von Rindern genauso viel zur Erderwärmung beitragen wie die gesamte EU? Auf solchen Kongressen lernt man einiges – und natürlich auch Leute kennen. Stimmt schon, inhaltlich gibt es bei mir viele Überschneidungen mit grünen Kernthemen. Aber ich bin ja in keiner Partei.»
«Jetzt wirst du dich erst mal mit Waffenlieferungen an die Ukraine und der Renaissance der Kernenergie auseinandersetzen müssen.»
«Wie stehst du dazu?»
Er lässt sich mit der Antwort Zeit. «Nun ja, ich frage mich, ob diese jungen Leute, die Straßenkreuzungen blockieren und sich an Kunstwerken festkleben, nicht etwas übersehen. Ich bleibe da meinem Hegel treu. Alles verkehrt sich irgendwann in sein Gegenteil. Gut und Böse sind untrennbar miteinander verbunden. Vielleicht sind diese Kinder die Wegbereiter der nächsten Diktatur: der ökologischen. Du musst das verstehen. Ich zweifele nicht daran, dass die Gründer der DDR es ursprünglich gut meinten. Sie haben genauso fest geglaubt, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, wie die Klimaaktivisten jetzt.»
Ruth spürt wieder die Bisswunde, die sich zunehmend mit einem Wärmegefühl bemerkbar macht, das Kribbeln breitet sich weiter aus.