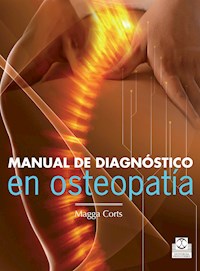99,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
<p><strong>Der Schädel – vom Überblick bis zum Detail – Zusammenhänge verstehen</strong><br></p><p>Überblicken Sie die Schädelknochen nach osteopathischen Gesichtspunkten. Zahlreiche Prometheus-Abbildungen, kombiniert mit Text und&nbsp;hervorgehobener osteopathischer Bedeutung, lassen Sie bis ins Detail den Aufbau und die Funktionen des Kopfes verstehen.<br></p><p>Lernen Sie das Kranium aus verschiedenen Perspektiven (ventral, lateral, kranial, kaudal) in unterschiedlichen Tiefen (oberflächliche Strukturen, tieferliegende Strukturen) kennen. Auch die embryologischen Entwicklungen werden einbezogen. Sie erkennen, wie Formen und Funktionen zusammenpassen und lernen die funktionell interessanten Strukturen. In osteopathischen Korrespondenzen erfahren Sie mehr über weitere Verbindungen der Strukturen, die Symptome sowie Pathologien aus osteopathischer Sicht erklären.</p><p>Ideal zum Nachschlagen und als Ergänzung zum Band „Anatomie für Osteopathen“. Beide Bände sind auch als Set erhältlich – sparen Sie gegenüber dem Einzelkauf!<br></p><p>Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform Osteothek zur Verfügung (Zugangscode im Buch).</p>
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Anatomie für Osteopathen - Kopf
Lehrbuch und Atlas
Magga Corts
328 Abbildungen
Autorenvorstellung
Magga Corts
Studium an der Deutschen Sporthochschule Köln (Studienschwerpunkte: Sportmedizin, Sporttherapie, Psychomotorik, Abschluss: Diplom Sportwissenschaft)
langjährige Tätigkeit in der betrieblichen Gesundheitsförderung, Arbeitsmedizin und Sporttherapie
Berufsfachschule IAT für Naturheilkunde in Köln
Staatliche Abschlussprüfung zur Heilpraktikerin
Abschluss acon-COLLEG DO.CN®, DO.CNPäd®
BAO-Abschluss mit 5-jähriger Osteopathieausbildung
Seit 1999 in eigener Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde tätig.
Dozentin für osteopathische Behandlungskonzepte osteopathische Techniken im Bereich der parietalen viszeralen, kraniosakralen Osteopathie und myofaszialer Wirkungsketten
Autorin der Fachbücher „Diagnoseleitfaden Osteopathie“ (Thieme 2020, 3. Aufl.), „Sportosteopathie“ (Haug 2013) und „Anatomie für Osteopathen“ (Thieme 2023, 2. Aufl.)
Geleitwort
Mit ihrem neuen Buch „Anatomie für Osteopathen – Kopf“ ist es Magga Corts hervorragend gelungen, für uns Osteopathen eine wichtige Lücke in der Literatur zu schließen. Dieses Werk ist eine Kombination aus Lehrbuch und Lernatlas und bietet neben sehr verständlichen Texten ein überaus anschauliches Bildmaterial. Die Erläuterungen einzelner Knochen, Nerven, Gewebeschichten (u. a.), eingebettet in den osteopathischen Gesamtkontext von Struktur und Funktionalität, ist didaktisch sehr gut umgesetzt. Ergänzend dazu lassen die Informationen über Bezüge und Wechselwirkungen von myofaszialen Ketten, kraniosakralen Bewegungsmustern anatomischer Strukturen und osteopathischen Korrespondenzen keine Wünsche offen. Ich bin mir sicher, dass dieses Lehrbuch ein „Must-have“ für die Schülerinnen und Schüler unseres ACON-COLLEGs, für die Aus- und Fortbildungsangebote in unseren bundesweiten ACON-Arbeitskreisen und für alle lern- und wissbegierigen, osteopathisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen sein wird.
Thomas Schreiber
Bundesausschussvorsitzender der ACON e.V.
Geleitwort
Ein weiteres Buch aus der Feder von Magga Corts zu begleiten, ist eine große Freude. Nachdem das erste Anatomiebuch „Anatomie für Osteopathen“ ein großer Erfolg ist und in Fachkreisen immense Beachtung findet, ist das neue Buch die konsequente Fortführung ihrer Arbeit. In diesem Buch steht das Kranium mit seinen vielfältigen, komplexen Strukturen im Mittelpunkt. In ihrer unnachahmlichen Didaktik zeigt Magga Corts uns anatomische Einblicke in diese Region, die das osteopathische Denken kennzeichnen. Ob es Durchtritte von Nerven oder Gefäßen am Schädel sind und die damit einhergehenden Entrapment-Möglichkeiten, ob es membranöse Strukturen sind, die unter Spannung geraten können, oder die Beziehung von knöchernen Strukturen zueinander, aus jeder Sicht ergeben sich Erklärungen für Behandlungsmöglichkeiten. Gerade im Vergleich mit anderen Anatomieatlanten zeigt sich, dass das osteopathische Denken oft andere Blickwinkel und Facetten benötigt.
Ich danke Magga Corts ganz herzlich für ihre präzise Arbeit, die eine Lücke in der anatomischen Didaktik schließt, und wünsche unseren Kollegen viel Erfolg bei der Anwendung des Buches.
Mit besten kollegialen Grüßen
Christian Blumbach
Vorstand ACON e.V.
Vorwort
Die Idee zu diesem Buch ist auf Nachfragen von Kollegen in osteopathischen Ausbildungsseminaren und Fortbildungsveranstaltungen entstanden. Als Dozentin wurde ich wiederholt gefragt, ob es ein Anatomielehrbuch gebe, welches das Kranium detailliert aus der osteopathischen Perspektive veranschaulicht und gleichzeitig komplexe osteopathische Zusammenhänge aufzeigt. Das war für mich Anlass, dieses Buch zu schreiben.
Jede Art von Einteilung stellt unterschiedliche Aspekte in den Vordergrund. So ist dieses Inhaltsverzeichnis eine übersichtliche Abfolge einzelner Strukturen. In den Unterkapiteln folgen dann die komplexen Verknüpfungen.
Bitte lesen Sie in dem speziell dafür gestalteten nachfolgendem Kapitel „Wie arbeitet man mit dem Buch“, wie das Buch strukturiert ist und wie Sie mit dem Buch arbeiten können.
In die osteopathischen Korrespondenzen fließen viele Aspekte ein, die auf praktischer Erfahrung basieren. Anatomische Gegebenheiten werden im funktionellen Kontext betrachtet. Hypothesen führen zu möglichen Erklärungen von Symptomen und Pathologien. Um osteopathische Dysfunktionen zu verdeutlichen und zu veranschaulichen, wird auf osteopathische Denkmodelle zurückgegriffen.
Damit wird auch deutlich, dass weiterhin Forschungsbedarf besteht und vieles noch empirisch untersucht werden muss. Eine Aufgabe dieses Buches ist auch, Denkanstöße zu geben und Perspektiven für wissenschaftliche Untersuchungen aufzeigen.
Dadurch ist eine Kombination aus Lehrbuch und Atlas entstanden, die die etablierten anatomischen Atlanten ergänzt. Gleichzeitig ist dieses Buch auch eine Ergänzung meines Buches „Anatomie für Osteopathen“ (2019). Viele Aspekte, die dort in textlicher Form dargestellt wurden, werden in diesem Werk veranschaulicht und vertiefend ausgeführt. Dennoch stehen beide Bücher unabhängig voneinander und sind auch jeweils als Einzelwerk eigenständig nutzbar.
Ganz herzlich möchte ich mich bei Frau Grübener vom Georg Thieme Verlag bedanken. Danke für die kreative konzeptionelle, inhaltliche Zusammenarbeit, für Anregungen und die methodisch-didaktischen Impulse für dieses Buch. Die jahrelange Zusammenarbeit mit Frau Grübener ist für mich als Autorin immer wieder eine kreative Quelle für das Schreiben.
Mein Dank gilt auch Frau Carolin Frotscher und Frau Ulrike Marquardt, die mir mit ihrer kompetenten Betreuung eine große Hilfe waren.
Danke möchte ich auch meiner Familie sagen, die mir bei dieser Arbeit stets mit Rat und Tat zur Seite stand.
Köln, Dezember 2022
Magga Corts
Wie arbeitet man mit diesem Buch?
Dieses Buch soll Sie dabei unterstützen, das für das osteopathische Handeln wichtige räumliche Denken in anatomischen Strukturen zu schulen. Die beschriebenen Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Strukturen und Kausalzusammenhängen im Gesamtkontext des menschlichen Körpers sollen Sie anregen, vom Detail auf das Große und Ganze zu schließen.
In diesem Lehrbuch und Atlas wird das Kranium aus verschiedenen Perspektiven (ventral, lateral, kranial, kaudal) in unterschiedlichen Tiefen (oberflächliche Strukturen, tiefer liegende Strukturen) detailliert betrachtet. Details werden dann wieder in das große osteopathische Puzzle eingebaut und in die Wechselbeziehung zum gesamten Organismus gesetzt.
Einige Knochen, wie z. B. das Os sphenoidale, sind topografisch derart komplex eingebunden, dass sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden müssen. Es wurde danach gewichtet, aus welcher Perspektive man besonders vieles erkennen und funktionell ableiten kann. Einzelne Details im Zusammenhang mit anderen Schädelknochen sind bei den jeweiligen osteopathischen Korrespondenzen erfasst, die in der jeweiligen Perspektive funktionell von Interesse sind.
Wo finde ich was? Zu Beginn eines jeden Hauptkapitels, das sich im Titel durch die perspektivische Ansicht kennzeichnet, erfolgt ein Überblick. Es werden allgemeine Funktionszusammenhänge, topografische Merkmale sowie Regionen aus der jeweiligen Perspektive beschrieben.
Wenn man eine Übersicht über die oberflächlichen und muskulären Strukturen des Kraniums sucht, wird man in den Kapiteln zur Faszienhülle fündig.
Wenn Sie Näheres zu einem Knochen des Kraniums lesen wollen, erhalten Sie detaillierte Informationen in den Unterkapiteln des Kapitels „Knöcherne Anteile des Kraniums“.
Die Sortierung der Knochen innerhalb der Hauptkapitel erfolgte nach der Perspektive, aus der man vom Äußeren des Kraniums den besten Überblick hat. Knöcherne Anteile, die nicht unmittelbar großflächig am äußeren Kranium sichtbar sind, findet man im Kapitel „Tiefere knöcherne Anteile“.
Bei den einzelnen Schädelknochen erfolgt zunächst eine allgemeine Form- und Funktionsbeschreibung, um einen ersten Überblick über die Funktionalität der anatomischen Struktur zu bekommen. Um die morphologische Wandlung anschaulicher darzustellen, wird jeweils kurz auf die embryologische Entwicklung eingegangen. Das Gestaltungsprinzip der einzelnen Kapitel: Es wird von der Gesamtübersicht zum Detail geführt.
Die Anatomie beinhaltet alle Strukturen, die für die osteopathischen Funktionszusammenhänge besonders wichtig sind. Neben den knöchernen Anteilen werden Suturen, benachbarte Knochen mit ihren suturalen Verbindungen, Foramina, Fissuren, Canales, Ligamenta, Muskeln, Faszien, intrakranielle Membranen, systemische Vaskularisation und das neurologische Netzwerk aufgeführt.
Die Durchtrittsöffnungen oder Passagen werden im Zusammenhang mit den durchtretenden Strukturen genannt. Die beteiligten vaskulären und neurologischen Anteile sind zur besseren Übersicht noch einmal gelistet.
Die dann folgenden Abbildungen veranschaulichen jeweils die knöcherne Struktur mit ihren Details aus allen Perspektiven (ventral, lateral, kaudal, kranial). Gelb markiert sind Strukturen, die aus osteopathischer Sicht interessant sind. Darauf wird u.a. detailliert jeweils in den Kapiteln „Osteopathische Korrespondenzen“ eingegangen. Oder sie sind in der Beschreibung der Anatomie im Text fettgedruckt, weil die damit verbundenen Strukturen wichtig für den Gesamtkontext sind.
Sie suchen etwas zu myofaszialen Wirkungsketten und deren Bezug zu Kranium? Nach dem Kapitel „Anatomie“ eines Schädelknochens können Sie in den Abschnitten „Myofasziale Wirkungsketten“ dazu weitere Informationen finden.
Der „Kraniosakrale Kontext“ bezieht sich auf die kraniosakrale Bewegung der anatomischen Struktur. Die physiologische Bewegung (biomechanisches Modell) wird beschrieben und der palpatorische Eindruck der stimmigen Bewegung dargestellt. Ergänzt wird dieses Kapitel, je nach Struktur, um die kraniometrischen Punkte und die Zuordnung zur Zentrallinie.
Sie möchten mehr vom kranialen Puzzle und dessen Wirkung auf den gesamten Organismus erfahren? Die „Osteopathischen Korrespondenzen“ erörtern die komplexen Zusammenhänge. Hier werden Strukturen besprochen, die im Sinne des osteopathischen Puzzles weitreichende Verbindungen haben und Symptome sowie Pathologien aus osteopathischer Sicht erklären können. Viele Aspekte basieren auf praktischer Erfahrung.
Eine stichwortartige Auflistung der „Korrespondierenden Strukturen“ stellt schließlich eine Auswahl dar, die den Kontext unterstreicht, dass es sich um den gesamten systemischen Ansatz des menschlichen Körpers handelt.
Komplexe knöcherne kraniale Strukturen wie Augenhöhle und Ohrenhöhle sind als einzelne Kapitel konzipiert.
Tipps und Hinweise für die Behandlung? Diese Behandlungshinweise enthalten zum einen eine Auswahl von Indikationen und zeigen zum anderen exemplarisch, welche Behandlungsmöglichkeit sich für die jeweilige Struktur anbietet. Hier werden beispielhaft Behandlungstechniken vorgeschlagen, die sich auf typische Funktionszusammenhänge bei Dysfunktion der beschriebenen Struktur beziehen. Hinweise zur Triggerpunktbehandlung runden das Kapitel ab.
Sie suchen osteopathische Aspekte zu neurophysiologischen Strukturen und zur Zirkulation? Die Kapitel „Membran- und Gefäßsystem“ und „ZNS, VNS und Hirnnerven, Plexus cervicalis“ zeigen den strukturellen Verlauf auf. Auch hier richten osteopathische Korrespondenzen den Fokus wieder auf das gesamte System. Denn Zirkulation und der neurophysiologische Gesamtkontext sind ein wichtiger Aspekt in den osteopathischen Denkmodellen.
Das Kapitel „Differenzialdiagnostik im Überblick“ gibt eine Übersicht über ausgewählte Pathologien, die sich im kranialen Bereich zeigen können. Dies bildet ein kleines Repetitorium für differenzierte Anamnese, Inspektion, Untersuchung und Behandlungsstrategien.
Bei der Lektüre sowie bei der Entdeckung der anatomischen Welt der Osteopathie wünsche ich Ihnen viel Freude.
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Autorenvorstellung
Magga Corts
Geleitwort
Geleitwort
Vorwort
Wie arbeitet man mit diesem Buch?
1 Einstieg in die kraniosakralen Komponenten
1.1 Das kraniale Puzzle: eine Übersicht
1.2 Hinweise zu Suturen und zur Schädelentwicklung
1.2.1 Überblick
1.2.2 Pivot-Punkte und Dysfunktion
2 Ventrale Ansicht Viszerokranium und Kranium
2.1 Überblick
2.1.1 Viszerokranium und Kranium
2.1.2 Regionen
2.2 Oberflächliche und tiefere Schicht
2.2.1 Faszienhülle, mimische Muskeln
2.3 Knöcherne Anteile Viszerokranium und Kranium
2.3.1 Os mandibulare
2.3.2 Os hyoideum
2.3.3 Os maxillare
2.3.4 Os zygomaticum
2.3.5 Os nasale
2.3.6 Os frontale
2.4 Tiefere knöcherne Anteile Viszerokranium und Kranium
2.4.1 Os palatinum
2.4.2 Os sphenoidale
2.4.3 Os ethmoidale
2.4.4 Concha nasalis inferior
2.5 Augenhöhle
2.5.1 Augenhöhle und Bulbus oculi
2.6 Schnittbilder
3 Laterale Ansicht Viszerokranium und Kranium
3.1 Überblick
3.1.1 Laterales Viszerokranium und Kranium
3.1.2 Regionen
3.2 Oberflächliche und tiefere Schicht
3.2.1 Faszienhülle, mimische Muskeln
3.3 Knöcherne Anteile Viszerokranium und Kranium
3.3.1 Os temporale
3.3.2 Kiefergelenk (Art. temporomandibularis)
3.3.3 Os parietale
3.3.4 Os lacrimale
3.4 Tiefere laterale Ebene
3.4.1 Vomer
3.5 Ohrenhöhle
3.5.1 Ohr
3.6 Schnittbilder
4 Dorsale Ansicht Kranium
4.1 Überblick
4.1.1 Hinteres Kranium
4.1.2 Regionen
4.2 Oberflächliche und tiefere Schicht
4.2.1 Faszienhülle, Muskeln
4.2.2 Fascia thoracolumbalis (FTL)
4.3 Knöcherne Anteile Kranium
4.3.1 Hinterhauptregion und Übergang Os occipitale und Atlas
4.3.2 Os sacrum/Os coccygis
5 Kaudale Ansicht Kranium
5.1 Überblick
5.1.1 Kaudales Kranium
5.1.2 Leitungsbahnen und Durchtrittsöffnungen
5.2 Oberflächliche und tiefere Schicht
5.2.1 Os occipitale
5.3 Schnittbilder
6 Kraniale Ansicht Kranium
6.1 Überblick
6.1.1 Kraniales Kranium
6.1.2 Regionen
6.2 Oberflächliche Schicht
6.2.1 Galea aponeurotica
6.3 Knöcherne Anteile Kranium
6.3.1 Kalotte
6.3.2 Schädelbasis von kranial
6.3.3 Synchondrosis sphenobasilaris (SSB), Synostosis sphenooccipitalis (SSO)
6.3.4 Leitungsbahnen und Durchtrittsöffnungen
7 Membran- und Gefäßsystem
7.1 Überblick
7.1.1 Membransystem des Schädels
7.1.2 Liquor cerebrospinalis und Ventrikelsystem
7.1.3 Arterielles System
7.1.4 Venöses System
7.1.5 Lymphatisches System
7.2 Schnittbilder
8 ZNS, VNS und Hirnnerven, Plexus cervicalis
8.1 Überblick
8.1.1 Großhirn (Telencephalon)
8.1.2 Zwischenhirn (Diencephalon)
8.1.3 Hirnstamm
8.1.4 Vegetatives Nervensystem (VNS)
8.1.5 Enterisches Nervensystem
8.1.6 Plexus cervicalis
8.2 Hirnnerven
8.2.1 N. olfactorius (I)
8.2.2 N. opticus (II)
8.2.3 N. oculomotorius (III)
8.2.4 N. trochlearis (IV)
8.2.5 N. trigeminus (V)
8.2.6 N. abducens (VI)
8.2.7 N. facialis (VII)
8.2.8 N. vestibulocochlearis (VIII)
8.2.9 N. glossopharyngeus (IX)
8.2.10 N. vagus (X)
8.2.11 N. accessorius (XI)
8.2.12 N. hypoglossus (XII)
8.3 Übersichtsabbildung
9 Differenzialdiagnostik im Überblick
9.1 Gesichtsödeme
9.2 Dyspnoe
9.3 Heiserkeit
9.4 Halsvenenstau
9.5 Kopfschmerzen
9.6 Sehstörungen
9.7 Vertigo
10 Abkürzungen
11 Glossar
12 Quellen und weiterführende Literatur
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
1 Einstieg in die kraniosakralen Komponenten
1.1 Das kraniale Puzzle: eine Übersicht
Der menschliche Schädel besteht in seiner Gesamtheit aus 22 Knochen ( ▶ Abb. 1.1), die über Suturen miteinander verbunden sind. Von den 22 Knochen sind 7 Knochen paarig angelegt. Grundsätzlich kann der Schädel unterteilt werden in Neurokranium (Hirnschädel) und Viszerokranium (Gesichtsschädel).
Zum Neurokranium gehören:
Os frontale (Stirnbein)
Os ethmoidale (Siebbein)
Os sphenoidale (Keilbein)
Os occipitale (Hinterhauptbein)
Ossa parietalia (Scheitelbeine)
Ossa temporalia (Schläfenbeine)
Das Viszerokranium setzt sich zusammen aus:
Ossa maxillae (Oberkieferknochen)
Ossa nasalia (Nasenbeine)
Ossa lacrimalia (Tränenbeine)
Ossa zygomatica (Jochbeine)
Ossa palatinae (Gaumenbeine)
Conchae nasalis inferior (untere Nasenmuscheln)
Vomer (Pflugscharbein)
Os mandibulare (Unterkieferknochen), Os hyoideum (Zungenbein) und die Gehörknöchelchen (Amboss, Hammer, Steigbügel) werden als extrakranielle Knochen bezeichnet.
Die Funktion des knöchernen Schädels ist u. a. der Schutz des zentralen Nervensystems, der Augen, des Hör- und Gleichgewichtsorgans und der Nasen- und Mundhöhlen. Gleichzeitig ermöglicht die Konstruktion von Unterkiefer und Mundhöhle, die Nahrung aufzunehmen und zu zerkleinern.
Merke
Die Ausprägung des Neurokraniums ist im Wesentlichen durch das Wachstum des Gehirns und den Wachstumszug großer Gefäße bestimmt. Ohne den Gestaltwandel des Gehirns schon während der frühen embryonalen Entwicklung würden sich weder die duralen, noch die bindegewebigen, noch die knöchernen Schädelanteile mit ihren Ossifikationszentren adaptiv gestalten.
Das Viszerokranium basiert in seiner Gestalt auf der embryonal angelegten Nasenkapsel. Sie differenziert sich später zum Siebbein. Os maxillare und die kleineren Gesichtsknochen lagern sich auf ihr auf. Morphologische Veränderungen entstehen dann durch das weitere Wachstum der Kopforgane ▶ [8], ▶ [9], ▶ [10].
Die Organe des Kopfes sind von kaudal nach kranial: der Pharynx mit der anschließenden Mundhöhle mit dem Gaumen, die die Zunge beherbergt. Weitere Organe des Kopfes sind die Kopfspeicheldrüsen, der obere Bereich der Atemwege mit den Nasenhöhlen und den Nasennebenhöhlen, das Hör- und Gleichgewichtsorgan im Innenohr , die Augen und das ZNS (zentrales Nervensystem) in Form des Gehirns.
Das Gehirn liegt intrakranial, weiter kaudal verläuft es als Rückenmark im Rückenmarkkanal und reicht bis ca. Höhe Lendenwirbelkörper 1/2 (Conus medullaris).
Auch hier zeigt sich wie u.a. bei Nerven- und Gefäßsystem die regionübergreifende Organisation: Das Verdauungssystem beginnt topografisch im Kopfbereich und reicht als Kontinuum bis zum Beckenboden.
Das arterielle Gefäßsystem des Kraniums speist sich aus der A. carotis communis, die sich dann an der Karotisgabel in die A. carotis interna (größtenteils intrakraniale Versorgung) und A. carotis externa (größtenteils extrakraniale Versorgung) aufteilt.
Venös wird das Kranium aus 2 Systemen drainiert, oberflächlich über die V. jugularis externa und die intrakraniale Region über die V. jugularis interna. Ein Zusammenfluss findet im Angulus venosus statt auf Höhe des M. scalenus anterior.
Lymphknoten befinden sich zahlreich im Bereich der Atemwege und Regionen des Mundes und in den Gehörgängen. Hier können Krankheitserreger erleichtert eintreten. Die Drainage findet über den Truncus jugularis sinister und Truncus jugularis dexter statt.
Der Liquor cerebrospinalis zirkuliert in den Hohlräumen des ZNS (Ventrikel, intra- und extrakraniale Subarachnoidalräume). Er wird vorwiegend in den Seitenventrikeln vom Plexus choroideus gebildet. Die Fluktuation des Liquors ist für Sutherland eine Ursache für den Cranio-Rhythmic-Impulse ▶ [34].
Im Kopfbereich befinden sich neben den verschiedenen Anteilen des ZNS und den Hirnnerven auch parasympathische Kopfganglien (Ggl. ciliare, Ggl. pterygopalatinum, Ggl. oticum, Ggl. submandibulare).
Die sympathischen Ganglien für den Kopfbereich befinden sich im Halsbereich (Truncus sympathicus, Ggl. cervicale superius). Die ventralen Äste des zervikalen Spinalnervs bilden den Plexus cervicalis, der mit seinen sensiblen Ästen die Haut um das Ohr und das seitliche Hinterhaupt versorgt. Die sensible Versorgung des Hinterhaupts erfolgt über die dorsalen Spinalnerven aus C 2 (N. occipitalis major).
Abb. 1.1 Schädel von ventral (Norma facialis). Kraniometrische Punkte dienen der Orientierung, z. B. für behandlungstechnische Handhaltungen, gelb unterlegt sind die Knochen des Viszerokraniums.
(Quelle: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Kopf, Hals und Neuroanatomie. Illustrationen von M. Voll und K. Wesker. 6. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2022)
Regionale Faszien des Kopfes umkleiden u. a. Muskeln und Organe des Kopfes, sind aber im Grunde die Fortsetzung des ganzkörperumfassenden Faszienkontinuums. Faszien umschließen auch die bindegewebig gefüllten Räume des Kraniums. Im Bereich des ZNS zeigen sie sich als strukturiertes Bindegewebe (Meningen). Faszien umhüllen und unterteilen den Körper in oberflächliche und tiefere Schichten. Ein Teil setzt an der Schädelbasis an. In ihrer Gesamtheit kann auch von einer Faszie gesprochen werden, deren Funktion nicht nur topografisch ist (umhüllen, unterteilen, verbinden, halten, formen, stabilisieren). Faszien haben nämlich auch mechanische Aspekte, wie Spannung übertragen und Gleitbewegungen ermöglichen. Immunologisch wirken sie durch ihre phagozytierenden Zellen. Neurophysiologisch sind die propriozeptiven Eigenschaften des Fasziennetzes von besonderer Bedeutung ▶ [101].
Die Diaphragmen als horizontal verlaufende Strukturen wirken im Fasziennetzwerk als Kreuzungspunkt, Stabilisator und Umlenkrolle. Die Diaphragmen sind Pufferzonen im Sinne der Körperstatik, unterstützen die zirkulierenden interstitiellen Flüssigkeiten des Körpers. Als venolymphatische Pumpe beeinflussen sie die Druckverhältnisse im Körper und sind Stütz- und Aufhängevorrichtungen für Organe ▶ [46], ▶ [80].
Aus osteopathischer Sicht ist die komplexe Architektur des Kraniums nicht nur aufgrund seiner Verbindung zum Sakrum entscheidend, sondern auch durch die faszialen, ligamentären, membranösen Kontinuitäten zum gesamten Organismus. Die zirkulatorischen Elemente (Blut, Lymphe, Liquor), die mechanische Funktionalität und neuronalen Verknüpfungen sind elementar. Es gilt das Grundprinzip: Funktion und Struktur sind reziprok gekoppelt.
Die Funktionalität der Sinnesorgane (Augen, Hörorgan, Gleichgewichtsorgan, Nase, Mund), propriozeptive-neurophysiologische Regelkreise und das emotionale Erleben, das vegetativ wesentlich Veränderungen im Gesamtorganismus beeinflussen kann, sind existenziell für die körpereigene Integration. Daraus ergibt sich eine holistische dynamische architektonische Konstellation, die für das osteopathische Behandeln elementar ist.
Die folgende Aufzählung zeigt strukturelle Anteile auf, die im Fokus osteopathischer Behandlungen stehen:
Verbindung der einzelnen Schädelknochen über Suturen
Hirn- und Rückenmarkshäute mit dem intrakranialen und extrakranialen Membransystem
Ventrikelsystem, Liquor cerebrospinalis, rhythmische Zirkulation
neuronale Komplexität und Verknüpfungen
muskuläres Zusammenspiel und gelenkige Verbindungen
Atmung, Atemmechanik, Herztätigkeit und Zirkulation
Vaskularisation und Lymphabflüsse
Viszera und myofasziale Einbindung
Faszienkontinuum und die Bedeutung der Diaphragmen
myofasziale Wirkungsketten
Kraftlinien
posturologische Körperkoordination
Es existieren zahlreiche osteopathische Modelle, die das kraniale Puzzle und seine Funktionalität zu erklären versuchen. Sie sind hilfreich für das grundlegende Verständnis des dynamischen Systems. Wie jedes Modell führt die Reduzierung darauf auch zu Defiziten. Die Ansätze für wissenschaftliche Untersuchungen, um genau das System näher zu klären, sind zahlreich. In Ermangelung wissenschaftlicher Ergebnisse wird hier auf das biomechanische und funktionelle Behandlungsmodell nach Sutherland zurückgegriffen. In den einzelnen Kapiteln wird näher auf die modellhaften Bewegungen eingegangen.
1.2 Hinweise zu Suturen und zur Schädelentwicklung
1.2.1 Überblick
Die Suturen sind ein Beispiel für die kinetische Morphologie anatomischer Strukturen. Es geht um Entwicklungsbewegungen, die zu ausgeformten differenzierten anatomischen Strukturen führen. Diese Kinetik beginnt mit der befruchteten Eizelle ▶ [8], ▶ [9].
Blechschmidt ▶ [10] sieht die Suturenentstehung im engen Zusammenhang mit dem embryonalen Wachstumszug von Blutgefäßen und Hirnwachstum. Das die Hirnanlage umgebende embryonale Bindegewebe (spätere Dura) adaptiert die kinematischen Wachstumskräfte und bildet Räume für die Gefäßentwicklung. Diese strangartigen Gewebeverdichtungen sind später gurtartige Verstärkungen der Dura. Sie sind Vorstufe der Schädelnähte. Schädelnähte sind dasjenige Bindegewebe, welches zwischen zwei benachbarten Schädelknochen liegt.
Eine Schädelnaht ist eine zugfeste Klammer, die den Knochenrand eines Schädelknochens umsäumt. Die Schädelnaht überbrückt die miteinander artikulierenden Schädelknochen. Im gesamten embryonalen, fetalen und postnatalen Entwicklungs- und Wachstumsverlauf zeigt sich, dass die Schädelnähte zudem auch eine Distanzierung der Schädelknochen voneinander unterstützen. Dadurch soll dem Schädelknochen Platz für das Knochenrandwachstum gelassen werden. Gleichzeitig halten die Schädelnähte die artikulierenden Schädelanteile gegen die Pulsationswellen der Gehirngefäße zusammen. Die Schädelknochenentwicklung basiert auf der Existenz der Schädelnähte. Die Schädelnähte sind Grundlage für die dynamisch-kinetische Entwicklung der Schädelknochen.
Die Suturen machen postnatal die weiteren Wachstumsveränderungen des kindlichen Schädels erst möglich. Die bindegewebige Verbindung der Schädelknochen untereinander ermöglicht eine hohe Elastizität und Plastizität. An den Kreuzungspunkten der Suturen befinden sich, postnatal noch gut sichtbar, bindegewebig überdeckte Spalten und Flächen zwischen den artikulierenden Schädelknochen. Dies sind die 6 Fontanellen, von denen 2 beidseits des Schädels liegen ( ▶ Abb. 1.2).
Die Suturen verknöchern zu deutlich unterschiedlichen Zeitpunkten mit unterschiedlichen Qualitäten. Quernähte entstehen zwischen gleich großen embryonalen Knochen. Breiten sich deren Ossifikationszentren schnell aus, dann verschieben sie sich gegen das Nahtbindegewebe. Hier bildet sich eine Sutura serrata, eine verzahnte Schädelnaht (z. B. Sutura sagittalis). Während des Gehirnwachstums versetzen sich diese Nähte kaum.
Eine Sutura plana, also ein parallel verlaufender Knochenrand, entwickelt sich bei Knochenanlagen, die sich langsam und geringfügig voneinander entfernen (z.B. Sutura internasalis).
Schrägnähte entstehen, wenn sich durch das Gehirnwachstum die Schädelnähte zueinander versetzen (z. B. Sutura zygomaticotemporalis). Erfolgt die Verschiebung quer zu den großen Knochenoberflächen, bildet sich hier eine Schuppennaht (z.B. Sutura parietomastoidea).
Tendenziell gilt, dass das Wachstum in Richtung anterior-posterior die transversalen Suturen unterstützt (z.B. Sutura coronalis, die sich zwischen dem Os frontale und den beiden Ossa parietalia befindet). Ein Breitenwachstum (transversal) ermöglichen die sagittalen Suturen (z.B. Sutur zwischen den beiden Ossa parietalia, Sutura sagittalis) ▶ [10].
Lage und Verknöcherung der Fontanellen
Hinterhauptsfontanelle (kleine Fontanelle, Fonticulus posterior):
kranial zwischen Ossa parietalia und Os occipitale
begrenzende Nähte: Sutura sagittalis (kranial), Sutura lamboidea (beidseits lateral)
Verschluss: ca. 3. Lebensmonat
späterer kraniometrischer Punkt: Lambda
vordere Seitenfontanelle (Fonticulus sphenoidalis):
beidseits lateral zwischen Os temporale, Os parietale und Os sphenoidale
begrenzende Nähte: Sutura coronalis (kranial), Sutura sphenoparietalis (okzipital)
Verschluss: ca. 6. Lebensmonat
späterer kraniometrischer Punkt: Pterion
Mastoidfontanelle (Fonticulus mastoideus):
lateral zwischen Os temporale, parietale und occipitale
begrenzende Nähte: Sutura squamosa (kranial), Sutura lamboidea (okzipital)
Verschluss: ca. 18. Lebensmonat
späterer kraniometrischer Punkt: Asterion
Stirnfontanelle (große Fontanelle, Fonticulus anterior):
zentral auf dem Schädeldach zwischen Ossa frontalia, Ossa parietalia
begrenzende Nähte: Sutura frontalis (ventral), Sutura coronalis (beidseits lateral), Sutura sagittalis (okzipital)
Verschluss: ca. 36. Lebensmonat
1.2.2 Pivot-Punkte und Dysfunktion
Pivot-Punkte: Umkehr- oder Wechselpunkte in der Ausrichtung der Suturenlippe werden als Pivot-Punkte bezeichnet. An diesen Punkten wechselt die abgeschrägte Suturenkante von innen nach außen oder umgekehrt. Eine nach innen abgeschrägte Suturenkante, also ausgerichtet zum Innern des Schädels, bedeckt eine nach außen gerichtete abgeschrägte Suturenkante ( ▶ Abb. 1.3). An den Pivot-Punkten findet keine Bewegung statt. Disengagement-Techniken orientieren sich an den Ausrichtungen von Suturenrändern.
Dysfunktion Sutur: Von einer Sutur in Dysfunktion spricht man, wenn beim Elastizitätstest eine Sutur oder ein Teil einer Sutur hart und unnachgiebig ist. D. h., sie ist in ihrer Mobilität eingeschränkt oder sogar unbeweglich. Der Druck bei der Untersuchung, der auf die Sutur gebracht wird, ist mäßig und langsam zunehmend. Je nach Suturenart (z. B. Schuppennaht, gezahnte Naht, Suturen mit Pivot-Punkten) ist die spezifische Behandlungstechnik auszuwählen.
Abb. 1.2 Schädel eines Neugeborenen.
Abb. 1.2a Ansicht von links.
(Quelle: Corts M. Diagnoseleitfaden Osteopathie. 3., unveränderte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020 nach Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Kopf, Hals und Neuroanatomie. Illustrationen von M. Voll und K. Wesker. 6. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2022)
Abb. 1.2b Ansicht von kranial.
(Quelle: Corts M. Diagnoseleitfaden Osteopathie. 3., unveränderte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020 nach Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. LernAtlas der Anatomie. Kopf, Hals und Neuroanatomie. Illustrationen von M. Voll und K. Wesker. 6. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2022)
Abb. 1.3 Richtung der Suturenränder. Pivot-Punkte sind erkennbar durch Umkehr- oder Wechselpunkt.
(Quelle: Corts M. Diagnoseleitfaden Osteopathie. 3., unveränderte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2020, nach Liem T. Kraniosakrale Osteopathie. 7. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2018)