
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nervenaufreibender Mystery-Thriller Romy verbringt die Ferien mit ihren Freunden Aurel und Jannis im abgeschiedenen Dorf Ancora. Ohne Handy, mitten in der Natur. Doch im Dorf häufen sich seltsame Ereignisse und Romy merkt, dass ihr unbeschwerter Sommer auf der Kippe steht. Schockiert muss sie feststellen, dass alles, was sie gerade erlebt, exakt einem Gedicht ihrer Mutter entspricht. Doch was hat ihre Mutter mit Ancora zu tun? Und warum endet die letzte Gedichtzeile mit Romys Tod? Um Ancora zu verstehen, muss Romy tief in der Vergangenheit graben und Geschehnisse ans Tageslicht bringen, die besser verborgen geblieben wären. Eine dunkle Bedrohung bahnt sich an – und die Frage: Kann ein Gedicht Wirklichkeit werden? Ancora ist ein Standalone.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Romy verbringt die Ferien mit ihren Freunden Aurel und Jannis im abgeschiedenen Dorf Ancora. Ohne Handy, mitten in der Natur. Doch im Dorf häufen sich seltsame Ereignisse und Romy merkt, dass ihr unbeschwerter Sommer auf der Kippe steht. Schockiert stellt sie fest, dass alles, was sie gerade erlebt, exakt einem Gedicht ihrer Mutter entspricht. Aber warum endet die letzte Gedichtzeile mit Romys Tod? Um Ancora zu verstehen, muss Romy tief in der Vergangenheit graben und Geschehnisse ans Tageslicht bringen, die besser verborgen geblieben wären. Eine dunkle Bedrohung bahnt sich an – und die Frage: Kann ein Gedicht Wirklichkeit werden?
»Colin Hadler und sein fast unverschämtes Talent: originell, klug und spannend mit jedem Wort und jeder Zeile.«Romy Hausmann
»Eine Geschichte mit starken Bildern und einer starken Heldin!«Anne Freytag
Der Autor
© Jakob Tscherne
Colin Hadler wurde 2001 in Graz geboren. Schon ab dem Alter von 12 Jahren spielte er in Schauspielhäusern Theater – manchmal durfte er sogar mehr als nur einen Baum verkörpern. Hadler schreibt Drehbücher, Gedichte und Romane. Noch in seiner eigenen Schulzeit tourte er durch andere Gemeinden und Bundesländer, um Jugendliche wieder zum Lesen zu bringen. Hadler lebt momentan in Wien und studiert Publizistik- und Kommunikationswissenschaft.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor*innen und Illustrator*innen:www.planet-verlag.de
Planet! auf Facebook:www.facebook.com/thienemann.esslinger
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
für Papa,
für immer
Prolog
Wenn er diese Fahrt überstehen will, ohne wahnsinnig zu werden, muss er an eine Tiefkühlpizza denken. Dessen ist sich Erik völlig im Klaren. Worüber er sich auch im Klaren ist, ist die Tatsache, dass er auf sich allein gestellt ist. Kein Funksignal. Kein Handyempfang. Keine beleuchteten Gasthäuser, die den Straßenrand zieren. Nur Wald und Einöde. So weit das Auge reicht.
Vor einer guten Stunde hat er die Autobahn verlassen und rattert nun mit dem alten Lkw seiner Firma über die beschädigte Landstraße. Gedankenversunken starrt er ins Nichts. In die alles verschlingende Schwärze, die sich für ihn fast schon lebendig anfühlt. Um sich die Monotonie der Strecke erträglicher zu machen, fantasiert er über eine Tiefkühlpizza. Zu Hause wartet eine auf ihn. Eine mit dünnem Boden und extra Käse. Daran, dass seine Frau bestimmt auch auf ihn wartet, will er nicht denken. Das würde seine Gehirnkapazität definitiv sprengen. Eine Sache genügt. Und sich zwischen einer Salami-Pizza und seiner scheiternden Ehe zu entscheiden, fällt ihm nicht sonderlich schwer. Seine Frau hat nie verstanden, warum …
Erik wird jäh aus seinen Gedanken gerissen. Er zuckt zusammen, verreißt das Steuer. Das Fahrzeug kommt so stark ins Schwanken, dass Erik es nur mit Mühe wieder unter Kontrolle bringt. Währenddessen hört er ihn. Den lang gezogenen, schmerzerfüllten Schrei aus der Dunkelheit. So hilflos und intensiv, dass sich der Ton regelrecht durch die Schwärze frisst. Nicht einmal vor der verriegelten Tür des Lkws macht er Halt, bohrt sich so tief in Eriks Verstand, dass er Gänsehaut bekommt. Ohne groß darüber nachzudenken, drückt er auf die Bremse, fährt rechts ran und bringt sein Fahrzeug zum Stehen.
Stille.
Sein Atem geht schnell, seine Hände schwitzen. Erik wendet den Blick zum Seitenspiegel und späht hinaus.
Nichts.
Hat er sich den Schrei nur eingebildet?
Nein. Ausgeschlossen. Er ist zwar übermüdet und hat einen langen Arbeitstag hinter sich, aber so einen Laut könnte er sich nicht einmal in seinen kühnsten Träumen ausdenken. Erik weiß, dass da etwas sein muss. Da draußen, in der Dunkelheit.
Erneut blickt er nach vorne, fokussiert den Straßenabschnitt im Wald, der vom künstlichen Licht des Wagens beleuchtet wird. Noch immer ist nichts zu hören. Es ist sogar so ruhig, dass Erik das Pochen seines eigenen Herzschlags in den Ohren spürt. Am liebsten würde er verschwinden – das Gaspedal durchdrücken und einfach losfahren. Doch er kann nicht. Irgendetwas hindert ihn daran.
Ein Gefühl? Eine Vorahnung?
Erik greift mit der linken Hand zur Tür, entriegelt das Schloss und drückt sie auf. Mit einem Quietschen öffnet sie sich. Ein weiterer Blick in die Dunkelheit.
Was, wenn sich jemand verletzt hat und Hilfe benötigt?
Je länger er sich diese Frage durch den Kopf gehen lässt, desto abstruser wirkt sie. Verletzt? Wer sollte hier mitten in der Nacht unterwegs sein?
Seit mindestens einer halben Stunde hat ihn kein Auto mehr überholt – niemand ist ihm entgegengekommen. Die Straße war wie leer gefegt.
Erik schnappt sich seine Jacke vom Beifahrersitz und knipst die Lampe der Fahrerkabine an. Anschließend kramt er im Handschuhfach, bis er eine Warnweste findet. Er zieht sich beides über und steigt aus dem Lkw. Es ist frisch. Erik kann seinen eigenen Atem nicht nur fühlen, sondern auch sehen. Ein Nebelschleier bildet sich vor seinem Gesicht. Nur kurz, denn im nächsten Moment verschluckt die Finsternis auch dieses Lebenszeichen. Die anwachsende Spannung lässt seine Nerven verrücktspielen.
Erik glaubt, eine Bewegung in der Dunkelheit wahrzunehmen. Reflexartig macht er einen Schritt zurück, stößt mit dem Rücken gegen das kalte Metall seines Lasters.
Da ist tatsächlich etwas. Direkt vor ihm. Etwas, das sich aus der Finsternis schält. Eine Gestalt, ein Schatten. Ein schwarzer Umriss in der noch schwärzeren Nacht. Eriks Körper ist wie versteinert, presst sich gegen den Wagen.
Und dann kann er die Gestalt erkennen.
Es ist ein Mädchen. Siebzehn, vielleicht achtzehn Jahre alt. Sie trägt ein zerfetztes, weißes Kleid. Eingetrocknete Blutspritzer sind darauf zu sehen. Ihre langen, dunkelblonden Haare kleben teilweise an ihrem verweinten Gesicht und vermischen sich mit den Tränen. Knapp vor Erik bleibt sie stehen. In ihren kastanienbraunen Augen spiegelt sich Angst.
»Hilf mir«, flüstert sie. Dann sackt sie zusammen.
Eriks Körper füllt sich rasend schnell mit Adrenalin. Er eilt zum Beifahrersitz des Lkws und packt sich die zusammengefaltete Stoffdecke, die darunter verstaut ist. Dann legt er sie über das verschreckte Mädchen und kniet sich zu ihr auf den Asphalt.
»Hey, alles ist gut. Du brauchst keine Angst zu haben«, murmelt er, weil es das Einzige ist, was ihm einfällt. Solche Situationen kennt Erik sonst nur aus Filmen. Doch das ist kein Film, das ist real. Alles davon. Das Mädchen, die Tränen – und auch das eingetrocknete Blut. »Was ist denn passiert?«
Das Mädchen gibt keine Antwort, rappelt sich stattdessen auf und bewegt sich zitternd auf den Wagen zu. Dann dreht sie sich noch einmal um: »Wir müssen fahren! Hörst du? Wir müssen unbedingt einsteigen! Jetzt!«
»Okay, okay. Ist ja gut«, entgegnet Erik und versucht dabei, beruhigend zu klingen. Sie hat eindeutig einen Schock. Noch mehr Panik kann sie nicht gebrauchen. Es wird Zeit, dass sie in die Wärme der Fahrerkabine kommt. Dort kann er dann die Polizei rufen. Vorausgesetzt, sein Handy hat diesmal Empfang.
Erik greift ihr helfend unter die Arme und gemeinsam umrunden sie das Fahrzeug. Mit letzter Kraft zieht sich das Mädchen hoch, sie setzt sich auf den Beifahrersitz.
»Bist du gestürzt?«, fragt Erik und mustert die blutigen Flecken am Kleid. Sie schüttelt den Kopf. »Wohnst du hier in der Nähe?«, bohrt er nach.
»Nein. Ich habe kein Zuhause. Nicht mehr.«
Erik beschließt, sie vorerst nicht weiter zu befragen. Er macht sich auf den Weg zur Fahrerseite, hievt sich auf den Sitz und schließt die Tür. In der Zwischenzeit hat auch das Mädchen die Beifahrertür geschlossen. Geschlossen und verriegelt. Mit einem drängenden Blick fixiert sie Erik.
»Fahr los! Bitte! Wenn du noch länger wartest, werden wir hier draußen sterben«, wispert sie und klammert sich an den Haltegriff. »Die Autotür wird sie nicht aufhalten.«
»Wen aufhalten?«
Keine Antwort.
Erik verliert die Geduld. »So läuft das nicht, okay? Ich weiß weder, wo du herkommst, noch, wie du heißt. Geschweige denn, was mit dir passiert ist.«
Das Mädchen scheint abwesend. Sie achtet nicht mehr auf ihn, sie achtet bloß auf die Finsternis. Schaut, ob sich in der Schwärze etwas regt.
»Ignis. Nenn mich einfach Ignis«, flüstert sie.
»Gut. Gut, das ist ein Anfang. Bist du verletzt, Ignis?«
»Nein.«
»Und das Blut?«
»Nicht meins.«
Erik gibt nach und umgreift mit beiden Händen das Lenkrad. Er will es nicht wahrhaben. Diese ganze Situation. Vor ein paar Minuten ist er noch seelenruhig die Landstraße entlanggefahren. Und jetzt? Jetzt sitzt ein verstörtes Mädchen neben ihm, völlig aufgelöst und verwirrt.
Was macht ihr solche Angst?
»Du musst mir sagen, wovor du weggerannt bist, okay?«
Die Augen des Mädchens huschen zwischen Erik und dem Fenster hin und her. Immer und immer wieder.
»Vor der Dunkelheit«, haucht sie. »Sie lebt. Die Dunkelheit lebt. Und sie wartet nur darauf, dass man unvorsichtig wird und einen Fehler macht. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Aber bitte, starte den Motor! Wir müssen hier weg.«
Erik seufzt, dreht den Schlüssel um und steigt aufs Gas. Er weiß, dass er die Polizei rufen sollte. Aber das Mädchen hat irgendetwas an sich. Etwas, weswegen er damit noch wartet. Außerdem hat er sie auch gespürt. Die Dunkelheit. Diese lebendige Dunkelheit.
***
Als die glühenden Rückleuchten des Lkws in der Ferne erlöschen, löst sich ein weiterer Umriss aus dem Schatten der Bäume.
Ignis ist entkommen. Sie ist entkommen, nachdem sie das Gleichgewicht ins Schwanken gebracht, die Regeln missachtet und ihre Prinzipien verraten hat. Und so schwört die Gestalt, dass sie das Mädchen eines Tages wiedersehen wird. Wo und auf welche Art, ist noch ungewiss. Aber es wird passieren.
Und dann wird das Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Dann wird die Dunkelheit wieder etwas zum Fressen bekommen.
Ignis muss sterben.
Ignis muss sterben.
Der Rabe fliegt nicht.
Kein Flügelschlag, kein Atemzug.
Er trotzt allen Naturgesetzen, jeglicher Logik.
Der Vogel ist eingefroren, nur etwa hundert Meter vor mir, mitten in der Luft. Ein pechschwarzer Fleck am wolkenlosen Himmel. Seine kleinen, diebischen Pupillen starren förmlich in meine Richtung. Und als ich den Blick erwidere, überkommt mich das vertraute Gefühl der Schwerelosigkeit. Mein Kopf pulsiert. Meine Hände kribbeln. Es ist, als würden sich meine Sinne verschärfen, während die Zeit – und somit auch die Welt um mich herum – stehen geblieben ist. Es gibt kein Leben, keinen Tod. Es gibt einfach nichts. Als hätte jemand den Stecker gezogen, der das Universum im Gleichgewicht hält.
Ich streiche mir meine verschwitzten, dunkelblonden Haare aus dem Gesicht und knie mich hin. Dann grabe ich meine Hände in die trockene Erde, die sich wie Sand anfühlt. Die Sonne knallt mir dabei in den Nacken.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Zeit stehen bleibt. Meist passiert es unerwartet, ohne Vorwarnung. Der letzte Stillstand ist aber schon Monate her. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir hier passiert. Mitten im nirgendwo, in dieser Einöde. Hinter der einzigen Tankstelle weit und breit.
»Hey, Puppe«, grölt plötzlich eine tiefe Stimme neben mir. Ich schrecke zusammen, drehe mich zur Seite und sehe den Tankwart, der sich an eine Betonwand lehnt.
Hey, Arschloch, begrüße ich ihn in Gedanken und verdrehe die Augen. Danach wende ich mich dem Raben zu, der wieder zu flattern begonnen hat. Durch die trockene Luft, begleitet von der stechenden Mittagshitze. Die Zeiger drehen sich weiter.
»Verirrt ans Ende der Welt, was?«, fragt der übel riechende Verkäufer und kratzt sich seinen Bierbauch, der nur mühevoll von seinem Unterhemd verdeckt wird.
Ich ignoriere seine Frage, gebe ihm aber still und heimlich recht. Diese Tankstelle befindet sich wirklich am Ende der Welt. Aber anscheinend ist das noch nicht weit genug, wenn man vor sexistischen Kommentaren fliehen will.
Es ist knapp eine halbe Stunde her, seit wir von der Fernstraße abgebogen sind. Mittlerweile begegnen wir kaum jemandem. Und das im Zentrum von Europa. Kaum Autos, kaum Menschen, kaum Tiere. Nur eine Ansammlung heruntergekommener Bauernhöfe, denen man die Armut schon von Weitem ansieht.
Den Grund dafür hat mir mein bester Freund Jannis erzählt. Nachdem in den 70er-Jahren ein nahe gelegenes Chemiewerk explodiert ist, wurde die ganze Gegend für längere Zeit zur Sperrzone erklärt. Dutzende Mitarbeiter sollen bei der Explosion ihr Leben verloren haben. Der Boden war über Jahre hinweg verseucht. Dass sich danach niemand darum riss, dort seine Kinder aufzuziehen, kann ich verstehen. Ich frage mich nur, ob es Absicht war, dass Ancora ausgerechnet hier in der Nähe gegründet wurde. Ging es ihnen darum, billiges Land zu kaufen? Oder gab es einen anderen Grund?
»Für eine Frau bist du ganz schön still«, brummt der ekelhafte Typ und reißt mich erneut aus meinen Gedanken.
Ich zucke mit den Schultern. »Puppen reden nicht«, sage ich, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen. Teilnahmslos kehre ich ihm den Rücken zu und umkreise die Tankstelle.
In den Fingerspitzen immer noch ein leichtes Kribbeln.
Als ich mich unserem Auto nähere, tritt Aurel hinter der geöffneten Motorhaube hervor und strahlt mich an. Sein T-Shirt ist ölverschmiert, auf seinen Wangen glitzern Schweißperlen. In der Hand hält er einen Schraubenschlüssel.
»Und? Konntest du dir ein wenig die Beine vertreten?«, fragt er.
»Gib’s doch zu«, sage ich grinsend. »Du willst nur wissen, ob ich es genieße, rein gar nichts zu tun, während du hier schuftest.« Mein Freund setzt zu einer Antwort an, aber ich unterbreche ihn. »Könnte mich dran gewöhnen«, sage ich und tupfe ihm mit einem Stofffetzen über die Wangen, wobei ich das Öl nur noch mehr verschmiere.
»Der Wagen läuft wieder«, verkündet er stolz und schließt die Motorhaube. Dann nimmt er mir den Lappen ab und wischt sich damit die Hände sauber.
»Jannis wird dir die Füße küssen«, behaupte ich. Insgeheim habe ich nie daran gezweifelt, dass Aurel das hinbekommt. Seine technische Begabung habe ich schon bewundert, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin.
Wenn man Aurel mit einem Haufen Schrott alleine lässt, hat man am nächsten Tag eine Mona Lisa mit Roboterarmen im Garten stehen. Technik hat ihn schon immer interessiert. Während andere Kinder im Park mit den Rutschen gespielt haben, stand er mit seinem Werkzeugkasten darunter und zerlegte sie in ihre Einzelteile. Viele weinende Kinder später, war er einen Haufen Blechteile reicher.
»Wir sollten weiterfahren«, sage ich und schaue zum Dach der Tankstelle, wo sich der Rabe niedergelassen hat. »Ich will keine Sekunde länger an diesem Ort bleiben, als unbedingt nötig.«
»Du suchst doch das Abenteuer«, sagt Aurel lächelnd. Als er jedoch merkt, dass ich weiterhin wie gebannt auf den Vogel starre, wird auch er ernst. Vorsichtig kommt er näher – streicht mir über den Arm, als wäre ich zerbrechlich. »Hey, Romy«, flüstert er. »Wir können immer noch umkehren. Woanders hinfahren. Ans Meer vielleicht?«
»Nein«, sage ich und drehe mich zu ihm. »So meine ich das nicht.«
»Aber ich meine es so. Vielleicht war die ganze Idee –«
»Aurel, bitte«, würge ich ihn ab und lege meinen rechten Zeigefinger auf seine Lippen. »Wir hatten das Thema schon oft genug. Ich will das hier. Ich will das hier wirklich. Und du wolltest mir doch beweisen, dass du Spaß haben kannst, ohne alles durchzuplanen.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln, sage: »Mach dich locker«, und schiebe mit meinen Fingern seine Mundwinkel hoch. Aurel fängt an zu grinsen.
»Lass das«, fordert er mich amüsiert auf und drückt meine Hand weg. »Du bist ja schlimmer als meine Mutter.«
Dann ist es kurz still.
Unser Blickkontakt fühlt sich elektrisierend an, ich spüre seinen Atem. Mein Freund hebt eine Augenbraue.
»Was?«, frage ich herausfordernd.
»Krieg ich einen Kuss?«, will er wissen.
Aber noch bevor ich mich zu ihm nach vorne beugen kann, ertönt eine tiefe Stimme hinter mir: »Das Einzige, was du kriegst, ist die Rechnung«, grunzt der Tankwart.
Großartig! Der schon wieder.
Wobei ich ehrlich gesagt überrascht bin, dass es in dieser Einöde sogar Rechnungen gibt und man nicht mit Tierfellen, Goldmünzen oder Stierhoden handeln muss.
»Eine Rechnung?«, erkundigt sich Aurel. »Wir haben doch nichts gekauft.«
»Ihr nicht«, sagt der Typ und zeigt auf die Glastür seines Geschäfts, die im nächsten Moment aufschwingt. »Aber euer Freund da!«
Jannis.
Mit drei Wasserflaschen im Arm torkelt er uns entgegen, auf dem Gesicht ein breites Grinsen. Als er bei uns ankommt, klopft er gegen das Autodach. »Na, wer sagt’s denn! Alles wieder repariert?«
Aurel nickt angespannt, während er dem Tankwart dabei zusieht, wie er im Gebäude verschwindet und zur Kasse trottet.
»Hier!«, sagt Jannis und drückt jedem von uns eine Wasserflasche in die Hand. Drei verschiedene Marken.
Fragend kneife ich die Augen zusammen. »Bitte sag mir, dass du keine Angst hattest, irgendjemanden zu diskriminieren, wenn du drei Flaschen von der gleichen Marke genommen hättest.«
Mein bester Freund lacht auf. »Hey, Diskriminierung gibt es nicht nur bei Menschen. Die gibt es auch bei … bei …«
»Bei Wasserflaschen?«, hake ich nach.
»Bingo! Bei Wasserflaschen«, erwidert Jannis, öffnet den Verschluss und trinkt mehrere Schlucke. Dann wischt er sich mit dem Ärmel über den Mund. »Zugegeben, in meiner Vorstellung klang das irgendwie heldenhafter.«
»Hast du sie bezahlt?«, fragt Aurel.
»Gut, dass du das erwähnst. Ich wollte euch eben fragen, ob ihr Kleingeld habt.«
Aurel kratzt sich ungläubig am Kopf. »Hast … hast nicht du gesagt, dass wir kein Bargeld mitnehmen sollen?«
Wieder herrscht kurz Stille.
Jannis hebt den Zeigefinger, öffnet den Mund – schließt ihn wieder. »Ah!«, stößt er nach einiger Zeit aus. »Ich wusste, da war was!«
»Oh mein Gott«, ächze ich und lasse meinen Kopf in den Nacken fallen. Als ich wieder zu Jannis schaue, bemerke ich seinen gewieften Gesichtsausdruck, den er sonst nur aufsetzt, wenn er etwas Dummes im Sinn hat. Also fast immer.
Ich will ihn noch aufhalten, da wirft mir Jannis schon seine halb leer getrunkene Wasserflasche zu, die ich nur um Haaresbreite fange. Eilig rennt er zum Auto, lässt einen Freudenschrei los und ruft: »Los, rein da!«
»Verdammt!«, flucht Aurel und quetscht sich auf den Beifahrersitz. Und bevor mein Kopf reagieren kann, tragen mich meine Beine zur hinteren Autotür. Als Jannis die Tankstelle mit quietschenden Reifen verlässt, stürmt der Tankwart aus seinem Laden. Er brüllt uns zornig nach.
»Das ist Freiheit!«, johlt Jannis und blickt begeistert zwischen Aurel und mir hin und her.
»Oder Diebstahl«, erwidert Aurel. »Aber ich verstehe, warum dir das Wort Freiheit lieber ist.«
Und ehe wirs uns versehen, sind wir wieder auf der Landstraße.
Dem Horizont entgegen, Richtung Ancora.
Aurel streckt nach ein paar Minuten seine Hand nach hinten und ich ergreife sie. Sein Puls ist hoch. Ich weiß, dass ihm diese Aktion zu spontan war. Mein Freund will immer auf alles vorbereitet sein. Erst dann kann er sich auf die verrückten Dinge einlassen, die das Leben für uns bereithält. Aber wegen seiner ruhigen, gelassenen Art schätze ich ihn auch. Sein Streben nach Logik, wenn ich mal wieder etwas überstürzen will.
Verträumt mustere ich seine schwarzen, zerzausten Haare, die mit den Sitzen verschmelzen. Es wirkt, als wäre er ein Teil davon. Im Kontrast dazu steht seine Augenfarbe. Hellblau. So intensiv, dass man sich darin verlieren kann.
Ein Paar sind Aurel und ich schon seit fast einem Jahr. Wir waren in der gleichen Klasse und haben deswegen auch zusammen den Abschluss gemacht.
»Ich hoffe, du fühlst dich wenigstens ein bisschen schlecht«, sagt Aurel, als er sich einigermaßen beruhigt hat und bricht damit das Schweigen. Er legt die Füße aufs Armaturenbrett. Die Klimaanlage pustet inzwischen kalte Luft durchs Auto – kühlt den Schweiß auf unserer Haut. Aurels Haar weht im Takt der Brise. Es ist schon spät, aber draußen ist es noch genauso heiß wie vor ein paar Stunden. Die Sonne steht tief.
Jannis schnaubt. »Der Typ hat eine Lektion verdient. Außerdem finde ich, dass Wasser ein Grundrecht sein sollte. Ja! Das ist es! Wir haben nicht gestohlen, sondern demonstriert.«
Zärtlich lege ich eine Hand auf Aurels Schulter. »Das war ein Idiot«, flüstere ich ihm zu. »Vielleicht war es wichtig, dass eine Puppe und zwei Teddybären ihm mal zeigen, wo’s langgeht.«
»Teddybären?«, fragt Aurel, nickt dann aber und sagt: »Klar. Wer denn auch sonst?« Anschließend dreht er sich zu Jannis: »Wie lange fahren wie denn noch?«
»Knapp eine Stunde, glaube ich«, antwortet er und dreht Musik auf. Wir haben für die Reise eine eigene Playlist erstellt. Eingespeichert unter dem kreativen Titel: Ancora.
Anker.
Der Ort, an dem wir unseren Sommer verbringen werden.
Und nicht zum ersten Mal frage ich mich, wer eigentlich auf diesen Namen gekommen ist und was er zu bedeuten hat. Ich frage mich, wie die Leute dort sein werden und wie sie leben.
Abgeschieden von der Zivilisation.
Da mein kleiner Notizblock griffbereit neben meinem Rucksack auf der Rückbank liegt, löse ich mich von Aurel, ziehe ihn zu mir heran und fange an zu schreiben:
An einem Ort, wo jeder jeden kennt,
gibt es einen Platz, der ist manchen Leuten fremd.
Ein Rabe fliegt über die Mauern, fliegt über den Wald,
er spürt, dass neue Menschen kommen,
er spürt, sie kommen bald.
Und seien sie auch noch so furchtlos,
niemand weiß, wie ihm geschieht,
er spürt, dass neue Menschen kommen,
sie treten ein, ins Jagdgebiet.
Ich dichte, um mich abzulenken. Das Stillstehen der Zeit wirkt noch in mir nach. Normalerweise geschieht es immer dann, wenn Gefahr droht. Ein zu schnell fahrendes Auto, ein herumliegendes Messer. Aber vorhin – da war nichts.
Oder doch?
Es gibt Tage, da kann ich nicht schlafen. Mit offenen Augen liege ich im Bett, den Blick auf die Zimmerdecke gerichtet, meine Gedanken drehen sich im Kreis. Ich male mir aus, wie es wäre, wenn meine Freunde oder meine Familie über diesen Teil meines Lebens Bescheid wüssten. Über mein Geheimnis, meinen Fluch.
Als ich zehn Jahre alt war, ist es das erste Mal passiert. Ich saß in der hintersten Sitzreihe meiner Klasse und war so in ein Gedicht vertieft, dass ich das Sirren der Deckenleuchte nicht wahrgenommen habe – das Knistern –, bevor das Kabel gerissen und sie abgebrochen ist. Dann blieb die Zeit stehen. Die Lampe schwebte in der Luft, nur wenige Zentimeter über meinem Kopf. Und als ich ausgewichen bin, krachte sie so heftig auf den Stuhl, dass die Splitter durch den ganzen Raum flogen.
Völlig verstört habe ich mich damals meiner ehemals besten Freundin anvertraut. Doch abgesehen davon, dass sie mir nicht geglaubt hat, stempelte sie mich auch noch als verrückt ab und lachte mich aus. Meine Mutter hatte zu diesem Zeitpunkt andere Probleme, ich wollte keine zusätzliche Last für sie sein. Also erzählte ich ihr nichts.
Irgendwann habe ich gelernt, es für mich zu behalten. Ich konnte es niemandem verübeln, meine Geschichte für eine Lüge zu halten, wo ich sie doch selbst kaum glauben konnte. Stattdessen habe ich begriffen, dass man alleine stark sein muss.
Dieser Tag vor acht Jahren, diese lebensgefährliche Situation, hat mich aber noch eine ganz andere Sache gelehrt: Wenn ich jemals sterben sollte, dann nicht in der hintersten Sitzreihe meiner Schule.
Ich versuche mich wieder auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und schaue aus dem Fenster. Die Hitze des Sommerabends spiegelt sich im Licht der tiefstehenden Sonne. Sie lässt den Asphalt förmlich schmelzen. Um uns herum vereinzelte Baumgruppen, junge Birken, Gehölz und blütenlose Sträucher. Die Landschaft ist karg.
Es scheint, als würde man in eine andere Zeit katapultiert werden. In eine Zukunft, in der die Menschen gänzlich von der Erde verschwunden sind, ausgerottet von den Launen der Natur. In eine Zukunft, in der nur Schutt und Asche von uns übrig geblieben ist.
Beim Vorbeifahren schmecke ich die rissige Erde auf meinen Lippen, stelle mir vor, wie die brennend heiße Luft durch meine Lunge strömt. Ein einsamer Industrieschornstein ragt wie ein Grabstein aus dem trockenen Boden. Er ist das einzige Überbleibsel, das an Zivilisation erinnert. Der Dreck brutzelt in der Sonne. Fast schon majestätisch. Man könnte meinen, dass die Wildnis zu glänzen beginnt.
Doch je weiter wir kommen, desto mehr Bäume, mehr Gras schießt aus der Erde. Die Risse werden gefüllt, die Sträucher bekommen Blüten. Vergangenes gerät in Vergessenheit.
»Und, Romy? Hat dich die Fahrt schon inspiriert?«, meldet sich Jannis zwischen zwei Songs zu Wort und deutet auf meinen Notizblock.
Aurel schüttelt fassungslos den Kopf. »Inspiriert? Durch diese Landschaft? Hier gibt es doch nur Dreck, Schlamm und … ja, eigentlich gibt es hier nur Dreck und Schlamm.«
Einen genauen Standort vom Dorf hat selbst Jannis nicht, der die Organisation unserer Reise übernommen hat. Nur eine Wegbeschreibung. Vorhin hat er gemeint, dass das letzte Stück über einen unbefestigten Waldweg führt. Die Ancoraner verlassen ihr Dorf bloß, wenn es zwingend notwendig ist. Etwa für bestimmte Besorgungen oder um zu telefonieren. Im gesamten Tal gibt es keinen Telefonmast, infolgedessen auch keinen Empfang.
»Ihr werdet schon sehen. Dieser Ort ist genau das, wonach Romy gesucht hat. Kein Großstadttrubel, keine Ablenkung, bloß Natur. Ich bin mir sicher, sie wird ihren Gedichtband hier fertigstellen können«, sagt Jannis und wirft mir einen kurzen Blick im Rückspiegel zu. »Für sechs Wochen fast gänzlich autark zu leben, wird eine unvergessliche Erfahrung sein. Solche Dörfer gibt es sonst kaum mehr.«
Ich lehne mich nach vorne und drehe die Musik ein wenig leiser, damit ich Jannis besser verstehen kann. Währenddessen fährt er unbeirrt fort: »Deswegen ist ihnen die Geheimhaltung auch so wichtig. Sie wissen, dass ein solcher Ort Touristen oder die Presse regelrecht anziehen würde.«
Jannis hat sich in Rage geredet. Wie immer, wenn er für etwas Feuer gefangen hat. So auch hier. Vor ein paar Wochen hat er das Dorf durch ein obskures Internetforum entdeckt und Kontakt mit der Gründerin aufgenommen. Ancora gewährt nämlich jedes Jahr ein paar Freiwilligen, in seine Welt einzutauchen. Dank Jannis’ Engagement war es für mich kaum verwunderlich, dass dieses Jahr wir eingeladen wurden.
»Müssen wir dort auch jagen? Tiere töten?«, fragt Aurel.
»Wohl kaum«, sagt Jannis. »Wir sind Stadtkinder. Die Bewohner von Ancora sind bestimmt schon froh, wenn wir mit ein paar wildgewachsenen Kartoffeln fertigwerden.«
Aurel nimmt seine Füße vom Armaturenbrett. »Hoffen wir’s. Laut Statistik habe ich noch ungefähr 60,4 Lebensjahre vor mir. Und zu sterben, ohne ein Tier mit meinen eigenen Händen umgebracht zu haben, klingt für mich durchaus reizvoll.«
»Wäre das nicht ein schöner Titel für deinen Gedichtband?«, schlägt Jannis belustigt vor. »60,4 Lebensjahre ohne Mord – Gedichte über die Partnerschaft.«
Ich schmunzle. »Ob ich ohne oder mit Mord schreibe, weiß ich noch nicht.«
So wie meine Mutter Ria schreibe ich, seit ich denken kann. Dafür musste sie mir nur einen Notizblock und einen Stift kaufen, was gerade so drin war. Geld hatten wir nie viel. Als andere Kinder aus meiner Klasse ins Kino gingen, habe ich mich in den Park gelegt und darüber geschrieben, wie es wäre, auch dort zu sein. Ich wurde verspottet, aber mich hat das kaltgelassen. Es mag sein, dass mir das Geld gefehlt hat – aber den anderen fehlte es an Fantasie. Und das fand ich viel schlimmer.
Meine Mutter hat mir damals eine Weisheit mit auf den Weg gegeben, die ich mir bis heute verinnerlicht habe: Man darf das Gedicht nicht schreiben, man muss das Gedicht sein. Deswegen wollte ich meine Texte nicht an irgendeinem Partystrand verfassen, sondern an einem besonderen Ort. An einem Ort wie Ancora.
Und doch sind es nicht ausschließlich der Gedichtband und meine Suche nach Abenteuer, die mich diesen Sommer hierhertreiben. Als Jannis mir davon erzählt hat – und möglicherweise habe ich es mir auch nur eingebildet –, da haben meine Finger angefangen zu kribbeln, mein Kopf hat pulsiert. Mich durchströmte das Gefühl, das ich sonst nur von den Momenten kenne, in denen die Zeit stehen bleibt. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat. Vielleicht der Name des Dorfes. Oder die Erzählungen vom Chemieunfall. Aber irgendein verborgener Teil von mir will – und davon bin ich überzeugt –, dass ich nach Ancora fahre.
Während unseres Gesprächs sind wir dem Wald immer näher gekommen. Bald schon ragen seitlich von uns die ersten Bäume aus der Erde. Wie in der Wegbeschreibung skizziert, entdecke ich rechts von uns einen geschotterten Forstweg, der von der Landstraße abzweigt und ins Tal führen muss. Die Dämmerung hat bereits eingesetzt. Das fahle Licht tanzt zwischen den Bäumen – im Auto ist die Unterhaltung verklungen.
Die dürre Landschaft, die mir vorhin die Sprache verschlagen hat, scheint Dutzende Kilometer entfernt. Wo zuvor Einöde war, ist jetzt moosbedeckter Waldboden. Er strahlt ein solch gesättigtes Grün aus, dass ich mich fühle, als würde er uns willkommen heißen. Als wären wir gar keine Fremdkörper. Ich denke an die unzähligen Wassermarken von der Tankstelle, daran, wie leicht uns die Natur versorgt und wie kompliziert wir sie verpacken.
Nach einiger Zeit geht es bergauf. Immer steiler, immer kurviger. Mein Kopf möchte mich glauben lassen, dass wir dem Himmel entgegenfahren. Ich warte nur darauf, von einer Wolke verschluckt zu werden – rein in das intensive Farbenspiel des Sonnenuntergangs. Doch statt der Wolken bekommen wir noch mehr Steine, noch mehr Erdlöcher, die uns ordentlich durchrütteln. Erst als wir die Anhöhe erreichen, wird der Waldweg fester. Links von uns kommt ein Plateau zum Vorschein.
»Halt mal an«, bitte ich und deute auf ein Auto, das neben ein paar Bäumen parkt.
Mit einem letzten Ruckler bringt Jannis den Wagen zum Stehen. Er schaltet den Motor ab. Als ich aussteige, weiten sich meine Augen.
Diese Aussicht!
Gemeinsam überqueren wir die Straße und schreiten zum Abhang. Ich atme tief ein, merke, dass die Luft hier eine andere ist. Wir sind auf einer Hochebene, so weit oben, dass wir die umliegende Gegend überblicken können. Die Aussicht raubt mir den eben geholten Atem.
Die Sonne ist fast untergegangen, aber ein letztes Glühen erhellt die weite, trockene Fläche, durch die wir eben noch gefahren sind. Ich sehe den Wald, der sich auf die Anhöhe zieht. Und auf der anderen Seite, da sehe ich tief unter uns vielleicht drei Dutzend Hausdächer.
Ancora. Das Dorf.
Es liegt in einem kleinen Tal, umgeben von Bergen und Wäldern. So idyllisch, so ruhig. Die Natur zeichnet uns ein Gemälde. Ich erkenne Rauch, der aus einigen Kaminen aufsteigt. Sehe kleine Punkte, die sich zwischen den Häusern tummeln. Menschen.
Aurel ist neben mich getreten. Er legt seinen Arm um mich und ich meinen Kopf auf seine Schulter. Zusammen bewundern wir den Ausblick.
»Es sieht friedlich aus«, sage ich.
Aurel seufzt. »Vergiss nicht, dass ich das für dich mache. Für uns.«
»Es wird dir gefallen«, antworte ich. »Du musst dich nur darauf einlassen.«
Jannis räuspert sich. »Noch mehr Kitsch und ich muss trotz der schönen Aussicht kotzen.« Er tritt von einem Fuß auf den anderen. »Bereit, euch von euren Smartphones zu trennen?«, fragt er und hält sein iPhone theatralisch in die Höhe. Dann schaltet er es ab. Kurz darauf hole auch ich mein Handy hervor.
Kein Empfang.
Genau wie Jannis es uns prophezeit hat. Aber jetzt, wo es allmählich Wirklichkeit wird, fühlt es sich doch komisch an.
Aurel sieht als Letzter auf sein Display. »Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir das durchziehen. Kein Netz, keine Updates, keine Nachrichten mehr.«
»Glaub mir, die Natur hat genug Nachrichten für dich. Du musst nur hinhören«, sagt Jannis leise. Dann dreht er sich um. »Kommt, lasst uns ins Dorf fahren, bevor es finster wird.«
Während er sich auf den Weg zum Auto macht, bleiben Aurel und ich noch kurz stehen.
Es ist gut, dass wir hier sind. Dass wir zusammen hier sind. Von sich aus wäre Aurel vermutlich nie auf die Idee gekommen, nach Ancora zu fahren. Keine Umfrage und keine Statistik hätten ihm dazu geraten. Aber er hat gespürt, dass diese Reise eine einmalige Chance ist, uns gegenseitig zu beweisen, dass unsere bröckelnde Beziehung einen Sinn hat. Dass wir uns auf etwas einlassen können – gemeinsam.
Auf diesen Ort.
Auf diesen Moment.
Träumerisch betrachte ich das Dorf, schweigend, aber mit der Gewissheit, dass Aurel bei mir ist. Ich bin voller Vorfreude auf das, was dieser Sommer zu bieten hat. Und habe die leise Hoffnung, ein fehlendes Puzzleteil meiner selbst zu finden.
Jannis’ Fluchen unterbricht unsere Zweisamkeit.
Irritiert drehe ich mich um.
Mein bester Freund funkelt mich über die Straße hinweg misstrauisch an. »Sehr lustig, Romy!«, ruft er. »Wirklich sehr lustig. Wo ist er?«
Ich ziehe Aurel mit mir zum Auto. »Wo ist wer?«, frage ich verdutzt.
»Tu nicht so. Du bist die Letzte, die aus dem Auto gestiegen ist.«
Aurel mischt sich ein: »Was ist denn los?«
Jannis wirkt perplex. »Du schwörst, dass du es nicht warst?«
»Ich weiß doch noch nicht einmal, was du meinst«, sage ich.
Jannis’ Blick huscht von mir zu Aurel, sein hellbraunes, gewelltes Haar hängt ihm ins Gesicht. Dann schüttelt er ungläubig den Kopf. »Also ich … ich habe den Schlüssel ganz sicher stecken lassen, aber jetzt …«
»Der Autoschlüssel ist weg?!«, fällt ihm Aurel bestürzt ins Wort.
»Ist er.«
Jannis geht ein paar Schritte in den Wald, dann wieder zurück. Er durchwühlt seine Hosentaschen, seinen Rucksack, das Auto. Nichts.
Wir helfen ihm suchen, schauen unter den Fußmatten, im Handschuhfach. Immer noch nichts. Mir fällt auf, wie kalt es geworden ist. Die Temperaturen sind in der kurzen Zeit bestimmt um einige Grad gefallen. Ein frischer Wind braust über die Anhöhe, ich fröstle.
Irgendwie seltsam. Ich habe zwar schon gehört, dass es Temperaturstürze dieser Art geben soll, aber nur in der Wüste. Nicht hier. Nicht in Europa.
Jannis blickt hoch. »Merkwürdig«, flüstert er. Dann dreht er sich zum Wald um, starrt in die Dunkelheit. Als würde er nur darauf warten, dass plötzlich jemand aus dem Unterholz gesprungen kommt.
»Ist vielleicht Karma. Wegen den gestohlenen Wasserflaschen«, sage ich, um der Stille keinen allzu großen Raum zu geben.
»Drei Wasserflaschen gegen ein Auto?«, fragt Jannis. »Also entweder, Gott ist der größte Umweltaktivist, den ich kenne, oder er hat einen verdammt schlechten Humor.«
Aurel reibt unterdessen die Hände aneinander. »Gehen wir ins Dorf«, sagt er. »Ich habe keine Lust, die ganze Nacht hier draußen zu verbringen. Und um den Schlüssel können wir uns auch noch morgen kümmern.«
»Morgen? Du spinnst ja«, giftet Jannis. »Ist schließlich nicht dein Auto, richtig?«
Mein bester Freund ist wütend, weil er es sein möchte. Er war von Anfang an nicht begeistert davon, dass Aurel mitkommt. Um das Auto geht es ihm gar nicht. Jannis’ Eltern haben Geld – eine Menge davon. Er müsste sich nur bei ihnen melden und würde ein neues bekommen. Dennoch verabscheut er diese Lebensweise, hasst seine Privilegien. Sein Vater ist Immobilienmakler und seine Mutter Anwältin. Beide kompensieren die fehlende Liebe mit Geld.
»Schau mal«, versuche ich ihn zu beruhigen. »Sieh es positiv. Den meisten Menschen wird kein Schlüssel gestohlen. Du bist gerade total gegen den Mainstream.«
Das ist auch so eine Sache mit Jannis. Er tut immer das, was andere nicht tun. Als meine Jahrgangsstufe die Abschlussprüfungen geschrieben hat, ist er von der Schule gegangen, um ein halbes Jahr um die Welt zu reisen. Und da die meisten Achtzehnjährigen auf Alkohol und Partys aus sind, pilgerte er von einem Schweigekloster in Rumänien zu einem Lachyoga-Kurs in Indien. Selbst Jannis’ Augenfarbe weicht von der Norm ab. Wobei ich bezweifle, dass das schon von Geburt an so war. Ich würde ihm ohne Weiteres zutrauen, dass er seit Jahren mit einer farbigen Kontaktlinse herumläuft, nur um aus der Masse herauszustechen.
Jannis muss ungewollt schmunzeln. »Das ist die schlechteste Aufmunterung, die ich je gehört habe.«
»Wenigstens ist der Rest des Autos noch da«, fügt Aurel hinzu.
»Oh! Die Aufmunterungen werden ja immer besser«, antwortet er und schaut dabei nachdenklich zu dem anderen Wagen hinüber. Die Wut in seinen Augen ist abgeflaut.
»Denk nicht einmal dran«, mahnt Aurel. »Du stiehlst kein Auto!«
Jannis beginnt zu lachen. »Für wen hältst du mich?«, fragt er, geht zum Kofferraum und reicht uns kurzerhand das Gepäck. »Wobei der Gedanke schon was hat. Romy kann über Schwerverbrecher schreiben – und wir können die Schwerverbrecher sein!«
Als sich Jannis anschließend zu Fuß auf den Weg ins Tal macht, frage ich: »Jetzt doch nicht mehr weitersuchen?«, und folge ihm zusammen mit Aurel.
»Wir haben keine andere Wahl. Und vermutlich bringt es bei dieser Dunkelheit wirklich nichts.« Während wir also den unbeleuchteten Feldweg hinunterstapfen, reimt Jannis vor sich hin: »Wenn dich tausend Ängste quälen, musst du nur ein Auto stehlen.« Dann dreht er sich zu mir um. »Na? Glaubst du, ich habe das Zeug zum Dichter?«
Ich hole auf – achte dabei, dass ich nicht über einen Stein oder Ast stolpere. Es ist dunkel, zu dunkel. Mit der Zeit ändert sich aber nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Weg. Immer schmaler wird er, immer mehr Zweige und Wurzeln, die den Boden bedecken. Die Bäume rücken näher. So, als würden sie uns am Ende des Weges zerquetschen wollen.
»Ja. Ich finde schon, dass du das Zeug zum Dichter hast«, antworte ich nach kurzem Überlegen.
»Echt?«, fragt Jannis stutzig.
»Zu einem einsamen, arbeitslosen und verzweifelten Dichter.«
»Na, immerhin«, sagt er. »Tut mir leid, Romy, dass ich vorher so aufgebracht war. Ich hätte euch nicht beschuldigen dürfen. Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist.« Jannis sieht sich um. »Weißt du eigentlich, wo wir sind? Das ist doch kein richtiger Weg mehr.«
Angestrengt versuche ich durch die Baumreihen zu spähen. Inzwischen ist es stockfinster geworden. Ich erkenne nichts, keine Häuser, keine Menschen, kein Dorf. Aurel, der natürlich darauf vorbereitet ist, packt seine Taschenlampe aus und leuchtet uns den Weg.
Ich hake mich bei Jannis ein. »Du bist der Letzte, der sich entschuldigen muss. Und sieh es mal so: Mit dem Auto hätten wir hier sowieso nicht langfahren können.«
Jannis freut sich seit Wochen auf diesen Sommer – und kaum hat er gestartet, geht alles schief.
Ich leide mit ihm. Durch das Stillstehen der Zeit weiß ich, wie es sich anfühlt, nicht verstanden zu werden. Man sucht und sucht, aber die Antworten scheinen trotz aller Bemühungen weit entfernt.
Oft finden wir aber nur deshalb keine Antworten, weil wir uns die falschen Fragen stellen.
»Halt«, wispert Aurel so plötzlich, dass ich jäh aus meinem Gedankengang gerissen werde. Ich erstarre.
»Was ist denn los?«, haucht Jannis und zieht mich instinktiv näher an sich.
Statt zu antworten, bewegt Aurel das Licht der Taschenlampe ein Stück weit nach oben. Der Lichtkegel trifft auf eine junge Frau. Sie steht abseits des Weges im Dickicht, trägt einen weißen Umhang und eine Blumenkette mit den ausgefallensten Farben. Ihre kurzen, braunen Haare hat sie sich auf die Seite gekämmt.
»Seid ihr Jannis, Aurel und Romy?«, ruft sie uns zu.
Ich drücke Aurels Taschenlampe etwas runter, flüstere: »Du blendest sie ja«, und wende mich dann der Frau zu. »Ja! Ja, das sind wir.«
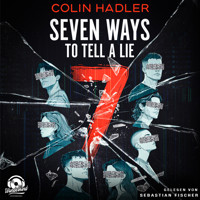
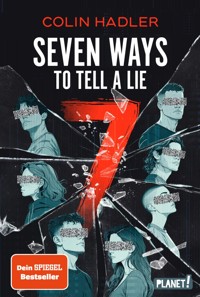
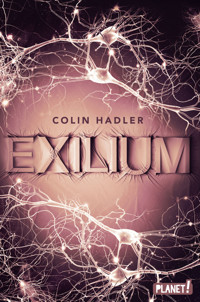
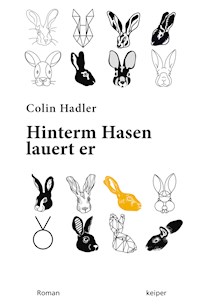














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










