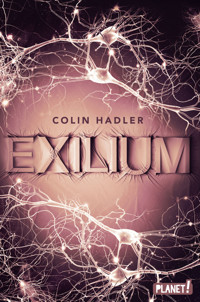
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was bleibt von dir, wenn du keinen eigenen Willen mehr besitzt? Nachdem Lennox bei einem Autounfall nicht nur seinen rechten Arm, sondern auch seine Schwester verliert, flüchtet er sich in die digitale Welt, um seine Sorgen zu vergessen. Sein neuer, technisch nachgerüsteter Arm hilft ihm dabei, sich überall reinzuhacken und jede Menge Unsinn anzustellen. Doch einem Gerücht kann Lennox nicht entfliehen: In seiner Stadt verschwinden immer mehr Menschen spurlos. Als Lennox ungewollt entdeckt, wie an einer der Vermissten Experimente durchgeführt werden, sieht er sich mit einer schrecklichen Wahrheit konfrontiert: Wie viele Menschen haben noch ihren freien Willen? Und wer steckt dahinter? Nur Lennox' außergewöhnliche Hacker-Skills können die Stadt retten. Aber wem kann er trauen, wenn alles vernetzt ist? Ein süchtig machender Thriller ab 13 Jahren – voller Nervenkitzel und unerwarteter Wendungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Was bleibt von dir, wenn du keinen freien Willen mehr besitzt?
Seitdem Lennox bei einem Autounfall nicht nur seinen rechten Arm, sondern auch seine Schwester verloren hat, ist sein Leben nicht mehr dasselbe. Er bleibt am liebsten zu Hause, hat kaum Freunde und verpulvert seine außergewöhnlichen Hacker-Skills dank seines technisch nachgerüsteten Arms für sinnlose Streiche. Doch einem Gerücht kann Lennox nicht entfliehen: In seiner Stadt verschwinden immer mehr Menschen spurlos. Als er zufällig entdeckt, wie an einer der Vermissten Experimente durchgeführt werden, sieht er sich mit einer schrecklichen Frage konfrontiert: Wie viele Menschen haben noch ihren freien Willen? Und wer steckt dahinter? Lennox gerät in einen verstörenden Sog, bei dem er sich bald nicht mehr sicher ist, was Realität ist und was Lüge.
Ein Thriller voller Nervenkitzel und unerwarteter Wendungen.
Der Autor
© Jakob Tscherne
Colin Hadler wurde 2001 in Graz geboren. Schon ab dem Alter von 12 Jahren spielte er in Schauspielhäusern Theater – manchmal durfte er sogar mehr als nur einen Baum verkörpern. Hadler schreibt Drehbücher, Gedichte und Romane. Noch in seiner eigenen Schulzeit tourte er durch andere Gemeinden und Bundesländer, um Jugendliche wieder zum Lesen zu bringen. Hadler lebt momentan in Wien und studiert Publizistik- und Kommunikationswissenschaft.
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf:www.planet-verlag.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Song zum Buch
Titelsong »Exilium« von LUMINYA.Jetzt auf allen gängigen Songportalen undauf YouTube streamen.
Prolog
In meiner Kindheit fand ich es nie schlimm, Angst zu haben. Es war ein faszinierendes Gefühl. Immer dann, wenn ich den Tod vermutet habe, wurde mir Leben eingehaucht. Der Adrenalinschub hat mich angespornt – hat mich körperliche Kräfte spüren lassen, von denen ich zuvor nur träumen konnte.
Ich war naiv, selbst für ein Kind.
Mittlerweile weiß ich, wie sich wahre Angst anfühlt. Schleichend nistet sie sich in deinen Verstand, beflügelt dich, damit du noch tiefer in den Abgrund fällst. So wie heute.
Ich spüre den Druck auf meinen Handgelenken, das robuste Seil, mit dem ich an den alten Holzstuhl geschnürt wurde. Die LED-Lampe über mir flackert. Sie baumelt an einem angeschnittenen Stromkabel, das jede Sekunde zu reißen droht.
Trotz des schwachen Lichts ist das Gemälde vor mir deutlich zu erkennen. Es befindet sich an der rot gestrichenen Wand. Eine Eidechse ist darauf zu sehen. Sie ist groß – ihre Schuppen sind rau und stehen so unnatürlich von ihrem geschlängelten Körper ab, als wäre sie unheilbar krank. Schlimmer sind nur ihre Augen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihr nicht zum ersten Mal begegne – wo sie doch stets dort hängt, in diesem winzigen Zimmer –, aber ihre schwarzen Pupillen haben etwas menschliches an sich.
Die Eidechse bewegt sich. Erst ist es nur ein Zucken, dann ihre Zunge, die wie ein Pfeil aus ihrem Mund geschossen kommt. Das Tier rekelt sich, windet seine Gliedmaßen. Schuppe für Schuppe schält sich die Eidechse aus dem Bilderrahmen. Sie zischt, tapst über die Wand und hinterlässt Abdrücke auf der Tapete. Am Boden angekommen, flüchtet sie sich unter einen Umhang. Mein Blick schweift nach oben. Ich habe meinen Vater gar nicht bemerkt, so leise hat er sich in den Türrahmen gestellt. Eine Kapuze verbirgt sein graues Haar, seine Augen sind leblos und seine Lippen so blass, als würde kein Blut mehr durch sie fließen.
»Es ist Zeit«, sagt er und kommt einen Schritt auf mich zu. »Lennox, mein Junge.« Zärtlich fährt er mir über die Wange – und das ist der Moment, an dem ich zu schreien beginne.
»Fass mich nicht an!«, brülle ich, wobei sich der salzige Geschmack von Schweißperlen in meinem Mund ausbreitet. »Verschwinde!«
Mein Vater dreht sich weg, öffnet einen Glaskasten, der schief in die Wand gehämmert wurde. Es wird stickiger. Qualm steigt mir in die Nase. Ich rüttle an meinen Fesseln, reiße meinen Kopf zur Seite. Als ich erneut nach vorne blicke, steht nicht mehr mein Vater vor mir.
»Mama«, flüstere ich. »Bitte nicht! Nicht schon wieder.«
Meine Mutter lächelt. »Es geht schnell vorbei, Lennox«, verspricht sie mit sanfter Stimme und zieht sich die Kapuze vom Kopf. »Du musst nur deine Schuld begleichen.«
»Verdammt«, wimmere ich. »Was habe ich denn getan? Mama! Sag mir doch, was ich getan habe!«
Der Rauch wird dichter – er wandert meine Füße empor, kriecht in meine verschwitzte Kleidung und breitet sich im gesamten Zimmer aus. Ich muss husten, mein Rachen brennt höllisch.
»Nichts«, antwortet meine Mutter. Sie verliert dabei jegliches Feingefühl, der sanfte Unterton in ihrer Stimme verschwindet. »Du hast rein gar nichts für sie getan.«
Der Bilderrahmen löst sich auf, so auch der Kasten, der links von mir gehangen hat. Meine Mutter entfernt sich.
Als ich plötzlich eine Berührung an meinem Bein wahrnehme, schaue ich nach unten. Qualm. Das ist alles, was ich sehe. Meine untere Körperhälfte wurde schon zur Gänze verschlungen. Nur krabbelt da ganz sicher etwas Lebendiges auf mir – etwas Großes. Noch größer als die Eidechse.
»Der Unfall war nicht meine Schuld«, bringe ich röchelnd hervor. »Ich wollte das nicht!«
Die Lampe an der Decke ist inzwischen heller geworden, sprüht Funken. Eine magere Gestalt formt sich aus dem tobenden Lichtspiel. Emilia.
Die blauen Augen meiner jüngeren Schwester schimmern, ihr aschbraunes Haar fällt ihr wie ein Wasserfall über die Schulter. Ein süßlicher Duft haftet an ihrer Kleidung.
»Ich glaube dir«, wispert Emi mit ihrer kindlichen Stimme. Wie ein Gänseblümchen steht sie inmitten eines aufkommenden Sturmes. »Aber das rettet dich auch nicht mehr.« Meine Schwester holt eine Spritze hervor. Die Nadel muss in dem Glaskasten gelegen haben, aufbewahrt für den richtigen Moment. »Du wirst merken, dass die Menschen, die dir am nächsten stehen, die dunkelsten Geheimnisse in sich tragen«, sagt sie. »Auch du bist so ein dunkles Geheimnis.« Auf ihrem Mund zeichnet sich ein Schmunzeln ab. »Mama hat uns immer gesagt, man soll nicht lügen. Man muss Geheimnisse aus der Welt schaffen. Sie auslöschen.« Emi hält mir die Nadel an den Arm. »Also löschen wir dich aus.«
Noch ehe die Spritze in meine Haut eindringt, schließe ich die Augen. Hilflos klammere ich mich an den Gedanken, dass es gleich vorbei sein wird. Das alles.
Als die Umgebung tatsächlich zur Ruhe kommt, traue ich mich hinzusehen.
Ich stehe auf einem Hochhaus.
Keine Fesseln mehr, kein Stuhl, keine Rauchschwaden. Die Luft ist kühl. Ringsherum stehen Wolkenkratzer und Kräne, die einen Betonwald bilden.
Was zur Hölle, denke ich. Normalerweise passiert das nicht.
Unerwartet schiebt mich etwas vorwärts. Ganz langsam, auf den Abgrund zu. Panisch schlage ich um mich, kämpfe dagegen an. Es hilft nichts.
Ich realisiere, dass ich irgendwo in meiner Heimatstadt bin. In Libea. Doch der Trubel, der hier sonst immer herrscht, ist verstummt. Da sind keine Menschen, die man durch die Fensterfronten beobachten kann. Kein Licht, das durch die Scheiben glänzt.
Einige Zentimeter vor dem Abgrund werde ich gestoppt. Ein Blick nach unten. Es sind mindestens hundert Meter, wenn nicht mehr. Niemand ist auf der Straße unterwegs, nicht einmal Autos. Und dann: ein Ruck, der meinen Körper durchfährt. Ich schreie. Und ich falle.
Ich falle ins Nichts, denke an die Eidechse, an die letzten Worte von Emilia. Ich denke, schreie und falle. Mein Körper dreht sich, die Umgebung verschwimmt. Alles pocht. Die verlassene Stadt und die Schwerkraft, die mich nach unten zieht. Ich denke, schreie und …
1
»Ich bin mir nie sicher, ob deine Katze überfahren wurde oder ob das dein normaler Gesichtsausdruck ist«, sagt Dorian und wischt sich mit einer Serviette den Mund ab. »Aber wie man es auch dreht und wendet, dein Burger wird trotzdem kalt.«
Ich blinzle mehrmals. Dann richte ich mich auf, strecke mich, um meinen Kreislauf wieder in Schwung zu bringen. »Du weißt doch, dass ich keine Katze habe«, murmle ich und nehme einen Schluck von meinem Softdrink.
»Keine Katze, keine Nerven, keinen Appetit«, ergänzt Dorian. »Nenn mir lieber eine Sache, die du hast.«
Kopfschmerzen, denke ich und werfe einen Blick zu den anderen Tischen. Die gestressten Familien mit ihren schreienden Babys sind kaum auszuhalten.
Faszinierend hingegen ist die Bulldogge neben uns. Seelenruhig sabbert sie vor sich hin, so auch die Frau, die den Hund an der Leine hat. Der ältere Mann am Schalter erkundigt sich seit einer halben Stunde nach einem Mädchen namens Claudia – und der Mitarbeiter entgegnet ihm zum hundertsten Mal, dass er zwar keine Claudia, aber eine große Cola und einen Cheeseburger haben kann. Das ganze Einkaufscenter ist der Inbegriff von Belanglosigkeit.
»Ich bin einfach ein bisschen neben der Spur«, verteidige ich mich.
»Ein bisschen?« Dorian schmunzelt. »Du fährst gerade mit einem Dreirad über die Autobahn. Deine Spur ist nicht einmal in Sichtweite.«
»Okay, gut. Du hast ja recht.« Ich nehme einen Bissen von meinem Burger, der noch schlechter schmeckt, als er aussieht. »Ich musste bloß an Nia denken.« Und an den Traum von letzter Nacht. Nur den erwähne ich nicht.
»Freu dich doch! Sie will sich mit dir treffen. Das ist kein Grund, traurig zu sein.« Dorians Gesichtsausdruck verändert sich schlagartig. »Du bist traurig. Das ist es, oder?« Er sieht mich besorgt, geradezu mitfühlend an. »Soll ich dich umarmen?«
»Nein!« Ich schüttle den Kopf. »Nein, nein, nein!«
»Du brauchst eine lange, feste Umarmung.«
»Auf keinen Fall!«, wiederhole ich. »Ich brauche –«
»Liebe von deinem besten Freund!«
Ich verdrehe die Augen. »Eine Kopfschmerztablette würde reichen. Ich brauche keine …« Dorian fängt an, sich über den Tisch hinweg zu mir zu strecken. »Hey! Lass das«, fauche ich, doch er hat mich schon halb umschlossen.
»Pscht«, flüstert er mir mütterlich ins Ohr. »Ich bin hier.« Dorian tätschelt mir den Rücken. »Alles ist gut.«
»Alles war gut«, erwidere ich. »Jetzt ist es einer der schlimmsten Momente meines Lebens.«
»Ich weiß«, antwortet Dorian. »Das weiß ich. Deswegen bin ich für dich da.«
»Nein, ich … Ach, vergiss es.«
Nach einigen schier endlos wirkenden Sekunden lässt er von mir ab und widmet sich seinem Essen.
Dass sich Nia mit mir treffen will, macht mich nicht traurig – ganz im Gegenteil. Ich verliere mich nur manchmal in meinen Gedanken. Vor allem hier, zwischen rot-weiß gestreiften Sitzbänken und leuchtenden Anzeigetafeln, auf denen Salatblätter und Tomatenscheiben durch die Gegend sausen. Wenn ich mit meinem Kopf woanders bin, kann das selbst Dodo nicht ändern.
Ja, Dodo.
So nenne ich Dorian ab und zu, wenn er sich verhält, als könnte er im nächsten Moment aussterben.
Warum Dorian und ich beste Freunde sind, ist schwer zu sagen. Manche Dinge passieren eben einfach. An dem einen Tag rutscht man in der Dusche aus, am anderen donnert man gegen eine Straßenlaterne – und ja, ich hatte plötzlich Dodo an der Backe.
Wir hängen gemeinsam ab, lästern über unsere Mitschüler und … tun noch andere Dinge, die von einer Freundschaft erwartet werden. Auf seine geliebten Partys begleite ich ihn jedoch nicht.
Dorian liebt das Feiern. Wenn er gut drauf ist, kuschelt er mit jedem, der ihn nicht mit einer Pistole bedroht. Er hat mexikanische Wurzeln – und die freundliche Mentalität seiner Eltern spiegelt sich bedauerlicherweise in seinem Charakter wider. Aber auch das Temperament. Dodo ist ein Klischee auf zwei Beinen. Während andere in den sozialen Medien unterwegs sind, ist er in irgendwelchen Clubs und tanzt sich die Seele aus dem Leib. Bei einem seiner letzten Ausflüge ist er sogar mit einem selbst gestochenen Ohrring aus einer Bar getorkelt.
Immerhin besser als mit einer Geschlechtskrankheit!
»Hast du den Zettel behalten?«, fragt mich Dorian schmatzend.
»Klar«, sage ich und ziehe demonstrativ das Stück Papier aus meiner Hosentasche, das mir Nia heute Vormittag in den Spind geworfen hat.
Verträumt mustere ich ihre Handschrift:
Morgen. 11 Uhr 30.
Café Zentral.
Wehe, du kommst zu spät.
Nia.
»Darf ich mal sehen?«
Schnell packe ich den Zettel wieder weg. »Du würdest es nicht verstehen.«
»Nicht verstehen?« Dorian verschluckt sich fast vor Lachen. Er hustet, ein weiterer Griff zur Serviette. »Du hast noch nie mit Nia geredet und jetzt willst du mir weismachen, ihr hättet schon eure eigenen Insider?«
»Nein.«
»Denkst du etwa, ich bin dumm?«
Ich schnalze mit der Zunge, sage: »Jetzt kommen wir der Sache schon näher.« Mein bester Freund grinst, als wolle er mich für meinen guten Konter belohnen. »Sie hat nicht viel geschrieben«, gestehe ich ihm schließlich. »Die Uhrzeit, wo wir uns treffen …«
»Und?«
Selbstsicher lehne ich mich zurück. »Und geflirtet hat sie auch mit mir. Aber eher … zwischen den Zeilen. Wie gesagt, du würdest es nicht verstehen.«
Dodo seufzt. »Ich wünschte, ich könnte dir auch nur ein Wort glauben.«
Wenn ich ehrlich bin, kann ich es noch nicht einmal selbst glauben. Nia muss meine vernarrten Blicke in den Pausen bemerkt haben. Meine Nervosität, wenn ich in ihrer Nähe bin. Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber dieses Mädchen … Nia ist einfach …
»Wirst du es ihr sagen?«, hakt er nach.
»Was denn?«
Dorian deutet auf meinen rechten Arm, der vollständig von einem Handschuh verdeckt wird. Als ich nicht antworte, sagt er: »Du solltest stolz darauf sein. Ehrlich! Mit deinen 17 Jahren hast du mehr Ahnung von Technik als meine Großeltern vom Leben.«
Ich hole meinen Laptop aus meiner Tasche und klappe ihn auf. »Apropos. Mir ist gestern Abend eine Idee gekommen.«
»Oh Gott.« Dodo versinkt förmlich in seinem Stuhl. »Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet.«
»So schlimm wird es nicht«, nuschle ich und tippe etwas in meine Tastatur.
»Das sagst du immer«, erwidert er und fängt beiläufig damit an, seine Sachen zu packen. »Bitte lass nicht das ganze Einkaufscenter in die Luft fliegen.«
Ich fokussiere mich auf das Display. »Keine Sorge. Ich mische den Laden nur ein wenig auf. Sonst versauern wir hier noch.« Als ich meinen Blick hebe, verspüre ich eine Vorfreude, die nicht wirklich auf Dorian überzugehen scheint. »Ich finde, auf den Bildschirmen und Anzeigetafeln waren genug Salatblätter zu sehen.«
Dorian kneift die Augen zusammen. »Du willst etwas abspielen? Auf allen Monitoren?« Er schnauft, schluckt die letzten Reste seines Burgers hinunter. »Stimmt. Meine Sorgen sind absolut unbegründet.«
Jeder, der in dieses überfüllte Einkaufscenter trottet, kauft und kauft, isst und trinkt, wartet und wartet – aber auf was eigentlich? Im Grunde wollen wir die Erlebnisse doch gar nicht in uns aufnehmen, die wir hier erleben. Wir konsumieren einen Reiz nach dem anderen, sodass wir den ersten schon vergessen haben, ehe der neue in unser Visier gerät. Scheinheiligkeit, wohin man auch blickt.
Deswegen habe ich es mir als Aufgabe gesetzt, den Menschen etwas zu geben, das sie ausnahmsweise mal nicht vergessen. Etwas, auf das sie schon die ganze Zeit gewartet haben. Sie wissen es nur noch nicht.
Mit dem Hacken habe ich angefangen, da war ich sieben. Die virtuelle Welt war mein Stofftier, mein sicherer Hafen, an dem ich anlegen konnte, wenn mich die Realität erdrückt hat. Im Laufe der Jahre habe ich allerdings gelernt, dass ich vor der Wirklichkeit nicht fliehen muss – wo ich sie doch nach Belieben steuern kann. Hacken ist für mich Kunst.
Unsere Spezies ist vom Affen zum Menschen und vom Menschen zu Glas geworden. Ich weiß, was jemand spricht, textet, aufnimmt und tut. Wo jemand ist, was er mag und wie oft er sein digitales Ich infrage stellt, aber nichts daran ändert. Der Mensch kann sein Smartphone gar nicht besitzen, wo er doch selbst zu ebenjenem geworden ist.
Bei meinen Freunden bin ich etwas gehemmter. Was den Suchverlauf angeht, übermannt mich aber auch hier öfter mal die Neugierde. In Dorians Fall habe ich viele Bilder entdeckt. Nackte Männerbeine, nackte Männerbrüste, nackte Männerköpfe, nackte … nun ja, irgendwann hatte er jedes Körperteil durch. Soll er mir doch einfach sagen, dass er schwul ist. Meine Güte! Kommen wir eben zusammen in die Hölle.
Wenn ich jedenfalls ein Passwort sehe, das Peter123 lautet, dann ist das eine Einladung für mich. Eine offene Tür zu einem All-You-Can-Eat-Büfett! Aber keine Sorge: Das soll jetzt nicht heißen, dass Dorians Passwort Peter123 lautet. Seines ist Dorian123.
Völlig zurückhalten konnte ich mich bisher nur bei Nia. Tief in meinem Inneren bin ich mir darüber im Klaren, dass ein gehacktes Handy kein idealer Start für eine feurige Liebesbeziehung ist. Ich brauche jeden Vorteil, den ich kriegen kann.
Nüchtern betrachtet bin ich nämlich eher ein Durchschnittstyp. Magerer Körperbau und schwarzes Haar, das ich mir an den Spitzen Blau gefärbt habe. Meine Klamotten sind schlicht, meist einfarbig – und wenn ich etwas Verbotenes tue, werde ich so bestürzt angesehen, als wäre ich die heilige Jungfrau Maria. Auferstanden. Und ein wenig männlicher.
Als ich an meinem Laptop vorbeispähe, sehe ich den Sicherheitsmann, der sich nur ein paar Meter von uns entfernt an eine künstliche Palme lehnt. Er kennt mich. Unschöne Erinnerung.
Dorian beugt sich nach vorne. »Gib mir Bescheid, bevor du loslegst, ja?«
»Zu spät«, sage ich in gedrosselter Lautstärke. »Ich bin schon längst im Server. Durch eine Fehlermeldung bei einem der Bildschirme ist ein offener Port entstanden, der mich –«
»Echt niedlich.« Dorian schlürft an seinem Apfelsaft. »Nach all den Jahren glaubst du ernsthaft, ich würde auch nur ein Wort davon verstehen.«
Der Sicherheitsbeamte dreht sich in meine Richtung, fixiert mich. Ich ignoriere ihn und schiebe Dodo die Tastatur hin.
»Bringen wir es hinter uns.«
»Du bist echt der verrückteste Mensch, den ich kenne«, antwortet er. Sein Lieblingsspruch in solchen Situationen. Dorian atmet tief ein und aus, es ist ein historischer Moment – in meiner Fantasie blasen Trompeten, Cheerleader fangen an zu tanzen. Ehe Dodo auf Play drückt, hält er in der Bewegung inne.
»Ab heute«, flüstert er und ballt seine linke Hand zur Faust, die er sich anschließend an die Brust hält. »Bin ich ein waschechter Hacker.«
Er drückt auf Enter.
Für eine gute Sekunde werden alle Bildschirme schwarz, die Burger und Softdrinks verschwinden. Danach sieht man eine Schneelandschaft. Eisschollen, tosendes Meer. Im stickigen Einkaufscenter breitet sich das Gefühl von Kälte aus. Überraschend wackelt ein Pinguin ins Bild. Dort, wo eigentlich sein Schädel sein sollte, sitzt der grinsende Kopf von Dorian.
Sämtliche Mitarbeiter des Restaurants hören mit einem Schlag auf zu arbeiten. Der Pensionist lässt davon ab, seine Claudia zu suchen. Und die Menschen, die erst nur vorbeigehen wollten, bleiben stehen. Wie gebannt starren unzählige Augenpaare auf das skurrile Video.
Ein zweiter Pinguin taucht auf – mit meinem Kopf. Die blauen Akzente in meinen Haaren ergänzen die trostlose Landschaft. Zusammen laufen wir über das Eis. Pinguin-Dorian fällt hin, rappelt sich wieder auf.
»Sei mir nicht böse«, wispere ich meinem besten Freund zu. »Irgendwann suche ich mir ein vernünftiges Hobby.«
»Lennox«, stößt Dorian aus, der es noch immer nicht richtig fassen kann. »Es ist … es ist wunderschön!«
Auf den Monitoren schleicht ein Eisbär ins Bild, der Kopf stammt vom Sicherheitsbeamten. Sogar mit einer kleinen Dienstmütze. Das Raubtier jagt den Pinguinen hinterher, die noch immer ein Grinsen aufgesetzt haben.
Einige Kinder fangen an zu lachen, prusten los. Und der Sicherheitsmann, der zuvor wie angewurzelt an seinem Platz gestanden hat, beginnt zu rennen. Er hat es auf mich abgesehen. Genau wie der Eisbär.
Zügig schnappe ich mir meinen Laptop und meine Tasche – und laufe ebenfalls. Das Video bricht ab, die Bildschirme werden schwarz.
»Sorry«, rufe ich und renne über einen vollgestellten Tisch. »Tut mir leid!« Ich dränge mich durch Menschenmassen, schmeiße unabsichtlich eine der künstlichen Palmen um und mache einen Hechtsprung zu den Rolltreppen. Der Angestellte ist hinter mir her, schreit, wütet.
Ich sprinte quer durch die große Eingangshalle. Damit ich den Brunnen in der Mitte nicht umrunden muss, hetze ich hindurch. Meine Hose saugt sich mit Wasser voll.
Vor dem Ausgang hat sich unterdessen ein Halbkreis von erschrockenen Besuchern gebildet. Als ich hindurchlaufen will, hält mich jemand am T-Shirt fest. Ich versuche, mich loszureißen, doch der Sicherheitsmann holt mich in der Zwischenzeit ein. Er packt mich an meinem rechten Arm. Und dann – völlig unerwartet – löst sich mein Handschuh. Wir kommen beide ins Straucheln.
Als ich den kalten Boden unter mir spüre, begreife ich, was das fehlende Kleidungsstück für mich bedeutet. Ich raffe mich auf, starre dorthin, wo mein Arm sein sollte. Die Mehrheit der Besucher tut es mir gleich.
Ja, sie hat schon etwas Seltsames, meine hochmechanische Prothese.
Willkommen in meinem Leben!
Ich bin der durchschnittliche Junge mit dem Roboterarm.
1xxFile
0101011101 Was 10000101110011
011 im 0100101101101
0101001101100011011010000110000101110100011 Schatten
101000110010101101110
0110011101100101011100110110001101101 geschieht 000011010
0101100101011010000111010000001010
2
Die Polizeistation neben dem Einkaufscenter ist wie eine zweite Heimat für mich. Seit ein paar Jahren bin ich zu einem Dauergast geworden – und wenn ich Lust und Zeit habe, helfe ich sogar beim Aufräumen oder gieße die Orchidee, die wie ein sterbender Schwan in einer Ecke versauert. Noch trauriger ist nur der Anblick des grauen Ventilators. Klein, rund und batteriebetrieben steht er auf dem Empfangsschalter, hinter dem sich mehrere Polizisten verschanzen. Er steht dort … und tut nichts. Die Polizisten schwitzen … und tun nichts. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Beamten, die alle Schwerverbrecher und Mörder unserer Stadt fangen sollen, es nicht einmal schaffen, die Batterien eines Tischventilators auszutauschen, läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Trotz der Hitze.
Gemeinsam mit einem Polizisten, der wohl erst seit Kurzem im Dienst ist, sitze ich auf einem Plastikstuhl im tristen Eingangsbereich und warte auf meinen Vater. Gelangweilt linse ich zu meinem Aufpasser hinüber. Auf seinem Handy ist eine Dating-App geöffnet, eine Frau lächelt mir entgegen, die so auch auf dem Cover eines Modemagazins hätte landen können. 27 Jahre. Pilotin. 1 Meter 62. Vor der Kulisse eines Golfclubs prahlt sie mit einer Luxus-Handtasche.
»Das Profil ist fake«, meine ich, woraufhin mich der Polizist perplex ansieht. Ich zucke mit den Achseln. »Bei der Airline gibt es eine Mindestgröße von 1 Meter 65. Außerdem hat der Hintergrund eine andere Auflösung als ihr Gesicht. Vermutlich reingeschnitten.«
Da sich der Beamte noch immer in einer Starre befindet, fällt mir auf, dass sein linkes Auge etwas kleiner ist als sein rechtes. Seine Miene verfinstert sich.
»Was ich auf meinem Handy mache, geht dich nichts an.«
Alles klar, notiere ich in Gedanken. Kleines Auge, großes Ego.
Noch bevor ich in Versuchung komme, etwas Unüberlegtes zu tun, betritt mein Vater den Raum.
»Ausweis bitte«, brummt der Polizist und lässt das Smartphone in seine Hosentasche verschwinden.
Schade – dabei hätten sie so gut zusammengepasst.
Mein Vater wirft mir einen vorwurfsvollen Blick zu, dann kramt er nach seinem Portemonnaie. Warum er jedes Mal so wütend ist, kann ich nicht nachvollziehen. Mittlerweile sollte er das Prozedere doch schon kennen. Und ein wenig frische Luft bekommt er auf dem Weg hierher auch.
Aaron, mein Vater, hat eine wichtige Position bei den Behörden inne. Deshalb keimt in ihm wohl die Angst, dass ich seinen Ruf schädigen könnte. Er ist schließlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass Libea – als eine der wenigen Städte weltweit –, ein eigenes Ausweissystem entwickelt hat. Jeder Bewohner und jede Bewohnerin verfügt über eine Karte, auf der ein 3D-Modell des Kopfes und der Fingerabdruck des Besitzers eingespeichert sind.
Ja, so sind wir. Wie Lemminge rennen wir zu den Ämtern. Heute ist es nur der Fingerabdruck, aber was ist es morgen? Werden wir uns dann alle eine Klippe hinunterstürzen, weil man uns nett darum bittet? Eines steht jedenfalls fest: Wenn ich an der Reihe bin, das schwöre ich, nehme ich diesen grauen Ventilator mit in den Tod.
Nachdem mein Vater alles Bürokratische mit Polizist Kleinauge geregelt hat, verlassen wir die Station. Wir nehmen keinen Bus, stattdessen gehen wir still nebeneinanderher. So wie ich Aaron kenne, will er mich mit seinem Schweigen bestrafen, aber sein Plan geht nicht auf. Ich genieße es, ohne Ablenkung in die Abendstimmung einzutauchen, die über der Stadt liegt. Wie ein Schiffsbrüchiger lasse ich mich im endlosen Meer der Schnelllebigkeit treiben.
Libea ist atemberaubend. Und das liegt nicht nur an den Abgasen, die einen in den Seitengassen kaum Luft holen lassen. Riesige Leinwände thronen hoch oben an öffentlichen Plätzen – an den Fassaden der Wolkenkratzer. Filmtrailer werden darauf gezeigt, Werbespots über neue Autos, teure Uhren und Essen, das zu makellos ist, als dass es jemals so serviert werden könnte. In den Clips treten die immer gleichen Stars auf – mit dem immer gleichen Lächeln. Hier unten, am Boden, ist die Welt eine andere. Heruntergekommene Imbissbuden, Zeitungsverkäufer, beleuchtete Schaufenster und rauchende Taxifahrer. Sie beleben eine Metropole, die niemals zum Stillstand kommt.
Wir passieren überfüllte Cafés an Straßenecken, Musiker, die zwischen Hundekot und umgeworfenen Mülleimern Songs anstimmen, die sie selbst nicht mehr hören können. Auch wenn jeder in dieser Stadt nach Individualität strebt, passen doch alle in eine Schublade. Die beschäftigten Krawattenträger, die frisch verliebten Paare, die randalierenden Jugendlichen und die wortkargen Pensionisten.
Als ich in eine der schmalen Gassen blicke, komme ich ins Stocken. Ein Typ sitzt auf dem Boden, den ich nirgendwo einordnen kann: Seine Kleidung zu formell für einen Obdachlosen, seine Erscheinung zu verwahrlost für einen Geschäftsmann. In einer Lache aus Schmutz und Wasser starrt er ins Leere, leblos. An seine Füße hat er ein Pappschild gelehnt. Mit verschmierten Buchstaben stehen darauf die Sätze: Was im Schatten geschieht. Exilium ist böse. Mein Vater drängt mich zum Weitergehen.
Wie ich es sonst nur von meinen Albträumen kenne, schwirren die beiden Sätze durch meinen Kopf. Kritik an Exilium hört man selten. Dabei ist es der einflussreichste Technik-Konzern, den wir in unserem Land haben. Und hier, in Libea, liegt der Hauptsitz des Unternehmens.
Fast jedes Handy, jeder Computer und jeder Laptop hat das Logo eingraviert: Ein simples E, das von einem Kreis umschlossen wird. Samuel Holler, der CEO von Exilium, grinst uns von den Leinwänden zu. Sein schwarzes Haar hat er sich zu einem Zopf zusammengebunden – und mit seinem maßgeschneiderten, weißen Anzug wirbt er für seine Produkte. Für die Smart-Home-Systeme, die Fitnessgeräte und die modernen Kücheneinrichtungen.
Morgen beginnen die Sommerferien. Einige Eltern waren bestimmt noch in den Läden und haben ihren Kindern eine neue Spielerei für den Urlaub besorgt. Für Exilium ist das ein großes Geschäft.
Mein Vater und ich kommen an einen Zebrastreifen, dessen Ampel gerade rot wird. Ich befreie meinen rechten Arm ein Stück weit von dem Handschuh. Danach gebe ich etwas in den eingebauten Bildschirm ein. Die Ampel springt sofort wieder auf Grün.
»Lennox!«, rügt mich mein Vater und schaut sich nervös um. »Was soll denn das?«
»Lange bleibt sie nicht auf Grün.«
»Das ist lebensmüde!«
»Diese Stadt ist lebensmüde«, halte ich dagegen. »Ich passe mich nur an.«
Die Idee, nach Libea zu ziehen, war die meines Vaters. Weil ihm hier ein lukrativer Job angeboten wurde, hat er die Hälfte seiner Familie einfach mitgeschleppt. Vom Land in die Großstadt. Den Eltern meines Vaters hat das damals so gar nicht gepasst. Sie haben sich zerstritten und den Kontakt abgebrochen. Mütterlicherseits sind meine Großeltern schon tot. Und ja, mittendrin bin ich. Keine Wahl, keine Großeltern und … keine Geschwister. Ich habe nur mich, meine Liebe zum Hacken, eine Verabredung mit dem schönsten Mädchen der Schule und natürlich Dodo. Früher hatte ich auch noch meinen Vater. Der Unfall und seine Arbeit haben jedoch vieles verändert.
Nach einer Stunde Fußweg biegen wir in die reichere Gegend von Libea ab. Mehrfamilienhäuser reihen sich kilometerweit aneinander, dazwischen Parks und säuberlich gestriegelte Hecken.
Es fängt an zu nieseln. Winzige Tropfen, die meine Haut kitzeln. Ein Jogger läuft an uns vorbei – er erinnert mich an Dorian. Mein bester Freund nutzt Sport als eine Art Ventil. Ich verstehe nur nicht, wie man es mögen kann, sich körperlich zu verausgaben. Freiwillig! Ich habe seit Jahren nicht trainiert und siehe da: Ich lebe immer noch. Das Argument, dass das an meinem Alter liegt, weise ich vehement zurück.
»Ich bin nicht sauer«, sagt Aaron aus dem Nichts und biegt in unsere Straße ein.
»Das ist so ein Satz, den Väter immer sagen«, behaupte ich. »Ich bin nicht sauer, nur enttäuscht.«
»Nein, enttäuscht bin ich auch nicht.«
Ich bleibe stehen. »Was dann?«
Mein Vater lehnt sich an eine Straßenlaterne, fischt eine Dose Pfefferminzbonbons aus seiner Tasche und streckt sie mir entgegen.
»Nein, danke.«
»Ist gut. Dann nehm ich eben zwei.«
Wieder hüllen wir uns in stumme Worte. Aaron wirkt alt, so wie er sich an die Laterne stützt, mit diesem nachdenklichen Blick. Der Nieselregen wird stärker. Er wäscht das Adrenalin ab, in das ich mich geflüchtet habe. Ein Kloß bildet sich in meinem Hals. Auch mein Vater sieht abgekämpft aus, erschöpft. Und plötzlich empfinde ich Reue. Das Schuldbewusstsein, das ich sonst immer gekonnt ignoriere, hält mich nun fest im Griff.
»Tut mir leid«, wispere ich. »Das heute war vielleicht etwas zu viel. Es ist nur …« Ich trete von einem Fuß auf den anderen. »Keine Ahnung.«
Mein Vater schaut hoch, in den Himmel. Sein graues, dichtes Haar hat er sich nach hinten gekämmt und seine Augenringe sind markanter als sonst. Er antwortet: »Ich vermisse Emilia auch.«
Ich bekomme Gänsehaut. Jedes Härchen, das nicht durch einen Wassertropfen an meinem Körper klebt, will sich mir entreißen.
»Bitte …«, hauche ich, doch mein Vater redet weiter.
»Seit zwei Jahren vergeht kein Tag, an dem ich nicht an sie denke. Die Wahrheit ist, Lennox, ich habe auch keine Ahnung.«
So offen hat Aaron noch nie über sie gesprochen. Es ist seltsam, das von ihm zu hören, wo er mir als Vater doch so fremd geworden ist. Ob es die Umstände waren, die einen Keil zwischen uns getrieben haben, weiß ich nicht. Aber er ist da. Und ich komme nicht gegen ihn an.
»Lass uns nach Hause gehen«, sagt er.
Ich nicke.
Bevor ich unsere Wohnung betrete, sticht mir etwas ins Auge. Die Tür meiner Nachbarin Tessa. Das Zahlenschloss, das darin verbaut wurde und das ich für mein Zimmer dreist kopiert habe, sirrt. Doch es ist etwas anderes, das meine Aufmerksamkeit erregt. Vier einfache Worte. Mit schwarzer Farbe wurden sie an die Tür geschmiert.
Was im Schatten geschieht.
Ich reiße mich davon los und verkrieche mich in mein Zimmer. Als ich meinen Computer einschalte, beginnt der erste Bildschirm zu leuchten. Dann der zweite, der dritte, der vierte … sechs Bildschirme fahren hoch.
Jetzt bin ich wirklich daheim.
Müde schnappe ich mir einen Energydrink aus dem kleinen Kühlschrank neben dem Bett und lasse mich auf meinen Stuhl sinken. Draußen ist die Sonne bereits untergegangen – in meinem Zimmer sind es lediglich die Bildschirme, die für diffuses Licht sorgen. Ich starte Musik.
Auf einem der oberen Displays klicke ich mich durch ein Forum. Die User, mit denen ich mich dort austausche, ticken ein wenig so wie ich. Wir alle wissen, wie man im Internet zu einem Geist wird.
Keine neuen Beiträge.
Leise singe ich zum Refrain des Indie-Songs und nippe an dem Energydrink, der mir viel zu bitter ist. Ich frage mich, weshalb ich das Zeug überhaupt trinke. Und dann frage ich mich, weshalb ich mich solche Sachen frage, da ich doch ohnehin nicht damit aufhören werde. Ich nehme einen zweiten Schluck.
Übergangslos finde ich mich in einem dieser bedeutungslosen Momente wieder. Es ist ein Zustand, in den ich rutsche – meist nach einem ereignisreichen Tag, wenn ich alleine in meinem Zimmer sitze und es selbst mein virtuelles Zuhause nicht schafft, mich aus meiner Einsamkeit zu befreien. Ich tue das, was ich dann immer tue: Ich ziehe meinen Handschuh aus. Und starre. Ich starre meine Prothese an, als würde ich nicht schon jedes winzige Detail wie meine Westentasche kennen. Als hätte ich mich nicht schon längst damit abgefunden, dass mich eine Maschine an ein lebendes Wesen erinnert.
Sehnsüchtig blicke ich auf das Foto meiner Schwester, das eingerahmt auf meinem Schreibtisch steht. Mein Arm konnte nach dem Unfall ersetzt werden. Emilia nicht. An ihrer Stelle sind die Visionen aufgetaucht, die Albträume, die Eidechse.
Seitdem ich die Prothese im Krankenhaus bekommen habe, tüftle ich an ihr herum, wenn mich meine innere Stimme nicht schlafen lässt. Angefangen hat es mit der Hand, die ich mit einem latexähnlichen, schwarzen Duplikat ersetzt habe. Nur die Innenfläche ist grau überzogen, ausgestattet mit einem Sensor.
Die restliche Prothese – mein Unter- und Oberarm sowie mein Ellenbogen – ist silbern und glatt. Jede Bewegung so präzise, als wäre sie aus Fleisch und Blut. Und am Handgelenk, dort, wo man sonst eine Uhr trägt, ist ein Display, das ich mit meinem Handy koppeln kann. Aber nicht nur damit. Auf der Unterseite meines Handgelenks zeichnen sich Kästchen ab, die sich mithilfe eines Befehls öffnen lassen. Darunter verbergen sich Geheimnisse, illegaler Krimskrams. Sie sind entstanden, als mir das gewöhnliche Internet zu gewöhnlich wurde und ich ins Darknet abgerutscht bin. Neben einem der Kästchen befinden sich drei Löcher, die man kaum sieht. Ein integrierter Lautsprecher und ein Mikrofon.
Ich bin eine wandelnde Karaokebar. Eine Alarmanlange. Ein moderner Frankenstein. Manchmal habe ich den Eindruck, meine Hand fühlt mehr als mein Herz.
Verdammtes Selbstmitleid, denke ich, leere meinen Energydrink und zerdrücke die Blechdose. Ich rolle mich auf meinem Stuhl nach hinten, ziele auf den Mülleimer – doch gerade als ich zum Werfen ansetze, stürzen meine Bildschirme ab. Um mich herum wird es dunkel. Nachtschwarz. Das Absterben der Musik macht den Raum noch beklemmender.
In meiner Position ausharrend, halte ich den Atem an. Ich schaue aus dem Fenster. In den anderen Häusern brennt noch Licht.
Seltsam.
Ich rolle zurück an den Schreibtisch und lege die Blechdose neben die Tastatur. Unbeholfen taste ich mich bis zum Einschaltknopf meines Computers vor. Der Prozessor reagiert nicht.
»Mist«, fluche ich, stehe auf und tapse zur Tür. Verschlossen. Die Ziffern im Eingabefeld zeigen mir einen imaginären Mittelfinger. »Komm schon, geh auf!« Ich rüttle an der Klinke, die bei einem Stromausfall normalerweise mit Notstrom betrieben werden sollte.
Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein!
Ich hole mein Handy aus meiner Hosentasche und will meinen Vater anrufen, als etwas auf dem Bildschirm vor mir erscheint. Ein weißer Schriftzug.
HALLO, LENNOX.
Unschlüssig fixiere ich meinen Namen, bewege mich nicht von der Stelle.
BEGRÜSST DU MICH GAR NICHT?
Die Buchstaben glühen wie ein böses Omen in der Dunkelheit. Ich bin wie gelähmt, kann keinen klaren Gedanken fassen. Es ist, als hätte mein Computer ein Eigenleben entwickelt.
DU BIST GANZ SCHÖN STILL.
»Nein, ich …« Die Wörter in meinem Mund überschlagen sich. Vorsichtig komme ich näher. »Wer bist du?«
ICH BIN DAS, WAS IM SCHATTEN GESCHIEHT.
Der nächste Schriftzug erscheint auf einem anderen Bildschirm.
ICH WERDE DICH IN GEFAHR BRINGEN.
Noch ein Bildschirm.
ABER DU WIRST DICH NICHT DAGEGEN WEHREN.
Wieder das Display vor mir.
ICH BIN NAHE. GANZ NAHE.
Das Zahlenschloss meiner Tür summt, dann entriegelt es sich.
KOMM RUNTER IN DEN PARK.
KOMM ZU MIR.
3
Wie hypnotisiert ziehe ich mir meine Jacke an, verlasse die Wohnung. Raus in die unheilvolle Nacht.
Für den Bruchteil einer Sekunde ist es, als würde mich meine Kindheit einholen – das Gefühl der Angst, das mich nicht verschreckt, sondern ködert. Ich hinterfrage gar nicht, wer oder was da draußen auf mich lauern könnte. Ich weiß nur eines: Wer es schafft, sich in mein Computersystem zu hacken, kann kein primitiver Axtmörder sein. Und mit allem anderen werde ich fertig.
Draußen ist es frischer als gedacht. Frierend reibe ich meine Hände aneinander, mache einige Schritte nach vorne und schaue mich um. Keine Menschenseele. Niemand, der durch die Nacht streift.
Der Park, der sich neben unserem Mehrfamilienhaus befindet, wird von einer einzigen Straßenlaterne beleuchtet. Mattes Licht, das die Umrisse einer Schaukel auf die Grasfläche wirft. Der Wind braust, die Bäume knarren. Reine Dunkelheit belagert die Gassen.
»Hallo?«, rufe ich. »Ist da wer?«
In einem der Nachbarshäuser spielt jemand Klavier, dumpf dringen die Töne durch das Glas. Ich fühle mich beobachtet. Die Schatten werden länger, dehnen sich aus und scheinen nach mir greifen zu wollen. Wenn in unserer Stadt die Sonne untergeht, bekommt die Finsternis Augen. In weiter Ferne raschelt etwas.
»Wie in einem beschissenen Horrorfilm«, flüstere ich und drehe mich im Kreis, betrachte die Schaukel, die wegen des Windes leicht zu wippen begonnen hat. Wachsam schiele ich zu meiner Prothese und drücke gegen den Nagel meines kleinen Fingers. Meine Fingerkuppen öffnen sich, nur wenige Millimeter. Ein gedimmtes Licht strahlt unter meinen Nägeln hervor – auf die Umrisse des Parks. Und dann sehe ich die Karte.
Mein Herz pocht spürbar schnell in meiner Brust. Mich ummantelt ein Kribbeln, eine Anspannung, die eine überwältigende Lebendigkeit innehat. Die Klaviermusik blende ich aus.
Beleuchtet vom Schein meiner Fingerkuppen schimmert die ominöse Karte im Gras. Sie ist schwarz, rechteckig und mit golden eingestanzten Koordinaten versehen.
»Ich muss sie verloren haben«, sagt eine Stimme aus dem Nichts, irgendwo hinter mir. Ich schrecke zur Seite und sehe gerade noch, wie die Gestalt aus einem Schatten tritt. »Du darfst sie behalten.«
Vor mir steht eine Frau, die in tiefster Nacht eine Sonnenbrille trägt. Sie hat dunkelblondes Haar, Stirnfransen. Ihre Lippen glänzen rubinrot und der süßliche Duft von Rosen umgibt sie – und als wäre ihr Auftreten nicht schon bizarr genug, hat sie sich einen Lutscher in den Mund gesteckt.
Es ist Tessa. Meine Nachbarin. Eine Frau Mitte 40, der ich gelegentlich über den Weg laufe.
Ohne auf eine Reaktion von mir zu warten, betätigt sie einen Countdown auf ihrer Uhr. »Zehn Minuten«, merkt sie an. »Danach werden sie mich finden.« Anschließend blickt Tessa auf die gegenüberliegende Straßenseite. »In fünf Minuten kommt der nächste Passant. Aber der wird uns nicht stören.«
Ich bin so irritiert, dass ich nur steif dastehe. Wie der Ventilator in der Polizeistation tue ich rein gar nichts.
Tessa lächelt, nimmt sich die Brille ab und hebt die Karte vom Boden auf. Sie drückt sie mir in die Hand. »Eine halbe Minute ist schon rum«, sagt sie. »Wir haben nicht viel Zeit.«
Dort, wo ich sonst immer einen fiesen Spruch auf Lager habe, finde ich nicht einmal ein Stottern.
»Gut. Wie du willst.« Tessa schnappt sich den Stiel ihres Lutschers und zeigt damit auf mich. »Du hast keinen Plan, was das hier soll. Dabei gibt es einen ganz simplen Grund, wieso du zu mir in den Park gekommen bist.« In ihren Pupillen flackert Schadenfreude. »Du führst ein armseliges Leben.«
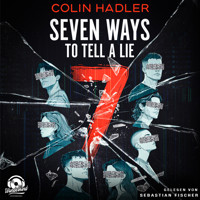
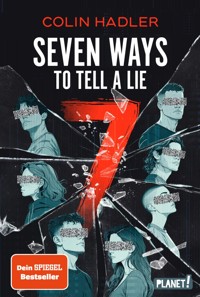

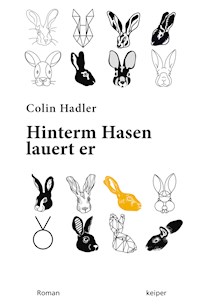














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










