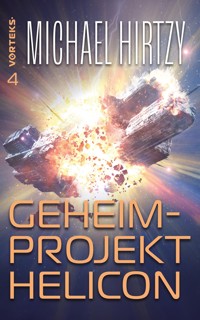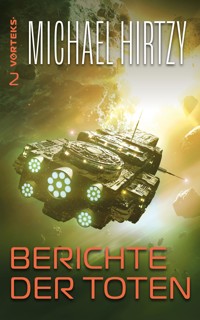8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: LizardCreek Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Erstmalig komplett in einem Band. Die komplette Bilder der Apokalypse Trilogie. Dystopischer Science Fiction Thriller. BAND 1 - Vor dem Abgrund : SIE SIND EIN WERKZEUG. GESCHAFFEN, UM UNS ALLEN DAS LEBEN ZU ERLEICHTERN. ANPASSUNGSFÄHIG, FLEXIBEL UND GEFÄHRLICH. Fünf Studenten bekommen den Auftrag, eine revolutionäre Nanotechnologie zu prüfen. Die Studierenden wittern ihre große Chance. Bald müssen sie erkennen, dass sie und ihre Auftraggeber unterschiedliche Ziele haben. Sie gehen ihren eigenen Weg und der Erfolg gibt ihnen recht. Schnell müssen sich die fünf eingestehen, dass sie nicht alles so fest im Griff haben, wie sie es glauben. Unkontrollierter Ehrgeiz trifft auf Nanotechnologie und löst eine Kette von Ereignissen aus, die niemand vorhersehen konnte. BAND 2 - Countdown zum Untergang: ANCOS ES WURDE ERSCHAFFEN UM UNS DAS LEBEN ZU ERLEICHTERN EINE FEHLENTSCHEIDUNG HAT ES VERLETZT JETZT IST ES BEREIT, ZURÜCK ZU SCHLAGEN. Das rasante Wachstum hat Stephanie und ihr Team bei Fastlane blind gemacht. Nach Jahren des Erfolgs hat eine einzige Fehlentscheidung ausgereicht, um alles zu zerstören. In den Tagen nach der Katastrophe in Berlin müssen die Gründer des Technologiekonzernes Fastlane sich der Wahrheit stellen. Tausende Menschen mussten ihr Leben lassen, weil sie der Meinung waren, alles unter Kontrolle zu haben. Ab was genau geschehen ist, verstehen sie noch immer nicht, bis zu dem Moment, an dem die Behörden entscheiden, das Computersystem, das sie über Jahre aufgebaut haben abzuschalten. Die Fortsetzung des spannenden Technothrillers Vor dem Abgrund. BAND 3 - Weg ohne Wiederkehr: ANCOS HAT GESIEGT. Zwei Jahre sind seit dem verheerenden Angriff auf ANCOS vergangen. Die künstliche Intelligenz, entstanden durch einen Fehler, hat gesiegt. Die Menschheit findet sich in einer Welt ohne moderne Technologie wieder. Nanobots, entwickelt, um das Leben zu erleichtern, sind zur lebensbedrohlichen Gefahr geworden. Ein trügerischer Frieden herrscht zwischen der übermächtigen KI und den Überlebenden. In den entvölkerten Städten kämpfen die letzten Zurückgebliebenen um ihr Überleben. Bis zu dem Augenblick, als jene, die den Untergang ausgelöst haben, erkennen müssen, dass es einen viel bedrohlicheren Gegner gibt. Alle 3 Romane in einem Band. Ungekürzte Gesamtausgabe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
MICHAEL HIRTZY
ANCOS
BILDER DER APOKALYPSE – DIE KOMPLETTE TRILOGIE
© 2021 Michael Hirtzy | c/o Autorenservice Gorischek / Am Rinnergrund 14/5 / 8101 Gratkorn / Österreich
1. Auflage 2022
Vollständige und ungekürzte Sammelausgabe der als Einzelbände erschienen Romane:
Vor dem Abgrund – Erstauflage Juni 2020
Countdown zum Untergang – Erstauflage April 2021
Weg ohne Wiederkehr – Erstauflage Juni 2022
Covergestaltung und Buchsatz: Catherine Strefford | www.catherine-strefford.de
Titelillustration mit Bildern von © Leonhard_Niederwimmer – Pixabay, © geralt – Pixabay
Logo: Isabel Kutscherer
Lektorat Band 1 – 3 : Marieke Kühne | textzucker.at
Korrektorat Band 1 & 2 Magda Werderits
Korrektorat Band 3 : Tino Falke | tinofalke.de/lektorat
E-Book veröffentlicht über Tolino Media.
Alle in diesem Roman vorkommenden Personen, Ereignisse und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen oder Ereignissen sind rein zufällig.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
BAND 1:
VOR DEM ABGRUND
JETZT
»Scheiße, Scheiße, Scheiße!«
Er starrt mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera. Der Raum hinter ihm verschwimmt im Dunkeln. Nur schwache Umrisse sind sichtbar, Schränke, eine Tür, ein Tisch. Auf dem Display erkennt er den Schweiß auf seiner Stirn. Sein Blick rast hin und her, sein Atem geht stoßweise und die sonst gepflegten Haare stehen in alle Richtungen ab. Seine Hand zittert und mit ihr das Handy. Er bemerkt es und lehnt das Gerät an ein Glas auf dem Tisch. Dann setzt er sich ein wenig aufrechter hin und beginnt zu sprechen.
»Ich bekomme keine Verbindung. Festnetz, Mobilfunk und Internet funktionieren nicht. Das Rechenzentrum ist wie ferngesteuert. Es ist, als wären unsere Rechner neu aufgesetzt worden.«
Leise flucht er, ehe er sich besinnt und tief durchatmet. Er versucht, ruhig und gefasst zu wirken, doch seine Augen verraten ihn, zeigen die Panik.
»In den letzten fünf Minuten vor der Abschaltung ist der Datenverkehr nach außen explodiert. In jeder Sekunde wurden zig Terabyte an Daten ins Netz gejagt.«
Er überlegt einen Moment, ob er mehr sagen soll. Schließlich beendet er die Aufnahme. Er starrt immer noch Richtung Handy, doch sein Blick verliert sich in der Ferne. Er wird die Ereignisse weiterhin dokumentieren, wird alles daran setzen rauszukommen, zu überleben.
TEIL 1
ENTWICKLUNGEN
»Alle streben nach Wachstum. Der Hunger nach mehr ist grenzenlos und es ist offensichtlich, dass diese maßlose Gier, von der unsere Welt getrieben wird, viele für die Realität blind macht. Jedes Wachstum hat Grenzen, natürliche oder künstlich geschaffene. Dort, wo der Ausbreitung keine Grenzen gesetzt werden, spricht man nicht mehr von Wachstum, sondern von Krebs.«
MIRIAM MALESHA – AUS EINER PRIVATEN NACHRICHT – DATUM UNBEKANNT
1
STEPHANIE • 2031
»Frau Ruber, Ihre Diplomarbeit ist nicht in einer Sackgasse – sie ist tot.«
Die massive Holztür glitt ihr aus den Fingern und fiel hinter ihr ins Schloss, während der Satz in ihren Ohren widerhallte. Labners Worte trafen sie völlig unvorbereitet, obwohl ihm sein Ruf vorauseilte. Dr. Dr. Ing. Labner war ein Genie auf dem Gebiet der Robotik und Nanotechnologie. Darüber hinaus war er sozial eigenwillig, grüßte nie, vermied es, sein Gegenüber im Gespräch anzusehen, und ließ jeden, unabhängig von Alter oder Stellung, spüren, dass er ihn nicht respektierte.
Labner empfing sie in seinem Büro, das im vierzehnten Stock an der Spitze des University Towers thronte. Eine breite Glasfront hinter ihm gestattete einen atemberaubenden Blick über die Seestadt. An den Seitenwänden hingen acht Monitore, die wechselnde technische Diagramme zeigten. Ein gewaltiger Glasschreibtisch, der groß genug war, um darauf Tischtennis zu spielen, trennte die beiden.
Seine Stimme war weder aufgeregt noch verärgert, sondern ruhig und emotionslos. Er wollte Stephanie nicht verletzen – sie war ihm egal, genau wie alle anderen Studierenden. Wer zu seinem Prestige beitrug, war von Wert, alle anderen waren wertloser Ballast. Sein Gesicht zeigte nie ein Lächeln. Die kleinen Augen hinter einer schmalen, randlosen Brille waren stechend, als wollte er sie mit Blicken durchbohren.
Stephanie verharrte, unschlüssig, ob sie flüchten oder einen weiteren Schritt in seine Richtung wagen sollte.
»Planen Sie, wie Ihre Arbeit in Totenstarre zu verfallen?«
Ein weiterer verbaler Angriff, der sein Ziel nicht verfehlte und sie wie ein Messerstich traf. Er deutete widerwillig auf den Stuhl vor sich.
»Setzen Sie sich!«
Mit schnellen Schritten eilte Stephanie zum Schreibtisch und sank zitternd auf den Ledersessel, der so niedrig war, dass sie unweigerlich zu ihm aufschauen musste.
Labner fixierte sie wie ein Jäger sein Wild durch das Zielfernrohr. Wartete er auf eine Antwort? Eine Entschuldigung? Vielleicht eine Rechtfertigung? Sie bezweifelte es. Mittlerweile kannte sie ihn gut genug, um zu wissen, dass er neben Unfähigkeit und Faulheit vor allem Ausreden hasste.
Die Sekunden verrannen und fühlten sich wie Stunden an. Sie versuchte ihn direkt anzusehen, doch sein starrer, boshafter Blick brachte sie davon ab. Die Welt auf der anderen Seite der breiten Glasfront schien stillzustehen. Sie fühlte den Schweiß auf der Stirn und schon traf sie der nächste Satz wie ein Peitschenhieb.
»Gerade von Ihnen hätte ich mir anderes erwartet. Liegt es vielleicht daran, dass Sie zu viel Zeit mit ziellosen Bastelarbeiten verbringen, oder an Ihren langen Nächten im Campus-Café?«
Woher wusste er davon? Überwachte er seine Studierenden? Ein boshaftes Lächeln umspielte seine Lippen.
In diesen Sekunden, bevor Labner genüsslich das Ende ihrer Laufbahn verkünden würde, rasten die letzten Monate, die an diesen Punkt geführt hatten, vor Stephanies geistigem Auge vorbei.
2
STEVEN • 2029
Unter der brennenden Julisonne lief ihm der Schweiß den Rücken hinunter. Er schob die verspiegelte Sonnenbrille von der Stirn und starrte verärgert nach oben, als könnte er die Sonne allein durch Willenskraft dazu bringen, sich hinter Wolken zu verstecken. Ein schweißnasses Shirt, das am Rücken klebte, war das Letzte, was er brauchte. Heute war sein Tag, heute konnte er zeigen, was er draufhatte. Die Brille glitt wieder vor seine Augen. Er würde sich den Tag nicht von der Sonne ruinieren lassen. Die letzten sechs Monate hatte er darauf hingearbeitet und jetzt würde er sein Werk präsentieren. Er richtete sich auf und verließ den Container, der als Garderobe, Aufenthaltsraum und Werkstatt jedem Team zur Verfügung gestellt worden war.
»Mensch Steven, hast du da drinnen gepennt, oder was?«, rief ihm jemand zu.
Er sah abrupt in die Richtung, aus der die Stimme kam, und im selben Moment verlor er die Konzentration. Der linke Fuß verpasste die tiefer liegende Metallstufe, rutschte ab und er kippte vorwärts. Mit wedelnden Armen versuchte er sich festzuhalten, verfehlte den Türgriff haarscharf, stolperte einen Schritt weiter und verlor endgültig den Halt. Er knallte auf den staubigen Boden und seine Sonnenbrille segelte in hohem Bogen davon.
»Scheiße!«, zischte er kaum hörbar. Halb lag, halb kniete er im Staub und fühlte sich wie ein Vollidiot, als er sich wieder aufrichtete.
»Cooler Auftritt«, hörte er und spürte eine schwere Hand, die ihm freundschaftlich auf den Rücken klopfte.
Steven wandte sich um und sah seinen Freund und Unglücksbringer Ayaz, der für den Sturz verantwortlich war. Der fünfundzwanzigjährige, übergewichtige Türke hielt ihm mit einem breiten Grinsen im unrasierten Gesicht die Hand hin.
»Ein Salto vorwärts wäre schön gewesen.«
Steven ergriff die angebotene Hand und musste grinsen. Er stand auf und schlug Ayaz auf die Schulter.
»Das war der Plan, aber weil du mich abgelenkt hast, habe ich den Absprungpunkt nicht erwischt.«
In diesem Moment weiteten sich Ayaz’ Augen und er starrte mit heruntergeklappter Kinnlade an ihm vorbei. Steven sah ihn fragend an und wandte sich dann um. Zwei Schritte hinter ihm stand eine Frau mit seiner Sonnenbrille in der Hand. Sie war das genaue Gegenteil von Ayaz – mindestens einen Meter achtzig groß, lange rote Haare, schlank und drahtig mit sichtbaren weiblichen Kurven. Sie hielt ihm seine Brille hin und sah die beiden von oben bis unten an.
»Wettbewerbsteilnehmer?«, fragte sie lässig.
Steven und Ayaz nickten und starrten sie wortlos an.
»Und sehr gesprächig, wie ich merke.«
Erst jetzt bemerkte Steven, dass er noch immer nickte. Die Hitze, die ihm in den Kopf stieg, kam diesmal nicht von der Sonne. Begleitet von einer peinlich langen Pause brachte er endlich den nächsten Satz hervor: »Ganz genau, Team TCM.«
Sie blickte ihn fragend an. »Traditionelle chinesische Medizin?«
Mist, fuhr es ihm durch den Kopf. Sechs Monate Vorbereitung und nie war ihnen aufgefallen, dass ihr Kürzel missverständlich war. »Nein, nein«, sagte er hastig, »Texas Chainsaw Massacre.«
Ihre Augen funkelten und ein breites Grinsen erschien auf ihrem Gesicht. »Ah, die Herren haben einen guten Filmgeschmack. Zumindest übertrifft er den Kleidungsstil.«
Erst jetzt registrierte Steven, dass sie ihm immer noch die verspiegelte Pilotenbrille entgegenhielt. Zögerlich nahm er sie an. Bevor er eine passende Antwort fand, drehte sie sich um und entfernte sich.
Im Gehen blickte sie über die Schulter und sagte: »Bin gespannt, was euer Roboter so draufhat.«
Ayaz fand seine Sprache wieder und rief: »Wie cool war das denn! Die kennt echt Texas Chainsaw Massacre?«
Die Antwort blieb Steven im Hals stecken, denn in diesem Moment dröhnte die Stimme des Moderators aus der Arena: »Der nächste Kampf beginnt in zehn Minuten – Team Krawallbruder gegen TCM!«
Jeder Gedanke an die Unbekannte war vergessen. Ihre Zeit war endlich gekommen. Seit sechs Monaten hatten sie sich auf den Roboterwettkampf vorbereitet. Bisher waren sie nur Zuschauer gewesen, doch dieses Jahr würden sie bei den Newcomern teilnehmen. Sie wollten nicht nur Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern gewinnen. Zwei Jahre waren in den Bau ihres Kampfroboters und in die Entwicklung der Software geflossen. Die Vorgabe war, einen Roboter zu bauen, der die Größe von einem Kubikmeter nicht überschritt, nicht von außen gesteuert wurde und gegen andere Roboter kämpfen konnte. Dem Gewinner winkten keine akademischen Ehren, sondern ein Preisgeld von zehntausend Euro.
Die meisten Teams setzten sich aus sechs bis acht Studierenden zusammen. Steve und Ayaz hatten sich allerdings in den Kopf gesetzt, es zu zweit zu schaffen. Sie hatten einen Roboter gebaut, der aussah wie ein Ei mit Kettenantrieb. Dazu hatten sie eine Software und die passende Sensorsteuerung entwickelt. Für diese Arbeit hatten sie das Studium für sechs Monate links liegen gelassen.
Minuten später schallte die Fanfare, die den Einmarsch der Teams ankündigte, über die Arena am Rande der Seestadt. Hunderte Studierende standen rund um das kreisrunde, fünfzig Meter durchmessende, eingezäunte Areal. Bei den Zuschauern brandete Gelächter auf, als Steven und Ayaz ihren Roboter an den Startpunkt brachten. Wie sollte ein Ei auf Ketten ohne sichtbare Waffe das Monstrum auf der anderen Seite besiegen?
Der gegnerische Roboter trug denselben Namen wie das Team – Krawallbruder. Er war ein viereckiger Kasten auf Rädern, an dessen Außenseiten eine Axt, ein Schweißbrenner und ein hydraulischer Vorschlaghammer angebracht waren. Er nutzte die erlaubte Maximalgröße bis zum letzten Millimeter aus. Ihr fünfzig Zentimeter langes Kampf-Ei namens Jawbreaker wirkte dagegen wie ein Scherzartikel – genau wie sie es beabsichtigt hatten.
Ayaz prüfte ein letztes Mal die Antriebskette und den Motor, Steven startete die Software. Die Roboter mussten in der Arena selbstständig agieren. Der Wettkampf zielte also sowohl auf die Programmierkünste der Teams als auch auf deren Konstruktionsfähigkeit ab.
Ein weiterer Fanfarenstoß läutete den letzten Countdown ein. Mit lautem Getöse aus den Publikumsrängen wurden die letzten zehn Sekunden heruntergezählt. Der Countdown sprang auf null und im selben Moment hämmerte infernalische Metal-Musik aus den Lautsprechern. Die ersten Worte des Sängers begleiteten die beiden Roboter, die sich in Bewegung setzten.
Sekundenlang schienen die Maschinen unschlüssig, drehten sich hin und her, bis sie ihren Gegner wahrnahmen. Die Motoren heulten auf. Begleitet vom stampfenden Rhythmus und den Gitarrenriffs beschleunigten die beiden und rasten aufeinander zu.
Der Schweißbrenner von Krawallbruder flammte auf und ein Jubeln ging durch die Zuschauerränge. Zeitgleich grölte der Sänger aus den Boxen, wie um die Teams anzuspornen.
Krawallbruder setzte mit dem hydraulischen Hammer zum ersten Schlag an, als bei Jawbreaker eine Veränderung zu erkennen war. An der Vorderseite öffnete sich ein zwanzig Zentimeter langer und zehn Zentimeter breiter Spalt. Ein lautes Kreischen drang aus dem kleinen Ei und übertönte die Musik. Im selben Moment, in dem Krawallbruders Hammer zum ersten Mal an seine Flanke donnerte, glitt eine im Sonnenlicht gleißende Kreissäge hervor. Die Lautstärke der Musik erreichte ihren Höhepunkt und dröhnte in den Ohren.
Das Sägeblatt kam erstmals mit dem Metallgehäuse von Krawallbruder in Kontakt und Funken sprühten. Gleichzeitig erwachte der Schneidbrenner mit einem Flammenstoß zum Leben. Die Menge jubelte und verstummte plötzlich, denn die Kreissäge durchschnitt den Stahlmantel des Gegners und fraß sich weiter ins Innere von Krawallbruder. Metallfetzen flogen in alle Richtungen, Funken stoben aus dem Inneren und der hydraulische Arm mit dem Vorschlaghammer fiel krachend zu Boden. Plötzlich schoss eine Stichflamme aus Krawallbruders Mitte und signalisierte einen Volltreffer in der Gasleitung. Sekundenbruchteile später war es vorbei. Krawallbruder zerbrach in zwei Hälften.
Die Arena war erfüllt vom Kreischen der weiterlaufenden Kreissäge und vom Dröhnen der Musik. Wie eine Verabschiedung des gefallenen Kämpfers hallten die letzten Worte des Sängers über den Platz.
Schlagartig verstummte die Musik und das Publikum begann begeistert zu applaudieren. Der Jubel brandete über Steven und Ayaz hinweg, die über die Bande sprangen und die Arme in die Luft reckten – der erste Gegner war besiegt. Sie fielen sich in die Arme und blendeten die Welt um sich aus. Erst ein Aufschrei vom gegenüberliegenden Ende der Arena, gefolgt vom erneuten Kreischen der Kreissäge, riss sie in die Realität zurück.
Ayaz sah Steven erschrocken an: »Kann es sein, dass du vergessen hast …«
»… dass ich vergessen habe, Jawbreaker abzuschalten? Scheiße, ja!«, ergänzte Steven und suchte panisch das Tablet, mit dem sie den Roboter steuern konnten.
Jawbreaker schob sich durch die Trümmer von Krawallbruder. Mit ausgefahrener Kreissäge rollte er auf das nächste Hindernis zu – die Bande, die Arena und Zuschauerränge trennte. Das angebrachte Werbebanner lag bereits in Fetzen am Boden. Die Holzplatten der Bande boten der Kreissäge kein Hindernis und hüllten den Roboter in Sekunden in eine Wolke aus Staub und Spänen. Das Publikum schrie und stürmte in alle Richtungen davon. In der Mitte des Aufruhrs erkannte Steven die Rothaarige, die seine Sonnenbrille aufgehoben hatte. Sie stand seelenruhig da und schien von den ganzen Ereignissen unberührt.
Vom Schock erstarrt musste Steven zusehen, wie Jawbreaker die Barriere durchbrach. Von jedem Widerstand befreit kreischte die Säge erneut auf und der Roboter setzte seine Zerstörungsfahrt auf einer kerzengeraden Linie fort. Unverändert stand die Rothaarige da und beäugte den Kampfroboter, der zielgerichtet auf sie zurollte, interessiert. Ein Meter Sandboden und eine altersschwache Holzbank trennten sie voneinander. Die Säge senkte sich langsam auf die Höhe der Sitzfläche und fraß sich durch das Holz wie durch Butter. Wie vom Blitz getroffen hielt Jawbreaker von einem Moment auf den anderen inne und die Säge kam zur Ruhe. Völlige Stille fiel über die Arena. Der Staub senkte sich und mit lautem Knacken brach die Bank, keine zwanzig Zentimeter vor der Rothaarigen, auseinander.
Steven sah sich hektisch um. Dort stand Ayaz, der das verloren geglaubte Tablet in der Hand hielt und hektisch atmete wie ein Marathonläufer, der gerade die Ziellinie überschritten hatte.
Mit gemächlichen Schritten kam die Rothaarige auf sie zu und lächelte. »Nettes Spielzeug, das ihr da habt. Die Software allerdings scheint mir noch unausgereift.«
3
STEPHANIE • 2031
»Liegt es vielleicht daran, dass Sie zu viel Zeit mit ziellosen Bastelarbeiten verbringen, oder an Ihren langen Nächten im Campus-Café?«
Ihre Gedanken drehten sich im Kreis. Lag Labner mit seiner Frage richtig? Sekunden verstrichen, die er sichtbar genoss. Sein boshafter Gesichtsausdruck verstärkte die nächsten Worte.
»Ich sehe, dass ich wohl richtig liege.« Hämisch grinsend lehnte er sich zurück, um den finalen Dolchstoß vorzubereiten.
Stephanie blieb weiterhin stumm und wartete darauf, wie er ihren Rauswurf formulieren würde. Tausend Gedanken kreisten ihr im Kopf und untergruben ihren verzweifelten Versuch, sich passende Worte zurechtzulegen.
Labner erhob sich. »Haben Sie angenommen, dass ich keine Ansprüche an meine Studierenden habe? Ich kenne Ihre Vergangenheit und war mir sicher, Ihre Zukunft zu kennen. Ich betreue keine Verlierer. Ich vergebe einmalige Chancen an die, bei denen ich Potenzial sehe. Trotz Ihrer Vergangenheit haben Sie die Aufnahmeprüfung als Drittbeste Ihres Jahrganges absolviert. Im Gegensatz zu anderen haben Sie Ihre Zeit nicht mit dem mehrmaligen Wechsel der Fachrichtung verschwendet, Sie haben an der Robotik festgehalten. Ich habe Sie aus dem Sumpf gezogen und Ihnen eine Chance geboten, die Sie mir mit einer Abschlussarbeit danken, die an Aussagekraft kaum zu unterbieten ist.«
Er wandte ihr den Rücken zu und blickte durch das Fenster auf den Universitätscampus und die anliegenden Bürobauten. »Ich habe Ihnen die Tore zu einer neuen Welt geöffnet. Frau Ruber, ich habe Sie aufgenommen, da ich große Stücke auf Sie gesetzt habe – ein Mädchen vom Land, aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen und mit einer konfliktreichen Kindheit.«
4
STEPHANIE • 2031
Woher kannte Labner ihre Vergangenheit? Fischte er im Trüben und erwischte sie zufällig am falschen Fuß oder hatte er sie bis ins letzte Detail durchleuchten lassen?
Labner lag völlig richtig. Sie war ein Kind vom Land, aufgewachsen im geografischen und wirtschaftlichen Niemandsland – Unterstinkenbrunn, eine Stunde Autofahrt von Wien, dafür nur wenige Minuten Fußweg von der tschechischen Grenze entfernt. Für Erholungssuchende war es das Paradies im Grünen, doch für Stephanie, eine Heranwachsende, deren Freundeskreis großteils in den nahe gelegenen Städten wohnte, war es die Hölle auf Erden. Der Ort hat siebenhundert Einwohner, ein Gemeindeamt, eine Kirche, eine Dreckslacke, die sich Freibad nennt, und unzählige Sport-, Trachten- und Schützenvereine, deren Versammlungen hauptsächlich als Ausrede dienen, sich am Wochenende besinnungslos zu besaufen.
Stephanie musste sich zwingen, nicht in Tränen auszubrechen, wenn sie an ihr Zuhause dachte – an den Ort, der ihr Schutz und Geborgenheit hätte bieten sollen, für sie aber die Hölle gewesen war. Sie war in einem Vier-Generationen-Haus aufgewachsen. Ihre Urgroßeltern, erzkonservative Bauern, wohnten im Erdgeschoß. Darüber lebten ihre Großeltern, die das Haus mit dem Geld ihrer Eltern erbaut hatten. Im zweiten Stock lebten ihre Eltern – ihr Vater, ein mittelmäßig erfolgreicher Schlosser, der einen eigenen Betrieb mit zwei Mitarbeitern führte, und ihre Mutter, die halbtags in der Gemeinde arbeitete und die Einzige mit stabilem Einkommen war. Ihr hatte die Bank den Kredit gewährt, der notwendig gewesen war, um anzubauen und damit Platz für die dritte Generation zu schaffen.
Stephanie und ihre um vier Jahre ältere Schwester Lena waren in einem Umfeld aufgewachsen, in dem offen ausgetragener Streit zur Tagesordnung gehört hatte. Das hatte sie zusammengeschweißt. Sie waren durch dick und dünn gegangen und hatten sich gegenseitig Halt gegeben – bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem Lena ihren ersten Freund nach Hause gebracht hatte.
Es war ein Abend wie so viele zuvor und alle Familienmitglieder saßen gemeinsam beim Abendessen im Esszimmer. Was nach Heimatroman-Idylle klingt, war für Stephanie der alltägliche Horror. Die Stimmung war schlimmer als üblich, denn Lena war nicht pünktlich zum Abendessen erschienen und Mutter wollte warten.
Polternd schrie Stephanies Urgroßvater: »Es ist achtzehn Uhr! Um achtzehn Uhr wird Abendbrot gegessen. Das ist seit achtzig Jahren so und wird wegen dem Balg, das du nicht unter Kontrolle hast, nicht geändert!«
»Lena, sie heißt Lena und wir können wohl fünf Minuten warten! Sie hat versprochen heute dabei zu sein, um uns Armin vorzustellen«, erwiderte Stephanies Mutter.
»Armin, was ist Armin für ein Name? Klingt wie ein Vollidiot. Muss er ja sein, wenn er sich auf ein nutzloses Gör wie deine Tochter einlässt«, setzte Urgroßvater nach.
Keine Minute später war der allabendliche Streit wieder in vollem Gange. Einzig Stephanies Vater saß stumm am Tisch und kaute auf seinem Essen herum, als müsste er einen Stein zermahlen.
Genau in diesem Moment machte Lena auf sich aufmerksam. Wie lange sie und Armin schon im Raum gestanden hatten, wusste Stephanie nicht, doch Lenas Gesichtsausdruck machte klar, dass es schon eine ganze Weile gewesen sein musste. Tränen standen in ihren Augen und ihre Finger umklammerten seine. Stephanie bewunderte Armin für seine Reaktion. Er blieb vollkommen ruhig, die Beschimpfungen schienen ihn nicht zu berühren. Lena schaffte das nicht.
»Ich hasse euch!«, schrie sie und ließ die Gespräche verstummen. »Ihr seid alt und verbittert und ich wünschte, ihr würdet euch gegenseitig umbringen! Dann hätte diese ständige Streiterei endlich ein Ende. Ihr könnt mich alle mal! Ich ziehe zu Armin, das wollte ich euch heute sagen.«
Damals hatten diese Worte Stephanie eiskalt erwischt. Lena, ihr einziger Halt im Chaos der Familie, wandte sich von ihr ab.
Ihr Vater sprang auf und hämmerte mit der Faust auf den Tisch. »Wann du ausziehst, entscheide immer noch ich!«
Lenas Gesicht verlor alle Farbe, Armins Augen weiteten sich. Die sonst so ruhige und besonnene Lena zeigte plötzlich eine völlig andere Seite.
Ihr Körper straffte sich und mit bestimmter Stimme sagte sie: »Es ist mir scheißegal, was du sagst! Ich bin volljährig und mache, was ich will. Ich packe meine Sachen und gehe – jetzt, sofort!«
Ohne auf seine Antwort zu warten packte sie Armin an der Hand und zog ihn zu ihrem Zimmer. Ihr Vater schrie ihr hinterher, ihre Mutter heulte und ihr Großvater knurrte: »Dumme Frauen. Wissen nicht, wo ihr Platz ist. Das habt ihr davon, dass ihr keine Burschen bekommen habt.«
Stephanie sprang auf und folgte Lena in ihr Zimmer. Mit Tränen in den Augen schleuderte ihre Schwester alles, was sie zu greifen bekam, in Taschen, Koffer und Einkaufstüten. Stephanie stand in der Zimmertür und starrte sie ungläubig an – sie würde wirklich aus ihrem Leben verschwinden. Armin schnappte die ersten beiden Koffer und machte sich dazu auf, das Kriegsgebiet Wohnzimmer zu durchqueren, während sich Lena ihr mit feuchten Augen zuwandte.
»Es tut mir leid, Häschen. Ich kann nicht mehr. Was ich da draußen gesagt habe, damit habe ich nicht dich gemeint.« Sie schloss Stephanie in die Arme. »Ich muss hier raus, bevor ich wahnsinnig werde. Sobald ich bei Armin eingezogen bin, kannst du uns jederzeit besuchen kommen.«
Sie glaubte ihrer Schwester, dass sie ihr Angebot ernst meinte, doch beide wussten, dass ihre Eltern Stephanie nie mit dem Auto zu Lena bringen würden – und anders waren die dreißig Kilometer nicht zu bewältigen.
Zwei Stunden später war sie weg. Ab da entlud sich der Ärger nur mehr über Stephanie und das führte dazu, dass ihre beruflichen und schulischen Ambitionen wie im Sturm verflogen. Sie wollte einfach weg, egal, auf welchem Weg. Ihr einziger Halt in dieser Zeit war die Familie ihrer besten Freundin.
Andreas Familie war das genaue Gegenteil von Stephanies. Ihre Eltern waren aufs Land gezogen, um dem Stress der Stadt zu entgehen. Sie blickten auf berufliche Erfolge zurück, hatten drei Unternehmen aufgebaut, um diese nach der Geburt ihrer Tochter wieder zu verkaufen und ein ruhiges Familienleben zu führen. Wann immer es ging, verbrachte Stephanie ihre Zeit bei Andrea und fand bei ihr eine Zweitfamilie. Sie und ihre Eltern gaben ihr Rat, wenn sie nicht weiterwusste, und Kraft, wenn sie aufgeben wollte. Ein Gespräch blieb ihr besonders in Erinnerung.
Es war der erste warme Abend des Jahres und Stephanie feierte den sechzehnten Geburtstag bei Andrea. Am Vortag hatte Lena bei einem ihrer seltenen Besuche eröffnet, dass sie im fünften Monat schwanger war. Ihr Vater hatte sie angeschrien, ihre Mutter hatte geheult. Großvater hatte ihren Eltern erklärt, dass sie unfähig seien, Kinder zu erziehen, und schuld daran seien, dass seine Eltern im letzten Jahr gestorben sind.
Stephanie saß in der Dämmerung mit Andrea und ihren Eltern auf deren Terrasse und formulierte zum ersten Mal jene Frage, die ihr seit langem am Herzen lag.
»Was soll ich aus mir machen?«
Alle drei sahen sie lange an, dann beugte sich Andreas Mutter vor und legte ihr die Hand auf den Unterarm. »Stephanie, wichtig ist, dass du Dinge machst, an denen du Freude hast. Es bringt dir nichts, jahrelang bis zum Umfallen zu arbeiten und am Ende zu erkennen, dass du nie deinen Weg gegangen bist. Du bist intelligent, mutig und offen. Mach etwas, für das du dich begeistern kannst. Schau auf dich und frage nicht, was andere für richtig halten.«
Andreas Vater fügte dem, mit einem Seitenblick auf seine eigene Tochter, zwei Sätze hinzu: »Wozu du dich auch entscheidest, denke dabei an eines: Es geht nicht darum, dass andere stolz auf dich sind, du machst es für dich.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Und sei dir sicher, egal was du machst, du kannst uns jederzeit um Hilfe bitten.«
Andrea lachte und sprang auf. »Das hilft ihr nicht weiter. Komm, ich zeige dir, wie ich das mache. Wir schreiben Pro-und-Kontra-Listen!«
Trotz aller Listen blieb Stephanie mangels anderer Ideen erst einmal in der Schule. Nach der mit Bauchschmerzen und viel Glück bestandenen Matura stellte sie fest, dass die mit sechzehn angefangene Liste der Dinge, die sie nicht wollte, immer länger geworden war.
»Ist dir schon mal aufgefallen, dass auf der No-Go-Seite nur Sachen stehen, die nichts mit Technik zu tun haben?«, fragte Andrea sie eines Abends.
Sie lag völlig richtig. Genau betrachtet waren Computer, Elektronik und Technik die einzigen Themen, bei denen es Stephanie nicht kalt den Rücken hinunterlief. In Mathematik hatte sie maturiert, weil ihr beim Gedanken daran nicht das Grausen kam. Interesse für eine bestimmte Materie zeigte sich bei ihr nicht in Begeisterung, sondern im Fehlen von Abneigung dagegen.
5
STEPHANIE • 2031
»Frau Ruber, ich habe Sie aufgenommen, da ich große Stücke auf Sie gesetzt habe – ein Mädchen vom Land, aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen und mit einer konfliktreichen Kindheit.« Nach einer kurzen Pause setzte er fort. »Ich habe nicht damit gerechnet, so bitter enttäuscht zu werden.«
Er stand immer noch mit dem Rücken zu ihr und sah aus dem Fenster, seine Worte trafen sie dadurch jedoch nicht weniger. Sie zitterte vor Wut und zwang sich, die Vergangenheit beiseitezuschieben. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn und ihr Puls raste. Für ihn war sie nichts weiter als ein kleiner, sich windender Wurm. Stephanie setzte zu einer Erwiderung an, doch wieder kam er ihr zuvor.
»Liegt Ihre mangelnde Einsatzbereitschaft und Leistung vielleicht daran, dass Sie Ihre Zeit damit verschwenden, mit Männern beim Fahrradbasteln zu flirten? Nehmen Sie sich Ihre Kommilitonin Frau Malesha als Vorbild. Sie bringt ihr Studium und einen Partner ohne unnötige Ablenkungen unter einen Hut.«
Stephanies Herzschlag beschleunigte sich und kurz glaubte sie, ohnmächtig zu werden. Er schien alles über ihr Privatleben zu wissen, dabei hatte sie Ralph erst vor vier Monaten kennengelernt. Mit dem Verweis auf Miriam wurde aber klar, dass sie nicht die Einzige war, die er im Visier hatte.
In diesem Moment ließ er seine Arme sinken und drehte sich wieder zu ihr. Er beugte sich vor, stützte seine Hände auf die gläserne Tischplatte und sein Gesicht nahm einen diabolischen Ausdruck an.
»Sie bringen mich in eine unangenehme Lage. Ich müsste Sie umgehend aus dem Betreuungsprogramm entlassen. Das würde das Ende Ihrer Laufbahn an der Technischen Universität und wohl an jeder anderen respektablen universitären Einrichtung bedeuten. Nichts liegt mir ferner, als Ihre akademische Laufbahn zu beenden …«
Sie hätte fast aufgelacht und biss sich, um Zurückhaltung ringend, auf die Unterlippe. Nichts lag ihm ferner? Was für ein Hohn. Das Einzige, was er verhindern wollte, war die Blamage, dass ihm, dem Allwissenden und Unfehlbaren, ein Fehler unterlaufen war.
»… daher habe ich entschieden, Ihnen eine zweite Chance zu geben. Ihre bisherigen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass Sie keine Theoretikerin sind. Das ist bei einer Frau nicht weiter verwunderlich.«
Wut kochte in Stephanie hoch. Wollte er damit sagen, dass Frauen sich nicht für den akademischen Betrieb eigneten? Hielt er alle Frauen für unterbelichtet? Bevor sie eine Entgegnung formulieren konnte, fuhr er fort.
»Sie verfügen über umfangreiches Wissen und die Bereitschaft, ständig Neues zu lernen. Das macht Sie interessant. Doch es scheint, dass Sie zur Theorie die Praxis brauchen, um Höchstleistungen zu erreichen. Daher habe ich ein Angebot für Sie.«
6
RALPH • 2030
Von dezentem Klingeln begleitet öffneten sich die Schiebetüren und Ralph schob sein Fahrrad in den Bikeshop, der im kleinen Geschäftsgebiet zwischen dem Universitätscampus und dem Wohngebiet der Seestadt lag. Die verklemmte Vorderbremse hatte den ganzen Weg von Stevens Kellerabteil bis hierher gequietscht. Sein Blick schweifte durch den Raum, der wie der Gehweg vor dem Geschäft mit neuen und gebrauchten Fahrrädern vollgestellt war. An den Wänden standen zum Bersten volle Regale mit Zubehör und Ersatzteilen, die er nicht einmal benennen können würde, wenn sein Leben davon abhinge. Nicht ohne Grund hatte er das Rad quer durch die Seestadt geschoben. Seine letzte Fahrt mit einem Fahrrad lag über zehn Jahre zurück. Damals war er noch in die Schule gegangen. Heute nutzte er E-Scooter und manchmal ein E-Moped. Aber ein Fahrrad, mit Kettenantrieb und Pedalen? Niemals. Es war Ayaz, der ihn auf die Idee gebracht hatte, dass er so an Stephanie drankommen könnte.
Sie kam aus der Werkstatt, die versteckt im hinteren Bereich des Ladens lag. Sie hatte die langen roten Haare zum Pferdeschwanz gebunden und trug ein schlabbriges ölverschmiertes T-Shirt und Jeans mit Staubflecken an den Knien. Das einzige Accessoire war der verschmierte Lappen, der auf der Schulter lag und an dem sie sich im Gehen die Hände abwischte. Jede andere Frau hätte er so nicht einmal beachtet, aber sie wirkte, sogar jetzt, atemberaubend. Wie schaffte sie das? Zum ersten Mal hatte er sie in einer Vorlesung gesehen und Steven auf sie aufmerksam gemacht. Inmitten der nerdigen Studierenden hatte sie mit ihrer Natürlichkeit wie ein Leuchtfeuer auf ihn gewirkt und seine volle Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Er hatte mit verkniffenem Grinsen gesagt: »Stephanie, die kenne ich. Letztes Jahr hätte ich sie fast in zwei Hälften gesägt.«
Ab diesem Moment hatte er sie nicht mehr aus dem Kopf bekommen und versucht, Informationen über sie zu sammeln. Steven und Ayaz wussten ein wenig, doch nicht annähernd so viel, wie ihr Netzprofil offenlegte. Sie lebte in der Nähe des Campus in einer Smart-Living-Anlage für Studierende. Online fand er Dutzende Einträge, in denen sie postete, wie lästig das ständige Pendeln zwischen Mistelbach und Wien war. Am deutlichsten vor acht Monaten.
»Jetzt reicht’s. Nie mehr ÖBB! Habe endlich eine Wohnung in Wien. Jetzt heißt es Geldverdienen, um die bezahlen zu können«, hatte sie gepostet.
Darüber war ein Foto des Bikeshops zu sehen, in dem er jetzt stand. Ihr Profil gab weitere Informationen preis. Sie war am Land mit Eltern, Schwester, Großeltern und Urgroßeltern aufgewachsen. Ein Beitrag schoss ihm durch den Kopf, den sie zwei Tage davor veröffentlicht hatte.
»Ich ziehe sicher nie in eine WG. Zwanzig Jahre mit vier Generationen reichen. Der tägliche Kampf, es allen recht zu machen, und ständige Konflikte sind das Letzte, was ich brauche.«
Jetzt stand sie vor ihm und stemmte ihre Hände in die Hüften. »Hi! Was kann ich für dich tun?«
Wie viel Zeit war vergangen? Hatte er sie die ganze Zeit angestarrt? Ihr Kopf war leicht zur Seite geneigt und ihr Gesichtsausdruck wechselte von freundlich zu genervt. Langsam fand er die richtigen Worte.
»Ich denke, die Bremsbeläge sind hinüber und bevor ich bei der nächsten Fahrt aus der Kurve fliege, hätte ich gerne neue«, sagte er mit schelmischem Grinsen und sah dabei auf das alte Rad.
Sie sah zuerst ihn und dann das alte, leicht rostige Ungetüm an seiner Seite an. Ihre Augen wurden größer. Sie trat zwei Schritte auf ihn zu und er roch ihr Parfum, während sie vor dem Rad in die Knie ging.
Sekunden verstrichen, dehnten sich zu einer Minute, in der sie das verrostete Gefährt begutachtete. Sie rüttelte an einigen Teilen und ein leises Schnaufen entwich ihren Lippen. Jede Bewegung war zielgerichtet und Ralph musste sich zwingen, nicht daran zu denken, wie es sich anfühlen musste, ihre Hände auf seinem Körper zu spüren. Endlich stand sie wieder auf und sah ihn an.
»Die Bremsbeläge sind echt deine einzige Sorge?«
»Im Großen und Ganzen schon.«
»Ah ja. Und die rostige Kette, die ungeschmierten Pedale, die kaputte Lenkaufhängung und das gerissene Bremsseil machen dir keine Sorgen?«
Die Hitze schoss ihm in den Kopf. Was sollte er antworten? Dass er keine Ahnung hatte, wovon sie sprach? Die Sekunden rasten dahin und endlich fand er eine Antwort. »Ganz ehrlich, ich bin nicht unbedingt ein Experte. So lange es fährt, bin ich glücklich.«
Stephanie schüttelte den Kopf und stieß ein kurzes Lachen aus. »Fahren kannst du das, was du mit dem Teil machst, wohl nicht nennen. Selbstmord mit Anlauf trifft es wohl eher. Aber es ist dein Leben.«
Sie trat hinter die kleine Theke in der Mitte des Verkaufsraumes und begann einen Auftragsschein auszufüllen. »Ich mache dir einen Vorschlag. Ich tausche die Bremsbeläge, erneuere das Bremsseil und schmiere Kette und Pedale. Mit ein wenig Glück kann ich den Riss in der Aufhängung schweißen. Danach ist es weiter ein alter Rosthaufen, aber du bist keine Gefahr mehr für die anderen Verkehrsteilnehmer.«
Sie sah ihn abwartend an. Das klang verdammt aufwendig und vor allem kostspielig. Ralph haderte mit sich selbst. Sollte er zugeben, dass er nicht plante, jemals mit dem Rad zu fahren und es nur gebraucht hatte, um sie anzusprechen? Oder sollte er sein Bankkonto abräumen und seine Rolle weiterspielen?
Ihr Blick verharrte weiter auf ihm und plötzlich begann sie laut zu lachen. »Du solltest dein Gesicht sehen.«
Verwirrt starrte er sie an. Was war jetzt los?
»Mal ehrlich. Glaubst du, dass du der Erste bist, der hier reinkommt und ein Rad mitbringt, um mich anzuquatschen?«
Sie schüttelte den Kopf und eine Strähne fiel ihr dabei ins Gesicht. Sie wischte sie mit einer schnellen Handbewegung zur Seite. Das war es dann wohl, er war aufgeflogen. Doch das freundliche Blitzen in ihren Augen verschwand nicht.
»Zumindest hast du dich bemüht. Die meisten kommen mit neuen Rädern daher und erzählen von unerklärlichen Geräuschen, die sie nicht lokalisieren können. Aber du? Du bringst wenigstens eines mit, das wirklich Reparaturen braucht.«
Sie schien das Ganze mit Humor zu nehmen. Ralph sah den einzigen Ausweg darin, die Wahrheit zu sagen.
»Das Ding gehört mir noch nicht einmal. Ein Freund von mir hat es seit über zehn Jahren im Keller stehen und meinte, es wäre eine gute Idee, es zu dir mitzunehmen.«
»Der Beweis, dass er von Fahrrädern so viel versteht wie du, ist somit erbracht.«
»Steven ist eher der Busfahrer. Er meint, da kann er besser denken.«
»Steven? Doch nicht etwa Steven Chen?«, fragte sie belustigt.
Ralph nickte und sie lachte wieder auf – glockenhell und freundlich. Hoffnung keimte in ihm auf. Sie schien ihm die Scharade nicht übel zu nehmen.
»Doch. Genau der.«
»Das erklärt alles. Hat er zwischenzeitlich mal wieder versucht, eine Frau in zwei Hälften zu sägen?«
Ralph erinnerte sich an Stevens Erzählung. »Nicht, dass ich wüsste. Derzeit konzentriert er sich darauf, eine App zur simultanen Steuerung von Minidrohnen zu programmieren.«
»Wenn er das ähnlich erfolgreich macht wie seine Gegnererkennung beim Roboterduell, kreisen bald amoklaufende Kameradrohnen über den Campus – nicht gerade ein beruhigender Gedanke.« Sie sah wieder zu dem verrosteten Rad an seiner Seite, bevor sie fortfuhr: »Zurück zu deinem kleinen Scherzartikel hier. Eine Reparatur lässt bestimmt sechs- oder siebenhundert Euro in die Kasse meines Chefs wandern. Ich mache dir ein Angebot – für fünfzig Euro verschrotten wir das Ding für euch und mit dem ersparten Geld lädst du mich am Freitag zum Essen ein. Was hältst du davon?«
Ralph konnte sein Glück nicht fassen. Verstand er sie richtig? Wollte sie wirklich ein Date mit ihm?
»Bevor du dir falsche Hoffnungen machst: Das wird kein Date. Ich erlaube dir nur, dich dafür zu entschuldigen, dass dir kein besserer Weg eingefallen ist, um mich anzusprechen.«
Ralph grinste sie an, im Wissen, gewonnen zu haben. Vielleicht nicht ganz, aber zumindest war er einen großen Schritt weitergekommen. »In zwei Tagen?«
Stephanie runzelte die Stirn. »Da heute Mittwoch ist, kommt das rechnerisch hin, ja.«
Er nickte und schob das Rad in ihre Richtung. »Das gehört jetzt dir. Soll ich gleich zahlen oder am Freitag?«
»Wir machen um sechs Uhr zu. Sei zehn Minuten vorher da.«
»Perfekt! Anschließend gehen wir in die Seestadt, dort gibt es ein neues Steaklokal.«
Es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Endlich hatte er wieder Fuß gefasst und war Herr der Lage. Breit grinsend wandte er sich der Tür zu – er konnte sein Glück nicht fassen.
7
STEPHANIE • 2031
»Ich gebe Ihnen bis Montag um neun Uhr Zeit. Bis dahin habe ich entweder Ihre Zusage und die Lebensläufe Ihrer Projektgruppe, oder Ihr schriftliches Ansuchen, meine Betreuung aus persönlichen Gründen zu verlassen, vorliegen.«
Mit diesem Ultimatum endete das Gespräch mit Labner. Wozu sollte er auch mehr sagen? Er bot Stephanie die Chance ihres Lebens. Sie konnte annehmen oder ablehnen, so oder so würde es eine radikale Veränderung bedeuten. Tausende Dinge gingen ihr durch den Kopf und dabei wanderte sie wie im Traum über das Campusgelände.
Zu Hause angekommen war sie ihrer Entscheidung keinen Schritt näher. Die Wohnungstür fiel hinter ihr ins Schloss und sofort griff sie zum Tablet, um die beiden Personen anzurufen, die seit ihrer Kindheit ihre Stützpfeiler in allen Lebenslagen gewesen waren. Innerhalb von zehn Sekunden sah sie am Splitscreen zwei freundliche Gesichter. Eines davon war das von Andrea, hinter der die nächtliche Skyline von Manhattan zu sehen war. Sie war vor drei Jahren ausgewandert, arbeitete in der Redaktion eines wissenschaftlichen Verlages im Großraum New York und teilte sich ihr Apartment mit ihrem Freund und vier Katzen. Zwei davon versuchten recht stürmisch die Oberhand über das Tablet zu bekommen.
Rechts von ihr sah sie Lena, die gerade in ihrem Garten saß und die Sonne genoss.
»Ich komme gerade vom seltsamsten Gespräch meines Lebens«, eröffnete Stephanie und schon sprudelte alles über das Gespräch mit Labner aus ihr heraus.
Andrea unterbrach sie nach einer Weile: »Der Typ macht mir Angst, gibt es irgendwas, das er nicht über dich weiß?«
»Die Frage stelle ich mir auch. Aber was soll’s, sein Angebot ist unglaublich!«, rief Stephanie.
»So unglaublich, dass du alle Bedenken über sein Eindringen in dein Privatleben beiseiteschieben willst?«, hakte Lena nach.
Kurz überlegte sie und nickte: »Er hat mir angeboten, eine Projektgruppe für eine völlig neue, revolutionäre Technologie zu übernehmen. Seit Jahren arbeitet er mit zig anderen Labors und Universitäten daran, Nanoroboter zur Marktreife zu bringen. Und jetzt scheint es so weit zu sein! Er will, dass ich das Team leite, das die Maschinen auf Marktreife prüft.«
Lena sah sie fragend an. »Was sind Nanoroboter?«
Bevor Stephanie überlegen konnte, wie sie das Thema in einfache Worte fassen konnte, sprang Andrea in die Bresche: »Das kann ich als populärwissenschaftliche Redakteurin sicher besser erklären als unsere liebe Akademikerin. Einfach gesagt handelt es sich bei Nanorobotern um mikroskopisch kleine autonome Maschinen, die dazu dienen, Arbeiten in einem vordefinierten Aufgabengebiet zu erledigen. Zu Beginn wollte man Roboter in der Größe von Blutkörperchen entwickeln, um mit deren Hilfe Krebszellen zielgerichtet anzugreifen oder Medikamente an den genauen Wirkungsort zu bringen.«
Lenas Blick zeigte Skepsis. »Ernsthaft? Ihr wollt Menschen Miniroboter einflößen?«
Andrea schüttelte den Kopf. »Das war die ursprüngliche Idee, doch bis heute ist nichts daraus geworden. Die Steuerung ist problematisch. Um autonom auf alle Herausforderungen reagieren zu können, benötigen die Maschinen ein hochkomplexes Steuersystem, das bei so geringen Baugrößen keinen Platz hat.«
Stephanie war überrascht, wie schnell Lena den Ausführungen folgen konnte, denn schon kam das nächste Problem zur Sprache: »Für mich klingt das nicht wie ein Produkt, das bald Marktreife erreicht.«
»Das kannst du laut sagen«, antwortete Andrea. »Seit zehn Jahren gibt es Ansätze, den Begriff Nanomaschine neu zu definieren und weiter zu fassen. Zuletzt hörte ich von Maschinen in der Größe von Stecknadelköpfen, die alle notwendigen Merkmale einer Nanomaschine umfassen sollen. Aber das ist bisher reine Theorie und weit von der Praxistauglichkeit entfernt.«
Jetzt war Stephanies Moment gekommen und sie grinste die beiden an. »Es ist keine Theorie. Labner und seine Kollegen haben ihr Ziel erreicht und funktionierende Nanoroboter entwickelt. Sie haben massive Unterstützung von einem japanischen Technologiekonzern bekommen, der Geld ohne Ende in das Projekt gestopft hat. Die Entwicklungszeit dauert bereits über zwanzig Jahre. Entweder die Nanoroboter erreichen jetzt endlich Marktreife oder der Geldhahn wird abgedreht.«
Andrea wirkte nach wie vor argwöhnisch. »Häschen, bitte verstehe das nicht falsch. Sollte das stimmen, ist es die größte technische Revolution seit der Erfindung des Wagenrades. Aber warum lässt ein honoriger, wenn auch größenwahnsinniger Professor so eine Entwicklung von Studierenden testen?«
Dieselbe Frage beschäftigte Stephanie auch und flammte immer wieder in ihrem Kopf auf. »Es gibt ein gutes Dutzend Testgruppen weltweit. So wie es mir Labner erklärt hat, braucht er unverbrauchte Geister, um sich des Themas anzunehmen.«
»Oder unverbrauchte Gesichter, denen er die Schuld für einen etwaigen Fehlschlag zuschieben kann«, warf Lena ein und Stephanie musste sich eingestehen, dass ihr dieser Gedanke auch schon gekommen war.
»Ich kann zwischen Pest und Cholera wählen. Entweder ich hänge meine akademische Karriere jetzt gleich an den Nagel oder ich nehme die Herausforderung an und versuche sie zu stemmen. Funktioniert es, wird Labner die meisten Lorbeeren einheimsen und mein Name in der zweiten oder dritten Reihe stehen. Aber ich habe dann mein Abschlussdiplom und an der größten technischen Revolution der letzten Jahrzehnte mitgearbeitet. Dann kann ich mir aussuchen, wo ich arbeiten will. Geht das Ganze in die Hose, bin ich dort, wo ich heute schon bin: am Ende.«
Sie diskutierten über eine Stunde, doch Stephanie hatte ihre Entscheidung bereits getroffen.
8
PRESSEMELDUNG 1
Programmierbare Materie wird marktreif
Forscher des MIT (Massachusetts Institute for Technology), des Tokyo Institute of Technology, der Hongkong University of Science and Technology, der Technischen Universität Wien und der Robotics University of Singapur haben in einem internationalen Projekt, unterstützt von namhaften Technologieunternehmen, erfolgreich Nanoroboter zu einem Verbund zusammengeführt. Diese sogenannte programmierbare Materie kann eingeschränkt logische Operationen durchführen, ähnlich denen von einfachen Rechnern, und so unterschiedliche vordefinierte Formen annehmen.
Die Grundlage für diese Nanoroboter kommt aus der Medizintechnik. Vor allem in der Krebsforschung wird bereits seit dem Jahr 2000 mit Nanorobotern experimentiert, um neue Therapieformen anbieten zu können. Im ersten Schritt können die Nanoroboter die Form starrer Werkzeuge einnehmen.
»Die Nanoroboter können in unter einer Minute bereits Hämmer, Meißel, Schraubenzieher und Ähnliches formen«, so Professor Dr. Dipl.-Ing. Mark Foster. Laut Dr. Foster sind die Roboter jedoch noch zu weitaus mehr fähig. »Das war bloß der erste Schritt. In weiterer Folge müssen wir die Software und Algorithmen verbessern, damit wir komplexere Systeme formen können.«
Revolution in der Werkzeugtechnik
»Nanoroboter könnten bald in der Lage sein, umfangreiche Programme auszuführen und komplexe Arbeitsschritte selbstständig zu erledigen,« erklärt Dr. Dr. Ing. Daniel Labner.
Er und seine Kollegen erschufen die Nanoroboter, indem sie verschiedene Erkenntnisse der Robotik, Medizintechnik und Biologie nutzten. Die größte Herausforderung sei derzeit die eingeschränkte Rechenkapazität der einzelnen Nanoroboter.
»Um eine bestimmte Schwelle zu überschreiten, gibt es unterschiedliche Ansätze, die wir erforschen. Auf der einen Seite gibt es wichtige Erkenntnisse der Schwarmintelligenzforschung, zum anderen die Überlegung, aufwendige Rechenprozesse an eine externe Steuereinheit zu übergeben.«
Derzeit ist die Herstellung der Nanoroboter kostspielig und der Einsatzbereich eingeschränkt. Das Team um Labner ist jedoch zuversichtlich, diese Probleme in naher Zukunft lösen zu können. Die Roboter sollen flexibel genug werden, um alle erdenklichen Einsatzbereiche abzudecken. Laut Gerhard Machele, Leiter der Usability Gruppe, könnten erste Produkte innerhalb der nächsten zwölf Monate in den Handel gelangen.
9
STEPHANIE • 2031
Inzwischen war es zu einer Tradition geworden, dass sich Stephanie mit einer kleinen Gruppe an Studierenden jeden zweiten Freitagabend im Campus-Café traf. Es lag auf halbem Weg zwischen der Bibliothek und dem Hauptgebäude, unmittelbar neben den Eingängen der zwei größten Vorlesungssäle und mit Blick entlang der U-Bahn-Trasse bis zum See, der dem Stadtgebiet seinen Namen gab. Für die meisten Studierenden und Lehrkräfte war das Café ein zweites Wohnzimmer. Auf der einen Seite gab es bequeme Sitzecken, Sofas und Loungestühle, die dazu einluden, den ganzen Tag hier zu verbringen. Auf der anderen Seite standen lange Holztische inmitten Dutzender kleinerer, die zwei oder vier Gästen Platz boten. Jeder fand hier seinen Rückzugsort. Sie saßen oft hier und unterhielten sich über Projekte, meckerten über Vortragende und kommentierten aktuelle Filme und Serien.
In unterschiedlichen Konstellationen hatten sie in den letzten Jahren mit Miriam, Ayaz, Ralph und Steven gelernt oder gearbeitet. Daraus waren vier kleine Applikationen entstanden, die einigermaßen erfolgreich in den diversen App-Stores angeboten wurden. Sie hatten viel gewollt, doch bisher nur wenig erreicht. Ähnlich verlief es bei ihren jeweiligen Studien. Sie waren nicht erfolglos und bestanden ihre Prüfungen, erreichten aber bestenfalls Durchschnittsleistungen. Sie schwammen in der Masse mit und wären wohl irgendwann in gut bezahlten Jobs gelandet, kleine Arbeiterameisen, die erfolgreicheren Menschen folgen mussten. Alle waren sich bewusst, dass sie sehr schnell viel mehr erreicht hätten, wenn sie ausreichend Zeit ins Lernen oder die Entwicklungsarbeit investiert hätten. Was ihnen fehlte, war der Ansporn.
Stephanie war die Letzte, die an diesem Abend an den Tisch kam, und unterbrach die laufende Diskussion über die einundzwanzigste Staffel von The Walking Dead.
»Ich muss bis Montag ein Team für Labner zusammenstellen«, sagte sie statt einer Begrüßung.
Die ganze Gruppe war verblüfft und starrte sie stumm und mit fragendem Blick an. Steven war der Erste, der die richtigen Worte fand. »Was zahlt er?«
Ohne Stephanie eine Chance zur Antwort zu geben, übernahm Miriam und imitierte Labners emotionslose Stimme. »Ruhm und Ehre, Herr Chen. Sie dürfen sich im Glanz meiner Genialität sonnen und später in Ihrem Lebenslauf darauf hinweisen, für den schleimigsten Kotzbrocken der Universität Sklavendienste erbracht zu haben.«
Die ganze Gruppe lachte lauthals los und Miriam setzte noch einen drauf. »Für einen Doktor Doktor Diplom Ingenieur tätig sein zu dürfen ist Bezahlung genug! Geld würde dieses Erlebnis schmälern.«
Nachdem sie sich wieder gefasst hatten, stellte Ralph die Frage, auf die alle bereits warteten. »Was genau sollen wir für den alten Sack machen?«
»Der alte Sack hat mich zur Testleiterin für sein neuestes Spielzeug ernannt«, antwortete Stephanie. »Labner hat von Tokida Industries drei fertige Nanotools zum Testen bekommen. Sie basieren auf seiner Grundlagenforschung, die er gemeinsam mit der Universität an Tokida verkauft hat.«
Stephanie wusste seit langem, dass die Universität mit dem Konzern kooperierte und alle Labors und Werkstätten mit Tokida-Werkzeugen bestückt waren. Sie nahm an, dass dies den anderen auch schon aufgefallen war. Stephanie kam nicht dazu weiterzureden, denn Steven fasste den Blick der anderen in Worte: »Verarsch jemand anderen, liebste Stephanie.«
Stephanie, die von ihren Freunden als die Ruhige, manchmal geradezu Lethargische, in der Gruppe gesehen wurde, strahlte in diesem Moment über das ganze Gesicht. »Kein Scherz! Labner hat mich zur Testgruppenleiterin ernannt. Bis Montagmorgen muss ich ihm mein Kernteam nennen. Reichtum wartet nicht auf uns, aber immerhin bekommen wir dieselbe Vergütung wie seine Laborassistenten. Dazu winkt uns für die Dauer der Zuteilung die Freistellung von den Lehrveranstaltungen und Prüfungsverpflichtungen. Selbst die Studiengebühren übernimmt seine Abteilung.« Kurz pausierte sie, um Luft zu holen und damit die anderen das Gesagte sacken lassen konnten. Dann fuhr sie fort: »Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht. Ich will euch in meinem Team haben. Niemand anderem vertraue ich so wie euch. Gemeinsam können wir das schaffen! Was sagt ihr dazu?«
10
RALPH • ERINNERUNGEN 2031
Das Produkt, das uns vorlag, war ein Vorserienmodell, dessen Marktstart bereits zwei Monate später erfolgen sollte, um sicherzustellen, dass es das erste kommerzielle Produkt dieser Art am Markt war. Ohne Stephanies Kontakt zu Doktor Labner wären wir nie in die Nähe des sogenannten MultiTools gekommen. Das Institut für Robotik in Wien war die einzige Testgruppe mit akademischem Hintergrund und entsprechender Laborausrüstung. Bei allen anderen handelte es sich um Unternehmen, die am Betatestprogramm teilnahmen. Das war unsere Chance! Wir spürten ein Lodern der Begeisterung in uns. Bedenken gab es zu diesem Zeitpunkt keine. Wir waren gierig auf die Perspektive, die sich uns bot. Wir würden Teil der technologischen Revolution sein und sahen uns bereits in die Geschichte der Wissenschaft eingehen.
Der Einführung folgten drei Tage mit juristischen und fachlichen Belehrungen. Parallel dazu mussten wir auf die Ergebnisse unserer Sicherheitsüberprüfung warten. Ich fühlte mich wie der Herr der Welt – ein Student in einer gesicherten Laboranlage, dem alle Ressourcen in unbegrenztem Ausmaß zur Verfügung standen. So lange wir die Testergebnisse rechtzeitig ablieferten, bekamen wir alles, wonach wir verlangten. Unsere Kerngruppe ergänzten fünf weitere Studierende. Sie führten vor allem die Material- und Langzeittests durch. Uns kam es zwar seltsam vor, einen Langzeittest in sechs Wochen durchzuführen, doch wir blieben zuversichtlich. Wir erledigten das Geforderte und redeten uns selbst ein, wissenschaftlich korrekt zu arbeiten.
Das Hauptaugenmerk galt zuerst der Hardware. Sie schien solide gebaut zu sein und auch den Materialtest bestand das Tool mit Bravour. Wir legten den Fokus auf die Bohrfunktion, da diese die größte Belastung für das Werkzeug bedeutete. Versuche auf Metall, Granit und Stahlbeton zeigten keinerlei Materialermüdung. Weder Hitze noch Kälte oder Widerstand konnten die Nanoroboter stoppen. Sie bohrten, hämmerten und zertrümmerten jedes Material – es war der Traum jedes Handwerkers. Die ersten Zweifel kamen uns erst nach dem achtundvierzigstündigen Dauertest.
11
STEPHANIE • 2031
Die Besprechungsräume für die Laboranten lagen am Ende des schmucklosen Ganges, der die Verwaltungsbüros im achten Stock vom Forschungstrakt trennte. Jeden Tag führte ihr Weg unzählige Male durch den tristen Gang, in dem jeder Schritt am schlammbraunen Linoleumboden quietschte. Obwohl sie in den letzten achtundvierzig Stunden kaum Schlaf gefunden hatte, fand Stephanie sich zusammen mit dem Rest des Teams am frühen Morgen in jenem kleinen Besprechungsraum ein, der ihnen für die Dauer des Projektes zugewiesen worden war. An einer Wand hing ein Siebzig-Zoll-Monitor, auf dem Formeln und Zahlenfolgen angezeigt wurden. Das Team saß um den Tisch versammelt und Stephanie stand vor den Displays und starrte auf die Zahlenreihen. Sie kämpfte gegen die Müdigkeit an und unterdrückte ihr Gähnen, um stark zu wirken.
Seit Beginn des Projektes verbrachten sie und ihr Team Unmengen an Zeit in den Labors und Büros. Ganze Nächte und Wochenenden flossen in Testläufe und Auswertungen. Oft endeten Treffen, die am Freitagnachmittag angesetzt waren, erst am Sonntagabend. Dazwischen verlor sie jegliches Zeitgefühl und bekam von der Welt um sich herum nichts mit. Stephanie schwamm auf einer Welle der Euphorie.
Während Miriam, Ayaz und Steven das Wochenende damit verbracht hatten, den lang geplanten Dauertest durchzuführen, hatte Stephanie sich mit Ralph in ihre Wohnung zurückgezogen und die vergangenen sechsunddreißig Stunden an der Optimierung der Berichte und Auswertungen gearbeitet. Sie musste lächeln, als sie an den heutigen Morgen dachte.
Mit einer dampfenden Kaffeetasse in der Hand hatte sie am Fenster ihrer Wohnung gestanden und Ralph war von hinten an sie herangetreten. In der Fensterscheibe hatte sich sein Lächeln gespiegelt, als er seine Arme zärtlich um sie gelegt und ihr ins Ohr geflüstert hatte.
»Dieses Wochenende hätten die apokalyptischen Reiter durch Wien ziehen können, ohne dass wir es mitbekommen hätten.«
Noch immer spürte sie seine Hände an den Hüften, seinen Atem im Nacken und wieder strömte dieses angenehme, warme Gefühl durch ihren Körper – Sicherheit, Geborgenheit, weit weg von den Sorgen und Belastungen des Alltags. Stephanie kannte Ralph nun seit achtzehn Monaten und hatte die letzten Wochen mehr Zeit mit ihm verbracht als mit allen anderen. Für einen Moment drohte sie, in den Gedanken an ihn zu versinken. Sie zwang sich, sich auf die Herausforderungen zu konzentrieren, die vor ihr lagen. Sie wandte sich um und musterte ihr Team.
»Müssen wir uns Sorgen machen?«, fragte sie Steven.
Unter seinen Augen zeichneten sich tiefe Ringe ab. Drei leere Red-Bull-Dosen standen vor ihm, eine weitere umfasste er mit zittriger Hand und neben seinen Unterlagen standen zwei weitere bereit. Es war das Bild eines Menschen, der das ganze Wochenende durchgearbeitet hatte.
Er grinste und sagte: »Ich werde es überleben. Noch einmal ziehe ich allerdings keinen Achtundvierzig-Stunden-Test durch. Da ich allerdings annehme, dass sich deine Frage nicht auf meinen Zustand bezieht, lautet die Antwort: Frag mich was Leichteres.«
Steven tippte auf das Tablet vor sich. Am Monitor erschien eine Grafik, auf der eine stetig fallende Linie zu erkennen war. Ein langes Gähnen hielt ihn davon ab weiterzusprechen und er wedelte mit der Hand in Miriams Richtung, die nahtlos übernahm.
»Unser Testobjekt war ein Nanobohrkopf, mit dem wir auf einen Doppel-T-Träger aus gehärtetem Stahl losgegangen sind. In vierundzwanzig Stunden Dauerbetrieb hat das Werkzeug rund ein Prozent an Masse verloren.« Sie deutete auf das Tablet. »Diese Linie zeigt den Gewichtsverlust des Tools während der Testperiode. Da ein Bohrkopf zwanzig Prozent der Gesamtmasse des Nanoblockes benötigt, kommen wir theoretisch auf zwölftausend Betriebsstunden, bevor alle Nanobots aufgebraucht sind. In der Praxis werden es wahrscheinlich acht- bis neuntausend sein. Soweit wir bisher wissen, verlieren die Nanoblöcke beim Unterschreiten von siebzig Prozent ihrer Anfangsmasse die Funktionalität.«
Steven startete ein Zeitraffervideo auf dem Tablet. In zwei Minuten sahen sie den gesamten Testablauf. Der Roboterarm presste den Bohrer an den Stahlträger, zog ihn wieder heraus und setzte ihn wenige Zentimeter daneben wieder an. Das passierte zehnmal pro Stunde, also vierhundertsiebenundsiebzig Mal in achtundvierzig Stunden.
»Nach dreißig Stunden mussten wir pausieren«, kommentierte Steven. »Da ist die Bohrmaschine durchgebrannt. Der Nanobohrkopf hatte zu diesem Zeitpunkt eine Temperatur von nur vierzig Grad. Von dieser Seite her ist der Test ein voller Erfolg gewesen.«
Ralph sah ihn skeptisch an. »Von dieser Seite her?«
Einem langen Zug aus der Energydrink-Dose folgte ein lautes Seufzen. »Dass defekte Nanobots ausgeschieden werden, war uns von Anfang an bekannt. Jetzt wissen wir, in welcher Größenordnung sich der Ausfall bewegt.«
Unruhe keimte in Stephanie auf. »Ich höre ein großes Aber auf uns zukommen.«
»Jep. Das Aber gilt den ausgeschiedenen Bots«, sagte Steven.
Eine neue Grafik erschien am Monitor und Miriam übernahm wieder das Reden. »Rings um den Bohrkopf herum ist ein Auffanggehäuse mit Absaugung angebracht, um die defekten Nanobots zu sammeln. Das hat gut funktioniert. Unsere abschließende Gewichtsmessung hat ergeben, dass wir neunundneunzig Komma fünf Prozent der Bots auffangen können. Die Überraschung kam bei den weiteren Untersuchungen.«
Miriam tippte auf ihr Tablet und ein weiteres Video wurde eingeblendet. »Die ausgeschiedenen Roboter haben weiterhin elektrische Aktivität gezeigt. Unter dem Mikroskop haben wir erkannt, dass nicht alle funktionsuntüchtig werden. Mit einer App haben wir unsere Beobachtungen ausgewertet. Der Balken am linken Rand zeigt die Menge der insgesamt ausgefallenen Bots, die Linie auf der Zeitachse zeigt, wie viele davon aktiv geblieben sind. In der Mitte seht ihr ein Video der ausgeschiedenen Bots unter dem Mikroskop.«
Miriam startete das Video. Zuerst zeigte es nur eine graue Fläche. Erst nach und nach waren unzählige kleine Würfel zu erkennen. Die Linie auf der Zeitachse blieb am Nullpunkt. Nach einigen Sekunden kam es vereinzelt zu Bewegungen. Parallel dazu zeigte die Linie eine Aufwärtsbewegung. Zuerst stieg sie langsam, dann immer schneller. Die Nanoroboter bewegten sich, teils zielstrebig, teils ungelenk aufeinander zu. Das Bild wirkte durch die schnellen Bewegungen immer unschärfer, die Linie stieg weiter an. Schließlich stoppte das Video.
Stephanies Gedanken rasten. Das konnte, das durfte nicht sein.
»Wisst ihr, was das bedeutet?«, keuchte sie.
Alle nickten.
Miriam antwortete: »Noch liegt kein endgültiges Ergebnis vor, wir müssen den Nanoabfall der letzten zwölf Teststunden erst analysieren. Die ersten Hochrechnungen zeigen aber bereits, dass ein Drittel der ausgeschiedenen Nanoroboter in unterschiedlichen Stufen funktioniert. Das geht vom Aussenden elektrischer Impulse bis zur Fähigkeit, sich zu bewegen.«
»Wie lange bleiben sie funktionsfähig?«, fragte Stephanie und sank in einen der freien Stühle, um zu verhindern, dass ihre Knie nachgaben.
»Das lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Aktuell beobachten wir vier Nanohaufen, um herauszufinden, ob sie weiterhin aktiv bleiben oder irgendwann komplett ausfallen.«
Stephanies Blick wanderte von einem zum anderen. Sie brauchte Zeit, um sich wieder zu fassen und wieder Herrin der Lage zu werden. Magensäure stieg die Speiseröhre hoch und sie kämpfte die aufkeimende Übelkeit nieder.
Sie schluckte und sagte: »Bei uns im Labor ist es nicht weiter schlimm. Wir fangen die Reste auf und vernichten sie. Aber was machen die Endkunden, die mit dem Nanowerkzeug arbeiten, ohne sich Gedanken darüber zu machen? Was passiert, wenn die Nanobots unkontrolliert in die Umwelt kommen?« Ihre Schultern zitterten sichtlich. Wir können die Tragweite der Ergebnisse noch nicht abschätzen. Im besten Fall kommen auch die neunundzwanzig Prozent zum Stillstand und werden zu bedeutungslosen Metallpartikeln. Ich hoffe, dass sie in der kurzen Zeit, die ihre Batterien halten, nicht allzu viel Unheil anrichten können, selbst wenn sie funktionsfähig bleiben.«
Stephanie versuchte, ruhig zu bleiben und souverän zu wirken. Sie wandte sich an Ayaz, bei dem sich ebenfalls die Spuren der letzten Wochen zeigten.
»Wie sieht es mit der Steuerung aus?«, fragte sie.
Ayaz hatte einige Kilos abgenommen, seine Hose saß locker um die Hüften und der Gürtel war bis zum Anschlag zugezogen. Die sonst zurückgegelten Haare standen ihm ungewaschen vom Kopf ab. Seine Augen wirkten müde, die Schultern hingen herunter und das fleckige T-Shirt, das er seit zwei Tagen nicht gewechselt hatte, tat sein Übriges zum Gesamteindruck. Langsam griff er zum Stapel eng bedruckter Bögen, die vor ihm am Tisch lagen, runzelte die Stirn und sah in die Runde.
»Kurzgefasst: Die Software ist im besten Fall ein hochpreisiger Scherzartikel«, sagte er. »Wir haben den Programmcode in den letzten Tagen auseinandergenommen. Ich persönlich denke, dass die Entwickler von Tokida weniger vom Softwareprogrammieren verstehen als ein Zehnjähriger. Die jährliche Nutzungsgebühr von fünfhundertfünfzig Euro, die Benutzer für das Software-Abo zahlen sollen, sind Wucher. Ich frage mich auch, ob die eingeschränkten Bedienungsmöglichkeiten eine Marketingentscheidung sind oder ob sie an der Unfähigkeit der Programmierer liegen. Sie werden dem Potenzial des Tools bei weitem nicht gerecht.«
Ralph stimmte Ayaz zu. »Der Code wirkt wie von jemandem ohne Ausbildung mit der Hilfe eines Handbuches und gegoogelter Befehlszeilen zusammengestöpselt. Es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen, nicht einmal die Kommunikation mit den Nanomaschinen ist verschlüsselt. Jeder Schüler, der halbwegs hacken kann, schafft es, sich unter Zuhilfenahme von ein oder zwei legal kaufbaren Apps in die Kommunikation zwischen Controller und Hardware einzuklinken. Das ist keine ungesicherte Backdoor, sondern ein weit geöffnetes Hangar-Tor mit Hinweistafeln.«
Ayaz setzte einen drauf und sagte: »Niemand im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte wird das kaufen.«
»Ein Bericht, in dem wir das alles festhalten, wäre das Ende des Nanotools, noch bevor es auf den Markt kommt«, stellte Miriam fest. »Mal ehrlich, unsere Testergebnisse sehen aus, als würde uns ein erster Prototyp vorliegen.«
Ayaz fasste das, was alle dachten, in Worte: »Das Ding ist von einer Marktreife so weit entfernt wie die Erde vom nächsten bewohnbaren Planeten.«
Erneut senkte sich Stille über den Raum. Stephanie war bewusst, was ihre Ergebnisse auslösen würden, wenn sie diese bekannt machen würden. Sie nahm sich Zeit, um ihre Gedanken zu sortieren, und sagte dann gerade heraus: »Wenn wir ihm diese Ergebnisse vorsetzen, nagelt uns Labner an die Wand, zerstückelt uns und begräbt uns in der tiefsten Grube, die er finden kann. Einen Universitätsabschluss wird dann keiner von uns bekommen. Wir machen ihn und sein gesamtes Forschungsteam zur Lachnummer, ganz zu schweigen von seinem Auftraggeber Tokida.«
Miriam ballte die Hand zur Faust und reckte sie in die Luft. »Lasst mich mal zusammenfassen: Die Steuerungsapp ist unausgereift.« Sie streckte den Daumen aus. »Die interne Software weist gewaltige Sicherheitslücken auf, vor allem in den Kommunikations- und Steuerprotokollen. Der Funktionsumfang ist lächerlich, jeder fünfzig Euro teure Werkzeugkoffer vom Diskonter kann mehr.« Es folgten Zeige- und Mittelfinger. »Dazu kommt der undokumentierte Schwund von Nanopartikeln kombiniert mit der Erkenntnis, dass die abgestoßenen Nanobots teilweise funktionstüchtig bleiben.« Nun waren alle fünf Finger ausgestreckt und Miriams flache Hand klatschte auf die Tischplatte. »Das allein reicht, um das MultiTool zum Sicherheitsrisiko für Nutzer und Umwelt zu machen. Was wollen wir tun? Killen wir das Projekt und unsere akademische Zukunft gleich oder warten wir bis Montag?«
Bei diesen Worten zuckte Stephanie wie vom Blitz getroffen zusammen und schüttelte den Kopf. »Das ist für mich keine Option. Egal, was wir von Labner halten, er hat überall Kontakte. Es wäre nicht nur das Ende unserer akademischen, sondern auch unserer beruflichen Laufbahn. Ich bastle gerne, doch den Rest meines Lebens Fahrräder zu reparieren, entspricht nicht meiner Lebensplanung.«
Für einen Moment waren alle still, dann ergriff Ralph das Wort: »Wir könnten unsere Verbesserungsvorschläge auch an Tokida verkaufen.«
12
STEPHANIE • 2031
»Und, habt ihr schon mehr herausgefunden? Ist das Nanowerkzeug wirklich ein Rohrkrepierer?«, fragte Andrea mit besorgtem Blick.
In den letzten Tagen hatte Stephanie fast täglich per Videoanruf mit ihr gesprochen. Sie half Stephanie, die Ereignisse zu verarbeiten, und von Tag zu Tag wurde die wachsende Skepsis in Andreas Fragen spürbar.
Stephanie nickte zur Bestätigung und antwortete: »Ja und nein. Teile unserer bisherigen Tests lassen darauf schließen, dass nicht alles so ausgereift ist, wie es sein sollte. Die Nanoroboter funktionieren wie beschrieben …«
»Mach mal halblang«, unterbrach sie Andrea. »Funktionalität klingt anders. Habt ihr darüber nachgedacht, welche verborgenen Gefahren noch in den Nanobots stecken könnten?«
Wie so oft in den letzten Tagen spürte Stephanie wieder Unbehagen. Irgendetwas stimmte nicht, da musste sie Andrea zustimmen. Es war wie ein unangenehmer Geruch, den sie nicht zuordnen konnte.
Andrea schüttelte den Kopf und sprach weiter: »Dir ist klar, dass die Dinger ein Sicherheitsrisiko darstellen? Und dass es zum Himmel stinkt, dass Tokida