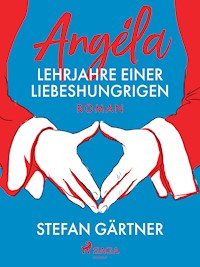
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Überleben ist alles – dies ist das Motto des kleinen Königreichs Transelbanien, welches von Erik dem Spitzen regiert wird. Die Rettung: die Vermählung der Tochter des loyalen Marquis de Fromageur mit dem Grafen de la Mairie. Angéla beugt sich ihrem Schicksal in der Hoffnung, das Königreich zu retten, doch als ihr eines Tages der herrische, aber elegante Marechal Joaquin de la Rotz begegnet, beschließt die junge Marquise ihrer großen Liebe an den Hof von König Elmûmt dem Dicken zu folgen. Bald nimmt sie am Kampf um seine Nachfolge teil und nutzt ihren weiblichen Charme, um sich die Männer gefügig zu machen. Hemmungslos, bezirzend und mit jeder Menge Witz zieht Angéla die Fäden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Gärtner
Angéla – Lehrjahre einer Liebeshungrigen
Ein erotisch-historischer Schelminnenroman
Saga
Angéla – Lehrjahre einer Liebeshungrigen
Coverimage/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2013, 2022 Stefan Gärtner und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728438763
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Merci beaucoup:
Matthias Bischoff, Aenne Glienke, Gunnar Homann,
Hans Leuschner, Ulrike Leuschner, Oliver Nagel,
Birgit Staniewski.
Pour Anna, comme tout.
O my friend! Did I not know how much you despise prudery; and that you are too young, and too lovely, to be a prude ...
Miss Howe an Miss Clarissa Harlowe, 19. März [1747]
»Was wollt Ihr?«, fragte sie unsicher. »Ich habe so viel zu tun ...«
»Was, zum Teufel, kann eine Frau anderes zu tun haben, als zu lieben?«
Anne Golon, 1959
Erster Jeil
Das grane Land
Erstes Kapitel
in dem ein König Kinder isst, eine Marquise nicht ins Gefängnis will, ein Haushaltsvorstand einen Russen kauft und eine Dame viel Spaß hat
Jetzt sag schon, Valerie«, quengelte Ebi und hielt sein Steckenpferd im Zaum. »Warum isst König Erik so gern kleine Kinder? Erzähl es uns!«
»Weil sie ihm so gut schmecken, ihr Nervensägen, was dachtet ihr?«, antwortete Valerie Potaufeu und rührte energisch im Suppenkessel, und Angéla, die mit Rapunzel, ihrer kleinen Schwester, beim Feuer auf dem Boden saß, glaubte zu sehen, wie ein Schweißtropfen von Valeries Nase in den Eintopf fiel. Angéla kannte diese Gruselgeschichten zur Genüge, und obwohl sie bereits zwölf war und wusste, dass Erik der Spitze Kinder aß, mit Soße, Kartoffeln und Kompott, überlief sie ein Schauer, wenn die Köchin, den Betteleien der Kinder nur allzu willig nachgebend, mit furchterregender Selbstverständlichkeit (und, wie Angéla zu merken groß genug war, erheblichem Vergnügen) eine neue oder nicht so neue Untat des Königs zum Besten gab.
Mit vor Angst geweiteten Augen klammerte sich Rapunzel an ihre Puppe und rückte an die große Schwester heran, und Ebi, der kleine Bruder, stand starr wie ein Zinnsoldat.
»Auf seiner Burg«, rührte Valerie weiter, »gibt es einen Keller, in dem ein riesiger Fleischwolf steht. Da lässt Erik die kleinen Kinder, die er tagsüber hat einfangen lassen, schlachten und zu Wurst verarbeiten. Und wenn er einen Staatsbesuch hat, dann gibt es Wurst, Wurst und noch einmal Wurst! Eine Wurstsuppe oder einen Wurstsalat vorweg, ein Wurstgulasch als Hauptgang und zum Nachtisch einen Blutwurstpudding! Und manchmal«, die Köchin unterbrach ihr Rühren und vergab einen strengen, geradezu vorwurfsvollen Blick, »beißen die Gäste auf etwas Hartes. Sie glauben erst, es ist ein Stück Knorpel. Die meisten schlucken es einfach hinunter, denn es sind feine Herrschaften, die wissen, dass es sich nicht geziemt, etwas auszuspucken, auf dem man bereits herumgekaut hat. Aber manche nehmen die Serviette an den Mund und lassen den Knorpel darin verschwinden; und wenn sie aber nachsehen, was sich da in die ihnen aufgetischte Wurst geschlichen hat, dann sehen sie – dann erkennen sie ...«
»Was?«, brach es aus Ebi heraus, und die kleine Rapunzel ließ, sei’s aus Erschrockenheit über den Schrei des Bruders, sei’s aus Angst vor der Auflösung, die Valerie so grausam verzögerte, ihre Puppe fallen und schlang die Ärmchen um Angéla.
»... dass es eine kleine Murmel ist. Denn beim Murmelspiel«, die Köchin betonte jede Silbe einzeln, schlug am Kesselrand den Löffel aus, legte ihn beiseite und wischte sich die Hände an der Schürze ab, »lassen sich die Kinder ... besonders gut einfangen!« Bei den letzten Worten hatte Valerie einen Satz gemacht, und jetzt jagte sie, einem Kinderfänger Eriks gleich, mit ausgebreiteten Armen die vor Angst und Ausgelassenheit kreischenden Kinder durch die Küche von Schloss Templin.
»Kinder! Valerie!«
Die Marquise de Fromageur hatte die Küche betreten und musste sich hörbar Mühe geben, empört zu klingen; tatsächlich schien sie eher amüsiert, und wenn sie ungehalten war, dann über Valeries Angewohnheit, die Kinder mit Politik zu behelligen. So stand die Marquise eine Weile in ihrem Hauskleid aus blauer, verblichener Serge, die Hände vor dem Schoß gefaltet, wie ein Standbild ihrer selbst, umtost von ihrem Nachwuchs; Valerie hatte es allerdings für angezeigt gehalten, nach einem raschen, betretenen Knicks an ihre Kochstelle zurückzukehren.
»Hat Valerie euch wieder Geschichten erzählt?«, fragte die Marquise mit gespielter Strenge und etwas weniger gespielter Resignation. Kaum hatte Rapunzel die Mama entdeckt, lief sie mit weit geöffneten Armen auf sie zu und vergrub ihr blondes Köpfchen in den Falten des mütterlichen Kleides, und Angéla, die fürchtete, Rapunzel werde, vom Auftauchen der Mutter erschreckt, doch noch zu weinen beginnen, beeilte sich mit dem Hinweis, Valerie habe gewissermaßen auf Befehl gehandelt.
»Valerie, lass sie doch bitte mit diesem Unsinn in Ruhe«, mahnte die Marquise, eine kleine blonde, unscheinbare Frau, die immer so aussah, als komme sie gerade von der Gartenarbeit.
»Das ist kein Unsinn«, verteidigte sich Valerie vorsichtig. »Die Leute sagen es.«
»Die Leute sagen auch, sie hätten Rübezahl gesehen. Es interessiert mich auch nicht, ob es stimmt oder nicht. Mich interessiert allein, dass die Kinder nicht in einer Besserungsanstalt aufwachsen, weil sie draußen Sachen erzählen, die sie zu Hause aufgeschnappt haben. Und mein Ehrgeiz, die nächsten zwanzig Jahre im Gelben Emil zu verbringen, hält sich in Grenzen.«
Valerie rührte wieder in ihrer Suppe, jetzt nicht mehr nur schuldbewusst, wie Angéla auffiel, sondern tatsächlich ängstlich.
»Gelber Emil«, so nannte das Volk seinen schlimmsten Albtraum von Gefängnis. Aus rotgelbem Ziegel und im äußersten südöstlichen Landeszipfel gelegen, geisterte es durch die Fantasien als Ort ohne Wiederkehr, ewige Hölle und steingewordenes Verhängnis, das jeden traf, der sich über Erik, sein Reich oder seine Beamten lustig machte. Oft reichte es schon, wenn das Porträt Eriks, das jeder Haushalt an prominenter Stelle aufzuhängen hatte, nach dem Staubwischen schief hing und ein Gast, ob missgünstig, rechtschaffen oder bloß aus Angst, ein Mitwisser zu werden, dies zur Anzeige brachte, um den Haushaltsvorstand auf Jahre verschwinden zu lassen. Zwar kannte Angéla niemanden, dem das schon einmal widerfahren war, und als sie ihre Eltern gefragt hatte, ob sie von derlei wüssten und was denn ein Haushaltsvorstand sei, hatte der Vater gesagt, Majestätsbeleidigung sei eben strafbar, und die Mutter, die wie der Vater von jenseits der Westgrenze stammte und ihm nur unwillig ins kleine Königreich Transelbanien gefolgt war, hatte sehr kühl hinzugefügt, ein Haushaltsvorstand sei einer, der nie denselben Fehler einmal mache. Aber auch sie achtete peinlich darauf, dass Emmanuelle, die Hausmagd, beim Reinemachen das Bild des Königs nicht verrückte, und der Marquis hatte von einem durchreisenden Juden sogar eine Wasserwaage erworben, was die Sache aber erst recht kompliziert machte, denn Schloss Templin war, wie in Transelbanien üblich, derart schief und schlampig in die Landschaft gestellt, dass sich der Marquis vor das Dilemma gestellt sah, entweder der Lotrechten oder dem Augenschein stattzugeben. Es war ganz einfach, aber einfach nicht zu machen, und der Marquis, nach Herkunft und Erziehung das Gegenteil eines Transelbaniers, hatte grimmig einsehen müssen, dass er, wollte er ein echter Hiesiger werden, die gute Absicht nicht geringer achten dürfe als das Ergebnis. Er musste das lernen, so schwer es ihm fiel; wo er diesen Schutthaufen von Schloss nun einmal geerbt hatte.
Die Bauern verfolgten seine Kämpfe mit dem milden Vergnügen derjenigen, die ihre Lektion schon gelernt haben. Sie mochten ihn: die königstreuen, weil er freiwillig hier war und es »für unser achtzehntes Jahrhundert erstaunlich fortschrittlich« fand, dass die Bauern bezahlten Urlaub und einen Platz im königlichen Wappen hatten, die unwilligen, weil sie hofften, der Marquis bringe Unruhe, Subversion oder, noch besser, diese Beinkleider aus blauem Baumwollstoff, von denen die Rede ging, dass ganz Europa sie jetzt trage, während man hier schon froh sein musste, wenn es überhaupt Beinkleidung gab.
Auch sprach der Marquis nicht so, wie Eriks Beamte sprachen. Er war ein Mann des klaren Worts, und wenn einer von Eriks Steuereintreibern kam und fragte, ob denn die Steuern schon gezahlt seien, dann druckste er nicht, sondern antwortete geradeheraus mit »ja«, und wenn Angéla in ihrer scheuen, konsensbedachten Art ihn bat, eine Erhöhung des Taschengeldes unter Umständen in Betracht zu ziehen, im selben Ton mit »nein«; versäumte es aber nicht, seine Tochter, die mit gesenktem Kopf die Abfuhr still ertrug, mit dem Hinweis zu trösten, zu kaufen gebe es ja ohnehin nichts, und überhaupt sei die Familienkasse leer.
Und das war die Wahrheit.
Denn das Schloss, zumal in seinem beklagenswerten Zustand, kostete den Marquis mehr, als es ihm als Verwalter der angeschlossenen Staatsdomäne eintrug, weil diese längst nicht das aus Vieh und Boden holte, was schlechterdings möglich gewesen wäre. Das lag, wie der Marquis zwar wusste, aber lieber für sich behielt, an der Faulheit seiner Arbeiter und Bauern, die seinen Anweisungen, sosehr sie ihn persönlich schätzen mochten, nur mürrisch bis achselzuckend nachkamen; und da in Eriks Königreich die Leibstrafen abgeschafft waren (was, wie der Marquis fand, in sonderbarem Gegensatz zu Eriks angeblicher Lust am Kinderverzehr stand), hatte der Marquis de Fromageur keine Handhabe, sondern musste es mit gutem Zureden versuchen. Was aber erst recht nicht funktionierte.
»Aus jedem Taler, jeder Minute, jedem Gramm Vieh einen höheren Nutzeffekt!« Schorsch hatte die Hände so tief in den Taschen seiner Hose vergraben, als wolle er sich am Knie kratzen, und sog sorgsam an seiner Pfeife aus Schkopauer Weichholz. »Isch waas gar net, was des is, aan ›Nutzeffekt‹. Hast du des verstanne, vorhin, die Ansprach vom Scheff?«
»Es wundert mich immer wieder, wie wenig man doch weiß bei euch im Hessischen«, antwortete die dicke Berthe boshaft und legte ihre Patience, als sei sie im Gesinderaum allein. Sie gab sich Mühe, »im Hessischen« wie »im Hässlichen« auszusprechen, denn sie mochte den Knecht, und damit er das nicht merkte, war sie grob zu ihm, was Schorsch, den Zusammenhang witternd, mit sturer Freundlichkeit quittierte. In Hanau, wo er herkam, hatte er Frau und fünf Kinder, Kinder, die hübsch, klug und anstellig waren und also, wie Schorsch gefolgert hatte, unmöglich von ihm sein konnten, weswegen er schließlich ausgewandert war; und wann immer es in der Dorfschenke abends langweilig zu werden begann, imitierte Schorsch den Gesichtsausdruck der transelbanischen Grenzwachen, als er um Einlass und Aufenthalt gebeten hatte. Die Leute konnten nicht genug davon kriegen. Wer kam denn schon freiwillig hierher? Außer hin und wieder ein paar Postkutschenräubern?
»Bei uns dahaam waaß mer ne Menge«, wehrte sich Schorsch vergnügt und ließ behaglich seinen Knaster glühen. »Wie mer Äppler macht un Handkäs un Griee Soß, und wie mer die Leut unnerhalte tut, des wisse mer aach.«
»Unbedingt«, sagte Berthe mit einem Sarkasmus, den sich abzugewöhnen sie sich alle Mühe gab. Eine sarkastische Kinderfrau, wo gab es denn so etwas! »Berthe, hast du Lust, mit uns zu spielen?« – »Und wie. Ich will mir nur rasch die Fußnägel ausreißen!«
Sie legte eine Karte ab und fügte, um einen neutralen Ton bemüht, hinzu: »Hans Schonk, der größte Narr unter der Sonne.«
»Schenk«, verbesserte Schorsch nachsichtig. »Hans Schenk, bidde sehr. Und net Narr, sondern Alleinunnerhalter. Sein Programm ›Der blaue Bock‹ is bei uns Jahrzehnte gelaufe, ohne Unterbreschung, jeden Samstaachabend uffm Marktblatz. Vorher hat der Bock schön Äppler ausm Bembel gekrischt, so lang bis er blau war, und dann isser meckernd un schreiend alls hin und her un is in die Leut und hat zugebisse, und die Leut ham geschrieje un geklatscht, und dann kam der Hans Schenk un hat gesacht, was für ein zauwerhaftes Publikum mir sinn, und ein Lied gesunge von wesche, dass alles net so schlimm is, weil’s ja immä noch viel schlimmä sein könnt.«
»Noch schlimmer«, sagte Berthe, und würde Sarkasmus riechen, sie wären beide ohnmächtig geworden. Doch bevor sie sich über ihre anscheinend unausrottbare (und im Königreich Eriks ja nicht ganz ungefährliche) Neigung hätte ärgern können, stand Angéla in der Tür, die Hände vor dem Schoß gefaltet, wie sie es sich bei der Mutter abgeschaut haben mochte.
Angéla war ein freundliches, aber unscheinbares Kind. Blau schwammen Augen unterm Pony, und Optimisten hätten gefunden, ihr Blick sei halbvoll. Reserve war darin und Rückzug, und für die Vermutung, es sei mehr Sein in Angéla, als der Schein vermuten ließ, sprach zumindest, dass das Gegenteil schlecht möglich war. Sie bewegte sich wie ein Kälbchen, vorsichtig in seiner Neugier und unbeholfen in seiner Vorsicht, und dass ihre stille Traumverlorenheit nicht mit Absenz verwechselt werden durfte, sondern Ausdruck einer Konzentration war, deren Gegenstand nicht immer vor Augen lag, wusste Berthe vom Staaretz Sossenheim, der Angéla unterrichtete und in den höchsten Tönen von seiner Schülerin sprach.
»Noch nie habe ich so ein gelehriges Mädchen unterrichtet!«, pflegte der Geistliche zu prahlen, wobei er verschwieg, dass er zuvor überhaupt noch nie unterrichtet hatte, sondern aus einer Arrestzelle herausgekauft worden war, in der er wegen Zechprellerei, Störung der öffentlichen Ordnung und feindlich-negativer Einstellung zu jeder Art von regulärem Broterwerb gesessen hatte. Die Marquise war vor Missbilligung grün geworden, als ihr Gatte den aufgeschossenen, in einem zerschlissenen schwarzen Gewand steckenden und nach Stroh und Notdurft riechenden Gottesmann zu Hause angeschleppt hatte, und der Marquis hatte seine Verlegenheit hinter einer Barschheit verstecken müssen, für die er sich später schämte.
»Was soll ich denn machen«, war er am Abend zu seiner Frau ins Bett gekrochen. »Wir haben kein Geld, und Angéla braucht eine Ausbildung. Und Sossenheim verlangt bloß freie Kost und Logis.«
»Natürlich braucht das Mädchen eine Ausbildung«, hatte die Marquise geschnaubt. »Ich frage mich allerdings und bitte dich dringend mir zu erklären, was sie von diesem Herrn«, und ohne es zu wissen, gewann die Marquise den gar nicht existenten Kinderfrau-Berthe-Ähnlichkeitswettbewerb, »denn überhaupt lernen soll.«
»Religion«, antwortete der Marquis und wurde rot.
»Religion. Sehr gut. Das klingt, König Eriks tiefe Religiosität vorausgesetzt, nach einer sicheren Zukunft.«
Der Marquis schwieg, weil er wusste, wie recht seine Frau hatte. Seit Eriks Vater, Walter der Bärtige, bei seiner Taufe um ein Haar ertrunken wäre, war Religion zwar nicht verboten, aber doch verpönt. »Unsere Menschen«, pflegte der König in seiner hohen, irgendwie singenden Stimme zu verkünden, »wollen es nicht in einem Jenseits schön haben, das es nicht gibt, sondern heute, und dafür arbeiten sie fleißig und produzieren in hoher Qualität.« In hoher Qualität, dachte der Marquis und hörte Hühner lachen. Unsere Menschen produzieren und arbeiten, als verließen sie sich voll und ganz aufs Paradies.
»...Russisch«, sagte der Marquis trotzig. Dagegen konnte seine Frau schließlich nichts haben, Zar Leonid war Eriks bester Freund, vielleicht würde Angéla ja Diplomatin; oder wenigstens Mätresse.
»Russisch«, wiederholte die Marquise mit einem vorsichtig versöhnlichen Unterton, wobei unklar blieb, ob Einsicht oder bloß Müdigkeit aus ihr sprach. Der Marquis wusste, dass seine Frau König Erik hasste, Zar Leonid hasste, Transelbanien hasste und ihr die Aussicht, die älteste Tochter ausgerechnet Russisch lernen zu lassen, wie die Unterschrift unter ein Urteil vorkommen musste, das da hieß lebenslang; lebenslang bei schlechtem Wasser und den Klumpen, die in Eriks Läden als »Brot« feilgeboten wurden und die man ohne Wurst eigentlich gar nicht essen konnte.
Der Marquis, den Kopf am Bettgestell, stopfte sich das Kissen in den Nacken und faltete die Hände über der Bettdecke.
»Und das eine oder andere wird er ja wohl hoffentlich außerdem wissen, der gute Sossenheim. Staaretz wird man ja nicht einfach so«, sagte er, ohne im Mindesten zu wissen, was man als Staaretz wissen musste und was nicht. Er war sich ja nicht einmal sicher, ob es sich bei Sossenheim überhaupt um einen Staaretz handelte und was ein Staaretz eigentlich war. Den Zweifel verbarg er aber, es war diese Angelegenheit schon delikat genug.
»Lass es uns wenigstens versuchen«, hatte der Marquis schließlich gebeten und seinen Kopf in Richtung Gattin gedreht. Aber die wandte ihrem Mann bereits den Rücken zu.
»Na, mein Kind«, sagte die dicke Berthe und blickte von ihrer Patience hoch. »Unterricht vorbei?«
Angéla nickte vorsichtig, als habe sie geschwänzt und versuche, mit dem kleinsten aller Schwindel durchzukommen.
»Und? Was Schönes gelernt?« Berthe erschrak, weil sie fürchtete, ihre Frage könnte wieder höhnisch geklungen haben, aber weder Schorsch, der still an seiner Pfeife sog, noch das Kind rührten sich, so dass wohl alles in Ordnung war.
Englisch, sagte Angéla. Heute sei Englisch dran gewesen.
»Englisch!«, rief Berthe aus, ohne zu wissen, warum. Sie sprach die Sprache nicht, kannte fast keinen, der sie sprach, und hätte auch nicht gewusst, was selbst damit anfangen. Alles, was Berthe über England wusste, war, dass es am dortigen Königshof sehr munter zuging und dass die Schwiegertochter des Königs das Zeitliche gesegnet hatte, als sie mit ihrer Kutsche gegen einen Baum gefahren war, und in der Kutsche hatte ihr Liebhaber gesessen, ein Orientale mit angeblich 3000 Frauen, und der war ebenfalls gestorben, und der Hofnarr, von dem es hieß, er sei Sodomit, hatte bei der Beerdigung ein Lied über Blumen singen dürfen. So war das in England, und Berthe konnte gut darauf verzichten, die Sprache eines solch verderbten Landes zu beherrschen.
»Oh, Inglisch!« Schorsch zog die Pfeife aus dem Mund und grinste kennerhaft.
Ob er denn etwa Englisch könne, fragte Angéla erstaunt.
»Yes, yes!«, rief Schorsch und tat die Pfeife retour; entnahm sie wieder und deklamierte:
»Ei cän Inglisch werri well, doch es geht noch net so schnell!«
»Was? Was hat er gesagt?« Berthe beunruhigte der Gedanke, dass der Knecht ihr in etwas voraus sein könnte, und sei es nur in einer Sprache, die sie so rundheraus ablehnte wie sein dummes Hessisch.
Schorsch zwinkerte Angéla schmunzelnd zu, und das Mädchen erzählte der Kinderfrau, der Schorsch habe gesagt, er könne genau diesen einen Satz, und der laute übersetzt: Freitag ab eins macht jeder seins. Den Satz hatte ihr Schorsch beigebracht, als sie ihn dabei erwischt hatte, wie er einen Ballen Leder aus der Gerberei trug, und zwar so heimlich, dass der Diebstahl offenkundig war. Angéla hatte ihren Freund tadelnd angesehen und in ihrer scheuen Art gesagt, sie halte ein solches Vorgehen für »nicht hilfreich«, und obwohl Schorsch mehr ahnte als verstand, was sie ihm damit sagen wollte, hatte er, eine improvisierte, zusehends verstotterte Erklärung in besagtem Satz versanden lassend, den Ballen wieder retourniert. Und später, als Angéla fort war, natürlich zurückgeholt.
»Wie? Was? Freitag ab eins? Wieso Freitag ab eins? Was ist denn Freitag ab eins?« Und Schorsch und Angéla lachten, der eine meckernd, die andere fröhlich; und Berthe, die ihrerseits die junge Marquise gut leiden konnte, wollte sich nicht ärgern und lachte einfach mit.
Angéla wusste nicht, wie schlecht es um Sossenheims Englisch in Wahrheit bestellt war, und wenn sich der Staaretz dem Marquis gegenüber zu der Behauptung hatte hinreißen lassen, er sei »jederzeit« in der Lage, Unterricht im Englischen zu erteilen, weil er nämlich, wie er grob und hastig log, »in Irland missioniert« habe, dann nur deshalb, um die Zuversicht des Marquis, was die umfassenden und jedenfalls über Religion und Russisch hinausgehenden Kenntnisse des kommenden Hauslehrers anging, nicht zu trüben. Die Beschaffenheit dieser Kenntnisse musste dabei im Vagen bleiben, denn der Staaretz beherrschte neben seiner Mutter- zwar noch die Landessprache, sonst aber schlechterdings wenig; in Latein und Griechisch hatte er, gegen gewisse Gefälligkeiten, im Seminar immer abgeschrieben, und seine Kenntnisse der Mathematik beschränkten sich darauf zu wissen, was sich für ihn rechnete und was eher nicht. Ein Leben auf Schloss Templin rechnete sich, und also musste er die Rolle des Hauslehrers spielen, so gut er eben konnte.
Das mit dem Englischen war freilich eine Schnapsidee gewesen, denn die Marquise sprach es, hatte ihr Töchterchen bereits selbst unterrichtet und also jede Möglichkeit, Lernfortschritte oder, nach Lage der Dinge wahrscheinlicher, deren Ausbleiben festzustellen; Geographie, Astronomik, Naturgeschichte, da konnte er improvisieren, aber wie er Englisch unterrichten sollte, wusste der Himmel.
In seiner Not fiel Sossenheim die Rettung vor die Füße.
Er schlich des Nachts durchs Schloss, schlaflos, weil er nicht wusste, wie sein Sprachproblem zu lösen wäre, hungrig, weil das ein Problem war, das sich lösen ließ, und vorsichtig, um seinem Ruf, der nicht der beste war, keinen Vorschub zu leisten; und weil Gott seine größten Schafe nun einmal besonders liebt, ließ er den Staaretz, der die Küche nicht fand, in die Bibliothek geraten.
Sossenheim, der sich seines Verstandes zwar zu bedienen wusste, sich aus dem Geist als solchem aber nie viel gemacht hatte und im Seminar bloß als jüngster Sohn, fürs Militär zu rachitisch und die Feldarbeit zu ungeschickt, gelandet war, verspürte trotzdem Ehrfurcht vor ebenjener Gelehrsamkeit, die ihn, soweit sie ihn betraf, langweilte; und wie ein Tunichtgut fasziniert die Mühen eines Handwerks betrachtet, das er gerade darum respektiert, weil er es selbst nicht ausüben muss, schritt der Staaretz, behutsamen Fußes und mit ehrlicher Ehrfurcht, die Bücherwände ab, die im Mondlicht, das die Fenster hellte, ihr Angebot machten. Er bedauerte aufrichtig, dass er sich selbst so gar nicht zur Schriftstellerei eignete, weil er nämlich viel zu faul war; und bevor er aber einen stillen Selbstvorwurf in diese Richtung formuliert hatte, fiel ihm ein, wie wenig Bedarf für religiöse Literatur es hierzulande gab, und eine andere zu verfassen, hätte seine Fantasie nie gereicht. Im Westen, da war es freilich anders! Dort schrieb ja jeder alte Bischof seine Dummheiten auf und wurde richtig reich damit! Aber hier (und ein kleiner, unehrlicher Groll stieg in ihm hoch) war ja diesbezüglich keine Freiheit (Sossenheim dachte das Wort geradezu kursiv), hier entschieden ja Eriks Beamte, was gedruckt wurde und was nicht, statt dass es die taten, die doch wohl die meiste Ahnung hatten: die Leser!
Die Bücher nahmen die erregt revolutionären Gedanken des Gottesmannes still zur Kenntnis, sie hatten dazu keine Meinung; und also schwiegen sie auch, als der Schwarze die Leiter emporkletterte, die den oberen Teil der Bibliothek dem Zugriff erschloss.
Der Staaretz wollte nämlich ein Buch entwenden.
Er wollte es nicht unbedingt stehlen, umso weniger, als er bei den Lichtverhältnissen ja gar nicht sah, was er da stahl, und es gerade bei zu stehlenden Gäulen darauf ankommt, ihnen ins Maul zu schauen. Er wollte ein Buch an sich nehmen, vorübergehend, unerlaubterweise, weil er nun einmal hier war und die Gelegenheit günstig; und wie viele Dinge auf Erden werden getan, nur weil sie getan werden können! Sossenheim reizte der Gedanke, ein so gut wie perfektes Verbrechen zu probieren und sich gewissermaßen prophylaktisch schadlos für die ja durchaus erwartbaren Anwürfe betreffs seiner pädagogischen Fähigkeiten zu halten, im Übrigen war ihm auch langweilig; und so kletterte er bergauf, arretierte sich, indem er die Oberschenkel gegen die obersten Sprossen presste, und zog, weil nicht recht schwindelfrei, eilig aufs Geratewohl ein Buch aus dem Regal.
Da traf ihn ein Schuss.
Als Sossenheims Herz wieder schlug, schlug es so, als wolle es die verpassten Schläge dreifach zurückholen. Er merkte, wie seine Haut erst spannte und dann, vom Kopfe abwärts, sich prickelnd überbrühte. Wie auf einem flämischen, sehr dunkel geratenen Genrebild war er in der Bewegung erstarrt. Die Stille im Rücken ein Gast auf dem Sprung.
Die Zeit verrann in kleinen Tropfen, und nach einer Stunde oder deren fünf wagte er eine erste Bewegung – er musste mal, zum Teufel –, bugsierte den Band in die Lücke zurück und zitterte sich die Leiter hinab. Und grapschte das Buch, das unverlangt aus dem verstopften Regal geglitten und mit einem flachen, hellen Schlag unten angekommen war, vom Boden, tat es hastig unter den Rock und trollte sich. So froh war Sossenheim, dass er sogar ein Stoßgebet zum Himmel schickte, und bei Gott, er betete sonst nie.
So wie das Leben schlechthin ein kosmischer Zufall ist, so zufallsbestimmt ist das Leben des Einzelnen. Durch nichts als Zufall kommen wir so auf die Welt, wie wir es tun, und der Zufall bestimmt, welches Essen wir kriegen, welche Kleider wir tragen und ob wir dumm bleiben müssen oder klug werden dürfen. Wann immer der Marquis mit seinem Entschluss haderte, nach Transelbanien gegangen zu sein, um sich abends vor dem qualmenden Kamin bei minderwertigem Essen über den Schlendrian seiner Bauern zu ärgern, tröstete er sich mit dem Gedanken, dass Erik, was immer man gegen ihn haben konnte, der Macht des Zufalls in die Flanken boxte. Dass er, der Marquis, als Marquis de Fromageur zur Welt gekommen war und sein Knecht Schorsch als Schorsch, hatte hier weiter keine Folgen, als dass Schorsch bei vollem Lohn durch den Tag schlurfte und er, der Marquis, den Ärger hatte. Es war dies, schien ihm, eine Art von Gerechtigkeit; eine Gerechtigkeit, die freilich ihren Preis hatte. Aber hatte nicht alles seinen Preis?
Es darf also durchaus als Ironie unserer Geschichte verstanden werden, dass ausgerechnet ein Zufall, wie er im Reiche Eriks als lebensentscheidend doch eigentlich abgeschafft war, das Leben unserer Heldin so maßgeblich beeinflusste. Wenn nicht sogar vorentschied.
Denn das Buch, das unser Gottesmann so unfreiwillig aus dem Regal spediert hatte, war in Tat und Wahrheit in englischer Sprache verfasst, und die Handvoll Wörter, die Sossenheim kannte: »hello«, »goodbye«, »dog«, »refudiate«, reichte hin, um es als ein englisches zu erkennen, auch wenn er freilich keinen Schimmer hatte, wovon es handelte. Er verließ sich fürs Erste auf die Vermutung, es müsse sich um ein fröhliches Buch handeln, denn vorne drauf stand »Fanny«, und das bedeutete »lustig«, und außerdem zeigte das Frontispiz ein junges Frauenzimmer, woraus Sossenheim schloss, es müsse sich um ein lustiges Buch für junge Frauen handeln, und also eines, das im Verein mit einem guten Wörterbuch wie gemacht dafür sei, Angéla in englischer Lektüre zu trainieren. Bliebe bloß, mit dem Rasiermesser das Vorsatzblatt mit dem Exlibris zu entfernen, denn die Frage, wie das Buch in seinen Besitz gelangt war, wollte Sossenheim nicht beantworten müssen.
Mit geradezu triumphaler Geste hatte der sonderliche Pädagoge das Buch dann Angéla hingehalten, und das Mädchen, wiewohl noch viel mehr Kind als Frau, ahnte auf der Stelle, dass es mit diesem Buch eine Bewandtnis habe und es nicht unbedingt für Kinder gedacht war; denn erstens hatte die Frau vorne drauf sehr wenig an (und Angéla war alt genug zu wissen, dass das, über die Tatsache als solche hinaus, etwas bedeutete; sie selbst zog sich längst nicht mehr aus, wenn jemand dabei zusah), und zweitens konnte sie genügend Englisch, um den Untertitel sowohl zu verstehen als auch nicht zu verstehen:
Memoirs of a Woman of Pleasure, las sie laut, und Sossenheim nickte wissend.
»Ganz genau, junge Dame«, sagte er.
Eine Frau des Vergnügens?, übersetzte Angéla fragend.
»Eine Dame, die viel Spaß hat«, bestätigte der Staaretz forsch. »Genau wie Ihr!« Er war überzeugt davon, den richtigen Griff getan zu haben, wie absichtslos auch immer.
Und er befahl der jungen Marquise, daraus vorzulesen; verstand kein Wort; und beschränkte sich hinfort darauf, den Vortrag streng synkopisch abzunicken.
Eweites Kapitel
in dem unsere Heldin die Blaue Bluse findet, ein König einen uneinholbaren Vorsprung hat, Tagelöhner sich als undankbar erweisen und ein schöner Junge in Verlegenheit gerät
Es knackte im Gebüsch; und obwohl Angéla die Geräusche des Waldes nicht fremd waren, erschrak sie sacht und sah sich um; aber nichts rührte sich. Drum harrte auch sie.
So gut versteckt sie saß, in einer Kuhle im weichen Waldboden, die vom Astwerk eines vom Sturm gefällten Baumes gegen flüchtige Blicke geschirmt war, so unausdenkbar war doch, dass sie, Angéla, entdeckt wurde; es war schon schlimm genug, dass sie eventuell in die Hölle kam oder ihr wenigstens die Hand abfiel. Da hatte es mit Schimpf und Schande Zeit.
Der Wald stand grün und schwieg, Kühle gegen den heißen Frühsommertag gewährend, und während Angéla, zwar sicherheitshalber offenen Auges, aber inwendig doch ganz aufs Wesentliche konzentriert, sich einer heiklen Szene aus Sossenheims Englischbuch erinnerte und bald tastend, bald zupackend wieder Fahrt aufnahm, schnupperte sie die harzige Frische ihrer Umgebung und freute sich, dass Sommer war.
Allein schon, weil nicht immer alles nach Braunkohle stank, die, weil das Holz anderweitig gebraucht wurde oder irgendwie knapp war oder beides – »Unnerm Erik tät sogar am Amazonas das Holz ausgehe«, hatte sie Schorsch gegenüber Berthe spotten gehört –, in Transelbanien ein beliebter Heizbrennstoff war und im Übrigen auch wunderbar wärmte. Dafür klebte die Luft, war es kalt, vor stechend fettsüßem Qualm, und wenn Schorsch noch seine Pfeife in Betrieb hatte, die er mit per Honigzugabe aromatisiertem, »Gemisch« genanntem Tabak stopfte, dann rang die raue, paradoxe Süße des Kohlebrandes mit der penetrant heiteren des Pfeifenrauches, und erst viel später würde Angéla sich an diesen Geruch als den ihrer Kindheit erinnern; einer Kindheit, von der sie sich, mit vierzehn, langsam trennte.
Fürs Erste war sie aber froh, wenn sie durchatmen konnte, umso mehr, als ihr Atem mählich schneller ging; und kaum hatte sie abermals erwogen, ihr Englischbuch noch etwas strenger simulativ beim Wort zu nehmen und Valeries Gemüsebeet nach Strich und Faden durchzuprüfen, kam auch schon die Kavallerie und brauste so ungestüm über sie hinweg, dass sie die Augen schloss und sich dem anschwellenden, betäubenden Hufschlag ergab, der sie unter sich begrub und von der Welt trennte.
Hilflos lag sie ganz verströmt. Die Hufe schlugen leiser, der Blätterwind schluckte sie schnell.
Unschuldig stand der Wald.
Angéla atmete schwer.
Zufriedenheit durchströmte sie, doch Reue schließlich ebenfalls; sie wusste kaum, was sie da tat. Läuten hatte sie hören, es sei dies eine Sünde, wie alles, was untenrum sich tue, sofern es nicht natürlichem Zweck und Auftrag gehorche, denn der Herrgott habe die Geschlechter in all ihrer Verschiedenheit (deren Konsequenz und Bedeutung Angéla erahnt und schließlich voll durchdeutet hatte, seit Sossenheim sie lesen ließ) schließlich nicht zum Vergnügen geschaffen, weder zu seinem noch zu dem ihren. Angéla, während sie aufstand und ihr Kleid ausschlug, leuchtete das, wann immer sie darüber nachdachte, nicht ein, und so sie Reue empfand, dann eine künstliche, pflichtgemäße, vorgetäuschte. Es fiel ihr schwer einzusehen, warum das, was sie (zumal nach der wöchentlichen Englischlektion) doch durchaus als Bedürfnis empfand, weniger schicklich sein sollte als das Bedürfnis, die Notdurft zu verrichten; und solange sie jenem artverwandten (und, nicht wahr, ja schließlich auch arterhaltenden) Drang nicht in aller Öffentlichkeit die Zügel schießen ließ, sondern, zum Beispiel, im Wald, im Bett oder im Kartoffelkeller, unter der Treppe, im Kräutergarten oder auf dem Abort, in der Waffenkammer, der Remise, der Kutsche oder dem Stall, im Schrank, im Baum, im Busch oder im Heu, sollte es doch niemandes Schaden sein. Gut, der liebe Gott sah alles; aber er sah auch, wie der Bock auf der Ziege herumturnte oder Schorsch, wenn er zu tief ins Glas geschaut hatte, sich aus dem Stallfenster erbrach. Sollte das denn ein schönerer Anblick für den Beherrscher von Raum und Zeit sein als eines seiner Kinder, wie es sich ein bisschen kratzte, rieb und zwickte? Und hatte man als Beherrscher von Raum und Zeit nicht sowieso ganz andere Sorgen?
So dachte es in Angéla, und je länger sie durch den Wald schritt, über Stock und Moos und Stein, desto dünner wurde das, was sie als Reue sowieso nicht recht ernst nahm.
Der Junge stand da, als gehöre er zum Wald, regungslos wie eine Jungfichte; oder eine Blautanne, denn blau war sein Hemd. Eine gut gewachsene Blautanne. Er mochte einen Kopf größer sein als Angéla, die den Jungen, weil er sich nicht bewegte, erst wahrnahm, als sie ihn fast umgerannt hätte; und wie sie vor ihm stand (oder eigentlich erst einmal hinter ihm), war es zu spät, noch einen anderen Weg einzuschlagen, wie Angéla es instinktiv getan hätte, teils ihrer angeborenen Scheu wegen, teils weil sie fürchtete, man müsse ihr die jüngste Verwirrung unbedingt ansehen.
Als wäre damit irgendwas gewonnen, verharrte sie, wo sie zu stehen gekommen war, zwei Armlängen hinter dem Hemd, dessen rechter Arm rechtwinklig abstand, als halte wer die Hand vors Gesicht oder, wahrscheinlicher, schirme es gegen die Nachmittagssonne. Jetzt wandte der Junge den Kopf, und Angéla, die es nicht wenig faszinierte, dass sich ganze Wissenschaften mit der Beziehung von Ursache und Wirkung befassten, fand ihre Vermutung bestätigt.
Sie fragte sich, wie wahrscheinlich es wäre, dass der Junge einfach fortginge, ohne sie zu bemerken, er würde ihrer sicherlich gewahr werden, erschrecken und sie eine dumme Trine schelten; es war, unter den gegebenen Umständen, überhaupt kein bisschen zielführend, auf das Wunder zu hoffen, das doch sowieso ausblieb. Und also prüfte Angéla die Randbedingungen, wägte die Möglichkeiten, die sich daraus ergaben, fügte sich ohne Weiteres ins unausweichlich Faktische und räusperte sich, wie man sich räuspert, wenn man wahrgenommen zu werden wünscht.
Der Junge, dem Anschein nach überhaupt kein bisschen erschrocken, ließ die Hand sinken und drehte sich um. Er hatte ein freundliches, offenes Gesicht, das vor Frischluft und Gesundheit glühte. Er sah aus wie ein Bauernjunge, die Hände hingen groß an ihm herab und verhehlten nicht, dass sie Umgang mit Hammer und Sichel pflegten. Der Junge grinste; er kratzte sich mit rechts die Brust, sein Hemd stand hälftig offen. Die braunen Haare fielen ihm in wilden Wellen auf die Schultern, seine Beine steckten in Hosen aus grobem Leinen, er war barfuß. Er neigte vorsichtig den Kopf, wie es ein Ritter vor seiner Dame getan hätte, und Angéla wurde rot, weil sie glaubte, er mache sich über sie lustig.
»Du bist herangeschlichen, ein Reh hätte mehr Lärm gemacht.«
Der Junge grinste weiter, aber freundlich; es hatte nichts Herablassendes.
Und er, sagte Angéla, habe so still dagestanden, ein Stein hätte sich flinker bewegt!





























