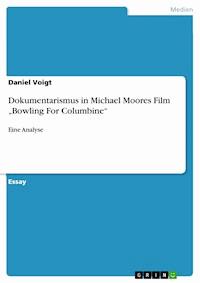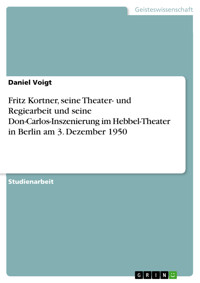Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Störungen systemisch behandeln
- Sprache: Deutsch
"Daniel Voigt hat mit 'Ängste, Panik, Sorgen' ein sehr gut geschriebenes, erkenntnisreiches Buch vorgelegt, das nicht nur für systemische Therapeut*innen interessant ist, sondern auch für selbst von Angst betroffene Personen einige Aha-Erlebnisse und Verhaltensanregungen bereithält. Die Lektüre kann all jenen Menschen empfohlen werden, die einen systemischen Umgang mit Ängsten und Panikstörungen erlernen wollen." socialnet.de "Ein sehr lesenswertes praktisches Lehr- und Arbeitsbuch, das auf Anhieb durch seinen übersichtlichen Aufbau und seine klare Gliederung besticht. Daniel Voigt gelingt es, auf anschauliche Weise aus systemischer Perspektive Angst-Störungen zu skizzieren und in diesem Zusammenhang Grundhaltungen und Kernmerkmale systemischer Therapietheorie aufzuzeigen." Training und Beratung "... Daniel Voigts Thema sind Ängste, Panik und Sorgen allgemein. Zwar ist das Lehr- und Arbeitsbuch des Diplompsychologen Voigt ausdrücklich an Kollegen adressiert, wenn er den systemischen Blick auf Angststörungen umreißt, die Konzepte anderer psychotherapeutischer Schulen vorstellt, die für die systemische Arbeit produktiv sind, und neurobiologisch erklärt, was bei Angst in Kopf und Körper geschieht. Doch es gelingt dem Autor, die komplexen Inhalte einerseits streng forschungsbasiert und zugleich anschaulich, behutsam, geradezu bescheiden zu präsentieren. Laien, die Fachtermini und die gelegentlich kompakten Literaturreferate nicht fürchten, sei das Buch daher ausdrücklich empfohlen. Zumal der ausgiebige Praxisteil, der die Hälfte des Buches einnimmt, eine Fundgrube an Tipps ist, wie wir auch alltäglichen Ängsten und Panikerfahrungen begegnen können." Psychologie Heute Neugestaltung der Beziehung zur Angst Angst ist die Begleiterin von Wachstum und Entwicklung. Sie gehört zum Leben und lässt sich nicht besiegen – im Gegenteil: Versuche, sie zu bekämpfen, zu kontrollieren oder zu vermeiden können dazu führen, dass die Angst immer mehr die Führung übernimmt. Systemische Therapie rückt diese störungserhaltenden Lösungsversuche in den Fokus und sucht nach Wegen, die Beziehung zur Angst neu zu gestalten: Akzeptanz und Selbstregulation statt Kampf und Kontrolle. Daniel Voigt zeigt, wie Klienten eine konstruktive und weniger leidvolle Beziehung zu ihren Ängsten und Sorgen entwickeln können. Eine Fülle von praktischen Anregungen unterstützt dabei, ängstliche Seiten zu versorgen und innere Angstmacher in nützliche Ressourcen zu verwandeln: Reframings und Geschichten, Musterunterbrechungen, Verschreibungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Externalisierung und Teilearbeit. Darüber hinaus werden hilfreiche Methoden zur Selbstregulation in Spannungszuständen sowie zur Aktivierung von inneren Helfern vorgestellt. Der Autor: Daniel Voigt, Dipl.-Psych.; Ausbildungen in Systemischer Therapie/Familientherapie (DGSF), Traumatherapie, EMDR, Verhaltenstherapie, Klinischer Hypnose/Hypnotherapie; Systemischer Supervisor (DGSF); Fortbildungen in Acceptance- und Commitment-Therapie (ACT) und Ego-State-Therapie. Seit 2012 eigene Praxis für Einzel-, Paar- und Familientherapie, Coaching und Supervision; Supervisor und Lehrtherapeut in der Systemischen Psychotherapieausbildung (GST Berlin, IF Weinheim).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Störungensystemischbehandeln
Vorwort der Herausgeber
Ursprünglich ein querdenkendes Außenseiterkonzept, hat sich der systemische Ansatz heute in vielen Bereichen der Therapie und der Beratung theoretisch wie praktisch etabliert. Auch Vertreter anderer Schulen bereichert er mittlerweile in ihrer Arbeit. Die Etablierung eines Paradigmas birgt für dieses selbst aber auch Risiken, weil sie stets mit der Verfestigung von Denk- und Handlungsgewohnheiten einhergeht. Die Reihe Störungen systemisch behandeln stellt sich vor diesem Hintergrund zwei Herausforderungen: Nichtsystemischen Behandlern und Vertretern anderer Therapierichtungen soll sie komprimiert und praxisorientiert vorstellen, was die systemische Welt im Hinblick auf bestimmte Störungsbilder zu bieten hat. Innerhalb der Systemtherapie steht sie für eine neue Phase im Umgang mit dem Konzept von »Störung« und »Krankheit«.
Historisch gesehen war einer ersten Phase mit erfolgreichen Konzepten zu Krankheitsbildern wie Schizophrenie, Essstörungen, psychosomatischen Krankheiten und affektiven Störungen eine zweite Phase gefolgt, die geprägt war von einem gezielten Verzicht oder einer definitiven Ablehnung aller Formen störungsspezifischer Codierungen. In jüngerer Zeit wenden sich manche Vertreter der systemischen Welt wieder störungsspezifisehen Konzepten und Fragen zu – und werden von anderen dafür deutlich attackiert. Diese neue Welle ist bedingt durch die Anerkennung der Systemtherapie als wissenschaftliches Heilverfahren, durch die sozialrechtliche Anerkennung und nicht zuletzt dadurch, dass viele im klinischen Sektor systemisch arbeitende Kollegen täglich gezwungen sind, sich zu störungsspezifischen Konzepten zu positionieren.
Die systemische Welt hat hierzu einiges anzubieten. Die Reihe Störungen systemisch behandeln will zeigen, dass und wie die Systemtheorie mit traditionellen diagnostischen Kategorien bezeichnete Phänomene ebenso gut und oft besser beschreiben, erklären und mit hoher praktischer Effizienz behandeln kann. Sie verfolgt dabei zwei Ziele: Zum einen soll systemisch arbeitenden Kollegen das große Spektrum theoretisch fundierter und praktikabler systemischer Lösungen für einzelne Störungen zugänglich gemacht werden – ohne das Risiko, die eigene systemische Identität zu verlieren, im besten Fall sogar mit dem Ergebnis einer gestärkten systemischen Identität. Gleichzeitig soll nichtsystemischen Behandlern und Vertretern anderer Schulen das umfangreiche systemische Material an Erklärungen, Behandlungskonzepten und praktischen Tools zu verschiedenen Störungsbildern auf kompakte und nachvollziehbare Weise vermittelt werden.
Verlag, Herausgeber und Autoren bemühen sich, einerseits eine für alle Bände gleiche Gliederung einzuhalten und andererseits kreativen systemischen Querdenkern die Freiheit des Gestaltens zu lassen.
An die Stelle der Abgrenzung und der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Therapieschulen ist heute der Austausch zwischen ihnen getreten. Die Reihe »Störungen systemisch behandeln« versteht sich als ein Beitrag zu diesem Dialog.
Dr. Hans Lieb, Dr. Wilhelm Rotthaus
Daniel Voigt
Ängste, Panik, Sorgen
Störungen systemisch behandelnBand 18
Herausgegeben vonHans Lieb und Wilhelm Rotthaus
Dritte Auflage, 2024
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Dr.h.c. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Dresden)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster) Jakob
R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln) Prof.
Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihe »Störungen systemisch behandeln«, Band 18
hrsg. von Hans Lieb und Wilhelm Rotthaus
Reihendesign: Uwe Göbel
Umschlag und Satz: Heinrich Eiermann
Redaktion: Veronika Licher
Illustrationen: S. 216 © Robert Lee
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Dritte Auflage, 2024
ISBN 978-3-8497-0373-8 (Printausgabe
ISBN 978-3-8497-8261-0 (ePUB)
© 2021, 2024 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: www.carl-auer.de.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Dank
Das vorliegende Buch ist Ergebnis eines Dialogs mit Patienten1, Kolleginnen und vor allem mit Teilnehmenden der systemischen Therapieausbildung, durch deren hilfreiches Feedback viele der hier beschriebenenen Ideen und Methoden verbessert und geschärft wurden. Dafür bin ich sehr dankbar.
Mein allergrößter Dank geht an Miriam Landsberg und Matthias Becker, die das Entstehen dieses Buches mit genau der richtigen Mischung aus Ermutigung und Kritik ermöglicht haben. Gelernt habe ich am meisten bei Klaus Mücke, Lydia Hantke, Hans-Joachim Görges und Gunther Schmidt, dafür danke ich ihnen hier von Herzen. Hans Lieb und Wilhelm Rotthaus gilt mein Dank dafür, dass sie dieses Buch mit viel Vertrauen und hilfreichen Anmerkungen als Herausgeber begleitet haben. Ein großer Dank geht an Max Wellner, der viele Grafiken in eine klare Form gebracht hat, sowie an Veronika Licher für das wertvolle Lektorat. Schließlich danke ich meinen Töchtern, die wahre Expertinnen im Umgang mit Angst sind: »Wenn ich Angst habe, was dann hilft? Also erstmal überleg‘ ich, ob mir das jetzt wichtig ist zu machen. Und wenn ja, dann hol‘ ich mir Freunde, die mir Mut machen, und dann probier‘ ich es immer wieder, bis es klappt.«
1 Auf genderneutrale Formulierungen habe ich im Interesse einer leichteren Lesbarkeit verzichtet. Stattdessen benutze ich weibliche und männliche Formen in losem Wechsel. Gemeint sind immer alle, unabhängig von Gender und Geschlecht.
Patienten und Klienten: Im Gesundheitswesen wird durchweg die Bezeichnung Patient (wörtlich: Leidender) für Menschen verwendet, die dort therapeutische Leistungen in Anspruch nehmen. Im systemischen Sprachgebrauch ist hingegen meist von Klienten die Rede, auch um den kooperativen Dienstleistungscharakter der therapeutisch-beraterischen Tätigkeit zu betonen. Dieses Buch versteht sich als Schnittstelle zwischen beiden Kontexten, daher nutze ich beide Begriffe.
Über dieses Buch und wie man es benutzen kann
Das vorliegende Buch soll vor allem ein praktisches Lehr- und Arbeitsbuch sein. Ich wünsche mir, dass die hier zusammengestellten Ideen und Methoden eine Anregung und Bereicherung sowohl für systemische Therapeutinnen als auch für Kollegen anderer Fachrichtungen sind.
Noch gibt es recht wenig Literatur, die Systemische Therapie mit den klinischen Störungsbereichen verbindet, wie sie in den psychiatrischen Diagnosesystemen (ICD und DSM) beschrieben werden. Für das Feld der Angststörungen soll dieses Buch eine solche Verbindung sein – zwischen klinischer Perspektive und systemischer Therapie.
Abgrenzung zwischen den Therapieverfahren steht nach wie vor hoch im Kurs – das ist einerseits sinnvoll, denn Unterschiede sind auch im systemischen Verständnis eben das, was eine Sache ausmacht. Andererseits findet die Psychotherapieforschung für verfahrensspezifische Wirkfaktoren wiederholt nur geringe Evidenz, während allgemeine kontextuelle Wirkfaktoren einen viel größeren Beitrag zum Gelingen von Psychotherapie leisten (Wampold, Imel u. Flückiger 2018; Grawe 2000). Was die Vereinbarkeit verschiedener therapeutischer Ansätze betrifft, so bevorzuge ich daher ein entschiedenes Sowohl-als-auch: ein verfahrensübergreifendes, an den zentralen Wirkfaktoren von Psychotherapie orientiertes Arbeiten statt therapeutischer Kleinstaaterei. Systemische Therapie kann aufgrund ihrer Methodenoffenheit jedoch viele Ideen und Interventionen integrieren, die in anderen Ansätzen zur Hilfe bei Angststörungen entwickelt wurden.
Psychotherapie verstehe ich als eine Mischung aus Handwerk, Wissenschaft und Kunst – daher ist auch dieses Buch einerseits subjektiv, persönlich und ein Spiegel meiner Arbeit mit Angstpatienten, vor allem im Therapieteil (Kap. 6). Andererseits versuche ich, eine allgemeine systemische Perspektive auf Angst und Angsttherapie zu beschreiben. Dazu habe ich drei Dinge getan:
Ich habe systemische Publikationen zum Thema Angst gesichtet und versucht, wichtige Aspekte daraus zusammenzufassen.
Allgemeine systemische Interventionsideen versuche ich, in ihrer konkreten Anwendung bei Angst zu beschreiben.
Eine Auswahl aus dem angstbezogenen Methodenrepertoire anderer Therapieansätze habe ich auf ihre Nutzbarkeit und Kompatibilität mit systemischen Prinzipien beleuchtet. Diese methodischen Anlehnungen stammen vor allem aus der kognitiven Verhaltenstherapie, der modernen Traumatherapie, der ericksonschen Hypnotherapie und der Akzeptanz- und Commitmenttherapie. Diese Auswahl ist persönlich und orientiert sich daran, was ich in meiner Arbeit mit Angstpatienten als hilfreich erlebe.
Wie können Sie dieses Buch benutzen?
Hier eine kurze Übersicht, was Sie in den einzelnen Kapiteln erwartet, und zwar von hinten nach vorn, beginnend mit dem Praxisteil:
Kapitel 6 – Praktisches Vorgehen und Methoden: Wenn Sie vorrangig an konkreter systemischer Arbeit und nützlichen Methoden interessiert sind, können Sie direkt hier mit dem Lesen und Stöbern beginnen. Im Anhang 1 finden Sie zudem eine Übersicht der einzelnen Methoden und Übungen und bei welchen Störungen diese am besten geeignet sind.
Kapitel 5 – Systemische Therapietheorie: Hier sind einige wichtige Grundprinzipien Systemischer Therapie beschrieben. Mit dem »Therapeutendilemma« und seiner systemischen Lösung wird das Spannungsfeld vorgestellt, in dem sich Systemische Therapie bewegt: zwischen kunden- und auftragsorientiertem systemischen Arbeiten einerseits und den Anforderungen des Gesundheitssystems andererseits, das eine Behandlung »krankheitswertiger Störungen« erwartet.
Kapitel 4 – Systemische Perspektiven auf Angst: In diesem Kapitel werden verschiedene systemische Ideen zum Verständnis der Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen beschrieben.
Kapitel 3 – Ideenpools und Perspektiven auf Angst: Hier finden Sie eine Sammlung anderer theoretischer Perspektiven auf Angst in Form von Ideenpools, die auch für systemisches Arbeiten nützlich sein können. Dies sind Konzepte anderer therapeutischer Schulen und die neurobiologische Perspektive, der hier der größte Raum gegeben wurde – mit vorläufigen Antworten auf die Frage, was bei Angst in Kopf und Körper geschieht und wie dieses Wissen in der Therapie genutzt werden kann.
Kapitel 2 – Klinische Perspektive: Das Konzept der »psychischen Störungen« und psychiatrische Diagnosen werden hier als eine Form der Wirklichkeitskonstruktion mit spezifischen Vor- und Nachteilen beleuchtet. Dann folgt eine Beschreibung der einzelnen Angststörungen mit Fallbeispielen.
Kapitel 1 – Einführung: Hier geht es um einige zentrale Unterscheidungen, Angst-Autobahnen, Kompetenz-Dschungelpfade, Ziele von Angsttherapie und die zwei Gesichter der Angst.
1 Einführung
1.1 Angst-Autobahnen und Kompetenz-Dschungelpfade
»Angst ist ein wichtiger Ratgeber, aber ein lausiger Anführer.«
(Noam Shpancer: »Der gute Psychologe«)
Angst ist die Beschützerin des Lebens und das wohl wichtigste Gefühl, das wir haben. Ohne sie wären unsere Vorfahren vom Tiger gefressen worden und wir längst Opfer unserer Neugier oder Risikofreude. Wenn jedoch Angst als Störung erlebt wird, dann hat sie meist die Führung im Leben übernommen und ihre Rolle als hilfreiche Beschützerin verloren. Die Beziehung der Betroffenen zu ihrer Angst wird von Angst vor der Angst bestimmt. Oberstes Ziel ist dann das Vermeiden und Kontrollieren dieses Gefühls. Hierzu entwickeln Patienten ein reiches Repertoire an mehr oder weniger hilfreichen Lösungsstrategien: Vermeidung der vermeintlichen Auslöser, Ablenkung, Betäubung mit Substanzen, Konsum und Arbeit, dauernde Kontrolle des eigenen Erlebens und der Umwelt, nichts dem Zufall überlassen usw. Der Preis dafür sind auf lange Sicht meist Erschöpfung, Rückzug, eingeschränkte Lebendigkeit und Verzicht.
Bei vielen Betroffenen ähneln die neuronalen Netzwerke von Angst und Vermeidung gut ausgebauten Autobahnen, während andere Wege im neuronalen Dschungel längst zugewachsen oder auf der inneren Landkarte gar nicht mehr verzeichnet sind. Diese anderen Wege sind die »Kompetenz-Dschungelpfade« des Vertrauens, des Mutes, der Zuversicht, der Selbstbestimmung und der Freude, des Verbundenseins mit eigenen Bedürfnissen, Zielen und wichtigen Menschen. Sie gilt es, wieder begehbar zu machen und auszubauen.
Was ist dann eine realistische Zielerwartung von Angsttherapie? Übergeordnetes Ziel Systemischer Therapie ist das Erweitern von selbstbestimmten Möglichkeiten und Handlungsspielräumen – statt Ausgeliefertsein und Einengung durch das Symptom. Ziel ist nicht Angstfreiheit, sondern wieder handlungsfähiger und lebendiger zu werden – auch mit oder trotz Angst. Das Gegenteil von Angst ist nicht »keine Angst«, sondern Vertrauen, Mut und Freiheit.
Systemische Therapie geht davon aus, dass sich das von Patientinnen definierte Problem der Angst und die bisherigen Lösungsversuche für dieses Problem (Kampf, Kontrolle und Vermeidung) gegenseitig verstärken. Nach dem Motto »Wenn du etwas stärken willst, bekämpfe es!« führen alle Versuche, die Angst zu besiegen, zu vermeiden oder zu kontrollieren dazu, dass sie langfristig größer wird. Systemische Therapie fokussiert daher weniger auf die Angst selbst, sondern auf die von diesen Lösungsversuchen geprägte ablehnend-kontrollierende Beziehung des Patienten zu ihr. Ziel ist eine Veränderung der Beziehung zur Angst: Akzeptanz, Integration und Kooperation mit der Angst, ohne von ihr beherrscht zu werden. Dies gelingt aber nur, wenn Patienten sich den massiven körperlichen und seelischen Erscheinungen der Angst nicht mehr hilflos ausgeliefert fühlen, sondern in der Therapie Strategien lernen, um die damit verbundene Spannung zu regulieren und sich zu beruhigen.
Das Neue steht immer in Konkurrenz zu den alten Mustern. Um die neuen Kompetenz-Pfade zu finden und begehbar zu machen, brauchen Menschen zugewandte Aufmerksamkeit, Energie und gute Ausrüstung. Therapie kann helfen, diese Aufmerksamkeit zu fokussieren und die nötige Ausrüstung zusammenzustellen. Therapeutinnen hilft etwas Geländekenntnis im Netzwerk der Angst, ein kleiner Vorrat an möglichen Landkarten des Gelingens und Ideen, wie man von einer Angst-Autobahn wieder hinunter und auf neuen Wegen vorankommt. Insiderkenntnisse aus der zentralen Straßenplanungsbehörde können auch nicht schaden – also Wissen darum, aus welchen guten Gründen diese Autobahnen einst gebaut wurden.
Bei all dem soll dieses Buch helfen.
1.2 Der Kern der Angst – Ein Worst-Case-Szenario
Ängste wirken oft im Verborgenen – vor allem auf subklinischer Ebene sind sie weder von außen sichtbar, noch werden sie bewusst erlebt. Sichtbar und zum Problem werden hingegen die Lösungsversuche und Bewältigungsstrategien für die Ängste, z. B. Perfektionsstreben aus Angst vor negativer Bewertung, Vermeidung von Alleinsein aus Furcht vor Trennung oder vor Panikattacken usw. Erst wenn diese Lösungsversuche infrage gestellt oder unmöglich werden, wird der Zugang zu den Ängsten und den damit verbundenen Befürchtungen frei. Diese Worst-Case-Szenarien ranken sich im Kern fast immer um die folgenden Themen:
Angst vor Tod, Sterben, Schmerz und Verletzung
Angst vor Kontrollverlust über den eigenen Körper, Ohnmacht oder Verrücktwerden
Angst vor Kritik, Beschämung und negativer Bewertung durch andere Menschen
Angst vor Trennung, Alleinsein und Verlust wichtiger Menschen
Angst vor Einsamkeit und Sinnlosigkeit des eigenen Lebens.
Das genaue Nachfragen nach der schlimmsten Befürchtung leistet auch in der Therapie oft einen wichtigen Beitrag zum Verstehen der Symptome und zur Verbesserung der Selbstbeziehung der Patientin (ausführlich dazu in Abschnitt 6.5.1).
1.3 Angst und Furcht
Angst und Furcht bezeichnen, wenn auch nicht trennscharf, unterschiedliche Zustände. Während Furcht sich in der Regel auf eine akute Gefahr bezieht, so kann Angst auch unabhängig von der unmittelbaren Gefährdung sein, wie etwa die Angst vor einem möglichen Unglück in der Zukunft. LeDoux (2016, S. 31 ff.) beschreibt sowohl Angst als auch Furcht als vorausschauende Reaktionen auf Gefahren, aber in unterschiedlichem Zusammenspiel mit dieser Gefahr:
»Furchtzustände treten auf, wenn eine Bedrohung gegenwärtig ist oder unmittelbar bevorsteht; Angstzustände sind die Folge, wenn die Bedrohung möglich, ihr Auftreten aber unsicher ist.«
Während also für Furcht die Nähe zur unmittelbaren Bedrohung typisch ist, so ist Angst stärker mit Sorge verbunden:
»… das Selbst [ist] sowohl an der Furcht als auch an der Angst beteiligt. Furcht erleben heißt zu wissen, dass ich selbst in einer gefährlichen Situation bin, und wenn ich Angst erlebe, mache ich mir Sorgen darum, ob zukünftige Gefahren mich selbst treffen könnten.«
So setzen auch Interventionen bei phobischen (Furcht-)Störungen stärker am Umgang mit den angstauslösenden Situationen an, während etwa bei der generalisierten Angststörung eher die quälenden Sorgen im therapeutischen Fokus stehen.
In Anpassung an den allgemeinen Sprachgebrauch und zur Vereinfachung benutze ich in diesem Buch jedoch fast ausschließlich den geläufigeren Begriff der »Angst«. Wenn nicht anders erwähnt, so ist die »Furcht« dann immer mit gemeint.
1.4 Die zwei Gesichter der Angst
Angst kann Leben retten, eine hilfreiche Ratgeberin sein oder ein Gefängnis und eine Qual. Sie signalisiert, dass etwas unsicher oder bedrohlich ist und verändert werden soll. Als sinnvolle Anpassungsreaktion auf Bedrohungen oder Gefahren ist sie ausgesprochen hilfreich und eine primäre adaptive Emotion. Hüther (1997) bezeichnet die mit Angst verbundene Stressreaktion als Lenkerin für viele neuronalen Anpassungsprozesse. Angst macht kreativ, erfinderisch und aktiv – sie hilft dabei, alte Verschaltungen zu lösen und neue Wege einzuschlagen.
Wenn Angst uns aber dauerhaft überflutet oder wir die Bedrohung nicht abwehren können, wird Angst eine maladaptive Emotion. Sie führt dann nicht dazu, dass wir durch Handeln zu mehr Sicherheit kommen – die Gefahr geht nicht vorbei, lässt sich nicht lösen oder klären. Die Angst bleibt, aber Hilflosigkeit gesellt sich dazu. Manche Bedrohungen, vor denen wir Angst haben, sind real längst vergangen, fühlen sich aber dennoch gegenwärtig an. Angst ist dann ein »Verrutschen in der Zeit«.
Häufig als belastend erlebt wird auch Angst als sekundäre Emotion. Das ist die Angst vor dem Erleben von Angst oder anderen unangenehmen Gefühlen – wie Scham, Hilflosigkeit, Schuld, innerer Unruhe, Heimweh, Versagen. Angst als sekundäre Emotion signalisiert vermeintliche Bedrohlichkeit dieser Gefühle und fordert dazu auf, sie zu vermeiden.
Die Herausforderung im Umgang mit Angst besteht darin zu entscheiden, wo es sinnvoll ist, ihr zu folgen, weil sie reale Gefahr oder Überforderung signalisiert, und wo es Mut und Vertrauen braucht, um sich ihr zu stellen und trotz Angst Neues zu wagen.
2 Klinische Perspektive auf Angst
2.1 Krankheit – Störung – Diagnose: Ist es nur Angst oder schon eine Störung?
Die Begriffe »psychische Krankheit« und »psychische Störung« werden oft synonym verwendet. Im traditionellen medizinischen Verständnis gehören zum Begriff der Krankheit neben spezifischen Symptomen auch bestimmte Ätiologie- und Therapievorstellungen. Da aber im Bereich der Psychiatrie und Psychotherapie glücklicherweise generelle Uneinigkeit über die »wahren« Ätiologien und »richtigen« Therapien herrscht, wurde in den gängigen psychopathologischen Klassifikationssystemen (ICD, DSM) auf ätiologische Erklärungen weitgehend verzichtet und der Begriff der psychischen Störung statt Krankheit gewählt.
Auch aus systemischer Sicht ist der Störungsbegriff sinnvoller, weil er auf Erlebens-, Verhaltens- und Interaktionsprozesse beziehbar ist. Jemand erlebt eine »Störung« in seinem intrapsychischen System oder in seinem sozialen Beziehungssystem, er »fühlt sich gestört«. Der Krankheitsbegriff hingegen impliziert viel stärker ein rein individuelles Defizit.
Aus systemischer Sicht wird eine psychische Störung oder Krankheit als Teil einer
»… je nach Perspektive als störend oder gestört erlebten Interaktion angesehen, an der eine oder mehrere Personen so sehr leiden, dass ihnen Krankheitswert zugeschrieben wird« (Schweitzer u. von Schlippe 2007, S. 15).
Störung und Krankheit sind daher im systemischen Verständnis keine »objektive« Wirklichkeit, sondern Ergebnisse sozialen Aushandelns. Es sind Zuschreibungen und Wirklichkeitskonstruktionen, die von Personen vorgenommen werden und die auf bestimmten Annahmen beruhen.
Entscheidend für Betroffene, ob sie ihre Angst als »krank/gestört« und behandlungsbedürftig erleben, ist in der Regel das Ausmaß der Lebenseinschränkungen – wenn subjektiv bedeutsame Dinge von Betroffenen nicht mehr getan werden können – und die mit der Angst verbundenen Probleme (z. B. körperliche Beschwerden, Schlafstörungen, Verspannungen).
2.1.1 Psychische Störungen als Wirklichkeitskonstruktionen
Diagnosen psychischer Störungen wurden als Wirklichkeitskonstruktionen im Kontext von Heilkunde und psychiatrisch-psychotherapeutischem Handeln entwickelt. Sie konstruieren Wirklichkeit auf zwei Ebenen: zum einen auf Konstruktebene – wie Diagnosen überhaupt in der Fachwelt entwickelt werden und Eingang in die Klassifikationssysteme finden, zum anderen auf individueller Ebene der Zuschreibung an eine Person – wie und unter welchen Umständen Diagnosen an Hilfesuchende vergeben werden und welche Auswirkungen das hat.
2.1.1.1 Konstruktebene (ICD, DSM): Diagnosen als Verhandlungsergebnisse
Ob ein Erleben oder Verhalten durch die Expertengremien in den psychiatrischen Diagnosesystemen (ICD und DSM) als pathologisch bewertet wird und wie bestimmte Symptome zu Störungen zusammengefasst werden, dabei spielen alle wichtigen Aspekte von sozialen und gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen eine Rolle: Macht und Einfluss, Koalitionen, Zugang zu Informationen und finanziellen Ressourcen etc. Ob ein Phänomen als Störung bezeichnet wird, ist darum nicht nur Folge von wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern auch von gesellschaftlichem Druck (erst 1991 wurde Homosexualität als »psychische Störung« aus der ICD gestrichen).
Mit jeder Novellierung von ICD und DSM »entstehen« zudem neue Störungen. So ist etwa im DSM-5 erstmals die Diagnose einer Trennungsangststörung auch bei Erwachsenen möglich. In der ICD-11 wird mit der neuen Diagnose der komplexen PTBS die Vielfalt von Affektregulationsproblemen, negativer Selbstwahrnehmung und Beziehungsstörungen in Verbindung gebracht mit wiederholten oder andauernden traumatischen Erfahrungen. Insbesondere um die Berechtigung der aus meiner Sicht sehr nützlichen Diagnose »komplexe PTBS« gab es heftige Auseinandersetzungen, die dazu führten, dass Patienten diese Störung nun für Diagnostizierende nach ICD-11 »haben« können, während sie sie nach DSM-5 »nicht haben«.
2.1.1.2 Individuelle Ebene: Diagnosen als Hypothesen mit Vor- und Nachteilen
Diagnosen sind in der Logik des Gesundheitswesens die notwendige Zugangsvoraussetzung für Hilfen. Für Menschen, die eine krankenkassenfinanzierte Psychotherapie aufsuchen, gilt darum: Ohne Diagnose keine Therapie.
Welchen Unterschied macht es nun, ob wir das Erleben und Verhalten einer Person als berechtigte, vielleicht auch zu überwindende, dabei aber normale, gesunde Angst ansehen oder ob wir es mit dem Etikett einer psychischen Störung und einer Diagnose versehen?
Diagnosen lassen sich als Hypothesen bzw. Heuristiken verstehen, die dem Ziel dienen, therapeutisch hilfreich zu sein. Der Sinn solcher Heuristiken und die Prüfung der diagnostischen Hypothese ergibt sich daher aus ihrem therapeutischen Nutzen, so wie sich aus konstruktivistischer Sicht die Richtigkeit einer Konstruktion aus ihrem kommunikativen Nutzen ergibt (Ludewig 2009, S. 32 ff.). Eine objektive Bewertung in »krank« oder »nicht krank« bzw. »richtige« und »falsche« Diagnosen ist hingegen weder vollständig möglich noch sinnvoll.
Die Bewertung als »krank« oder »gestört« und die konkreten Diagnosen sollten daher auf ihre hilfreichen und schädlichen Auswirkungen geprüft werden: Welche möglichen Vor- und Nachteile ergeben sich aus einer Diagnose für die betroffenen Patienten, deren Bezugssystem sowie die beteiligten Professionellen (siehe Kasten 1)?
2.1.1.3 Vor- und Nachteile von psychiatrischen Diagnosen
Vorteile:
Schutz vor Überforderung und Abwertung/sozialer Ausgrenzung (»kann nicht« statt »will nicht«)
Entlastung von Schuld und Versagensgefühlen (»Die Krankheit ist schuld« statt »Ich bin zu dumm …«)
gesicherter Anspruch auf Hilfen wie Psychotherapie, Versorgungssysteme (z. B. Krankengeld)
subjektive Verstehbarkeit und Handhabbarkeit der Symptome sowohl für Patientinnen (»Ich weiß, was mit mir los ist«) als auch für Therapeutinnen (»Ich weiß, was zu tun ist«)
erleichterte Kommunikation unter Professionellen durch Komplexitätsreduktion, Vergleichbarkeit für Forschung
Nachteile:
Risiko der Chronifizierung und Festschreibung von Problemen als selbsterfüllende Prophezeiungen
Probleme werden aus dem Kontext und der Interaktion herausgelöst und einem »Patienten« und seiner »Störung« zugeschrieben
Risiko von Stigmatisierung der Betroffenen
Ausschluss oder Nachteile bei Berufsunfähigkeits-, Lebens- und privaten Krankenversicherungen sowie beruflichen Gesundheitsprüfungen, z. B. vor einer Verbeamtung
Ausblenden von Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten der Person
Sinnhaftigkeit und kommunikativer Aspekt von »Symptomen« wird vernachlässigt
gesellschaftliche und soziale Faktoren werden ausgeblendet
Kasten 1: Vor- und Nachteile psychiatrischer Diagnosen
Die kritischen Auswirkungen von Angstdiagnosen halten sich, verglichen mit anderen psychiatrischen Diagnosen (z. B. »Persönlichkeitsstörungen«), sicherlich noch in Grenzen. Positiv aus Patientensicht ist häufig, dass mit der Diagnose z. B. einer Panikstörung oder einer sozialen Angststörung ein Zugewinn an Entlastung, Selbstakzeptanz (»Ich bin nicht dumm und nicht verrückt«), Selbstverstehen und Zugehörigkeit verbunden ist (»Anderen geht es auch so, ich bin nicht allein«). Dies sind zentrale Teile des für das Erleben von Gesundheit so wichtigen Kohärenzgefühls (vgl. das Salutogenesemodell von Antonovsky 1997).
Andererseits fokussiert die Diagnose einer Angststörung stark auf defizitäre Aspekte des Erlebens und Verhaltens (statt z. B. Angst als sinnvolle Bedürfnisinformation zu verstehen). Sie impliziert analog zu medizinischen Modellen das Ziel des »Wegmachens« der Symptome statt Akzeptanz und Integration. Zudem kann die Diagnose einer Angststörung als durchaus stigmatisierend im Sinne von »eingebildet krank« erlebt werden, insbesondere wenn zunächst der organmedizinische Bereich konsultiert und eine »Psycho-Diagnose« vom Patienten als Entwertung seiner körperlichen Beschwerden erlebt wird.
2.1.2 Wie nützlich ist die klinische Diagnosenbrille für systemische Therapeutinnen?
In der Systemischen Therapie spielen psychopathologische Diagnosen als Orientierung für die Therapeutin traditonell eine eher geringe Rolle. Handlungsleitend für die Therapie sind weniger die »objektiven« Störungssymptome, sondern eher deren Auswirkungen für und ihre Bewertung durch die betroffenen Patienten und Systeme. Eine Agoraphobie mit extremer Vermeidung aller Aktivitäten ist so lange keine »Störung«, bis sie von einem der Beteiligten als solche definiert wird. Ludewig (2009, S. 85 f.) schlägt daher vor, statt des Krankheitsbegriffs als Leitidee für klinisches Denken und Handeln das Konzept des »Problems« zu nutzen, da
»Probleme nicht auf der Abbildung einer unabhängigen Realität beruhen, sondern auf subjektiven Unterscheidungs- und Entscheidungprozessen«.
Diagnostik als eine Form der Komplexitätsreduktion erlaubt es, bestimmte beobachtete Muster Kategorien zuzuweisen, die mit bestimmten Handlungsoptionen verbunden sind (Muster: eine Patientin fährt aus Furcht vor einem Panikanfall nicht allein, sondern nur mit dem Partner Auto; Kategorie: »Sicherheits-Vermeidungsverhalten«, eingeschränkte Autonomie).
Da eine objektive Diagnostik einer Störung oder eines Problems nicht möglich ist, fokussiert Systemische Therapie weniger auf das Symptom Angst selbst als auf das damit verbundene Problem für die Betroffenen, z. B. das Leiden unter den körperlichen Anspannungszuständen, Sorgen über ein Wiederauftreten von Angstattacken oder die Einschränkungen der Handlungsmöglichkeiten.
Dennoch ist es hilfreich, die Sprache und Struktur der klinischen Diagnosen zu kennen und sie, ähnlich wie eine Brille, aufsetzen zu können, um zu schauen, ob sich damit neue Perspektiven auftun, die in der therapeutischen Arbeit hilfreich sind. Denn um das Konzept der Störungsdiagnosen herum gruppiert sich viel therapeutisches Erfahrungs- und Forschungswissen, das sich auf diese Diagnosen bezieht. Fast alle Lehrbücher klinischer Psychologie und Psychotherapie ordnen das darin enthaltene Wissen nach Diagnosen. Man muss als systemische Therapeutin diese Diagnosen nicht »glauben«. Es lohnt sich jedoch, sie zu kennen, um das darauf bezogene klinische Wissen einordnen und mit anderen darüber kommunizieren zu können.
Systemische Therapie findet zudem immer mehr in klassischen Domänen des medizinischen Krankheitsmodells statt, die mit psychopathologischen Diagnosen selbstverständlich operieren: in Kliniken, psychiatrischen Ambulanzen usw. Darum ist es nötig, an diese Systeme und die dort Tätigen wertschätzend anzukoppeln, sodass die Kommunikation auch mit »nicht-systemischen« Expertinnen möglich und nutzbringend ist.
Fazit: Die klinische Diagnosenbrille ist dann hilfreich, wenn sie die Denk-, Fühl- und Handlungsmöglichkeiten von Therapeutinnen und Patienten positiv erweitert – im Sinne des systemischen »ethischen Imperativs«: »Handle so, dass du die Zahl der Möglichkeiten vergrößerst« (von Foerster 1993).
2.2 Angst als klinische Störung
In den folgenden Abschnitten soll nun gezielt die »Diagnosenbrille« aufgesetzt werden, um Probleme, die mit Angst verbunden sind, unter klinischer Störungsperspektive zu betrachten und zu sortieren.
Angst ist Symptom der meisten psychischen Störungen, nur ein Teil davon wird jedoch in ICD und DSM zu den Angststörungen gerechnet. Die therapeutische Arbeit mit Angst ist aber ebenso zentral bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Zwangsstörungen, depressiven und somatoformen Störungen. Die systemtherapeutischen Konzepte im Umgang mit Angst, wie sie in späteren Kapiteln beschrieben werden, sind prinzipiell übertragbar auf Angst im Kontext all dieser Störungen.
2.2.1 Häufigkeit, Komorbidität und diagnostische Zuordnung von Angststörungen
Angststörungen sind häufig – etwa 15 % der Bevölkerung erfüllten irgendwann innerhalb der letzten 12 Monate die diagnostischen Kriterien dafür (Jacobi, Höfler u. Strehle 2014).
Es gibt deutliche Geschlechtsunterschiede: Fast alle Angstdiagnosen werden bei Frauen 2–3-mal häufiger als bei Männern gestellt. Soziale Angst bildet dabei ein Ausnahme, sie wird bei Frauen nur 1,4-mal häufiger diagnostiziert (Morschitzky 2009).
Eine Angststörung kommt dabei selten allein. Die meisten Menschen mit einer Angstdiagnose erfüllen zusätzlich die Kriterien für andere Störungen. Die Gemeinsamkeiten von Angststörungen untereinander sowie mit depressiven Störungen, Zwangsstörungen, somatoformen und posttraumatischen Störungen sind wahrscheinlich größer als die Unterschiede zwischen all diesen Störungskonzeptionen. Dies drückt sich in hohen Komorbiditätsraten der Störungen aus. 50–90 % der Patienten mit einer Angstdiagnose erfüllen die Kriterien für mindestens eine weitere Störung (Morschitzky 2009, S. 190 ff.).
Die Zuordnung einzelner Störungen zur Gruppe der Angststörungen variiert: In früheren Versionen des DSM wurden posttraumatische Störungen und Zwangsstörungen zu den Angststörungen gezählt – im DSM-5 wurde für sie jeweils ein eigenes Kapitel geschaffen.
Zur Diagnose einer Angststörung ist neben den konkreten Angst- und Vermeidungssymptomen immer erforderlich, dass dadurch alltägliche Lebensführung, berufliche Leistung oder soziale Beziehungen eingeschränkt sind und die Person darunter in bedeutsamer Weise leidet.
2.3 Spezifische Phobien
Frau N., eine 24-jährige Studentin, berichtet über massive Flugangst: »Schon Tage vor einem Flug bin ich so angespannt, dass ich nachts kaum schlafen kann. Wenn es dann so weit ist, habe ich die ganze Zeit im Flugzeug das Gefühl, keine Luft zu kriegen, und irgendwie Angst zu sterben. Vor allem bei Turbulenzen ist es eine Katastrophe – bei einem Flug vor ein paar Jahren habe ich die ganze Zeit geweint vor Angst. Das war mir so peinlich, seitdem bin ich nicht mehr geflogen. Erst jetzt in meinem Studium muss ich für Masterarbeit und Auslandssemester wieder fliegen. Zweimal hat mir der Hausarzt dafür Tavor2 verschrieben.
Das hat es einigermaßen erträglich gemacht, ich habe aber inzwischen Angst, davon abhängig zu werden, denn beim letzen Flug musste ich das schon Tage vorher nehmen, um die Zeit bis dahin irgendwie durchzuhalten.«
Die Patientin berichtet, dass sie die Flugangst schon lange kenne, erstmals sei sie aufgetreten, als im Alter von 14 Jahren auf einem gemeinsamen Flug ihr Onkel bei einem Asthmaanfall erstickt sei. Jetzt beim Darübernachdenken falle ihr ein, dass sie danach mehrere Monate nur flüsternd habe sprechen können. Das sei dann irgendwie von allein verschwunden. Sie habe kürzlich erstmals auch beim Autofahren auf der Autobahn so ein mulmiges Gefühl gehabt und wolle nicht, dass die Angst dahin »überschwappe« – darum, und weil die Medikamente ihr zu gefährlich seien, suche sie jetzt psychotherapeutische Hilfe.
Hauptmerkmal der spezifischen Phobien ist die massive und anhaltende Furcht vor bestimmten Objekten (z. B. Spinnen, Spritzen) oder Situationen (z. B. Fliegen mit dem Flugzeug, Gewitter), die wenn möglich vermieden oder nur unter großer Angst ertragen werden. Die Betroffenen schätzen ihre Angst selbst als übertrieben oder unbegründet ein, was aber nicht zur Beruhigung führt. Die Aufmerksamkeit der Betroffenen ist meist in einer Hyperfokussierung stark auf die rechtzeitige Erkennung der jeweiligen Gefahr und deren Vermeidung ausgerichtet. Diese Überaufmerksamkeit geht mit erhöhter Erregung einher, was dazu führt, dass selbst kleine Störungen oder allein die gedankliche Beschäftigung mit der Gefahr (zum Beispiel das Sprechen über Hunde oder fernes Bellen) bereits heftige Erregungszustände bis hin zu Panikattacken auslösen.
Häufigkeit und Typen spezifischer Phobien
Spezifische Phobien sind sehr häufig – bis zu 20 % aller Menschen erfüllen die Diagnosekriterien irgendwann in ihrem Leben, davon Frauen bis zu dreimal häufiger als Männer. Die Phobien sind trotz ihrer Häufigkeit jedoch selten der Grund für die Aufnahme einer Psychotherapie. Betroffene können trotz Vermeidung oft ein Leben ohne drastische Einschränkungen führen.
Die bis zu 200 beschriebenen Formen spezifischer Phobien werden meist in folgende Typen unterteilt (vgl. Morschitzky 2009, S. 78 ff.):
Tiertyp: