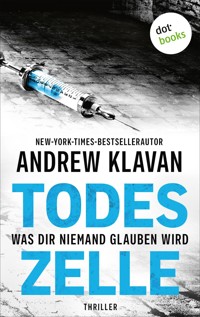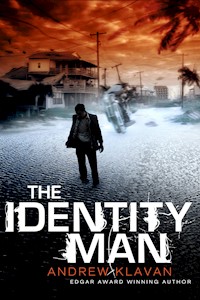5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das dunkle Herz einer Kleinstadt: Der Psychothriller »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen« von Andrew Klavan jetzt als eBook bei dotbooks. In der amerikanischen Kleinstadt Highbury bricht Panik aus, als der junge Peter Blue plötzlich Amok läuft und die örtliche Kirche niederbrennt. Psychologe Dr. Calvin Bradley versucht, zu dem offensichtlich tief verstörten Jungen durchzudringen und stellt bald fest, dass Peter immer wieder von einem Waldstück träumt, das Bradley aus seiner eigenen Jugend kennt. Neugierig geworden sucht er den Ort auf – und beobachtet seine Frau Marie in den Armen eines anderen Mannes. Als derselbe Fremde kurz darauf tot aufgefunden wird, ist im klar, dass Marie etwas damit zu tun haben muss – doch die Polizei hat bald Peter im Visier, der aus der Psychiatrie geflohen ist. Schon bald gerät Bradley in einen gefährlichen Konflikt, in dem jede falsche Entscheidung mehr als ein Leben kosten könnte … »Andrew Klavan gehört zu den originellsten Krimiautoren Amerikas.« Stephen King Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Thriller »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen« von Bestsellerautor Andrew Klavan wird alle Fans von Harlan Coben und K.L Slater begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Ähnliche
Über dieses Buch:
In der amerikanischen Kleinstadt Highbury bricht Panik aus, als der junge Peter Blue plötzlich Amok läuft und die örtliche Kirche niederbrennt. Psychologe Dr. Calvin Bradley versucht, zu dem offensichtlich tief verstörten Jungen durchzudringen und stellt bald fest, dass Peter immer wieder von einem Waldstück träumt, das Bradley aus seiner eigenen Jugend kennt. Neugierig geworden sucht er den Ort auf – und beobachtet seine Frau Marie in den Armen eines anderen Mannes. Als derselbe Fremde kurz darauf tot aufgefunden wird, ist im klar, dass Marie etwas damit zu tun haben muss – doch die Polizei hat bald Peter im Visier, der aus der Psychiatrie geflohen ist. Schon bald gerät Bradley in einen gefährlichen Konflikt, in dem jede falsche Entscheidung mehr als ein Leben kosten könnte …
Über den Autor:
Andrew Klavan wuchs in New York City auf und studierte Englische Literatur an der University of California. Danach arbeitete er als Reporter für Zeitungen und das Radio, bevor er sich ganz dem Schreiben seiner Spannungsromane widmete. Heute gilt Klavan als einer der großen Thriller-Experten der USA. Mehrere seiner Bücher sind mit dem begehrten Edgar-Award ausgezeichnet, für weitere Preise nominiert und/oder verfilmt worden.
Die Website des Autors: andrewklavan.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/aklavan/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Todeszelle – Was dir niemand glauben wird«, »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen«, »Todeszahl – Was tief begraben liegt«, »Hilfeschrei – Die Dunkelheit in uns«, »Opferjagd«, »Totenbild« und »Todesmädchen«.
***
eBook-Neuausgabe August 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2001 unter dem Originaltitel »Man and Wife« bei Forge/Tom Doherty Associates, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Verdächtige Ruhe« im Goldmann Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2001 by Andrew Klavan
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/1000 Words
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98952-257-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andrew Klavan
Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Jutta-Maria Piechulek
dotbooks.
Dieses Buch ist Ellen gewidmet.
TEIL EINS
Kapitel 1
Wenn ich sie weniger geliebt hätte, hätte es vielleicht keinen Mord gegeben. Wenn es weniger Hingabe in dieser Liebe gegeben hätte. Viele Männer führen glückliche Ehen. Zuneigung, Partnerschaft, ernste Gespräche, gemeinsame Ziele. Wenn sie mit blinder Leidenschaft beginnen, verblasst diese auch bald. Der Verstand schaltet sich wieder ein. Wenn ich sie nicht so sehr angebetet hätte, hätte ich klarer sehen können. Vielleicht. Wenn ich klarer hätte sehen können, wäre vielleicht niemand gestorben.
Das hier ist wohl so etwas wie ein Geständnis. Mit so etwas kenne ich mich ein bisschen aus. Schließlich habe ich die meiste Zeit meines Lebens als Erwachsener damit zugebracht, mir Geständnisse anzuhören, und ich kann Sie, die Sie das hier gerade lesen, gleich von Anfang an warnen. Ein Mann, der ein Geständnis ablegt, mag sich für eine Weile großtun. Er kann sich der Wahrheit vielleicht auf Umwegen nähern und dabei versuchen, sie ein wenig herauszuputzen, um seine Würde zu bewahren. Doch letztlich wird er Ihnen das Schlimmste von sich erzählen. Er hat keine Wahl. Seine Schuldgefühle und seine Einsamkeit werden ihn antreiben. Seine Hormone haben ihn voll im Griff, stärker und stärker, bis er schließlich sogar den zivilisierenden Einfluss der Heuchelei hinter sich lässt – was ihm genauso wenig nützt wie Geld einem Sterbenden. Wenn Sie genügend Geduld aufbringen, wird er Ihnen alles erzählen, Erlebtes oder Erträumtes. Kümmern Sie sich nicht um die großen Laster, um die romantischen und die, auf die er insgeheim stolz ist. Er wird Ihnen sein gesamtes, mieses kleines Menschenleben aufbürden, wird Sie durch die Abgründe seiner geifernden Fantasien zerren und Sie mit jedem wehleidigen, ekelhaften Traum von Neid und Boshaftigkeit in seinem schwachen und treulosen Herzen treffen. Was ihn immerhin zu einem gefährlichen Erzähler machen kann. Denn wie jeder andere Erzähler möchte auch er Ihr Mitgefühl haben. Er möchte, dass Sie sich mit ihm identifizieren. Er möchte, dass Sie zugeben, dass er gar nicht so viel anders ist als Sie selbst.
Das ist eine Sache. Und dann geht es um mich persönlich – schließlich bin ich nicht gerade das, was man einen Helden nennt. Fangen wir mit der physischen Erscheinung an. Ich bin eher klein, schmal, weich. Habe ein sanftes Gesicht und schütteres dunkles Haar. Meine Augen sind langweilig braun und haben – auch wenn ich in Hochform bin – Tränensäcke. Damit sehe ich älter aus als zweiundvierzig, auch ernster – und verdammt viel weiser –, als ich bin. Ich bin nicht besonders stark. Ich war nie schnell und wendig. Und mit den Frauen konnte ich es überhaupt nicht gut. Meine Tugenden, wenn ich sie überhaupt so nennen soll, gehören zu der Sorte, denen man bei einem vitalen amerikanischen Mann gemeinhin misstraut. Soll heißen, ich bin intelligent und gebildet. Ich versuche, ehrlich und mitfühlend mit den unglücklichen Menschen umzugehen, die mich aufsuchen. Da mir das Leben so viel geschenkt hat – Geld, Privilegien, Ansehen –, versuche ich, den weniger Glücklichen gegenüber großzügig zu sein. Was noch? Ich bin meiner Frau treu. Ich liebe meine Kinder. Mit anderen Worten, ich bin ein einigermaßen anständiger Bursche, aber alles andere als ein Held.
Wie auch immer – wenn Sie wissen wollen, was geschehen ist, dann bin ich der Erzähler, den Sie jetzt am Hals haben. Da ich gesündigt habe, ist es auch mein Geständnis und meine Geschichte, die ich erzähle. Auch wenn das kaum ein Trost ist – ich weiß wahrscheinlich besser als jeder andere über diese Sache Bescheid. Was auch immer ich sonst noch bin – hier und jetzt bin ich der Mann, der Marie geliebt hat. Und ich bin der Psychiater, der Peter Blue behandelt hat.
Peter Blue. Neunzehn Jahre alt. Sanft, verträumt, hart arbeitend, religiös. Und eines Samstags nachts Ende August schlug er seine Freundin, fuhr dann zur Oak Ridge Road und steckte die Trinitiy Church in Brand.
Seine Freundin Jenny Wilbur rief sofort nachdem Peter ihr Haus verlassen hatte die Polizei an. Ihre Stimme auf dem Band der Notrufzentrale klang zunächst laut und verzweifelt und tränenreich: »Er wird sich umbringen! O Gott! Wir hatten einen Streit! Jetzt will er sich eine Pistole besorgen!«
»Hat er Sie bedroht? Hat er Sie geschlagen?«, fragte Sharon Calley, die Sachbearbeiterin. »Sind Sie verletzt – hat er Ihnen irgendetwas angetan?«
Sofort wurde Jennys Stimme schwach und traurig. »Er wollte das nicht«, sagte sie. »Sie müssen ihm helfen. Bitte. Er sagt, er wird sich eine Pistole besorgen.«
Zu dem Zeitpunkt war im Recyclingcenter, der Mülldeponie an der Fair Street, wo Peter manchmal arbeitete, schon der Alarm ausgelöst worden. Der Streifenbeamte, der dem Alarm nachging, traf Jason Roberts, den Betreiber der Anlage, in seinem Büro an.
Roberts berichtete, dass jemand in sein Büro eingedrungen sei und den Safe aufgebrochen habe. Tatsächlich fehlte einzig und allein sein alter Smith & Wesson Revolver Model 10.
Doch schließlich war es Orrin Hunnicut, der Polizeichef von Highbury, der über Peter stolperte. Ich werde Hunnicut kurz beschreiben, weil er in dieser Geschichte eine große Rolle spielt.
Erst mal war der Mann an sich schon gewaltig. Er war an die einsfünfundneunzig groß. Hatte im College Football gespielt und besaß mit dreiundsechzig noch immer diese Statur. Breite Schultern, massige Arme, ein draufgängerischer Brustkorb und ein noch draufgängerischer vorgewölbter Bauch. Kein Hals. Sein Kopf saß einfach wie ein massiver Klotz auf diesem gigantischen Körper. Das Gesicht war irgendwie fleischig und gleichzeitig steinhart. Blasse, rötliche Haut ums Kinn herum. Dünne Lippen und kleine harte Augen. Er hatte kurz geschnittenes Haar, das abstand wie ein zorniges Feuer, das aus seinem Kopf herauszuschlagen schien.
Was ich sagen will ist: Er war ein harter Knochen. Und in letzter Zeit war er sogar noch härter geworden. Seine Frau war nach fünfunddreißig Ehejahren in diesem Winter gestorben. Ein freundliches, aber reizbares kleines Geschöpf, das einfach so dahinschwand. Meine Frau hatte im Rahmen ihrer Kirchenarbeit geholfen, sie bis zu ihrem Ende zu pflegen. Seit ihrem Tod jedenfalls war sein Gesicht noch versteinerter als zuvor. Und die harten Augen schienen noch kleiner geworden zu sein. Sie waren nun kaum mehr als schwarze Punkte, die aus der Tiefe des rötlichen Steins blitzten.
Und seit dem Tod seiner Frau verbrachte Chief Hunnicut, obwohl es in Highbury kaum Straftaten gab, fast seine gesamte Zeit auf dem Polizeirevier. Deshalb fuhr er auch an jenem Samstag so spät nach Hause, etwa um Mitternacht herum. Er fuhr in seinem Dienstwagen, einem Chevrolet Blazer, langsam über die mit Laub bedeckte Oak Ridge Road nach Hause. Es war eine warme feuchte Nacht. Dichte Wolken bedeckten den Himmel. Keine Sterne, aber ein heller dunkelsilberner Fleck im Südwesten, wo sich der Vollmond versteckt hatte. Der Turm der Trinity Church hob sich gegen diesen Fleck ab, und der Glockenturm und die Verschalung waren in diesem Widerschein deutlich sichtbar. Da der Rest der Kirche im Schatten der umstehenden Bäume stand, konnte Hunnicut den seltsamen rosafarbenen Schimmer ausmachen, der hinter den nach Osten hinausgehenden Fenstern wogte.
Mit quietschenden Reifen hielt er am Straßenrand. Eine fleischige Hand hob das Funkmikrofon an seine Lippen, noch während er aus dem Geländewagen mit Allradantrieb ausstieg.
»Hier ist Chief Hunnicut, schickt die Feuerwehr zur Oak Ridge. Bei uns hier brennt die gottverdammte Kirche.«
Was als Nächstes geschah, erfuhr ich zum Teil aus dem Polizeibericht, zum Teil von Hunnicut selbst und zum Teil auch aus seiner komischen, aber vielleicht nicht ganz wahrheitsgemäßen Schilderung des Staatsanwalts. Was ich hörte, war Folgendes:
Hunnicut ging mit donnernden Schritten zur Kirche hinauf. Er versuchte, die Doppeltür zu öffnen. Vergeblich; sie war verschlossen. Also nahm er Anlauf und rammte sie ein. Mit einem einzigen Stoß seiner gewaltigen Schulter. Die Türen flogen nach innen. Und Hunnicut flog hinterher.
Der Anblick, der sich ihm bot, hätte einen schwächeren Mann als ihn erzittern lassen. Zwei Kirchenfahnen, die an den vorderen Säulen hingen, standen in Flammen, so dass der Mittelgang von zwei Feuersäulen eingerahmt war. Zwischen ihnen fing das riesige goldene Kreuz an der Wand über dem Altar den Schein der Flammen ein und loderte dunkelrot auf. Dicker Rauch stieg darunter auf, breitete sich über den Kirchenbänken aus und zog zu den Dachsparren hinauf.
Einen Moment lang blieb unser Chief reglos und ungeschlacht auf der Türschwelle stehen und warf dem Feuer einen einschüchternden Blick zu. Und dann tauchte unter dem glühenden Kreuz und aus den Tiefen des Rauchs, eingerahmt von Dunkelheit und dem prasselnden Feuer, die Gestalt eines Mannes auf. Der große, schlanke Peter Blue trat durch das brennende Portal. Hunnicut konnte den wilden Ausdruck auf seinem Gesicht erkennen. Er konnte auch die Pistole sehen, die Peter umklammerte.
»Verschwinden Sie!«, rief Peter. Er hob die Pistole. »Hauen Sie verdammt noch mal ab!«
Das reichte. Hunnicut stampfte durch den Mittelgang auf ihn zu, schob sich ungerührt durch das Feuer, riss Peter den Revolver aus der Hand, und ohrfeigte den Jungen – peng, peng – zwei Mal.
»Du bedrohst mich mit einer Pistole, du kleiner Scheißer?«, schrie er, während die Flammen um sie herum loderten. »Ich werde dir damit deinen gottverdammten Hintern abwischen!« Er packte Peters Haare am Hinterkopf, zerrte ihn auf die Zehenspitzen, und führte ihn durch den Mittelgang zur Tür. »Du bist verhaftet wegen Brandstiftung und dem ganzen Scheiß, du Vollidiot! Bis du aus dem Gefängnis rauskommst, sind alle, die du mal gekannt hast, längst abgekratzt!«
Und dann schleuderte er ihn wie eine Windmühle aus der brennenden Kirche hinaus ins Freie.
Hunnicut hielt, was er versprochen hatte. Die Polizei beschuldigte Peter der Brandstiftung, der tätlichen Bedrohung, des nächtlichen Einbruchs, des Diebstahls, der Entwendung einer Feuerwaffe, der Bedrohung eines Polizeibeamten und der fahrlässigen Gefährdung. Theoretisch hatte der Junge an diesem Samstagabend mehr als fünfzig Jahre Gefängnis vor sich.
Die Bullen schnappten ihn sich. Dann sperrten sie ihn in eine der Zellen auf dem Polizeirevier. Es war geplant, ihn am Montag zu einer formellen Anklage vor das höhere Gericht in Gloucester zu bringen. Zur Festsetzung der Kaution, der Gerichtsdaten und so weiter. Nur kam es anders.
Peter hatte es abgelehnt, ein Telefongespräch zu führen, doch Pfarrer Michael Fairfax von der Trinitiy Church wurde von seiner Verhaftung unterrichtet. Sobald Fairfax sicher war, dass das Feuer in seiner Kirche gelöscht worden war, eilte er zum Polizeirevier hinüber und verlangte, den Gefangenen zu sehen. Einer der Polizeibeamten von Highbury begleitete ihn zum Zellenblock.
Die beiden fanden Peter nur mit einer Unterhose und einem T-Shirt bekleidet vor. Er war auf sein Bett gestiegen und hatte ein Hosenbein am Fenstergitter festgebunden. Dann hatte er sich das andere Hosenbein um den Hals geknotet. Und dann war er von der Pritsche heruntergesprungen.
Als der Polizeibeamte und der Geistliche schreiend in die Zelle stürzten, drehte sich Peter in der Luft, einmal rechts herum, einmal links herum, und wurde dabei langsam stranguliert.
Kapitel 2
In Highbury gibt es zehn Kirchen, von denen zwei der episkopalischen Glaubensrichtung angehören. Es ist eine anerkannte, wenn auch unausgesprochene Tatsache, dass die Trinitiy Church, die Kirche, die Peter angezündet hat, den Angehörigen der Arbeiter- und Mittelklasse im Westen der Stadt vorbehalten ist, während die Incarnation Church, die im Stadtpark steht, überwiegend von Reichen und der sonstigen gesellschaftlichen Elite besucht wird. Am Sonntagmorgen, nach Peters Inhaftierung und Selbstmordversuch, ging ich mit meiner Frau Marie in die Incarnation Church.
Als ich Marie vor fast fünfzehn Jahren kennen lernte, war sie streng genommen überhaupt nicht religiös. Eigentlich war sie einfach eine orthodoxe, leicht verrückte Anhängerin der Ersten Kirche der Verrückten. Sie stürzte sich sofort auf alles Außergewöhnliche, Neue und spirituell Exotische, das damals auf den Markt kam. Die Heilkraft der Pyramiden, die Weisheit der untergegangenen Stadt Atlantis, Außerirdische in Eden, druidische Steinkreise in Stonehenge – ich kann mich nicht einmal mehr an die Hälfte des Zeugs erinnern, an das sie geglaubt hat. Das alles war Teil ihres ungeheuren Charmes zu jener Zeit. Doch kaum waren wir verlobt, ließ sie das alles sausen. Einfach so. Sie ging auf direktem Weg aus diesem Land der Verrückten zu einem umfassenden, ungetrübten und meiner Ansicht nach sogar freudigen Glauben an die Rituale und Lehren der anglikanischen Hochkirche über. So war Marie, und so war ihre Hingabe. Und so war auch ihre Vorstellung von Liebe und Ehe. Mein Gott wurde ihr Gott – was einigermaßen drollig war, da mein Gott seit meiner frühen Kindheit nicht mehr mein Gott gewesen war.
Aber egal. Marie begann zur Kirche zu gehen, und ich ging normalerweise mit. Einerseits machte es sie glücklich, mich bei sich zu haben, andererseits gefiel es mir auch – mir wurde warm ums Herz bei diesen Erinnerungen an meine Kindheit. Und um ganz ehrlich zu sein, schadete meiner Stellung in der Stadt oder dem Ruf meiner Klinik nicht, dass ich für einen regelmäßigen Kirchgänger gehalten wurde. Aber das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund – der wahre Grund – warum ich mit meiner Frau zur Kirche ging, war, weil ich es unglaublich sexy fand, ihr beim Beten zuzusehen.
Sie war jetzt sechsunddreißig und nicht mehr die grazile Zwanzigjährige, in die ich mich Hals über Kopf verliebt hatte. Sie war ein Sonnenstrahl an diesem Ort. In dieser aus alten Steinen im englischen Stil gebauten Kirche, die ich so gut wie keine andere kannte. Solange ich mich erinnern kann, war sie jeden Sonntag vollgestopft mit den verknöchertsten angesehensten Verknöcherten von Connecticut. Eine dicht gedrängte selbstzufriedene Menge von Damenhüten und kostspieligen Männerhaarschnitten – und dann die einfache, treuherzige Marie. Sie leuchtete einfach. Vor allem, wenn sie sang. Wenn sie so dastand, konnte ich ihre Formen unter dem geblümten Sommerkleid erkennen. Sie hielt ihr geöffnetes Gesangbuch in den schmalen Händen. Sie hob die Augen – hellblaue Augen –, die noch immer so freundlich und so gläubig waren. Und ihre strohblonden Haare wirkten durch die silbernen Strähnen darin nun noch heller. Und sie hatte die süßesten Lachfältchen in ihren Mundwinkeln. Und sie sang mit dieser hohen, dünnen Stimme: »Herr, bleibe bei mir. Denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.« Und ich dachte an den leisen keuchenden Schrei, den sie manchmal von sich gab, wenn ich in ihr war, an den leise verklingenden Schrei, als würde sie tiefer und tiefer hinabsinken. Und aus dem Augenwinkel sah ich, dass ihre dünnen Lippen sich um die Worte herum formten, und ich dachte daran, dass sie mir morgens immer meinen Kaffee brachte und dann kichernd und murmelnd meinen Bauch immer weiter hinunter mit Küssen bedeckte, so dass der Kaffee unberührt auf dem Nachttisch dampfte und schließlich kalt wurde. »Wo fänd ich Hilfe, wärest du nicht hier?«, sang sie. »Hilf dem, der hilflos ist. Herr, bleibe bei mir!«
Am Ende des Liedes fühlte ich mich in meiner Unterhose etwas beengt. Als sich die Gemeinde polternd setzte, nutzte ich die Gelegenheit, um näher an sie heranzurücken, damit ich meinen Oberschenkel an ihren drücken und hin und wieder einen Hauch ihres Parfums und ihres Shampoos erhaschen konnte.
Es entstand eine Pause, in der gehustet und sich geräuspert wurde. Pfarrer Andrew Douglas stieg zur hölzernen Kanzel hinauf und schickte sich an, mit seiner Predigt zu beginnen.
Marie neigte den Kopf zu mir. Ich spürte ihre Haare an meiner Wange, fing ihr Lächeln auf und sah, dass ihre Augen glitzerten.
»Ich weiß genau, was Sie denken, Mr. Calvin Bradley«, flüsterte sie.
Und als ich aufstöhnte, zog die alte Dame hinter mir die Augenbrauen so hoch, dass ihr fast der Hut vom Kopf fiel.
Als wir aus der Kirche kamen, mussten wir in dem plötzlichen Sonnenlicht blinzeln. Die Feuchtigkeit der Nacht war von einer Serie von Gewitterschauern fortgespült worden, die kurz vor dem Morgengrauen niedergegangen waren. Der Tag war hell und trocken, ließ aber schon eine leichte herbstliche Kühle spüren. Mit Marie an der Hand hielt ich oben auf der Kirchentreppe inne und sah mich um. Der Himmel war sehr blau, das Gras im Stadtpark sehr grün, und die Ahornbäume waren noch immer üppig belaubt. Die fünf Kirchen, die um den Park herum standen, leuchteten weiß durch die Zweige. Das war das Herz von Highbury, absolut idyllisch.
Genau im Zentrum der Szenerie stand Pfarrer Fairfax. Gekleidet in sein kirchliches Schwarz und drohend wie ein Bestatter. Er sah mich an und machte mir ein Zeichen.
»Ich werde die Kinder holen«, sagte Marie. Sie ging in Richtung Sonntagsschule davon, die sich im Untergeschoss befand. Und ich stieg die Treppe hinab und ging zum Pfarrer der Trinity Church hinüber.
»Lassen Sie uns einen Spaziergang machen, Cal«, sagte er. Wir gingen auf dem Bürgersteig in Richtung Stadtmitte.
Ich hatte schon von dem Feuer gehört. Pfarrer Douglas hatte der Kirchengemeinde davon berichtet. Er hatte gesagt, dass ein Junge verhaftet worden sei, der Teilzeitgärtner und Aushilfsarbeiter der Kirche. Er hatte uns versichert, dass es sich nicht um ein Verbrechen aus Hass und auch nicht um einen Anschlag aus religiösen Motiven handelte. Einfach ein verstörter Junge aus einem zerrütteten Elternhaus. Die Fahnen und die Polster der Kirchenbänke hatten den größten Schaden durch den Rauch und die Flammen davongetragen, sagte er. Das klang alles andere als bedrohlich.
Doch während wir nebeneinander hergingen, konnte ich sehen, dass Fairfax bestürzt war. Was mich überraschte, weil er normalerweise kaum zu erschüttern ist. Ein gepflegter, gesunder und kompakter Mann in den Fünfzigern. Silbergraues Haar und ein vorspringendes Kinn. Der Typ des muskulösen Christen. Der ständig Komitees gründete und Wohltätigkeitsaktionen in Gang setzte, solche Sachen eben. Ein gewiefter Politiker, der das Talent besaß, Kontakte zu knüpfen und sie gut zu nutzen. Ein Mann von großem Einfluss in der Stadt.
Heute jedoch sah er, wie schon gesagt, verunsichert aus. Unrasiert, mit feuchten Augen und vor Schlaflosigkeit schlaffen Gesichtszügen.
»Das wird alles übermäßig aufgeblasen«, sagte er. Wir schlenderten langsam Schulter an Schulter an schönen alten Häusern mit weißen Schindeln vorbei. »Und es liegt nur an Chief Hunnicut. Er ist einfach fuchsteufelswild darüber, dass Peter – der Junge, Peter Blue – ihn mit einer Pistole bedroht hat.«
»Tja, das war aber auch eine blöde Idee«, sagte ich.
»Eine Atombombe könnte Hunnicut vielleicht aufhalten, aber auf eine Pistole scheißt er einfach.«
»Oh ... Hunnicut!« Fairfax’ Lippen bewegten sich ärgerlich. »Seit seine Frau gestorben ist, ist er einfach nur noch voller Wut. Er spuckt förmlich Feuer. Jeder Blödmann, der in meiner Stadt eine Kirche niederbrennt und eine Waffe gegen einen Gesetzeshüter richtet ...‹ und so weiter und so weiter. Er klingt so, als würde die Zivilisation, wie wir sie kennen, zerstört, wenn dieser arme, verstörte Neunzehnjährige nicht ins Gefängnis kommt.«
»Also, das Ende der Zivilisation würde mir sicherlich den Nachmittag verderben ...«
Fairfax lachte nicht. »Er kann nicht ins Gefängnis, Cal«, sagte er. Er blieb stehen. Berührte meine Schulter, als auch ich anhielt. Er sah mir mit diesen erschöpften Augen tief in meine. »Er kann nicht ins Gefängnis. Er wird sich umbringen. Wirklich. Er war in der vergangenen Nacht schon nahe dran. Es war schieres Glück, dass wir rechtzeitig kamen und ihn gerettet haben. Er ist jetzt im Krankenhaus, aber er schwört, dass er innerhalb einer Woche tot sein wird, wenn man ihn ins Gefängnis zurückbringt. Und ich glaube ihm.«
Ich hob meine Schultern. »Michael, er hat eine Kirche angesteckt, eine Waffe gezogen ... Wie kann man ihn vor dem Gefängnis bewahren?«
»Ich kann es nicht«, sagte Fairfax. »Sie können es.«
Es war gerade so angenehm auf der State Street. Der Himmel war klar, und alle Vögel sangen. Die Kirchgänger schlenderten nach Hause, und ein vereinzelter Autofahrer winkte uns zu, als er vorbeifuhr. Wir hatten uns dem Geschäftsviertel genähert und standen vor dem alten Haus, in dem Paul Cummings seinen Secondhand-Buchladen führte, eines meiner Lieblingsgeschäfte. Ich kann nicht behaupten, dass ich eine Vorahnung hatte, nicht einmal einen Hauch davon. Ich war einfach nur ein bisschen bestürzt, mehr nicht.
»Ich?«, fragte ich. »Was kann ich denn tun?«
Doch Fairfax hatte das auf seine übliche Art schon alles organisiert. David Robertson, ein hervorragender Strafprozessanwalt, gehörte zu seiner Kirchengemeinde. Er hatte zugestimmt, Peter zu verteidigen. Der Staatsanwalt, also der Ankläger, war Hank O’Connor. Er spielte mit Fairfax jeden zweiten Samstag Golf. Und er hatte zugesagt, dem Gericht zu empfehlen, sich zurückzuhalten, wenn Peter sich einer Behandlung unterziehen würde. Und schließlich war der Bezirksrichter in diesem Jahr Robert Tannenbaum, der Fairfax nicht nur in mehreren Komitees half, sondern auch ein alter Freund meines Vaters war. Sie spielten noch immer gelegentlich per E-Mail Schach miteinander.
»Das Problem ist«, sagte Fairfax, »dass Hunnicut bei der Law-and-order-Bande so beliebt ist. Das war schon immer so. Viele Freunde, viele Kontakte. Und er ist hart. Wenn er so auf dem Kriegspfad ist wie jetzt, kann er eisern sein. Er wird den Kirchenbrand aufbauschen und ihn in der Presse als ein Verbrechen aus Hass darstellen. Er wird es so hindrehen, als hätte Peter ihn wirklich erschießen wollen.«
»Also ...«
»Ohne Hilfe wird Peter überhaupt keine Chance haben. Ich kann Hank O’Connor nicht bitten, einen Polizisten mordenden, Kirchen niederbrennenden Psychopathen zu schonen. Hank will in ein paar Jahren für den Kongress kandidieren ...«
Er verstummte, und ich konnte sehen, wie das politische Schachspiel hinter seinen müden Augen ablief. »Und?«, fragte ich.
Er blinzelte und richtete sich auf. »Sie«, sagte er. »Cal, Sie sind einer der am meisten respektierten Männer in der Stadt.«
»Pah«, machte ich. »Sprechen Sie weiter.«
»Es stimmt. Die Leute haben Ihren Vater geachtet. Jeder ist verrückt nach Marie. Und jeder weiß, dass Sie so gradlinig sind wie ein Pfeil.«
»In Ordnung, in Ordnung. Genug der Schmeicheleien. Also was denn nun?«
»Wenn Sie mit Peter sprechen würden. Ihn befragen und beurteilen, was auch immer. Wenn Sie empfehlen würden, dass Peter besser eine Behandlung bekommen sollte als einen Gefängnisaufenthalt. Wenn Sie vielleicht sogar anbieten würden, ihn eine Weile im Manor aufzunehmen. O’Connor könnte das gut verwenden. Selbst Hunnicut würde sich vielleicht zurückhalten, wenn die Empfehlung von Ihnen käme.«
»Uff! Ich weiß nicht. Ich meine, ich fühle mich geschmeichelt, aber ...« Doch jetzt stellte ich auch ein paar Überlegungen an. Das Manor – meine Klinik – war von Spenden abhängig. Ich war mir nicht sicher, ob ich es riskieren wollte, dass Hunnicut auch Stimmung gegen mich machte. Und das alles für einen Jungen, der sich, schlicht und ergreifend gesagt, ein wenig Zeit hinter Gittern verdient hatte.
Fairfax schien zu wissen, was ich dachte. »Cal«, sagte er und beugte sich mir so nahe zu, dass ich seinen warmen Atem fühlen konnte. »Sie kennen mich. Ich würde um so etwas nicht für jeden bitten. Dieser Junge, dieser Peter Blue – hat irgendetwas Außergewöhnliches an sich.«
»Etwas Außergewöhnliches? Was verstehen Sie darunter?«
»Ich ... ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist einfach – wie eine Aura, die ihn umgibt. Eine geistige Aura. Wirklich. Anne und ich haben es beide gespürt. Es ist etwas – was ich noch nie zuvor erlebt habe. Ich meine, manchmal, wenn er irgendwelche einfachen Arbeiten bei uns verrichtete, im Garten arbeitete ... musste ich einfach zu ihm hinausgehen, verstehen Sie? Einfach mit ihm sprechen. Einfach in seiner Nähe sein ...« Er brach mit einem verlegenen Lachen ab.
Schaute weg. »Ich sollte so was nicht zu einem Psychiater sagen. Gott weiß, was Sie jetzt denken mögen.«
Was ich dachte? Nun ja, ich dachte, dass ich kaum eine Wahl hatte. Wenn dieser Junge so großartig war, wenn er nur verwirrt gewesen war, einfach nur einen Fehler gemacht hatte – und wenn obendrein auch noch ein Selbstmordrisiko bestand, wenn sein Leben in Gefahr war, also, was sollte ich da schon machen? Zum Teufel mit Hunnicut.
»Klar, Michael«, sagte ich. »Ich meine, natürlich, ich spreche gern mit ihm.«
Daran, wie sich sein Gesicht entspannte und wie er mir die Hand schüttelte, sah ich, dass dieser Junge ihm wirklich wichtig war. »Das ist großartig«, sagte er. »Das ist einfach großartig.«
»Aber ich kann nichts versprechen ...«
»Nein, nein. Mehr möchte ich gar nicht. Sprechen Sie einfach nur mit ihm, beurteilen Sie ihn und handeln Sie nach Ihrem Gutdünken. Das ist großartig. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.«
»Also ... mir kommt es so vor, als wäre Ihnen dieser Junge wirklich wichtig. Sie scheinen ja all Ihre Verbindungen aktiviert zu haben – außer Gott.«
»Ach, Sie können mir glauben«, sagte der Priester, während er mir noch immer die Hand schüttelte, »Sie können mir glauben, dass ich Gott als Ersten angerufen habe.«
Als ich »Gott« sagte, hatte ich das natürlich ironisch gemeint. Da in dieser Geschichte alle möglichen Kirchen und Priester vorkommen, ganz zu schweigen von Peter Blue, und da so viel von Gott die Rede sein wird, möchte ich das von Anfang an klarstellen. Als ich noch ganz klein war, habe ich geglaubt. Da mein Vater Priester der Incarnation Church war, habe ich natürlich geglaubt. Doch als ich zwölf war – zu einer Zeit also, als ich ihn und auch meine Mutter verstand –, war ich ein begeisterter Wissenschaftler mit Mikroskop, Chemiebaukasten und einer radikalen Philosophie.
»Alles, was geschieht, kann naturwissenschaftlich begründet werden«, verkündete ich meiner Schwester Mina zu dem Zeitpunkt. Sie war sieben Jahre älter als ich, schon auf dem College und der Inbegriff von Blasiertheit und die Quelle irdischer Weisheit. Sie war wohl damals während irgendwelcher Ferien zu Hause, lag auf dem Sofa und blätterte im Gebetbuch der anglikanischen Kirche herum. Das brachte mich in Fahrt. »Alles ist nur eine Kette von Ereignissen«, erklärte ich. »Mehr nicht.«
»Hmm – Materialismus«, murmelte sie in die Buchseiten hinein. »Das ist eine tolle Idee – aber woraus besteht sie?«
Ich überging das. Mina gab immer solche rätselhaften Äußerungen von sich, und ich war schließlich damit beschäftigt, mir meinen Standpunkt zu erarbeiten. »Es gibt einfach keinen Einfluss von außen, habe ich damit gemeint. Keine Wunder oder – oder Gott und Ähnliches.«
Mina legte sich das Buch auf die Brust und sah mich liebevoll an. »Für alles gibt es eine vernünftige Erklärung, Baby, wenn du das meinen solltest«, sagte sie. »Für alles gibt’s eine vernünftige Erklärung – und daran glauben manche Menschen.«
Was ich damit sagen will: Ich habe mein ganzes Leben lang an die Wahrheit der vernünftigen Erklärung geglaubt. Ich möchte das ganz klar festhalten, weil Sie wissen sollen, dass ich mich dem Fall Peter Blue so genähert habe – als Wissenschaftler. Und daran habe ich mich auch bis zum Schluss gehalten, trotz des beklemmenden Gefühls einer gewissen Schicksalhaftigkeit, das mich häufig im Umgang mit dem Jungen beschlich; trotz des Anflugs von Zufälligkeit und Unerklärlichem, das alles zu durchdringen schien – nicht nur während des Albtraums, der folgte, sondern von dem Moment an, als ich ihn kennen lernte, am Spätnachmittag jenes Montags.
Kapitel 3
Er stand niedergeschlagen mitten im Raum, als ich hereinkam. Reglos, mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf. Als ob er nicht aus seiner Gefängniszelle gerettet worden wäre. Als sei er tatsächlich ein Gehängter.
Sobald ich über die Schwelle trat, richtete er sich auf und sah mich an. Er sprach, wie es schien, direkt in meine Gedanken hinein.
»Willkommen zu meinem Selbstmord«, sagte er. »Schließen Sie sich den anderen an.« Und er lächelte strahlend.
Er war ein verblüffender Anblick. Groß, schlaksig, doch mit flüssigen eleganten Bewegungen. Ein sensibles Gesicht mit feinen Gesichtszügen, fast weiblich unter dem langen schwarzen Haar, fast schön, wenn er dieses blendende Lächeln zeigte. Doch seine grauen Augen verrieten auch einen wilden, herausfordernden, maskulinen Geist. Etwas Wissendes, etwas Tragisches und gleichzeitig Ausgelassenes. Willkommen zu meinem Selbstmord. Er hatte etwas an sich, was mir entnervend vertraut war. Ich wusste damals noch nicht, wie ich das einordnen sollte.
Ich trat näher und streckte ihm die Hand entgegen. »Ich bin Doktor Bradley.«
Wieder lächelte er das gleiche strahlende Lächeln. Er schüttelte mir die Hand und wedelte mit der anderen Hand fröhlich in der Luft herum – eine wegwerfende Geste, als wollte er sagen: Sehen Sie nicht auch, wie lächerlich das Ganze ist?
»Und ich ...«, verkündete er mit einer komischen Gebärde. »Ich bin Peter Blue.«
Wir befanden uns in einem Behandlungszimmer in der psychiatrischen Sicherheitszone des staatlichen Krankenhauses von Gloucester. Ein sehr deprimierender Raum. Man hatte sogar eine psychologische Beraterin eingestellt und von ihr Vorschläge zur Verschönerung der Räumlichkeiten erbeten. Sie schien der Ansicht gewesen zu sein, dass man die Patienten in einen Zustand der Heiterkeit versetzen sollte. Die zitronengelben Wände wirkten angeblich beruhigend. Die schrecklichen Bilder – Landschaftsdarstellungen in Pastellfarben – sollten einen wohl vergessen lassen, dass man in diesem Irrenhaus eingesperrt war und nicht wie ein Rehkitz durch Wiesen und Wälder springen konnte. Dann stand da noch ein riesiger Schreibtisch aus Holzimitat herum, der offenbar Autorität ausstrahlen sollte, dazu ein wuchtiger Sessel mit hoher Lehne für den Arzt und ein lächerlich niedriger Patientensessel. Und das alles war von einer tödlichen Blässe durch die unerträglichen Leuchtstofflampen an der Decke. Ein Fenster gab es auch, doch es war vergittert – und außerdem ging es nur auf einen kleinen Krankenhaushof hinaus. Es drang kein direktes Sonnenlicht herein. Der Raum war einfach nur schrecklich.
Ich rollte den Sessel hinter dem Schreibtisch hervor. Mehr konnte ich nicht tun. Ich stellte ihn so hin, dass ich Peter direkt anschauen und meinen Notizblock mit der rechten Hand auf der Schreibtischplatte festhalten konnte. Mit seiner großen Statur hatte er sich mittlerweile auf dem Sessel niedergelassen. Und er hatte die Beine schützend übereinandergeschlagen. Während ich meine Papiere sortierte, fiel mir auf, dass er mit seiner Hand an den Kragen seines Sweatshirts griff, ein geistesabwesender Versuch, die verblassende Quetschung an seinem Hals zu verbergen. Er schien seine Hand nur mit Mühe auf die Sessellehne hinunterzuzwingen. Danach starrte er mit ausdruckslosem Blick in eine Ecke und schien in Gedanken versunken.
Ich lehnte mich zurück und hustete einleitend. »Wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fragte ich ihn.
Er schaute verträumt auf und schien überrascht zu sein, dass ich überhaupt da war. »Mein Anwalt hat Sie zu mir geschickt, nicht wahr? Sie sollen herausfinden, ob ich therapierbar bin.« Sein Selbstmordversuch hatte ihn nicht heiser werden lassen. Seine Stimme war wohlklingend, tief und sanft. »Wissen Sie, es ist schon immer eines der größten Ziele in meinem Leben gewesen, therapierbar zu werden«, fuhr er ruhig fort. »Als ich noch ein Kind war, habe ich mir immer gesagt: ›Eines Tages möchte ich erwachsen und therapierbar sein‹.«
»Na, dann kann ja heute dieser Glückstag sein.«
Ich überraschte ihn mit dem Scherz – und er überraschte mich mit seinem Lachen. Es war ein plötzlicher und wunderbarer Klang. Tief und satt und beinahe kindlich in seiner Spontaneität. »Der Glückstag. Das ist sehr gut. Der Glückstag.«
»Also, deswegen bin ich hier«, sagte ich. »Was macht eigentlich ein so netter Bursche wie Sie in einem solchen Drecksloch?«
»Nun ja ... Ich habe meine Freundin geschlagen und eine Waffe gestohlen und eine Kirche abgefackelt. Und ich habe versucht, mich im Gefängnis zu erhängen. Wo sonst sollte ich denn jetzt sein?«
»Möchten Sie mir erzählen, wie all das geschehen konnte?«
Es entstand eine Pause – ein entscheidender Moment: Wollte er es mir erzählen? Ein staatlicher Seelenklempner hatte sich am Morgen schon an ihm versucht, also konnte er jetzt gut argwöhnisch sein. Seymour Rankel hatte einen erheblichen depressiven Schub auf Achse Eins diagnostiziert – eine ziemlich einfache Erkenntnis bei einem Burschen, der eine Schlinge um den Hals hatte. Doch auf Achse Zwei hatte er eine asoziale Persönlichkeitsstörung vermutet. Das ist nichts besonders Gutes. Wir behalten uns diese Kategorie normalerweise für die dickschädeligen Bösewichte vor. Sie bedeutet nämlich Gewalt, Verbrechen, eventuell Drogenkonsum. In Rankels vorläufigem Bericht waren die Worte Keine Reue dreimal unterstrichen.
Na ja, ich kenne Rankel. Er ist ein fauler, kleingeistiger Schmarotzer. Seine Diagnose war Mist. Da war ich mir jetzt schon sicher.
Die Pause dauerte an. Peter Blue musterte mich mit seinen blassen Augen und diesem Ausdruck verhängnisvoller Heiterkeit – als betrachte er nicht nur mich, sondern auch gleichzeitig das gesamte traurige und dumme Panorama des Lebens. Dieser Ausdruck erinnerte mich wirklich an etwas – an jemanden. Er beunruhigte mich.
Jetzt nahm er sein eines Bein herunter. Drehte sich in seinem Sessel so, dass er mir noch direkter gegenübersaß. Er hatte eine Entscheidung getroffen.
»Jenny wehzutun, war unentschuldbar«, sagte er leise. Er hob das Kinn mit einem Hauch von trotzigem Stolz. »Ich weiß, dass Sie mir nicht glauben werden, aber es war ein Unfall. Sie geht im nächsten Monat weg, auf dieses College in Ithaca, New York – nach Cornell. Und das bricht mir das Herz, weil ich sie so liebe, verstehen Sie. Ich weiß, dass sie dort neue Leute kennen lernen wird, die gebildet und intellektuell sind. Und sie wird nicht mehr mit einem Mann ausgehen wollen, der sich mit Gelegenheitsarbeiten durchs Leben schlägt. Der auf der Mülldeponie arbeitet.«
Ich hörte ihm unentwegt zu und beobachtete ihn weiter genau. Ich kann nicht behaupten, dass er mir auf Anhieb sehr vergeistigt vorkam. Doch für jemanden, der sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlug, war er sicherlich intelligent und fähig, sich klar auszudrücken.
Er sprach weiter. »Jenny und ich haben eine dieser Diskussionen gehabt. Sie wissen schon, die, die sich zu einem Streit entwickeln, noch ehe man es überhaupt merkt. Ich wollte nicht, dass sie geht. Jenny nahm meinen Arm, um mich zu besänftigen. Und natürlich wollte ich das genauso wenig. Also hob ich den Arm, um sie abzuschütteln.« Er zeigte mir, wie er den Arm gehoben hatte – nämlich schnell. »Mein Handrücken knallte ihr ins Gesicht, und sie fiel nach hinten und schlug mit der Schulter gegen die Tischkante.« Ihn schauderte, und er runzelte die Stirn. »Ich weiß sowieso, dass Sie mir nicht glauben, aber Sie können sie fragen. So etwas hat es bei uns noch nie zuvor gegeben. Es war unverzeihlich.«
»In Ordnung«, sagte ich. »Und was geschah dann? Sind Sie dann zur Mülldeponie gegangen und haben Ihrem Arbeitgeber die Pistole gestohlen?«
»Ja. Ich habe daran gedacht, mich zu erschießen.« Er sagte es mit einem Seufzer, mit einstudierter Lässigkeit. »Ich hatte mich noch nicht dazu entschlossen, aber ich habe darüber nachgedacht.«
»Weil Jenny ins College gehen würde.«
»Weil sie mich verlassen würde – na ja, ins College gehen würde, ja. Ich weiß, dass man von mir erwartet, zu denken, wie wunderbar das für sie ist, was für eine wundervolle Möglichkeit, und ich glaube auch, dass ich so denke. Ich glaube es. Ich meine aber, wenn es um den wahren Menschen geht, ist das College ganz schöner Mist. Und da wir gerade beim Thema sind, ich halte die Psychiatrie auch für einen ganz schönen Mist.« Er lachte. »Das nur nebenbei.«
Ich antwortete mit einem flüchtigen Lächeln. »Wie sieht es mit der Religion aus? Ist die auch Mist?«
»Warum fragen Sie mich das? Oh ja, natürlich, ich verstehe: weil ich die Kirche in Brand gesteckt habe. Nein. Nein, das hatte nichts damit zu tun. Ich glaube nicht, dass die Religion Mist ist. Ich glaube nur, das sie irgendwie traurig ist. Also, ich kann jederzeit im Wald stehen, und Gott wird durch meine Adern fließen, und Er und ich sind total miteinander verbunden.« Er erzählte mir das so natürlich, dass mir erst eine oder zwei Sekunden später aufging, was er gesagt hatte. Er hatte das so gesagt, wie ein anderer mir mitteilen würde, dass er gut zeichnen oder Musik vom Blatt spielen könne. Er konnte im Wald stehen und spüren, wie Gott durch seine Adern floss. Das war etwas, das er einfach tun konnte. Ich hatte damals keine Zeit, darüber nachzudenken, weil er schon weitersprach. »Aber in der Kirche ... Na ja, ich bin in die Kirche gegangen. Hin und wieder. Aber es hat sich für mich herausgestellt, dass die Kirche der einzige Ort auf Erden ist, wo ich Gottes Gegenwart überhaupt nicht spüren kann. Man betet dort und singt und setzt sich und kniet nieder und steht wieder auf. Und ich glaube, dabei denkt man: Ich will mehr. Irgendetwas! Biiiiitte!« Wieder dieses Lachen, voller Freude. »Es ist fast gespenstisch, dass es dort so leer ist. Es ist fast so, als läge man in einem Sarg. Außer ...« Er hob einen Finger und presste ihn sich auf die Lippen. »Außer wenn Annie manchmal singt.«
»Annie? Meinen Sie Anne Fairfax, die Frau des Pfarrers?«
»Ja. Ja.« Er lächelte breit und liebevoll, als er ihren Namen hörte. Seine Zuneigung schien wie sein Lachen zu sein, spontan und kindlich. »Armer Michael, ich meine Pfarrer Fairfax. Der steht dort am Altar und müht sich ab. Er singt die magischen Worte und nimmt den magischen Kelch und trinkt den magischen Wein. Und er erhofft sich von Jesus einen kleinen Klaps auf den Kopf. Nichts. Verstehen Sie? Gar nichts. Und dann geht seine verhuschte Frau dort hinauf, ja? Sieht nach nichts aus. Hat nur gerade das Schmoren dieser grauenvollen Tunfisch-Kasserollen für den Kirchenbasar unterbrochen. Dann geht sie hinauf und singt ihr Solo im Chor. Und plötzlich macht es peng! – hier ist Gott! Live und höchstpersönlich! Triumphwagen, Engel, Trompeten ... Es ist wie eine Parade!« Ich musste nun auch lächeln, als ich ihn auf seine spezielle Art lachen hörte, mit so viel Freude, so strahlenden Augen und seinen Händen – großen, kräftigen Arbeiterhänden –, die Gottes Ankunft in der Luft beschrieben. »Sie ist wie ein Radio, das auf den Kanal Gottes eingestellt ist. Wenn sie singt, spielt es einfach aus ihr heraus.« Er musste wieder lachen. Und dann verebbte es langsam. Er schüttelte den Kopf über die Absurdität. »Ich habe in Wirklichkeit die Musik in Brand gesteckt und nicht die Kirche.«
Ich rutschte auf meinem Sessel herum. »Na gut. Und was soll das bedeuten?«
»Also – ich habe dort gesessen. In jener Nacht. Mit der Pistole. Habe versucht, herauszufinden, ob ich mich umbringen soll. Ich glaube ja nicht, dass ich es wirklich getan hätte, doch ich ging in die Kirche, um darüber nachzudenken, weil ... also, ich vermute, weil es zu dunkel war, um in den Wald zu gehen und ich wusste, dass ich dort allein sein würde. Ich saß auf der Empore. Habe eine Zigarette geraucht. Habe mit dem Feuerzeug herumgespielt – klick, klick, verstehen Sie? Und ich vermute, dass ich gerade an die süße Annie gedacht habe – an die süße, nichts sagende kleine Ehefrau Annie und daran, wie schön es ist, wenn sie die Choräle singt. Und ich nahm eines der Gesangbücher aus dieser kleinen Tasche heraus, die vor den Sitzbänken hängen. Und ich begann die Lieder zu lesen – die Texte der Choräle, die sie manchmal singt. Und es war wie ... oh nein! Oh nein! Sie waren furchtbar! Verstehen Sie das? Was ich damit sagen will ist, wenn man sie von Annie gesungen hört, dann denkt man, oh, dieser Choral ist so wunderbar und geistlich und lebendig und von Gott erfüllt. Und dann standen diese Worte auf der Seite. Und sie waren – pathetisch! Das waren Bettelwörter! Bleibe bei mir! Ich bin so hilflos! Bleib bei mir, biiitte! Ich meine: zum Kotzen.«
Ich glaube, in diesem Moment habe ich es zum ersten Mal gespürt. Einen kleinen Schauer, ein prickelndes Gefühl von einem Mysterium. Einfach durch das zufällige Zusammentreffen, durch die Tatsache, dass es um den Choral ging, den auch Marie schon gesungen hatte.
»Also, ich wusste nicht«, fuhr Peter Blue fort, »ich wusste nicht, was ich tat oder dachte. Ich war einfach nur verwirrt, denke ich mal. Ich begann, diese – schrecklichen, schrecklichen Lieder aus dem Buch zu reißen. Und dann ... dann zündete ich jede einzelne Seite mit dem Feuerzeug an und warf sie einfach fort. Warf sie einfach fort, weil sie so schrecklich waren.« Er zuckte die Achseln »Was soll ich Ihnen noch sagen? Es war dumm von mir. Die – wie heißen sie noch gleich? – diese Drapierungen fingen Feuer, noch ehe ich überhaupt wusste, was geschah. Und bevor ich irgendetwas tun konnte ... kam dieser Polizist herein.«
»Chief Hunnicut.«
»Mhm.«
»Und was geschah dann?«
Er schniefte und zuckte die Achseln. »Sie wissen, was passiert ist. Ich bin sicher, dass Sie den Bericht gelesen haben. Er hat mich verhaftet.«
»Er hat Sie auch ein paarmal geschlagen, oder nicht?«
»Ja.«
»Ins Gesicht.«
»Mhm.«
»Das muss Sie doch ganz schön sauer gemacht haben.«
Er streckte die Arme aus und gähnte leicht. Ein Bild gelangweilter Gleichgültigkeit. »Nicht wirklich. Ich gehöre wirklich nicht zu den Leuten, die sich oft ärgern. Ich meine, es ist wegen Gott. Wenn man Gott wirklich spürt, verstehen Sie ... Wenn man tatsächlich spürt, wie sehr wir in Seiner Liebe miteinander verbunden sind – dann bleibt danach kein Raum mehr, um sich zu ärgern oder Leute zu hassen. Das ist einfach Zeitverschwendung.«
Ach Junge, dachte ich. Ach Bruder. »In Ordnung«, sagte ich. »Also, er hat Sie geschlagen, und das war prima.«
»Also, ich würde nicht sagen, dass es mir gefallen hat. Mir hat der Kerl leidgetan. Er muss verdammt viel Wut mit sich herumschleppen, um so was zu tun.«
»Tja, aber Sie haben eine Waffe auf ihn gerichtet, Peter. Polizisten mögen das nicht. Das ist bei denen ein wunder Punkt.«
Er versuchte wieder zu lachen, doch diesmal glückte ihm das nicht. Hinter der stolzen Pfiffigkeit in seinen Augen sah ich einen Hauch von Angst, von Aufruhr. Mir fiel wieder ein – als hätte ich es vergessen –, dass er erst neunzehn war. Wirklich noch ein Junge. Ein Junge und unglücklich. »Das hat mir ja nicht viel geholfen, oder? Dass ich eine Waffe hatte.«
»Nein«, sagte ich. »Das kann man nicht behaupten. Sie hatten eine Waffe, und der Chief hat Sie trotzdem geschlagen.«
»Als wäre ich ...«
»Was?«
»Nichts.«
»Machen Sie weiter, Peter. Er schlug sie, als ob Sie was gewesen wären?«
»Ach nein. Nichts.«
»Wie eine Frau. Das wollten Sie doch sagen. Er schlug Sie, als wären Sie eine Frau.«
»Ich hätte ...« Sein Mund verzog sich. »Ich hatte diese verdammte Waffe.«
»Das stimmt. Sie hatten die Waffe, und dieser Bastard hat Sie wie eine Schlampe geschlagen. Was für ein Gefühl hat Ihnen das vermittelt?«
»Klasse!«, fauchte Peter Blue. »Es war ein richtiger sommerlicher Muntermacher!«
Er wand sich in seinem Sessel und drehte das Gesicht weg. Ich blieb still sitzen und wartete. Der Augenblick dehnte und dehnte sich. Dann kam er mit einem tiefen Atemzug wieder zurück. Völlig verändert. Die Angst und der Aufruhr waren verschwunden. Die hochfliegende tragische Ironie war zurückgekehrt. Und auch das Lächeln. Er lächelte wieder liebevoll, nur galt die Zuneigung diesmal mir.
»Also ich vermute mal, dass ich ein bisschen wütend darüber war«, sagte er.
»Das vermute ich auch.«
»Sie sind wirklich gut.«
»Danke.«
»›Geschlagen worden wie eine Schlampe.‹ Das ist hervorragend. Woher haben sie das?«
»Ich arbeite viel mit Kindern. Da schnappt man so was auf.«