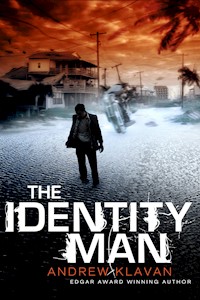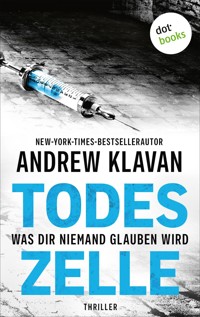
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine schreckliche Wahrheit: Der Psychothriller »Todeszelle – Was dir niemand glauben wird« von Andrew Klavan jetzt als eBook bei dotbooks. Vor sechs Jahren soll er ein schwangeres Mädchen erschossen haben. Jetzt ist der Tag seiner Hinrichtung gekommen. Frank Beachum bleibt nichts mehr, als sich von seiner Familie zu verabschieden, seinen Frieden mit Gott zu machen – und ein letztes Interview mit Reporter Steve Everett zu führen, der ihn im Hochsicherheitsgefängnis besucht. Everett soll eigentlich nur einen kleinen Artikel über Beachums letzten Tag verfassen – doch als er mit dem Verurteilten spricht, kommen ihm langsam Zweifel an dessen Schuld. Soll heute ein Mann zu Unrecht sterben? Fest entschlossen, die Wahrheit aufzudecken, verfolgt Everett die Spuren von damals – ein Wettlauf gegen die Zeit, denn ihm bleiben nur noch wenige Stunden, wenn er Beachum vor dem Henker retten will … »Ein großer, furchterregender Spaß. Füllen Sie die Kaffeekanne auf und verschließen Sie die Türen, bevor Sie beginnen.« Stephen King Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Thriller »Todeszelle – Was dir niemand glauben wird« von Bestsellerautor Andrew Klavan wird alle Fans von Steve Cavanagh und Michael Robotham begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Vor sechs Jahren soll er ein schwangeres Mädchen erschossen haben. Jetzt ist der Tags seiner Hinrichtung gekommen. Frank Beachum bleibt nichts mehr, als sich von seiner Familie zu verabschieden, seinen Frieden mit Gott zu machen – und ein letztes Interview mit Reporter Steve Everett zu führen, der ihn im Hochsicherheitsgefängnis besucht. Everett soll eigentlich nur einen kleinen Artikel über Beachums letzten Tag verfassen – doch als er mit dem Verurteilten spricht, kommen ihm langsam Zweifel an dessen Schuld. Soll heute ein Mann zu Unrecht sterben? Fest entschlossen, die Wahrheit aufzudecken, verfolgt Everett die Spuren von damals – ein Wettlauf gegen die Zeit, denn ihm bleiben nur noch wenige Stunden, wenn er Beachum vor dem Henker retten will …
Über den Autor:
Andrew Klavan wuchs in New York City auf und studierte Englische Literatur an der University of California. Danach arbeitete er als Reporter für Zeitungen und das Radio, bevor er sich ganz dem Schreiben seiner Spannungsromane widmete. Heute gilt Klavan als einer der großen Thriller-Experten der USA. Mehrere seiner Bücher sind mit dem begehrten Edgar-Award ausgezeichnet, für weitere Preise nominiert und/oder verfilmt worden.
Die Website des Autors: andrewklavan.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/aklavan/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Todeszelle – Was dir niemand glauben wird«, »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen sein«, »Todeszahl – Was tief begraben liegt«, »Hilfeschrei – Die Dunkelheit in uns«, »Opferjagd«, »Totenbild« und »Todesmädchen«.
***
eBook-Neuausgabe September 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »True Crime« bei Crown Publishers, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Ein wahres Verbrechen« Albrecht Knaus Verlag, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by Andrew Klavan
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 bei Albrecht Knaus Verlag GmbH, München,
in der Verlagsgruppe Bertelsmann
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Arkadiusz Fajer, Peeradontax
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-178-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andrew Klavan
Todeszelle – Was dir niemand glauben wird
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristian Lutze
dotbooks.
»Die guten Menschen sind sich immer so sicher, im Recht zu sein.«
Barbara Graham beim Betreten der Gaskammer in Kalifornien, wo sie am 3. Juni 1955 hingerichtet wurde, zu Unrecht, wie manche behaupten.(Zitiert nach Until You Are Dead: The Book of Executions von Frederick Drimmer)
»Ich will Ihnen kurz sagen, was ich von Journalisten halte: die Hand Gottes, die in den Sumpf hinabgreift, könnte keinen von ihnen auch nur in den untersten Rang der Niedrigkeit erheben.«
(Nothing Sacred, Drehbuch von Ben Hecht)
Vorwort
Dies ist keines dieser modernen Bücher, die Fakten und Fiktion vermischen. Alle beschriebenen Ereignisse und Gespräche habe ich entweder selbst miterlebt, oder sie wurden mir von einem oder mehreren Beteiligten berichtet. Trotzdem wird der Leser schnell feststellen, daß ich mich nicht nur auf die Beschreibung von Ereignissen und Gesprächen beschränke. Diese Geschichte wäre unvollständig, wenn sie nicht zumindest ein wenig – oder manchmal auch sehr viel – von unausgesprochenen Gedanken, Gefühlen und Motiven handeln würde. Und wo ich versucht habe, diese zu beschreiben, war ich zwangsläufig auf Vermutungen und Schlußfolgerungen angewiesen. Das heißt, manchmal mußte ich raten, was in den Köpfen der handelnden Personen vor sich ging.
Der Grund dafür liegt auf der Hand. Keiner weiß letztlich genau – Gott vielleicht ausgenommen –, was einen anderen im Innersten bewegt. Und wenn sich Menschen ihrer Emotionen nicht bewußt sind, wenn sie unehrlich oder schon tot sind, wird es sehr schwierig, an die Wahrheit heranzukommen. Also habe ich bei den mit Blindheit Geschlagenen, den Unehrlichen und den Toten – und im Verlauf meiner Recherchen bin ich allen dreien begegnet – meine eigenen Eindrücke wiedergegeben. Manchmal habe ich meine Hypothesen ausdrücklich als solche gekennzeichnet, häufiger jedoch habe ich gehofft, daß ihr hypothetischer Charakter aus dem Zusammenhang deutlich wird. Am Ende muß jeder Leser für sich selbst entscheiden, inwieweit mein Verständnis der menschlichen Natur jeweils vorurteilsbeladen oder fehlerhaft ist.
Ich sollte vielleicht hinzufügen, daß ich das Ganze eigentlich für eine ernsthafte Verletzung der journalistischen Regeln halte. Ich bin ein Zeitungsmann, ein Reporter fürs Aktuelle. Ich verstehe meinen Job so, daß ich aufzeichne, was ich sehe und was Menschen mir erzählen. Für gewöhnlich versuche ich mir meine brillanten Einsichten und Beobachtungen für abendliche Kneipenbesuche aufzuheben, wo ich Vertreterinnen des anderen Geschlechts mit meiner Tiefe und Sensibilität beeindrucken kann. Aber ein Buch zu schreiben, ist etwas anderes, als einen Zeitungsartikel zu schreiben. Ein Buch sollte ein Thema haben. Und wo immer ich von der mir vertrauten Form der Reportage abgewichen bin – wo immer ich mit der tatsächlichen Wahrheit ein wenig freizügig umgegangen bin –, hatte es etwas damit zu tun, wovon dieses Buch meiner Meinung nach handelt und wovon nicht.
Zunächst einmal geht es nicht um die Todesstrafe an sich. Meine Meinung darüber – und über das Konzept von »Themen« überhaupt – wird recht früh im Text deutlich, so daß ich hier nicht weiter darauf eingehen möchte. Ich will mich mit der Bemerkung begnügen, daß ich diese Frage jenen Kollegen überlasse, die beim anderen Geschlecht schon hinreichend brilliert haben und immer noch nicht mundtot sind.
Zweitens handelt dieses Buch nicht vom Rechtswesen. Die juristischen Aspekte des Falles Frank Beachum sind in zwei Büchern der beteiligten Anwälte in aller Ausführlichkeit dargelegt worden. Die Fänge des Todes, das Buch von Tom Weiss und Hubert Tryons, legt ein beredtes Zeugnis davon ab, wie sehr sich die beiden Autoren für die Verteidigung des Angeklagten eingesetzt haben. Walter Cartwrights Der dreizehnte Geschworene verfolgt einen anderen Ansatz. Als Ankläger in dem Fall attackiert er die amerikanischen Medien im Allgemeinen und mich im Besonderen, weil wir billige Gefühle mobilisiert und damit der Öffentlichkeit den Blick auf die Fakten verstellt hätten, wodurch die Gerichte bei der Ausübung ihrer gerechten Pflicht behindert worden wären. Ungeachtet meiner persönlichen Empfindungen für Cartwright muß ich zugeben, daß er seine Position exzellent begründet. In jedem Fall wissen alle drei Autoren sehr viel mehr über das Rechtswesen als ich, und alle drei waren sehr viel enger mit diesem Aspekt der Geschichte beschäftigt, als ich das je gewesen bin.
Drittens – und am wichtigsten – ist dieses Buch keine detaillierte Untersuchung des Mordes an Amy Wilson. Die Artikelserie, die ich für die St. Louis News geschrieben habe, sowie die Story, die ich auf der Grundlage der News-Artikel für den New Yorker verfaßt habe, haben mich, was dieses Thema angeht, ziemlich ausgebrannt. Ich werde auch nicht versuchen, mich gegen die jüngsten Angriffe selbsternannter Minderheitenführer und Kolumnisten sowohl der religiösen Rechten als auch der feministischen Linken zu verteidigen, die meinen »Charakter« in Frage stellen. Ich habe bestimmt nicht versucht, meinen »Charakter« zu verbergen – lesen Sie die folgenden Seiten, und er wird Sie regelrecht anspringen –, doch meine zahlreichen Unzulänglichkeiten verändern die Fakten in diesem Fall um keinen Deut.
So weit also dazu, wovon dieses Buch nicht handelt. Wovon aber handelt es? Es handelt von einem Montag, von dem 17. Juli des vergangenen Jahres, einem brutal heißen Tag, und davon, was an jenem Tag geschah, als Frank Beachum in die Todeskammer der Osage State Correctional Facility gerollt wurde.
Der Leser mag sich fragen, warum ich mich – wo es doch um die Erörterung so wichtiger Fragen wie die Todesstrafe, das Rechtswesen und Mord gehen könnte – auf die Erzählung einer so einfachen Geschichte beschränkt habe. Zumal einer Geschichte (die der letzten Stunden eines zum Tode Verurteilten vor seiner Hinrichtung), die sowohl im Journalismus als auch in der Literatur schon hinreichend oft erzählt worden ist. Nun, zum Teil, weil sie wahr ist und weil ich dabei war und dafür bezahlt wurde, sie zu schreiben. Aber auch, weil ich an jenem Tag Augenzeuge der bemerkenswerten Konfrontation einer Reihe von Menschen mit einer unbestreitbaren äußeren Realität geworden bin: der Realität des Todes, Zerstörer von Welten, fröhlicher Verschlinger von Philosophien. In einer Branche – in einer Gesellschaft –, die von Bildern und Worten, von Experten, Wahrheitsverdrehern, Spezialisten und arrivierten Kulturdeutern jedweder Provenienz derart überschwemmt wird, fand ich es wichtig, sich daran zu erinnern, daß diese äußere Realität existiert, daß es zu solchen Konfrontationen kommen kann und daß selbst unsere vornehmsten Ideen, Theorien, Wahrnehmungen und Gefühle im großen Weltenplan vielleicht rein gar nichts zu bedeuten haben.
Wie gesagt, ich habe versucht, die Gedanken und Gefühle so vieler an diesem Drama Beteiligter wie möglich nachzuvollziehen, um aufzuzeigen, auf welcher Weise sie einer Prüfung unterzogen wurden. Unter ihnen ist Frank Beachum naturgemäß der wichtigste, seine Verankerung im traditionellen Christentum und seine altmodischen Vorstellungen von Männlichkeit wurden direkt in den großen Schmelztiegel der Wirklichkeit geworfen. Doch da sind auch noch seine Frau Bonnie, sein Gefängnisaufseher Luther Plunkitt, sein Pastor Harlan Flowers, diverse Politiker, Anwälte und Journalisten, und last – und soviel ich weiß auch least – natürlich ich selbst.
Wiederum überlasse ich es dem Leser zu urteilen, ob und wie wir Beteiligten unsere mitternächtliche Konfrontation mit dem Unleugbaren überstanden haben.
Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die sich für dieses Buch zu Interviews bereit erklärt haben, sowohl die im Text Erwähnten als auch die anderen, die zu zahlreich sind, um sie hier namentlich aufzuführen, die mir mit Hintergrundinformationen behilflich waren.
Mein besonderer Dank gilt meinem Agenten Barney Karpfinger für seine unerschütterliche Unterstützung.
Außerdem möchte ich mich bei der Ford Motor Company bedanken.
Steven Everett
Erster Teil:Die Todeskurve
Kapitel 1
Am Unabhängigkeitstag erwachte Frank Beachum aus einem Traum. Seinem letzten Traum, bevor seine Stunde gekommen war. Einem grausamen Traum in einem eigenartig tiefen Schlaf, wenn man die Umstände bedenkt. Er war wieder hinter dem Haus gewesen, vor seiner Fahrt zu dem Laden, vor dem Picknick, bevor die Polizei gekommen war, um ihn abzuholen. Er hatte wieder das Geräusch des Rasenmähers gehört, hatte den Griff in den Handflächen gespürt und sogar das frisch gemähte Gras gerochen. Er hatte auch ihre Stimme gehört, Bonnies Stimme, die ihm von der Verandatür etwas zugerufen hatte. Er hatte ihr Gesicht gesehen, ihr Gesicht, wie es gewesen war, keck und kompakt unter kurzem hellbraunem Haar – nicht hübsch, hübsch war sie nie gewesen –, aber durch ihre großen, zärtlichen und aufmunternden blauen Augen von einem schimmernden Glanz überzogen. Er sah sie die Flasche hochhalten, die Flasche mit der Steaksauce. Sie hatte sie hin und her geschwenkt, um anzuzeigen, daß sie leer war. Er hatte in dem Hof in der heißen Sonne gestanden, und seine kleine Gail war wieder ein Baby gewesen. Hatte wieder in ihrer Sandkiste gesessen, die aus Plastik war und die Form einer Schildkröte hatte, hatte mit ihrem Schaufelchen auf den Sand gepatscht und vor sich hingelacht, die ganze Welt angelacht.
Für Frank war es, als ob er wirklich dort gewesen wäre. Es hatte sich gar nicht wie ein Traum angefühlt.
Nach dem Aufwachen blieb er noch etliche Minuten so liegen, zur Wand gedreht, die Augen geschlossen. Sein Kopf wollte den Traum festhalten, klammerte sich mit schrecklicher Sehnsucht daran. Doch der Traum löste sich gnadenlos auf, und Stück für Stück kam die Beobachtungszelle zurück. Er spürte die Pritsche unter seiner Schulter, sah die weiße Betonwand vor seinem Gesicht. Noch immer halb hoffend drehte er sich um ... Doch da waren sie: die Gitterstäbe seiner Käfigtür, der Wärter auf der anderen Seite. Er saß an seinem länglichen Schreibtisch und tippte den jüngsten Eintrag in sein Tagesprotokoll: 6.21 Uhr – Gefangener wacht auf Die Uhr hing hoch über dem gebeugten Kopf des Wärters an der Wand. Noch siebzehn Stunden und vierzig Minuten, bis sie Frank auf die Liege schnallen und ihn für die Spritze in den Exekutionsraum rollen würden.
Frank ließ sich wieder auf die Pritsche sinken und blinzelte zur Decke. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt, wenn ein Mensch träumt, er sei ein Schmetterling, könne er in Wahrheit auch ein Schmetterling sein, der träumt, ein Mensch zu sein. Aber das alte chinesische Sprichwort irrt. Frank kannte den Unterschied natürlich; er hatte ihn immer gekannt. Das Bleigewicht, das ihn einzwängte wie eine zweite Haut, der tonnenschwere Klumpen aus Trauer und Angst. Das war die Realität; er wußte, das war das wirkliche Leben. Er schloß die Augen und konnte noch ein oder zwei schmerzhafte Sekunden lang das frisch gemähte Gras riechen. Doch nicht so, wie er die Bewegung der Uhrzeiger spüren konnte, nicht so, wie seine Nervenenden das Verstreichen der Zeit registrierten.
Er ballte seine Fäuste. Wenn nur Bonnie nicht kommen würde, dachte er. Es wäre okay, wenn Bonnie nicht kommen würde, um sich zu verabschieden. Und Gail. Sie war kein Baby mehr, sie war jetzt sieben. Sie malte ihm mit ihren Wachsmalstiften Bilder von Bäumen und Häusern. »Hey«, sagte er dann immer, »das ist echt toll, meine Süße.«
Das würde das Schlimmste werden, dachte er. Mit ihr, mit ihnen zusammenzusitzen, während die Zeit verstrich. Das, so fürchtete er, würde mehr sein, als er ertragen konnte.
Langsam setzte er sich auf die Kante seiner Pritsche. Er bedeckte sein Gesicht mit den Händen, als wolle er sich die Augen reiben, und blieb lange so sitzen. Dieser verdammte Traum hatte ihn mit einer schmerzlichen Sehnsucht nach früher erfüllt. Er mußte seine Gefühle wieder in den Griff kriegen, sonst würde diese Sehnsucht ihn schwach machen. Das war seine größte Angst. Daß er jetzt noch schwach werden würde. Wenn Bonnie ihn am Ende zusammenbrechen sehen würde – oder, Gott bewahre, Gail ... Es würde sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Sie würden sich auf ewig so an ihn erinnern.
Er richtete sich auf und atmete tief ein. Er war ein ein Meter achtzig großer, schlanker Mann, muskulös gebaut unter den weiten Gefängnishosen und dem Baseballhemd mit dem Aufdruck CP-133. Er hatte zottiges braunes Haar, das ihm in Fransen in die Stirn fiel, und ein hageres, zerfurchtes Gesicht. Seine eng zusammenstehenden Augen waren braun, tief und traurig. Er fuhr sich mit dem Daumen über die Lippen und wischte sie trocken.
Er spürte die Augen des Wärters auf sich und sah zu ihm hinüber. Der Wärter hatte seinen Blick von der Schreibmaschine gelöst und sah in Franks Richtung. Er hieß Reedy. Ein drahtiger Junge mit einem harten weißen Gesicht. Frank erinnerte sich, gehört zu haben, daß er in dem örtlichen Drugstore gearbeitet hatte, bevor er in Osage anfing. Heute wirkte er nervös und verlegen.
»Morgen Frank«, sagte er.
Frank nickte ihm zu.
»Kann ich Ihnen irgendwas holen? Was zum Frühstück?«
Frank hatte ein flaues Gefühl im Magen, war jedoch trotzdem hungrig. Er räusperte sich, um nicht heiser zu klingen. »Wenn Sie mir Brötchen und Kaffee besorgen könnten«, sagte er. Seine Stimme zitterte nur am Ende ein wenig.
Der Wärter tippte Franks Bitte in sein Protokoll. Dann stand er auf und sprach mit dem anderen Wärter, der vor der Zellentür postiert war. Der andere Wärter steckte den Kopf durch die Tür. Auch er sah nervös aus und blaß. Es war, als würde er Franks Bestellung mit großem Respekt und Ernst entgegennehmen. Die ganze Prozedur hatte etwas so Zeremonielles, daß Frank übel davon wurde: Ein Schritt folgte auf den anderen in einem unvermeidlichen Ritual, so wie eine Minute auf die andere folgte.
»Kommt sofort«, erklärte Reedy ihm feierlich. Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück und setzte sich, um die Transaktion zu protokollieren: 6.24 Uhr – Frühstücksbestellung an Aufsichtsbeamten Drummer weitergeleitet.
Auf der Kante seiner Pritsche hockend betrachtete Frank jetzt seine Füße. Er versuchte, den armen nervösen Reedy aus seinen Gedanken zu verdrängen. Er versuchte sich zu sammeln, alles auszublenden, bis er das Gefühl hatte, allein zu sein. Er klemmte die Hände zwischen die Knie und faltete sie. Er schloß die Augen und konzentrierte sich. Er begann zu beten: sein Morgengebet.
Es beruhigte ihn. Er war sich stets und in jedem Moment bewußt, daß das Auge Gottes über ihn wachte, aber wenn er betete, konnte er dieses Auge auch wirklich dort oben über ihm spüren. Das Auge war dunkel und bewegungslos und blinzelte nie. Es war wie diese Kameras in den Decken von Fahrstühlen, die einen beobachten, auch wenn man sich völlig abgeschieden und alleine fühlt. Beim Beten fiel Frank wieder ein, daß er nicht allein war, und er spürte, wie das Auge über ihn wachte. Hinter diesem Auge, so sagte er sich, war eine ganz andere Welt, ein ganz anderes Rechtssystem, besser als das des Staates Missouri. An dieses System und seinen Richter wandte er sich, wenn er betete.
Er betete um Stärke. Er bat darum nicht für sich selbst, wie er sagte, sondern für seine Frau, für Bonnie und ihr kleines Mädchen. Er bat Jesus, sie in seine Erwägungen einzubeziehen, heute an diesem letzten Tag. Er betete, daß ihm die Kraft gegeben werden möge, sich von ihnen zu verabschieden.
Nach einer Weile fühlte er sich stärker. Der Traum war schon halb vergessen. Er hob den Blick zu der Uhr an der Wand. Und er spürte das Auge Gottes, das allzeit über ihn wachte.
Kapitel 2
Das Auge Gottes und das Auge der Medien werden häufig miteinander verwechselt, vor allem von den Medien selbst. Doch ob ersteres nun über Frank Beachum wachte oder nicht, eine Vertreterin letztgenannter Zunft hatte ihn jedenfalls fest in ihrem Visier.
Michelle Ziegler von den St. Louis News war eine eindrucksvolle Person. Jung, eigentlich fast noch ein Mädchen, erst dreiundzwanzig. Doch man merkte ihr die Unsicherheit nicht an, im Gegensatz zu ihrem guten Aussehen, das offensichtlich war, und einer verführerischen, intelligenten und erbarmungslosen Arroganz, die die Herzen der Männer in Angst und Schrecken versetzte und Frauen zu neidischer Verachtung provozierte. Was mich betrifft, ich mochte sie irgendwie. Sie hatte ein weiches ovales Gesicht mit einer römischen Nase und großen braunen Augen, die genug sahen, um einen ins Schwitzen zu bringen. Sie kleidete sich, wie sie war: eine Überfliegerin vom College, die man auf die Welt losgelassen hatte. Eine Bluse mit Knöpfkragen, die ihre Figur betonte – einen Körper, den man wohl anmutig genannt hätte, als das noch ein Begriff war. Und so kurze Röcke, daß die unreiferen männlichen Mitarbeiter der News regelmäßig Wetten auf die Farbe ihrer Slips abschlossen. Ich hatte einmal den Jackpot geknackt und vierzig Dollar gewonnen, als ich dreimal hintereinander auf Pink getippt hatte.
Sie war eine gute Reporterin oder würde es eines Tages werden. Sie hatte Autorität, und die Leute redeten mit ihr; ich glaube, sie hatten Angst, es nicht zu tun. Außerdem war sie von einer großen, kompromißlosen sozialen Vision beseelt, die alle möglichen Skrupel bezüglich ihrer Methoden auslöschte. Sie war bereit zu flirten, zu lügen, zu erpressen, Terror auszuüben oder zu stehlen, um an Informationen zu kommen. Jede Information: Wenn sie an einer Geschichte dran war, sammelte sie jedes Detail, jedes Dokument, jedes Zitat von jeder irgendwie beteiligten Person, das sie auftreiben konnte – das meiste davon verwendete sie nie wieder, sondern lagerte es in Pappkartons, die sich überall in dem verrückten Loft, das sie bewohnte, stapelten. Sie war keine besonders gute Schreiberin, ihre College-Ideologien waren meistens so dick und glühend aufgetragen, daß die Redakteure, die ihre Geschichten umschreiben mußten, ihnen den Spitznamen »Depeschen der Flammenden Michelle« gegeben hatten. Aber wenn man den ganzen Kram wegstrich – und das taten die Redakteure zum Glück meistens –, hatte sie immer alle Fakten zusammen, unsere Michelle, jedes Mal.
Sie war vor etwa einem halben Jahr auf den Fall Beachum angesetzt worden: ein Zeichen, daß auch Bob Findley ihr Talent zu würdigen wußte. Sie hatte einen Presseausweis für die Hinrichtung, und es war ihr sogar irgendwie gelungen, ein allerletztes persönliches Interview mit dem Verurteilten zu verabreden. Dieser Interviewtermin – ich muß schon sagen, er nötigte mir Respekt ab. Es war ein Verstoß gegen die Strafvollzugsvorschriften, die am Tag der Hinrichtung ab sechzehn Uhr jeden Kontakt des Gefangenen mit der Presse, selbst per Telefon, ausdrücklich verboten. Ich hatte schon persönlich mit Luther Plunkitt, dem Direktor von Osage, zu tun gehabt, und bei diesen Anlässen hatte er sich bezüglich derartiger Vorschriften in etwa so flexibel verhalten wie Granit. Michelle muß sich bis aufs Hemd ausgezogen haben, um die Genehmigung für dieses Interview zu bekommen – was sie im Notfall auch getan hätte; sie war absolut skrupellos. Ich mag das bei einem Menschen.
Am Abend vor ihrem Termin im Gefängnis – an jenem Sonntagabend – kam Michelle durch die Lokalredaktion auf meinen Schreibtisch zumarschiert, um mit mir eine kollegiale Konferenz über einige Aspekte des Falls abzuhalten. Sie pflanzte ihre anmutige Faust auf meine Schreibtischplatte und schenkte mir eines jener Lächeln voll trockenem Zorn, das selbst hartgesottene Redakteure vor Angst erzittern ließ.
»Die können mich mal am Arsch lecken«, fauchte sie.
Ich seufzte. Es war ein langes Wochenende gewesen – ständig erschossen sich die Leute gegenseitig –, und ich freute mich auf meinen freien Tag. Ich hatte mich gerade in meinem Stuhl zurückgelehnt, um ein letztes Mal gegen das Rauchverbot in den Redaktionsräumen zu verstoßen, bevor ich mich auf den Heimweg zu meiner kleinen Frau machte. Ich schob meine Brille hoch und rieb mir die Nase. Mir fehlte die Kraft für eine ernsthafte journalistische Diskussion.
»Aber damit bin ich durch«, fuhr Michelle fort. »Es ist mein Ernst.« Sie stolzierte den Gang hinter mir auf und ab. »Ich gehe zurück auf die Uni. Ich mache meinen Doktor. Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich werde Sachen schreiben, die etwas bedeuten.«
»Michelle«, erwiderte ich, »ich sag dir das nur ungern, aber du bist erst dreiundzwanzig: Du weißt nichts von Sachen, die etwas bedeuten.«
Wieder dieses trockene Lächeln, trotzdem lachte sie. »Du kannst mich ebenfalls mal am Arsch lecken, Ev«, sagte sie.
Ich lachte auch, trotzdem. Ich mochte sie wirklich. »Also gut«, sagte ich, »was haben sie gemacht?«
»Er. Alan. Mann.« Drei Sätze für einen einzigen Typen. Sie war reichlich geladen. »Der Große Weiße Männliche Herrscher des Universums. Er hat meinen Kommentar über den Fall Beachum gekippt. Ich habe zwei Wochen daran gearbeitet. Er hat Bob einfach überstimmt. Hat ihn – einfach überstimmt. Es war das Beste an der ganzen Story.«
Ich versuchte, mitleidsvoll auszusehen, was mir nicht leichtfiel. Ich hatte ihren Kommentar im Computer überflogen. Absolut klassische Flammende-Michelle-Schreibe. Ihr Aufhänger war, daß wir nur deswegen so ausführlich über Beachums Hinrichtung berichteten, weil er weiß war, während wir die zahlreichen Schwarzen, die im Todestrakt saßen, vernachlässigten und gleichzeitig Beachums schwangeres Opfer idealisierten, um die patriarchalischen Strukturen zu überdecken, die eben jene Gewalt, der die Frau zum Opfer gefallen war, erst hervorgebracht hatten. Ich persönlich fand, daß Alan ungewöhnliche Zurückhaltung bewiesen hatte, indem er den Kommentar einfach gekillt hatte. Ich hätte ihn vorher gefoltert.
Michelle stand da, sah mich wütend an und wartete, die Faust wieder auf meinen Schreibtisch gestemmt, auf eine Antwort. Um sie aufzuheitern, sagte ich schließlich: »Na ja, wenigstens darfst du dir die Hinrichtung morgen ansehen. Das ist immer ein echter Kick.«
Sie wurde rot, schloß die Augen und klappte den Mund auf, ihr Zeichen dafür, daß ich mich jenseits jeden menschlichen Verständnisses begeben hatte.
»Nein, es ist mein Ernst«, sagte ich. »Ich hab mal eine in Jersey mitgemacht. Es ist aufregend. Und, verdammt noch mal, wenn man die Typen bedenkt, mit denen sie es machen, ist es doch ein echt sauberer Spaß, meinst du nicht?«
Den Mund noch immer offen, trommelte sie mit den Fingerknöcheln auf meine Schreibtischplatte. »Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich noch mit dir rede«, sagte sie schließlich, als hätte sie den guten Vorsatz gebrochen, sich dieses Vergnügens in Zukunft zu enthalten. »Ich weiß nicht, warum ich überhaupt noch mit dir rede.«
Woraufhin sie tief einatmete, um ihren Zorn zu zügeln, mich wortlos sitzenließ und im Zickzack zwischen den Schreibtischen davonstapfte.
Ich legte die Füße auf meinen Schreibtisch und rauchte weiter. Ehrlich gesagt hatte auch ich keine Ahnung, warum sie noch mit mir redete. Aber sie tat es. Vermutlich war es einfach ein weiteres der vielen Rätsel des Lebens.
An jenem Abend muß Michelle in einer ihrer schwärzeren Stimmungen nach Hause gefahren sein. Etwa drei Stunden lang lag sie in ihrem Loft auf dem Bett und brütete vor sich hin, während draußen das letzte Licht des Sommertages erstarb. Nach einer Weile rauchte sie einen Joint, um ihre angespannten Nerven zu lockern.
Ihr Loft war, wie gesagt, eine verrückte Behausung, riesig, düster und wie ihre Studentenzimmer möbliert mit Kartons, Staubflocken, Stapeln von alten Zeitungen, halb gelesenen Büchern und Traktaten. Es befand sich im zweiten Stock eines alten Lagerhauses aus Backstein, in dem bis zu seiner Einstellung der Globe-Democrat seine Redaktionsräume gehabt hatte. Das Schild der Zeitung mit dem Weltkugel-Logo hing noch draußen über der Tür. Nur ein weiteres Loft in dem Gebäude war bewohnt; die von Tankstellen, Parkplätzen und Fast-food-Restaurants gesäumte Straße, an der das Haus lag, schlug eine Schneise durch ein nichtssagendes Gewerbegebiet, das sich bis zu den Slums im Norden erstreckte. Doch Michelle liebte dieses Loft inniglich, liebte es, diese Wände um sich zu spüren: wegen des Weltkugel-Logos und weil es nur einen Block vom PostDispatch und eineinhalb Blocks von der News entfernt lag. Weil es für sie erfüllt war mit dem Duft und der schimmernden Aura von Zeitungen. Zeitungen, das große romantische Ideal ihrer Studentenzeit. Agenten gesellschaftlicher Veränderung, Orte erlebter Geschichte, Schlachtfelder der politischen Meinung. Sie hatte den ganzen Unsinn geglaubt. Sie liebte Zeitungen. Selbst jetzt noch. Sie liebte sie noch immer.
Aber heute deprimierte sie ihre Wohnung nur noch mehr. Während sich die gelben Streifen der untergehenden Sonne durch die Schlitze der Jalousien zurückzogen und langsam verblaßten, zog sie an ihrem Joint und betrachtete durch den Qualm die im ganzen Zimmer verstreuten Kartons. Kartons gefüllt mit losen Zetteln, Notizblöcken und zerknitterten Unterlagen. Kartons, die von Fakten geradezu überquollen, von den vergessenen Details der Geschichten, an denen sie arbeitete. Fetzen, die sie mit dem hilflosen Instinkt eines Eichhörnchens im Herbst gesammelt hatte. Sie wollten sie darin begraben, sagte sie sich. Alan Mann. Bob Findley. Sie wollten sie in Details, Belanglosigkeiten und Nichtigkeiten begraben. Wenn sie an die Sachen dachte, die sie im College geschrieben hatte ...
Große Sachen, bedeutende Sachen. Theorien, die sie zum Star des Women’s Studies Department in Wellesley gemacht hatten. Harridan and Eunuch University, wie ich es immer nannte, wenn ich sie auf die Palme bringen wollte. Dort war sie sich brillant vorgekommen. Hatte Rassismus und das Patriarchat seziert, hatte die Last des europäischen Kulturerbes offengelegt, hatte Foucault – den lieben Foucault! – und die innere Tyrannei freier Gesellschaften erläutert. In jenen längst vergangenen Tagen hatte sie den intellektuellen Rausch der Erkenntnis erlebt, den nur Heranwachsende, Psychopathen und Professoren kennen. Und jetzt steckte sie tief im Sumpf dieser Kartons mit ihren Fetzen, ihren sinnlosen, nüchternen Kleinigkeiten und versank darin.
Was sie jedoch am meisten deprimierte, was sie absolut krank machte, während sie kiffend auf dem Bett lag, war die Tatsache, daß sie zu verstehen – oder doch zu ahnen – begann, daß dies genau der Grund war, warum sie den Job bei der Post angenommen hatte. Sie hatte begonnen, sich zumindest ansatzweise einzugestehen, daß sie diese Kartons, die zerknitterten Zettel, die unbedeutenden und nicht zueinander passenden Fakten – die Geschichten – mehr liebte als das Women’s Studies Department an der guten alten Harridan and Eunuch University.
Also saß sie etwa drei Stunden brütend und rauchend in ihrem Loft, bis ihr Kopf sich unendlich weit anfühlte und ihre Gedanken darin zu schwimmen schienen. Dann sprang sie auf, genauso unruhig wie zuvor, und strebte aus der Tür in die menschenleere Stadt dieses Sonntagabends.
Sie steuerte ihren kleinen roten Datsun zu Laclede’s Landing am Fluß, wo sie hoffte, irgendeine Aktivität, irgendein Zeichen von Leben anzutreffen. Die nächste halbe Stunde geisterte sie durch die gepflasterten Gassen zwischen den roten Backsteingebäuden, wanderte von einer altmodischen Straßenlaterne zur nächsten, rümpfte herablassend die Nase über die vorbeiziehenden Schatten der Touristen und ihrer Kinder, die archetypischen amerikanischen Ignoranten, die nicht wußten, was sie wußte. Schließlich landete sie in einem Jazzclub, der seinen Laden für eben jenes unwürdige Publikum offenhielt. Sie setzte sich an einen kleinen runden Tisch und begann Bourbon zu trinken, den sie mit bittersüßer Melancholie hinunterspülte. Ein Trio ältlicher weißer Herren im vorderen Teil des Raumes schien immer wieder den St. Louis Blues zu spielen. Sie schüttelte abwesend, aber überlegen den Kopf und trank weiter.
Sie blieb nicht lange allein. Ein junger Mann entdeckte sie, ein Assistenzarzt, der schon den ganzen Abend auf der Lauer gelegen hatte. Er stand an der Bar, einen Scotch in der Hand, und musterte sie. Michelle hatte mittlerweile den obersten Knopf ihrer Bluse geöffnet, und ihr marineblauer Rock ließ den größten Teil ihrer Schenkel frei. Der Assistenzarzt kannte sein Metier und spürte ihre Stimmung. Er löste sich von dem Messinggeländer der Bar und hielt durch den fast leeren Raum auf sie zu.
Sein Name war Clarence Hagen. Er war auf niedliche Art gutaussehend, mit dichtem, adrett frisiertem Haar und einem kecken Lächeln, das zu sagen schien: Klar, bin ich ein Haufen Scheiße, aber bin ich nicht süß? Er setzte sich an Michelles Tisch, spendierte ihr Drinks und lästerte über die flachgesichtige Kundschaft, bis Michelle losließ und loslegte. Dann runzelte er, ganz Experte, entweder interessiert die Brauen oder sank von der Klarheit ihrer Ideen überwältigt in seinen Stuhl zurück. Solcherart ermutigt ließ das betrunkene Mädchen die ganze Flut ihrer Weisheit über ihn herniedergehen, erklärte ihm im vertrauten, eifernden Maschinengewehr-Stakkato ihrer verlorenen College- tage die Kultur eines ganzen Kontinents. Oh, Michelle wußte, daß er ein Mistkerl war. So schlau war sie. Doch sie glaubte, daß dieses Wissen ihr die Oberhand geben würde. Sie kam sich zynisch und raffiniert vor und was-kümmert’s-mich, frei und stark genug, mit einem Mann zu spielen. Sie fühlte sich viel besser als in der ganzen Zeit vorher, seit Allan ihren Kommentar gestrichen hatte, so viel war sicher.
Sie verließ den Club mit Hagen gemeinsam. Er hatte seinen Arm um ihre Schultern gelegt, während ihre Hüfte angenehm gegen seinen Schenkel rieb. Sie stiegen in ihre Wagen und fuhren Richtung University City, wo Hagen wohnte. Michelle folgte seinem Trans Am mit ihrem Datsun. Sie hatte Mühe, beim Fahren das Steuer fest und die Augen offen zu halten. Nach etwa zwanzig Minuten parkten sie vor einem zweistöckigen Haus im nachgemachten Tudorstil, das sich der Assistenzarzt mit zwei anderen Jungmedizinern teilte. Jung-Clarence führte Michelle hinein.
Und dort fickte er sie, schnell und maschinell wie ein Kolbenmotor, in einem Schlafzimmer im Erdgeschoß. Michelle war mittlerweile so betrunken, daß sie schon wegdämmerte, während er noch vor sich hinpumpte. Sie trieb davon auf einem Ozean eigener Gedanken und lag dort mit einem anderen Mann an einem anderen Tag irgendwann in der Zukunft, wenn das Leben einfach sein und sie geliebt werden würde. Nach einer Weile bemerkte sie, daß Clarence fertig war und schnarchte, während er noch immer auf ihr lag. Sie wand sich unter ihm weg und rollte sich so weit wie möglich von ihm entfernt am Bettrand zusammen. Sie sagte sich, daß sie sich noch immer zynisch und raffiniert und was-kümmert’s-mich fühlte und daß Alan Mann sich zum Teufel scheren konnte, jawohl. Sie sagte sich, so ist das Leben, und schlief ein.
Und so verbrachte die Reporterin der St. Louis News die Nacht vor ihrem Interview in der Todeszelle mit Frank Beachum.
Am nächsten Morgen gegen halb sieben – etwa zur selben Zeit, als Beachum gerade aus seinem Traum erwachte – öffnete Michelle mühsam ihre verklebten Lider und wünschte sich wie Beachum weit fort von hier. Sie schreckte vor dem schlafenden Hagen zurück wie vor einer ekligen Spinne und stolperte nackt ins Badezimmer, um zu pinkeln und sich das Gesicht zu waschen. Eine Weile kniete sie über der Toilette, weil sie glaubte, sich übergeben zu müssen. Als das nicht der Fall war, stand sie heftig zitternd auf. Sie war an sich nicht nahe am Wasser gebaut, aber jetzt mußte sie sich beherrschen, um nicht einfach loszuheulen.
Hagen wachte auf, als sie sich anzog. Er setzte sich im Bett auf, den Kopf auf die Hände gestützt. Schnell knöpfte Michelle ihre Bluse zu. Ihr fiel nichts ein, was er hätte sagen können, ohne in ihr den Wunsch zu wecken, ihn umzubringen.
»Möchtest du Kaffee?« murmelte er.
»Halt einfach dein Maul«, sagte sie.
»Hey!« sagte er. »Was habe ich denn getan?« Als sie hinausging, murmelte er ihr einen Fluch hinterher und machte eine wegwerfende Handbewegung, bevor er mit ausgebreiteten Armen und heraushängender Zunge wieder aufs Laken sank.
Michelle verließ das Haus durch die Küche, wo Clarences Mitbewohner sie mit einem verschlafenen, anzüglichen Grinsen begrüßten, was ihre Laune vollends ruinierte. Sie knallte die Haustür zu und wankte den Weg zu ihrem Wagen hinunter.
Sie fuhr, bis sie in der Nähe ein McDonald’s entdeckte. Dort holte sie sich einen Kaffee, den sie, während sie neben ihrem Datsun auf und ab tigerte, auf dem Parkplatz trank. Sie verfluchte zunächst Hagen und die Männer als solche, aber das war’s natürlich nicht. Dumm! sagte sie sich schließlich. Wie kannst du so schlau und trotzdem so dumm sein? Ein Trucker, der auf dem Boulevard vorbeidonnerte, rief ihr eine obszöne Bemerkung zu – irgendwas von seinem Kopf unter ihrem kurzen Rock. Michelle fühlte sich schmutzig und elend und stieg wieder hinter das Steuer ihres Wagens.
Dort fing sie dann schließlich an zu weinen. Ihr Gesicht zerfiel wie das eines Kindes, und sie war auch so verzweifelt wie ein Kind. Sie weinte und stöhnte laut auf, und ihr Hals schnürte sich zu, bis sie glaubte, sie müsse an ihren eigenen Tränen ersticken. Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen und ließ den Kopf sinken, schüttelte ihn hin und her, so daß ihr Strähnen ihres schwarzen Haars ins Gesicht schlugen. Verzweifelt, so verzweifelt. Allein, so schrecklich allein. Keinen Freund seit der High-School. Keine Freunde seit dem College. Und auch keine richtigen Freundinnen; sie war immer zu überlegen gewesen. Ihr soziales Leben war eine einzige Serie von Fehlurteilen. Ihre Karriere – aus der sie ihre Selbstachtung zog – war in eine Sackgasse geraten. Sie wußte alles über alles und nichts über nichts. Sie hatte keine Ahnung, wie sie ihr Leben leben sollte. Das zumindest glaubte sie in ihrer Weisheit.
»Mein Leben ist beschissen«, knurrte sie wütend, voller Selbsthaß, und weinte. »Mein Leben ist so beschissen.«
Gegen sieben Uhr fünf hatte sie sich ausgeheult und fühlte sich besser. Schniefend warf sie den leeren Kaffeebecher auf den Rücksitz auf die Mülldeponie zu den anderen leeren Kaffeebechern und Fast-food-Kartons, vergilbten Zeitungen, Notizbüchern und Pressemitteilungen. Mit einem zittrigen Seufzer ließ sie den Wagen an. Sie hatte einen Entschluß gefaßt. Sie wußte, was sie tun würde. Der Wagen schoß quietschend und heftig schlingernd auf die Fahrbahn.
Wahrscheinlich hätte sie jemand aufhalten sollen. Aber die Bullen haben auf den Straßen weiß Gott alle Hände voll zu tun und können nicht überall sein. Trotzdem hätte sie am Abend zuvor wahrscheinlich irgendjemand anhalten sollen, so betrunken, wie sie gefahren war. Und an diesem Morgen ging es ihr kaum besser. Sie fühlte sich fiebrig und aufgequollen. Ihre Nebenhöhlen waren verstopft, ihr Magen fühlte sich an wie ein auf dem Kopf stehender Vulkan. Ihre Sicht war von dem ganzen Alkohol, dem Dope und den Tränen verschwommen. Sogar sie wußte, daß die Zahnrädchen in ihrem Gehirn nur rostig quietschend in Bewegung kamen, sie dachte langsam, reagierte langsam. Aber verdammt, das war schließlich nicht das erste Mal, daß sie so nach Hause fuhr. Sie hatte es schon oft gemacht und noch nie einen Unfall gehabt. Sie dachte, es würde auch diesmal klappen.
Das tat es auch – zunächst jedenfalls, auf dem breiten Boulevard, der zurück in die Stadt führte. Der Montagmorgenverkehr war schnell, aber um diese Zeit noch nicht allzu dicht. Michelle heftete ihren Blick an die roten Rücklichter eines Wagens vor ihr und ließ sich von ihnen ziehen wie vom Blick eines Vampirs, raste ihnen in dösender Trance hinterher. Sie dachte an ihren Entschluß und nickte sich mit fest aufeinandergepreßten Lippen aufmunternd zu. Sie würde bei der Zeitung bleiben, dachte sie. Dafür war sie geboren, sie wußte es, und sie würde sich von niemandem zum Aufgeben drängen lassen. Sie war schlauer als die anderen – als Alan, Bob und ich –, sie war schlauer als wir alle, und sie würde besser sein als wir alle. Sie mußten sie ja nicht mögen, sie mußten sie nur drucken ...
Sie verzog ihr Gesicht, als es in ihrem Darm rumorte. Sie mußte dringend auf die Toilette, doch sie wollte nicht anhalten.
Sie wollte nach Hause, um sich ihre eigene Blödheit abzuduschen, und dann wollte sie von vorne anfangen, bis Alan Mann ihre Artikel Wort für Wort fraß. Sie würde weiter mit Everett reden. Everett würde es ihr beibringen. Er war zwar ein Mistkerl, aber er war der beste von allen, und sie würde ihn dazu bringen, ihr alles beizubringen, was er wußte. Dann konnte er seine blöden Witze reißen. Dann konnte er zusehen, wie sie an ihm vorbeizog. Sie trat aufs Gaspedal. Wolkenkratzer glitten an ihr vorbei, Parks, Tankstellen und seltsame kleine Enklaven mit Cafés in Backsteinhäuschen. Alles schwebte in einem vagen Taumel am Rande ihres Gesichtsfelds dahin. Michelles große Augen glänzten vor Entschlossenheit. Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einem entschlossenen Lächeln. Ja, dachte sie.
Und dann kam sie in die Dead Man’s Curve.
So nannten die Einheimischen sie: die Todeskurve. Auch die Zeitungen nannten sie manchmal so. Vermutlich kein besonders origineller Name, aber zutreffend. Hier, direkt an der Stadtgrenze, verlief die Straße auf einmal in einer langgezogenen weiten Kurve mit nichts außer dem Parkplatz einer Tankstelle an ihrem äußersten Punkt. In einem scheinbar endlosen Bogen wurden die herandonnernden Fahrzeuge auf den Parkway geleitet. Hier waren schon etliche Fahrzeuge außer Kontrolle geraten. An genau derselben Stelle hatte es in den letzten eineinhalb Jahren zwei tödliche Unfälle gegeben. Michelle fuhr mit Höchstgeschwindigkeit in die Kurve hinein, die Gedanken weit weg. Sie blinzelte und hatte nur eine Hand am Steuer, während sie sich mit der anderen den Bauch massierte.
An der steilsten Stelle verloren die Hinterreifen des Datsuns ihre Haftung auf der Fahrbahn. Michelle spürte, wie der hintere Teil des Wagens weggerissen wurde. Sie schreckte hoch und riß das Steuer gewaltsam in die andere Richtung – was genau das Falsche war. Der Wagen schlingerte in heftigem Zickzack geradeaus, während die Straße der Kurve weiter folgte. Er schoß über den Bordstein und den Bürgersteig auf den Parkplatz, wo der Asphalt von Öl- und Benzinresten so glitschig war, daß sich der Datsun scheinbar immer schneller zu drehen begann. Michelle kurbelte verzweifelt am Steuer. Es blieb ohne Wirkung. Der Wagen drehte sich einmal um sich selbst. Die weiße Wand der Tankstellengarage vor der Windschutzscheibe wurde größer und größer.
Michelle stieß einen schrillen Schrei aus: »Bitte!«
Der Wagen krachte frontal gegen die Wand.
Michelle wurde wie ein Geschoß aus ihrem Sitz gerissen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Das Glas explodierte, Scherben schnitten in ihr Fleisch, ihre Knochen knackten wie Äste. Als sich Darm und Blase entleerten, verlor sie das Bewußtsein. Ihr Körper schlug auf der zusammengedrückten Motorhaube auf wie ein Wäschesack. Schnell war ihre blaue Bluse durchweicht und rot.
So blieb sie regungslos liegen, während um sie herum zischend Qualm und Dampf aufstiegen.
Kapitel 3
Es war fast zehn Uhr, als der Anruf Bob Findley in der Lokalredaktion erreichte. Er legte den Hörer auf, blieb einen Moment lang sitzen und starrte in die Stille, auf das unübersichtliche Labyrinth aus braunen Schreibtischen, auf denen sich dunkle Computerterminals erhoben. Die Neonröhren unter den weißen Plastikverkleidungen an der Decke tauchten den Raum in ein nüchternes, leicht dunstiges Licht.
Bob atmete tief ein und ordnete seine Gefühle. Er war sich nicht sicher, wie er reagieren sollte. Findley hatte den Ruf, ein äußerst kontrollierter Mensch zu sein, und dieser Ruf war ihm wichtig. Er war jung und in leitender Funktion tätig, und er wollte, daß ihn die Mitarbeiter für einen Ausbund an Gelassenheit hielten. Nie hob er die Stimme oder sprach schneller, als er denken konnte, vor allem nicht in Notfällen oder unter dem Druck einer Deadline. Inmitten des größten Chaos machte er gern leise ironische Bemerkungen, so daß jeder, der selbst in Panik war, darauf vertraute, daß er die Situation absolut im Griff hatte. Meistens hatte er das auch. Er war ein guter Lokalchef. Intelligent, informiert, ein wenig unerfahren, aber bereit, auf den Rat anderer zu hören. Wenn überhaupt, dann fragten sich einige von uns höchstens manchmal, ob er nicht vielleicht ein bißchen zu beherrscht war. Er hatte ein rundes, rosafarbenes, jungenhaftes Gesicht, das knallrot anlief, wenn er wütend war, selbst wenn er mit leiser Stimme weitersprach. Einige von uns fragten sich manchmal, ob ihm nicht eines Tages der Kragen platzen und sein Kopf explodieren würde wie ein Luftballon.
Doch Bob wollte nicht nur ruhig und beherrscht wirken, er wollte auch nett sein: mitfühlend, wie er es nannte. Er war sehr mitfühlend. Er arbeitete hart daran. Irgendwie hatte er es sogar geschafft, so auszusehen: großgewachsen mit einem leicht schwabbeligen Körper und weichen Gesichtszügen unter einem dichten braunen Haarschopf. Immer im gebügelten Hemd – ein blaues Arbeitshemd oder die schickere Version in Pink – mit einer munteren Krawatte, Hosen, kein Jackett. Leger, aber ernsthaft, aufmerksam, nett. Mitfühlend. Als leitender Redakteur wie auch als Privatmensch bezog er zu jedem Thema stets die humane, die liberale Position. Er dachte, daß jedermann human und liberal sein müßte, wenn er sich nur die Zeit nehmen würde, die Dinge in Ruhe zu durchdenken. So war er, unser Bob.
Deswegen fand er es jetzt, nachdem er den Hörer aufgelegt hatte, ein wenig schwierig, die angemessene Reaktion zu finden. Wenn er zu ruhig war, war er nicht mitfühlend. Und wenn er zu mitfühlend war, konnte er nicht ruhig bleiben. Schließlich strich er sich nachdenklich über das Kinn, zog die Brauen hoch und murmelte: »Mannomann.«
Die stellvertretende Lokalchefin Jane March blickte rasch von ihrem Terminal auf. Sie kannte Bob und schloß deshalb aus seiner Bemerkung, daß mindestens ein Flugzeug über dem Busch-Stadion abgestürzt sein mußte.
»Ist Alan schon da?« fragte er sie leise.
Ernsthaft neugierig geworden, wies sie mit dem Kopf in Richtung Flur. »Er holt sich gerade einen Kaffee.«
Bob nickte langsam und überlegte. Dann stand er behutsam auf, verließ gemessenen Schrittes die Lokalredaktion und strebte den Flur hinunter Richtung Kantine.
Im Flur traf er Alan Mann, der auf dem Rückweg zu seinem Büro war. In der Hand hielt er einen Styroporbecher mit schwarzem Kaffee, während er in seiner Jackentasche eine Papiertüte mit einem Riesenstück Streuselkuchen verbarg. Als Bob sich ihm in den Weg stellte, legte er die freie Hand schützend auf seine Jackentasche.
Alan war unser Chefredakteur, ein Mann Mitte Fünfzig, der Bob Findley mit seinen ein Meter fünfundachtzig deutlich überragte. Er hatte breite Schultern, und sein Körper war schlank und muskulös bis auf den Bauch, der wie ein Volleyball tumorartig über seinen Gürtel quoll. Er hatte ein schmales Gesicht mit Hakennase, breiter Stirn und buschigen Augenbrauen. Die lauernde Miene eines Habichts: das war Alan.
Bob blieb direkt vor ihm stehen und wandte sich mit leiser Stimme an Alans gesenkte Stirn. »Ich habe gerade einen Anruf von Michelle Zieglers Bruder erhalten.« Er machte eine ausholende Geste mit seiner geöffneten Hand, was er oft tat, als wolle er alle Anwesenden ermahnen, ruhig zu bleiben. »Michelle hatte einen Autounfall.«
Alan knurrte. »Wie schlimm?«
»Schlimm«, sagte Bob und wedelte noch ein wenig mit seiner Hand. »Sie befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Ärzte glauben nicht, daß sie es schaffen wird.«
Eine ganze Weile sah Alan weiter wütend auf ihn herab, als ob er nichts gesagt hätte. Dann ging er wortlos, nur mit einem angewiderten Kopfschütteln, geradewegs an ihm vorbei den Flur hinunter. Bob folgte ihm langsam zurück in die Redaktionsräume.
Jane March beobachtete die beiden Männer genau, während sie Alans Büro betraten. Als Bob die Tür hinter sich schloß, flüsterte sie: »Verdammt!« Alan hatte die Jalousien vor den Glaswänden heruntergelassen, weil er vorgehabt hatte, unbeobachtet und in aller Ruhe seinen Streuselkuchen zu verzehren. Von ihrem Schreibtisch aus konnte Jane nur die Schatten der beiden Männer hinter den weißen Jalousien erkennen.
In seinem Büro ging Alan Mann zunächst um den Schreibtisch. Er hatte noch immer nichts gesagt. Er stellte den Kaffee auf die Tischplatte, bevor er seinen Streuselkuchen aus der Tasche zog und mit demonstrativer Wucht auf den Tisch knallte: Es war jetzt nicht die Zeit für kleinliche Täuschungsversuche. Er ließ sich in seinen Drehstuhl fallen und runzelte düster die Stirn.
Schließlich sagte er: »Die blöde Gans. Was war denn, war sie betrunken, oder was?«
Bob lächelte gequält. Alan hatte ihn engagiert, Alan war sein Mentor, und weil er im Fernsehen genug knurrige Chefredakteure gesehen hatte, ging Bob normalerweise davon aus, daß Alan wie sie trotz allem ein Herz aus Gold hatte. Deswegen glaubte Bob, die Größe aufbringen zu können, Alan nicht zu verachten. Trotzdem hatte er bisweilen das heimliche Gefühl, daß die Welt zivilisierter sein würde, wenn Dinosaurier wie Alan Mann ausgestorben und alle mehr oder weniger genauso mitfühlend sein würden wie er selbst.
»Ich weiß nicht«, antwortete Bob jetzt freundlich. »Es ist an der Auffahrt auf den Parkway passiert, die üble weite Kurve. Die sollten da wirklich bald mal was unternehmen.«
Alan wußte natürlich genau, was Bob von ihm dachte, und spielte seinen Part bis ins letzte aus.
»Die blöde Gans«, sagte er noch einmal. »Was hatte sie heute?«
Bob verstand die Frage nicht.
»Muß jemand für sie einspringen?« sagte Alan. »Hatte sie heute irgendeinen wichtigen Termin?«
»Oh ...« Bob war überrascht. Nicht, daß er nicht daran gedacht hätte, er hatte nur angenommen, daß sie zunächst ihrer gemeinsamen Betroffenheit Ausdruck verleihen würden, bevor sie dieses Problem erörterten. »Sie hatte das Interview mit Frank Beachum in Osage.«
»Ach ja. Richtig. Heute wird der gute alte Frank abgespritzt, was?« Alan gluckste. Er nahm den Deckel von seinem Kaffeebecher und lehnte sich in seinen ledernen Chefsessel zurück. »Hatte die Ziegler ein Ticket für die Show?«
»Ja. Sie sollte hinfahren, das Interview machen, wieder zurückkommen und dann nachts noch einmal rüberfahren, um bei der Hinrichtung dabeizusein.«
»Mein Gott. Warum muß das ausgerechnet mir passieren?«
Bob lachte. »Ich glaube, für Michelle ist es ein bißchen schlimmer, Alan.«
Alan knurrte in seinen Kaffee hinein.
»Ich weiß nicht, ob der Direktor sich auf einen Ersatzmann für das Interview einlassen wird. Oder, was das angeht, auch Beachum. Aber der Presseausweis für die Hinrichtung ist auf die Zeitung ausgestellt; da können wir schicken, wen wir wollen. Ich dachte, wir ziehen Harvey von dem Untersuchungsausschuß ab und setzen ihn ...
»Setz Everett drauf an«, unterbrach ihn Alan. »Auf beides, das Interview und die Hinrichtung.«
Alan nippte an seinem Kaffee und wartete die Wirkung des Schlages ab, dehnte den Augenblick in die Länge. Er wußte, was Bob von mir hielt.
»Steve ist nicht da«, sagte Bob rasch, aber ohne viel Hoffnung. »Er hatte das ganze Wochenende Polizeidienst. Er hat seinen freien Tag.«
»Jetzt nicht mehr. Wir brauchen ihn. Wie – heißt – er – noch – unten in Osage – der Direktor – Plunkitt – Steve hatte früher schon mit ihm zu tun. Ich bring ihn da rein. Und Beachum wird es egal sein, mit wem er redet.« Er nippte wieder an seinem Kaffee. Er liebte derartige Diskussionen.
Doch Bob war auf der Hut, er hatte das Gefühl, vorsichtig sein zu müssen, hatte den Eindruck, daß es politisch nicht besonders klug wäre, mich runterzumachen. Alan Mann und ich waren Freunde, gute Freunde, seit Urzeiten. Alan war Dozent gewesen, als ich an die Columbia University kam. Später hatte er dann einen Posten als Lokalchef angenommen und mir nach meinem Examen einen Job bei seiner Zeitung verschafft. Dort arbeiteten wir fünf Jahre zusammen, bis er in seine Heimat nach Missouri zurückkehrte. Und als er hörte, daß man mich gefeuert hatte und ich in New York keinen Job mehr bekommen würde, drängte er mich, zu ihm zur News zu kommen. Wir hatten uns immer gut verstanden, wir beide, trotz des Altersunterschiedes. Manchmal gingen wir nach der Arbeit zusammen einen trinken. Unsere Familien trafen sich sonntags zum Essen. Trotzdem war Bob die Sache wichtig – außerdem ging er nie einer Konfrontation mit jemandem aus dem Weg, der ihm so viel Angst einjagte wie Alan Mann. Es war für ihn eine Frage der Ehre.
»Ich bin sicher, daß ich auch Harvey an Plunkitt vorbeischleusen kann«, sagte er mit seiner leisen, vernünftigen Stimme. »Plunkitt liebt es, sich seiner guten Beziehungen zur Presse zu rühmen.«
»Und du glaubst, Everett ist ein Arschloch«, sagte Alan.
»Ich glaube nicht, daß er ein Arschloch ist ...«
»Du irrst. Er ist ein Arschloch. Glaub mir. Ich kenne ihn. Eine Menge Leute, die gut in ihrem Job sind, sind Arschlöcher, Bob.«
Bob hob seine Hand zu jener besänftigenden Geste. »Das weiß ich, Alan.«
»Wenn ich diese Zeitung ohne Arschlöcher machen müßte, könnte ich sie als Rundbrief verschicken.«
Bob lächelte beschwichtigend. Doch er gab noch nicht auf. »Es ist nur, daß Everetts Stärke meiner Meinung nach eher die Fakten-orientierten Geschichten sind. Ich habe nichts dagegen, daß er über die Hinrichtung berichtet. Aber das Interview sollte im Grunde mehr eine Human-Interest-Kiste werden. Michelle wollte noch ein paar emotionale Aspekte bringen, zur Abrundung ihrer Story.«
»Ihre Story?« sagte Alan laut. »Depeschen der flammenden Michelle?« Er stellte seinen Styroporbecher auf den Tisch. Er kam jetzt richtig in Fahrt. »Nun hör mir mal gut zu. Ich finde es beschissen, daß Michelle sterben wird. Ein Mädchen von Anfang Zwanzig! Wenn ich den Lauf der Welt bestimmen würde, wäre das nie geschehen, das kannst du mir glauben. Trotzdem kennst du Michelles Kommentare genausogut wie ich. Sie würde einen guten Aufhänger selbst dann nicht erkennen, wenn er ihr in ihren süßen College-Girl-Hintern beißt. Everett schon.«
»Einen nachrichtlichen Aufhänger schon, aber dies ist mehr eine Hintergrundstory.«
Alan richtete sich mit weit aufgerissenen Augen auf. »Eine Hintergrundstory? Wow! Donnerschlag! Eine Hintergrundstory.«
»Komm schon, Alan ...«
»Was ist das Hintergrundthema?«
»Die Todesstrafe. Ich meine, der Staat bringt heute abend einen Menschen um, Alan.«
»Eine Hintergrundstory.« Alan lehnte sich in seinem Stuhl zurück und konnte sein Entzücken kaum verbergen.
Bob wurde langsam ein wenig verzweifelt und auch ein bißchen wütend. Er hatte seine eigenen Gründe, mich nicht hinzuziehen zu wollen, und die meisten davon waren privater Natur. Aber wie das in Diskussionen so läuft: Er hatte ein paar logische Vorwände gefunden, mit denen er seine Gefühle erklären konnte, und jetzt glaubte er sie. Er fand, daß sie offensichtlich waren. Er fand, daß jeder, der anderer Meinung war, am eigentlichen Problem vorbeiredete. Und daß er einem diese Dinge erklärte, als wäre man ein kleines Kind, war eine von Bobs persönlichen Schwächen.
Also sagte er, während er sehr bewußt seine Hand wieder öffnete: »Dieser Typ, dieser Beachum, wird uns keine Neuigkeiten mitteilen, verstehst du. Er wird uns keine einzige Information geben, die wir nicht schon haben. Darum geht es auch gar nicht. Es geht – bei einer Story wie dieser – darum, daß die Leute nachempfinden können, wie es ist, darauf zu warten, daß einem der Staat Gift in den Arm spritzt. Ich meine, in diesem Staat wird alle paar Monate ein Mensch hingerichtet, und es landet normalerweise auf Seite drei des Lokalteils, bestenfalls auf Seite eins der Stadtausgabe. Aber das hier ist eine St.-Louis-Story, deshalb ist es für uns ein Aufmacher. Aber wir können sie nur so groß bringen, wenn wir diesen Typen vermenschlichen, wenn wir den humanen Aspekt der ganzen schmutzigen Angelegenheit in den Vordergrund stellen. Wir wollen, daß der Leser begreift, daß es bei der Todesstrafe genau darum geht: Ein menschliches Wesen wird getötet. Und ja, ich finde, das ist ein wichtiges Thema.«
»Findest du, ja?« sagte Alan und zog eine Braue hoch. »Und was ist mit dieser Amy Dingsda, der schwangeren Kleinen, der unser Frankie Boy in den Hals geschossen hat? Was ist mit ihrer Menschlichkeit? Gehört das auch zu dem Thema?«
»Nun, ja.«
»Ich meine, Everett war das ganze Wochenende hier, weil in zwei Tagen sechzehn Menschen durch Schußwaffen verletzt wurden – sechzehn –, vier davon tödlich. Was ist mit diesem Thema?«
»Also gut, ja, das ist auch ein Thema.«
»Michelle dachte, das Thema wäre pi-pi und tü-tü, ich weiß nicht, was zum Teufel sie gedacht hat. Wer entscheidet denn, was das Thema bei dieser ›Hintergrundstory‹ ist?«
Mit einem fast anzüglichen Grinsen beugte Alan sich in seinem Stuhl vor. Er liebte das hier, er liebte es. Er griff nach der fettigen Papiertüte auf seinem Schreibtisch, unfähig, noch länger zu widerstehen. »Willst du ein Stück Streuselkuchen?«
»Nein«, sagte Bob. »Nein.«
Alan zog den Kuchen heraus und biß hinein. »Ich will dir mal was sagen«, murmelte er mit vollem Mund. »Themen – Hintergrundthemen – sind das, was wir uns ausdenken, um einen Vorwand zu haben, eine gute Story zu bringen. Wenn ein Richter einer Anwältin an die Titten grabscht, geht es um das Thema sexuelle Diskriminierung. Wenn ein Neunjähriger seinen Bruder mit einer Uzi abknallt, lautet das Thema Gewalt bei Kindern. Die Leute wollen über Geschlechtsteile und Blut lesen, und wir machen Themen daraus, um ihnen einen Vorwand zu liefern. Das ist der Unterschied zwischen einer renommierten Zeitung und einem billigen Revolverblatt: die Verlogenheit.«
Bob warf die Hände in die Luft und suchte Zuflucht in seiner sanften Ironie. »Nun, dann sollte ich Steve vermutlich doch anrufen«, sagte er leise. »Das ist eine absolut präzise Beschreibung seiner Einstellung.«
Alan lehnte sich wieder zurück, entspannt diesmal, und kaute, den Kuchen in der Hand. Sein brütendes Habichtgesicht war leicht nach oben gewandt. Ein zweites Frühstück, eine journalistische Debatte, eine Chance, Bob abzukanzeln: Einmal abgesehen von der Tatsache, daß sich eine seiner Reporterinnen totgefahren hatte, ließ sich der Vormittag richtig nett an. »Laß mich dir etwas über Steve Everett erzählen«, sagte er, während er mit der freien Hand die Krümel von seiner Krawatte wischte. »Weißt du, warum sie ihn in New York gefeuert haben? Kennst du die Geschichte?«
Bob mußte zugeben, daß er sie nicht kannte.
»Er hat den Bürgermeister auffliegen lassen«, sagte Alan. »Den Bürgermeister von ganz Scheiß New York. Steve bekam ein geheimes Memo in die Hände über einen Schmiergeldvertrag zwischen Euer Ehren und einem ehemaligen Bezirksbürgermeister, der auch bereit war, die Sache zu bestätigen. Ihm konnte es egal sein: Er war schon verurteilt worden. Steve brachte die Story in seiner Kolumne. Und am nächsten Morgen: keine Kolumne. Die Zeitung hatte sie gestrichen. Steve kommt in die Redaktion und macht ein Höllenspektakel, bis er plötzlich vor die Jungs im obersten Stockwerk zitiert wird. Große Überraschung – und was glaubst du? Der Besitzer der Zeitung liegt mit dem Bürgermeister in einem Bett. Irgendeine Immobiliengeschichte, Gemauschel um einen Flächennutzungsplan, was weiß ich. Steve ist jedenfalls ausgerastet. Er sagt, entweder die Kolumne kommt, oder ich gehe. Und so kam es, daß der Bürgermeister von New York ehrenvoll aus dem Amt geschieden ist, während die Stadt St. Louis sich bis zum heutigen Tag mit Everetts illustrer Anwesenheit schmücken kann.«
Alan stopfte den letzten Bissen Streuselkuchen in den Mund und leckte sich die Finger wie ein fetter zufriedener Kater. Neben dem Tanzen mit seiner Frau war das Spielen mit den Köpfen seiner Untergebenen eines seiner Hauptvergnügen im Leben. Und mit Bob ganz besonders; vermutlich weil er so ernst und aufrichtig war. Die Geschichte über mich zum Beispiel – den ehrlichen Reporter, der von korrupten Politikern aus der Stadt gejagt wurde, so etwas könnte im Film passieren. Es wäre das, was man den »Background« des Helden nennen würde, das, was passiert ist, bevor der Film angefangen hat. Der Chefredakteur würde es dem Lokalchef etwa fünfzehn Minuten nach Beginn erzählen, damit man weiß, daß der Held ein Guter ist, trotz seiner Macken, ein Kerl, dem man vertrauen kann.
Leider war es in meinem Fall erstunken und erlogen. Es ist nie passiert. Alan hatte es sich nur ausgedacht, weil er wußte, daß es Bob maßlos ärgern würde, mich wie einen Filmhelden zu sehen. Er wußte, daß er sich winden würde.
Und Bob wand sich, während er, sein rosiges Gesicht ausdruckslos, vor dem Schreibtisch stand. So intelligent und redegewandt er auch war, er liebte das Kino, und jenes heroische Bild von mir traf ihn hart, nagte an ihm und machte ihn sprachlos. Er schob seine Hände in die Taschen seiner Khakihosen. Manchmal konnte Alan wirklich ein Schwein sein.
»Also gut«, sagte Bob nach einer Weile – und Alan hätte fast laut losgelacht, als er sah, wie Bob die Worte herauswürgte. »Also gut. Wie du willst. Ich werde versuchen, Everett zu Hause zu erreichen.«
Kapitel 4
Der Zufall aber wollte es, daß ich nicht zu Hause war. Ich war bei Bob zu Hause, genauer gesagt in Bobs Bett. Ich rauchte eine Zigarette und betrachtete den nackten Hintern seiner Frau.
Sie hieß Patricia, und sie hatte einen hübschen Hintern. Rund und rosig, genau wie Bobs Gesicht, wenn man es bedachte. Im Moment jedoch fiel mir vor allem der längliche ovale blaue Fleck direkt unterhalb der rechten Rundung ins Auge. Vermutlich hatte ich ihn dort hinterlassen, als ich ihr einen Klaps gegeben hatte.
Jetzt hatte ich ein schlechtes Gewissen. Schließlich war es kein wütender Klaps gewesen. Sie wollte es so. Sie mochte es, wenn ich sie beim Sex an den Haaren zog und sie schlug. Mein Ding war es, ehrlich gesagt, nicht, aber es war doch ziemlich aufregend und mal was anderes als mit meiner Frau zu Hause. Aber dieser blaue Fleck. Ich hatte einfach die Beherrschung verloren, und jetzt hatte ich ein schlechtes Gewissen.
Sie drehte sich um, und mir stockte der Atem. Nach sechs gemeinsamen Wochen blieb mir beim Anblick ihres Körpers noch immer die Luft weg. Groß, kräftig und von einem dunklen Rosa, mit vollen Hüften und großen Brüsten, die zu beiden Seiten herabquollen, wenn sie auf dem Rücken lag. Kühl wie eine Statue mit einem marmorkalten, von rotbraunem Haar gerahmten Gesicht, fein geschnitten, distanziert, neugierig und ein wenig spöttisch. Alles in allem eine coole Braut, die gute Patricia.
Sie blinzelte mich verschlafen an. »Gefällt er dir wirklich?« fragte sie.
»Dein Körper?« fragte ich. »Ja, ich würde ihm neun Komma sieben von zehn möglichen Punkten geben.«
Sie lächelte und strich sich das Haar aus dem Gesicht. »Tut mir leid. Ich muß wohl für eine Minute eingeschlafen sein. Ist es schon spät?«
»Nein. Es war wirklich bloß eine Minute. Wir sind noch in der Zeit.«
Sie räkelte sich und legte ihre Hand sanft auf meine Brust. Sie ließ ihre Finger über das schwarze Haar gleiten, bis sie auf den Pik-förmigen Flecken rohen Gewebes direkt unterhalb des Brustbeins stieß.
»Was ist das eigentlich?« murmelte sie.
»Ich weiß nicht. Hatte ich schon immer.«
»Es ist irgendeine Narbe. Irgendwas muß dir zugestoßen sein.«
»Vermutlich.«
»Haben dir deine Eltern nie davon erzählt?«
»Nein. Meine Adoptiveltern – sie wußten es nicht. Es war schon da, als ich zu ihnen kam.« Ich beobachtete ihre Finger, den weinroten Nagellack. »Es war schon immer da.«
Sie zog ihre Hand zurück und räkelte sich erneut, dehnte beide Arme anmutig nach hinten, bis ihre gefalteten Hände das Kopfteil des Bettes berührten. Sie gähnte. »Ich meinte die Zeitung.«
»Was?«
»Als ich dich gefragt habe, ob er dir wirklich gefällt. Wir haben über deinen Job bei der Zeitung geredet, bevor ich eingeschlafen bin. Oder nicht?«
»Oh. Ja. Haben wir wohl.«
Sie ließ ihre Arme sinken. »Ich meine, arbeitest du wirklich gerne dort?« Sie wandte sich mir zu, den Kopf in eine Hand gestützt. »Das Ganze kommt mir einfach irgendwie so – monoton vor. Nach einer Weile, meine ich. Es sind doch immer wieder dieselben Geschichten, oder nicht? Wie oft kann man ein Zugunglück oder einen Mord oder eine Wahl interessant finden?«
Es ging eigentlich um Bob, muß man wissen. Wenn sie mit mir zusammen war, ging es eigentlich immer um Bob.