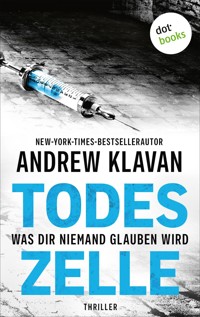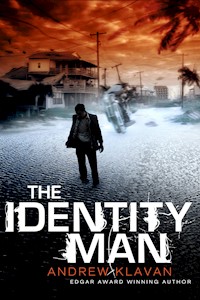6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein Erbe aus Schuld und Gier: Der packende Thriller »Totenbild« von Andrew Klavan jetzt als eBook bei dotbooks. Als der amerikanische Filmemacher Richard Storm erfährt, dass er nicht mehr lange zu leben hat, reist er ein letztes Mal nach England, um endlich herauszufinden, wie viel Wahrheit hinter den Schauergeschichten steckt, die er seit Jahren auf die Leinwand bringt. Doch anstelle von Geistern trifft er auf die junge Sophia Endering, deren düstere Familiengeschichte sie wie ein bedrohlicher Schatten verfolgt: Eine skrupellose Sekte ist auf der Suche nach dem Tryptichon, einem mysteriösen Gemälde, das seit langer Zeit im Besitz von Sophias Familie ist – und ihr fanatischer Anführer ist bereit, alles zu tun, um es in seine Hände zu bekommen. Sophia und Richard bleibt nur eine Wahl: Das Tryptichon finden und für immer zerstören. Eine gefährliche Jagd beginnt … »Klavan zieht alle Register... Die Spannung ist hoch, der Spaßfaktor höher.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der nervenaufreibende Psychothriller »Totenbild« von Bestsellerautor Andrew Klavan wird alle Fans von Stephen King und Mariette Lindstein begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als der amerikanische Filmemacher Richard Storm erfährt, dass er nicht mehr lange zu leben hat, reist er ein letztes Mal nach England, um endlich herauszufinden, wie viel Wahrheit hinter den Schauergeschichten steckt, die er seit Jahren auf die Leinwand bringt. Doch anstelle von Geistern trifft er auf die junge Sophia Endering, deren düstere Familiengeschichte sie wie ein bedrohlicher Schatten verfolgt: Eine skrupellose Sekte ist auf der Suche nach dem Tryptichon, einem mysteriösen Gemälde, das seit langer Zeit im Besitz von Sophias Familie ist – und ihr fanatischer Anführer ist bereit, alles zu tun, um es in seine Hände zu bekommen. Sophia und Richard bleibt nur eine Wahl: Das Tryptichon finden und für immer zerstören. Eine gefährliche Jagd beginnt …
»Klavan zieht alle Register... Die Spannung ist hoch, der Spaßfaktor höher.« Publishers Weekly
Über den Autor:
Andrew Klavan wuchs in New York City auf und studierte Englische Literatur an der University of California. Danach arbeitete er als Reporter für Zeitungen und das Radio, bevor er sich ganz dem Schreiben seiner Spannungsromane widmete. Heute gilt Klavan als einer der großen Thriller-Experten der USA. Mehrere seiner Bücher sind mit dem begehrten Edgar-Award ausgezeichnet, für weitere Preise nominiert und/oder verfilmt worden.
Die Website des Autors: andrewklavan.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/aklavan/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Todeszelle – Was dir niemand glauben wird«, »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen sein«, »Todeszahl – Was tief begraben liegt«, »Hilfeschrei – Die Dunkelheit in uns«, »Opferjagd«, »Totenbild« und »Todesmädchen«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »The Uncanny« bei Crown Publishers Inc., New York. Die erste deutsche Hardcover-Ausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Das Tryptichon« bei Diana, München. Die erste deutsche Taschenbuchausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Augen der Angst« bei Heyne, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1998 by Amalgamated Metaphor Inc.
Copyright © der ersten deutschen Hardcover-Ausgabe 1999 by Diana Verlag AG, München und Zürich
Copyright © der ersten deutschen Taschenbuchausgabe 2002 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pavel L Photo and Video, sefa yamak
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-284-8
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andrew Klavan
Totenbild
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Sepp Leeb
dotbooks.
Dieses Buch
ist für meine Mutter und
meinen Vater
»Bleib, Illusion!«
Hamlet
IVorspiel: Black Annie
Seine Augen! Seine Augen waren voller Angst. Und obwohl ich ihn erst vor sechs Monaten in London gesehen hatte, schien er seitdem um ebenso viele Jahrzehnte gealtert zu sein. Er war wie ich Anfang Dreißig und starrte mir nun durch die halb offene Tür von Ravenswood Grange entgegen mit der furchtsamen Feindseligkeit, all dem Argwohn eines Eremiten, der in seinen finstersten Meditationen gestört wurde.
Meinen Einspänner hatte ich bereits fortgeschickt. Ich hörte, wie die Hufschläge des Pferdes auf der langen Auffahrt des Gutshauses hinter mir leiser wurden. Das herbstliche Dämmerlicht zog sich um mich zusammen, die windgepeitschten Wolken des tiefhängenden Himmels drückten von oben auf mich herab. Das Haus selbst, die ganze graue Masse aus Stein, ragte wie drohend vor mir auf. All dies – und all die abscheulichen Raben, die von den Traufen und Giebeln des Hauses finster auf mich herabspähten – trug dazu bei, den Schauder der Angst zu verstärken, mit dem ich auf der Schwelle des Gutshauses stand und in die gezeichneten Züge meines ehemaligen Schulkameraden blickte.
»Mein Gott, Quentin!« brachte ich schließlich hervor. »Mein Gott, Mann, wo sind die Bediensteten?« Denn er war selbst an die Tür gekommen, und nicht nur die Eingangshalle hinter ihm, sondern das ganze Haus um ihn herum lag bis auf die flackernde Kerze in seiner zitternden Hand in völligem Dunkel.
Auf das Geräusch meiner Stimme hin blickte Quentin sich abwesend um, als merke er erst jetzt, daß er verlassen worden war. Langsam richtete sich sein angstvoller Blick wieder auf mich – und doch, mir war, als ginge er durch mich hindurch. Gerade so, als wäre ich unsichtbar, ein Geist, und als sähe er nur die verlassene Auffahrt, die sich, überschattet von zwei Reihen düsterer Blutbuchen, im Dämmerlicht verlor. »Fort«, hauchte er mit einer hohen, brüchigen Stimme, der Stimme eines alten Mannes. »Alle fort. Sie wollten nicht bleiben. Nicht einer von ihnen wollte bei mir bleiben. Nicht ein einziger.«
Der Wind frischte auf. Das herbstliche Laub wirbelte raschelnd um meine Füße. Von der Spitze eines Giebels kam der heisere Schrei eines Raben, seltsam triumphierend, grausig. Ich erschauderte. Doch schließlich löste ich mich aus der Erstarrung, die mich angesichts des verstörten Zustands meines Freundes befallen hatte. Ich trat vor und streckte meine Hand aus. Doch Quentin fuhr sich nur flüchtig mit der Zunge über die Lippen und wich vor mir in die finstere Eingangshalle zurück.
Ich folgte ihm, betrat das Haus. Mit einem unheilvollen Donnern fiel die mächtige Holztür hinter mir zu. Ich zwang mich, dem ebensowenig Beachtung zu schenken wie dem ominösen Halbdunkel, das sich rings um Quentins einsame Flamme verbreitete. Mit einem tröstenden Wort auf den Lippen trat ich noch einmal auf ihn zu. Dieses Mal wich er nicht zurück. Ich nahm den armen Mann beim Arm und führte ihn behutsam in den Salon.
Dort machte ich Feuer, doch es trug nur wenig dazu bei, die gedrückte Stimmung zu vertreiben, die über dem Raum lag. Alles wirkte verlassen und unbewohnt. Auf den Leisten der Vertäfelung lag dichter Staub, von den Deckenbalken hingen Spinnweben. Auf dem Fußboden und den Möbeln waren achtlos Papiere und Notizbücher verstreut.
Die Wärme und Behaglichkeit, die der Feuerschein im Kamin spendete, wurde rasch verschluckt – von den hohen Decken, von den düsteren Bildteppichen an den Wänden und von den schweren Vorhängen der schmalen Rundbogenfenster.
Als ich mich vom Kamin erhob, stellte ich fest, daß Quentin in einen Lehnsessel gesunken war. Stumm und mit offenem Mund saß er da, wie gebannt von den Schatten, die über das verschlungene Muster des Orientteppichs huschten. Der Lichtschein des Feuers, der Lichtschein der Kerze, die er immer noch achtlos in der Hand hielt, fuhren über seine eingefallenen Wangen wie rote Finger, wie eine Vorahnung vom Höllenfeuer. Ich nahm die Kerze aus seinem matten Griff und zündete damit eine Lampe an, die auf dem Tisch neben seinem Sessel stand. Dabei wurde ich entsetzt des vollen Ausmaßes seiner unheimlichen Verwandlung gewahr.
Er bot fürwahr einen traurigen Anblick, und das um so mehr, als ich noch in bester Erinnerung hatte, wie er kein halbes Jahr zuvor ausgesehen hatte. Damals hatten wir in meiner Stadtwohnung zusammengesessen, so, wie das ehemalige Schulkameraden eben tun, lässig in einen Sessel oder auf das Sofa gelümmelt. Wir hatten uns mit derselben jugendlichen Heftigkeit wie dereinst bis tief in die Nacht hinein unterhalten. Als Kirchenmann mit einer einträglichen Pfründe in Sussex war Quentin wie eh und je ein vehementer Verteidiger des Glaubens, ein Apologet Newmans, ein Unterstützer Puseys, ein glühender Verfechter des hehren Rituals und des tiefen Mysteriums. Ich, ein Arzt mit einer kleinen, aber prosperierenden Praxis in der Harley Street, war gleichermaßen entschlossen, mich für die Wissenschaft in die Bresche zu werfen und Vernunft und Experimentierlust als den Königsweg zur Entschlüsselung der subtilen Mechanismen des Uhrwerks Leben zu predigen.
Deutlich erinnerte ich mich an die Vehemenz, mit der Quentin mir widersprochen hatte, an das Leuchten in seinen Augen und an das Beben seiner Stimme, wenn er das Wunderbare und das Übernatürliche als verläßlichsten Führer zur Wahrheit anpries.
Doch jetzt – keine vierzehn Tage, nachdem er nach Ravenswood zurückgekehrt war, um dort nach dem plötzlichen Tod seines älteren Bruders und seiner Schwägerin deren Nachlaßangelegenheiten zu regeln – war sein offenes, energisches Gesicht faltig und ausgemergelt und seine hagere Gestalt ebenso verfallen wie die Ruinen der alten Abtei, die außerhalb der Mauern des Gutes stand. Mir fiel trotz all meines medizinischen Wissens nichts Besseres ein, als ihm ein Glas Brandy anzubieten. Dieses führte er nun mit meiner Unterstützung zitternd an seine Lippen.
Die Arznei tat bald ihre Wirkung. Leise hüstelnd stellte er das leere Glas neben die Lampe und blinzelte zu mir hoch, als sähe er mich zum ersten Mal.
»Dem Himmel sei Dank, Neville«, sagte er. »Du bist gekommen.«
»Natürlich bin ich gekommen, alter Knabe«, erwiderte ich so zuversichtlich, wie ich konnte. »Sobald ich deinen Brief erhalten hatte. Aber was zum Teufel ist los mit dir? Du siehst aus, als hättest du Schreckliches durchgemacht.«
Bei diesen Worten schien eine Erinnerung das Entsetzen in seinen Augen neu zu entfachen. Er wandte sich von mir ab und starrte in das mittlerweile hell lodernde Feuer. »Du hast dich getäuscht, Neville, weißt du das?«
»Ich mich getäuscht? Inwiefern?«
»In allem. In allem«, wiederholte er niedergeschlagen. »Es gibt eine Welt jenseits der, die wir kennen. Es gibt ein Jenseits, und es ist ... es ist ...« Aber er sprach den Satz nicht zu Ende. Stattdessen sah er mich, als er den Kopf wieder hob, mit einem Ausdruck solch bemitleidenswerten Entsetzens an, daß alle weiteren Worte überflüssig waren. »Neville«, flüsterte er dann plötzlich wie elektrisiert und beugte sich mit einer eindringlichen Geste zu mir vor. »Neville, ich habe es gesehen. Ich habe sie gesehen!«
»Sie? Wen meinst du?« entgegnete ich scharf. Das Frösteln, das meinen Rücken hinaufzukriechen begann, hatte mich in einen leicht gereizten Zustand versetzt. »Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Komm zur Sache, Mann! Wen hast du gesehen?«
In eben diesem Moment schienen ihn die Kräfte wieder zu verlassen. Der arme Kerl sank matt in seinen Sessel zurück, das Kinn sackte ihm auf die Brust, und seine Züge wurden schlaff. Als seine Stimme wieder ertönte, war sie so gespenstisch wie das Echo aus einem leeren Grab.
»Black Annie!« war alles, was er sagte.
Ich wußte nicht, ob ich darüber lachen oder angesichts dieses weiteren Beweises seiner Sinnesverwirrung erschrecken sollte. Zu guter Letzt, nachdem ich das Gesicht abgewandt hatte, um meine Reaktion vor ihm zu verbergen, sagte ich lediglich: »Hör mal, glaubst du eigentlich, daß es in diesem Mausoleum irgendetwas zu essen gibt?«
Zum Glück war das der Fall. Und nun stellte sich heraus, daß nicht alle Bediensteten das Haus verlassen hatten. Zumindest ein Mädchen – aus purem Mitleid mit seinem jungen Herrn, wie ich annahm – war geblieben. Unter der Bedingung, das Haus rechtzeitig vor Einbruch der Dämmerung verlassen zu dürfen, hatte sie sich bereit erklärt, sich tagsüber meines Freundes anzunehmen. Daher fand ich bei genauerem Nachsehen eine kalte Mahlzeit im Speisezimmer vorbereitet. Nichts weiter als eine bescheidene Portion Hammelfleisch, einen halben Laib Brot und eine eher unglücklich gewählte Flasche Bordeaux, doch es genügte. Ich brachte die karge Mahlzeit in den Salon, wo wir sie vor dem Kamin verzehrten. Wir aßen schweigend. Um ehrlich zu sein, wir tranken erheblich mehr, als wir aßen. Auf mein Drängen hin überwand sich Quentin, halbherzig von seinem Hammelkotelett zu kosten. Ich für meinen Teil saß die meiste Zeit gedankenversunken vor meinem Wein und dachte über das nach, was ich bislang erfahren hatte.
Black Annie. Der Name – in solch furchterregendem Ton von meinem Gefährten ausgesprochen – war mir nicht gänzlich unbekannt. Es gab, so erinnerte ich mich, eine alte Geschichte, die Ravenswood Grange mit einer solchen Gestalt in Verbindung brachte. Quentin selbst hatte sie mir während unserer Schulzeit an einem jener Abende erzählt, an denen wir uns nach dem Lichterlöschen gegenseitig um den Schlaf zu bringen versuchten, indem wir uns von Bett zu Bett allerlei Schauergeschichten zuflüsterten.
Ich erhob mich von meinem Stuhl und ging zu einem der Fenster in der gegenüberliegenden Wand. Als ich zwischen den verbeulten Bleizügen hindurchblickte, sah ich, daß sich die Nacht noch nicht vollständig über das Gut gelegt hatte. Sobald der dreiviertelvolle Mond zwischen den dahinfegenden Wolken sichtbar wurde, breitete er einen Schleier aus unstetem und blassem Licht über das welke Weideland im Osten. Auf diesem Stück Land, bald sichtbar, bald den Blicken entzogen, stand ein düsteres und unheilvolles Gebilde: die Ruinen von Ravenswood Abbey – der Keil einer eingestürzten Kapellenwand, die schiefen Grabsteine eines alten Friedhofs.
In der Zeit, bevor die alte Religion den Verwüstungen Heinrichs VIII. zum Opfer fiel, hatte sich das Land, auf dem jetzt das Gut stand, innerhalb der Grenzen jener Abtei befunden, mit der auch die Geschichte von Black Annie in Zusammenhang stand. Es handelte sich wohl kaum um eine wahre Geschichte. Ich glaube, es gibt in ganz England keine ähnliche Ruine, in der nicht zu mitternächtlicher Stunde irgendein verstorbener Mönch oder sonst jemand umgeht. Im Fall von Ravenswood Abbey, so sagt die Legende, ist es der Geist einer Nonne – wegen ihres schwarzen Ordenskleides Black Annie genannt–, der in dem verfallenen Gemäuer spukt. Besagte Nonne war zu ihren Lebzeiten von einem Augustinerdomherrn verführt worden – einem schwarzen Domherrn, wie sie wegen ihrer Kutten hießen. Es gab das übliche Nachspiel: Die arme Frau wurde bald schwanger. Doch bevor ihre Sünde offenbar werden konnte, verschwand sie auf unerklärliche Weise. In Wahrheit war es ihr mit Hilfe ihrer Mitschwestern gelungen, sich in einer Geheimkammer im Schlaftrakt des Nonnenklosters zu verstecken. Dorthin brachten ihr die Nonnen Essen und Trinken – und hielten während der häufigen Besuche ihres Buhlen Wache. Als jedoch der Zeitpunkt ihrer Niederkunft näher rückte, wurde klar, daß dieses Versteckspiel nicht für immer so weitergehen konnte. Erschwerend kam noch hinzu, daß damals im ganzen Land Getreue des Generalvikars unterwegs waren, um im Auftrag des Königs nach Beweisen für Korruption in den Reihen der Geistlichkeit zu suchen. Aus Angst vor Entdeckung überredete daher der Domherr seine Geliebte, das Neugeborene seiner Obhut zu übergeben. Er versprach ihr, das Kind an einen sicheren und geheimen Ort zu bringen, wo es von einer ihm persönlich bekannten Amme bestens versorgt würde. Nachdem jedoch der niederträchtige Domherr der Mutter den Säugling entwendet hatte, schnitt er dem wehrlosen Geschöpf in der Hoffnung, sein Vergehen vor den königlichen Inspektoren für immer vertuschen zu können, die Kehle durch und versteckte seinen winzigen Körper auf dem Gelände der Abtei. Wie nicht anders zu erwarten, drang die Kunde von dieser abscheulichen Tat irgendwann auch bis in das Versteck der untröstlichen Mutter vor. Als die Beamten des Königs eintrafen, um ihre Inspektion durchzuführen, wurden sie unverzüglich in die geheime Kammer geführt, wo sie die unglückliche Frau – zweifellos zu ihrer nicht geringen Genugtuung – an einem kräftigen Strick von einem der Deckenbalken hängend vorfanden. Das war die grausige Geschichte, die mir Quentin eines Nachts im Schlafsaal erzählt hatte. Und mit einem entsprechend schaurigen Tonfall hatte er flüsternd hinzugefügt, es heiße, der schwarzgewandete Geist der Nonne gehe bis zum heutigen Tag in den Ruinen der Abtei um.
Ich fürchte, ich habe bei dem Gedanken an dieses Schauermärchen einen leisen Laut des Spotts von mir gegeben. Denn als könne er meine Gedanken lesen, sagte Quentin hinter mir: »Daran kannst du dich doch noch erinnern, oder?«
Ich deutete aus dem Fenster. »Ich kann mich an irgendeinen Unsinn erinnern, den du mir einmal in der Schule erzählt hast, aber ...«
»Es ist wahr, Neville«, rief er aus. »Es ist alles wahr!« In einem neuerlichen Anfall von Erregung sprang er von seinem Sessel hoch und stürmte in die Mitte des Raumes. Dort blieb er unter dem Bildteppich der keuschen Susanna stehen, deren im Laufe der Zeit verblichene Haut der Feuerschein wieder rosig und lebendig erscheinen ließ. Quentins blasse, gequälte Gesichtszüge wurden ebenfalls von Flammen und Schatten zerfurcht, auch sie erhielten ein verschlungenes Eigenleben, während er seine zitternde Hand hob, um aus dem Fenster zu deuten. »Ich sage dir, ich habe sie gesehen. Da draußen. Bei der Abtei. Und das ist noch nicht alles ...« Doch sein Arm sank bereits wieder hinab, und er schüttelte mutlos den Kopf.
»Was noch?« hakte ich nach.
»Oh!« Aus diesem Laut sprach solch eine Hoffnungslosigkeit, daß all meine ungeduldige Skepsis von einer Welle des Mitgefühls fortgespült wurde. »Ich wußte, du würdest mir nicht glauben, Neville. Du mit deinem Vertrauen in Wissenschaft und Vernunft – du mit deiner neuen Religion, die es nicht erwarten kann, die alte zu verdrängen. Aber ich sage dir, ich habe sie gesehen, und vor allem ... vor allem habe ich sie gehört.« Quentin warf einen so verstohlenen, wissenden Blick auf die Eichentür des Raumes, daß sich in mir zum ersten Mal der Verdacht regte, er sei tatsächlich verrückt. »In diesem Haus«, murmelte er. »Sie war in diesem Haus.«
Erschüttert – über seinen Gesichtsausdruck, seinen Tonfall – versuchte ich erneut, einen herzlichen, unbesorgten Ton anzuschlagen. »Nun gut. Es tut schwerlich etwas zur Sache, ob ich dir glaube oder nicht. Wenn sie dir erscheint, so wird sie hoffentlich keine Skrupel haben, auch mir zu erscheinen. Dann kann ich mich auf ›das vernünftige und wahre Zeugnis meiner eigenen Augen‹ berufen. Und ich hege nicht den geringsten Zweifel«, fügte ich mit gedämpfter Stimme hinzu, »daß wir uns dann daranmachen können, dieser Sache auf den Grund zu gehen.« Quentin nickte nur und kehrte mit schweren Schritten zu dem lodernden Feuer im Kamin zurück. »Paß auf, was du sagst, Neville«, riet er mir noch. Dann ließ er sich wieder in seinen Sessel sinken.
»Ich habe keine Angst«, versicherte ich ihm.
Aber das war eine Lüge. Ich hatte große Angst, wenn auch nicht aus den Gründen, die er vermutlich unterstellte. Es war der Verstand meines Freundes, um den ich fürchtete. Welche Erscheinung er auch immer gesehen haben mochte – für mich als nüchtern denkenden Arzt bestand kein Zweifel, daß es sich nicht um einen »seltsamen, nicht zur Ruhe kommenden Geist« handelte, sondern vielmehr um eine Vorspiegelung seiner verwirrten Sinne. Was ich freilich nicht beurteilen konnte, war, ob sich diese Sinnesverwirrung noch behandeln ließ, oder ob Quentin – und ich habe schon mehrere solche Fälle beobachtet – bereits unwiederbringlich dem Wahnsinn verfallen war. Ich erwartete – um nicht zu sagen, fürchtete –, daß noch diese Nacht eine Antwort auf meine Frage bringen würde.
So hielten wir also Wache, er und ich. Das Feuer brannte herunter, und das Öl in der Lampe verzehrte sich. Langsam senkten sich die Schatten von den Deckenbalken auf uns herab. Die Gestalten auf den Wandteppichen verschmolzen mit dem Dunkel, bis nur noch ein spähendes Auge da, ein geheimnisvolles Lächeln hier, eine greifende Hand dort im flackernden Licht aufleuchteten, begleitet vom Knacken eines verglühenden Scheits. In diesen Stunden hatte ich ausreichend Gelegenheit, mir mehr oder weniger kluge Gedanken über den Zustand meines Freundes zu machen. Ungeachtet meiner eigenen Überzeugungen bin ich, so hoffe ich zumindest, kein Gegner aufrichtigen Glaubens. Dennoch konnte ich nicht umhin, mich zu fragen, ob es nicht vielleicht Quentins geistliche Studien waren, die ihn derart verstört hatten. Die zivilisierte Form von Religion, der wir in unseren modernen Zeiten anhängen, ist schließlich tief in uraltem, fast vergessenem Geisterglauben verwurzelt. Waren es diese abergläubischen Vorstellungen, so fragte ich mich, die – vom Fieberwahn meines Freundes zum Bildnis der Black Annie geformt – in den Ruinen der Abtei ihr Unwesen trieben?
Während ich derlei Gedanken nachhing, ging die Lampe aus. Auch die Glut im Kamin brannte zischend weiter herunter, und noch tiefere Dunkelheit umschloß uns. Verstohlen beobachtete ich meinen Freund, und meine Besorgnis nahm noch zu, als ich erkannte, daß die Niedergeschlagenheit, mit der er unsere Wache begonnen hatte, allmählich einem Zustand wachsender Anspannung und Erregung wich. Irgendwo außerhalb des Raumes schlug eine Uhr. Es war Mitternacht.
Plötzlich sprang Quentin auf und rief: »Das ist die Stunde! Sie ist hier!«
Bevor ich etwas antworten konnte, war er durch den Raum ans Fenster geeilt und hatte das Gesicht an die Scheibe gedrückt. Ich war ihm dicht auf den Fersen und blickte nur wenige Augenblicke später über seine Schulter.
Die Scheibe beschlug von seinem Atem, als er heiser hervorstieß: »Da draußen!«
»Ich kann nichts sehen!« entgegnete ich. Weiter als einen Meter entfernt war nichts mehr zu erkennen als tiefe schwarze Nacht.
Schließlich frischte der Wind auf. Ich hörte es im Kamin und sah es kurz darauf an den Bewegungen einer Ulme, deren nackte Zweige sich zitternd zu biegen begannen. Und sobald der Wind stärker wurde, rasten die Wolken über den Himmel – und der Mond trat immer öfter hinter ihnen hervor. Sein gespenstischer silberner Schein hob die Landschaft aus dem Dunkel. Hinter der verschlungenen Silhouette der Ulme waren nun die Ruinen der Abtei zu sehen – trostlos, schwarz und drohend. Die ständig wechselnde Beleuchtung, durchwirkt von den rasch vorüberziehenden Wolkenschatten, verlieh der Szenerie etwas Unwirkliches, es sah aus, als würde ringsum alles schweben. Wir blickten durch die Scheibe wie durch einen zerrissenen Vorhang in eine andere Welt.
Und dann sah ich sie. Die Gestalt war in ein weites Gewand gehüllt. Die Kapuze hatte sie tief ins Gesicht gezogen, und sie war rabenschwarz, so schwarz, daß sie weniger wie ein Lebewesen als vielmehr wie die Abwesenheit jeden Lebens erschien. Langsam, mit ehrfurchtgebietender Würde, schritt sie zwischen den Grabsteinen des Friedhofs dahin.
Ich kann das lähmende Entsetzen nicht beschreiben, das mich bei diesem unheimlichen Anblick befiel. Mir gefror das Blut in den Adern. Starr vor Angst stand ich wie gelähmt da. In den schier endlosen Momenten, in denen sich das Wesen bedächtig auf die Überreste der Kapellenwand zubewegte, war ich außerstande, mich zu bewegen, zu sprechen oder auch nur zu atmen, sondern stand nur mit weit aufgerissenen Augen und wie versteinert da. Nicht einmal den Tod selbst hätte ich so bedrohlich gefunden wie diese schwarze Gestalt, die mir wie ein Bote aus einer Welt jenseits des Todes schien, aus einer Welt jenseits aller Vernunft, aus einer Welt – und das war das Schlimmste – jenseits aller Vergebung und Gnade.
Mit lebloser Würde setzte die stumme, traurige Erscheinung ihren Weg fort ans Ende des Friedhofs, zu den Überresten der Kapelle. Dort, neben der eingestürzten Mauer, dort – obwohl ich es als jemand schreibe, der kaum dem Zeugnis seiner eigenen Augen trauen mag –, dort also schien dieses pechschwarze Nicht-Wesen zu meinem ungläubigen Staunen mit immer noch gemessenen Schritten tiefer und immer tiefer in der harten Erde zu verschwinden, bis nur noch der von der Kapuze verhüllte Kopf über die Oberfläche ragte. Und dann war auch er verschwunden.
Fast im selben Augenblick schoß, vom heulenden Wind über den Himmel gepeitscht, eine gewaltige Wolkenmasse über die Ruine hinweg auf uns zu. Binnen weniger Sekunden hatte sie sich vor den Mond geschoben. Der zerrissene Vorhang schloß sich. Erneut drückte tiefes Dunkel gegen das Fenster.
Sekunde um Sekunde verstrich. Indes – ich war immer noch unfähig, mich zu bewegen – starrte ich weiter wie gebannt in das undurchdringliche Dunkel hinaus, als hätte ich die seltsame Szene noch immer vor mir. Es war Quentins erstickter Schrei, der mich aus meiner Erstarrung riß. Ich drehte mich um und sah, daß er haltlos zu zittern begonnen hatte. Durch seine zusammengebissenen Zähne entwich seiner Kehle ein trockenes, ersticktes Schluchzen. Aus Furcht, es könne sich um die Vorstufe eines Schlaganfalls handeln, zwang ich mich einzugreifen und packte ihn entschlossen am Arm.
»Ist ja gut«, sagte ich lauter, als ich beabsichtigt hatte. »Ist ja gut, Mann, reiß dich zusammen! Es ist vorbei. Sie ist weg.«
»Weg?« Die Stimme, die aus ihm hervorbrach, konnte meine Bedenken keineswegs vertreiben. Sie klang erstickt und hohl, beherrscht von einem kaum unterdrückten hysterischen Lachen. »Sie ist nicht weg.« Er sah mich mit leuchtenden Augen an. »Du Narr! Sie ist nicht weg. Du mußt wissen, hier gibt es unterirdische Gänge. Da draußen. Unter der Abtei. Abwasserkanäle, Geheimgänge für den Nachschub. Die natürlich zum Teil eingestürzt sind, gewiß. Aber es gibt ein ganzes Netz von unterirdischen Kanälen und Gängen. Und einer von ihnen ... einer von ihnen führt ...«
Bevor er zu Ende sprechen konnte, ertönte ein Geräusch – ein Geräusch aus dem Innern des Hauses! Leise, aber nicht zu überhören. Hartnäckig. Es schien von irgendwo unter uns aufzusteigen und durch die Wände zu dringen, bis es den dunklen Salon vollständig erfüllte. Ticktick. Tick-tick. Tick-tick.
Ich habe Leute erzählen hören, die Haare hätten ihnen zu Berge gestanden, doch ich selbst hatte diese Erfahrung noch nie gemacht. Das Geräusch ähnelte dem Ticken eines Uhrpendels, leiser und schwächer als ein Klopfen an der Tür, aber mit dem gleichen unangenehmen Nachdruck. Während mein Blick langsam über die dunklen Gestalten und Gesichter auf den Bildteppichen wanderte, verstummte es. Doch dann ertönte es von neuem:
Tick-tick. Tick-tick.
Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder Quentin zu.
Er lächelte mich an, aber sein Lächeln war durch solch eine abgrundtiefe Verzweiflung verzerrt, daß ich mich außerstande fühlte, es zu erwidern. Er beugte sich vor, und aus seiner Miene sprach fast so etwas wie Genugtuung, als er flüsterte:
»Einer dieser Gänge führt zum Priesterloch.«
Tick-tick. Tick-tick. Tick-tick.
In Abteien und in den Häusern in ihrer Umgebung, das wußte ich, gab es oft geheime Kammern und Verstecke – gebaut, um während der Verfolgungen der Tudor-Zeit bedrohten Priestern Unterschlupf zu bieten. Es war durchaus möglich, daß diese »Priesterlöcher«, von denen König Heinrich immer behauptet hatte, die Domherren benutzten sie für ihre geheimen Liebschaften, durch unterirdische Gänge mit dem Rest der Abtei verbunden waren.
»Ein Priesterloch?« sagte ich, als das leise Klopfen abermals ertönte, und das fiebrige Leuchten in den Augen meines bemitleidenswerten Freundes noch intensiver wurde. »Wo ist es? Können wir es uns ansehen? Komm schon, raus mit der Sprache, Mann!«
Zum zweiten Mal in dieser Nacht warf Quentin einen seltsam wissenden Blick auf die Tür.
Tick-tick. Tick-tick. Wieder dieses infernalische Geräusch. Was war das bloß?
»Im Arbeitszimmer«, sagte Quentin.
Ich zögerte nicht. Auch nur das geringste Verharren hätte meine Entschlossenheit zunichte gemacht. Mit mehr Kühnheit als ich tatsächlich verspürte, schritt ich durch den Raum auf den Kamin zu. Ich nahm eine Kerze vom Kaminsims und bückte mich, um den Docht an ein glühendes Scheit zu halten. Als die Kerze zu brennen begann, trug ich sie zu Quentin. Sein Gesicht sah im flackernden Schein der kleinen Flamme angespannt und verkrampft aus, denn er begann zu ahnen, was ich vorhatte.
»Neville«, stieß er hervor. »Wir können, wir dürfen auf keinen Fall ...«
»Und ob wir dürfen«, unterbrach ich ihn grimmig. »Folge mir.«
Ich zog ihn vom Fenster fort und hinter mir her zur Tür. Es war eine drastische, aber wirksame Maßnahme. Sobald er einmal seiner Passivität entrissen war, schien seine frühere Tatkraft bis zu einem gewissen Grad wieder zurückzukehren. Sein Zittern ließ nach, und als ich aus dem Salon auf den Gang hinaustrat, folgte er mir aus freien Stücken.
Mit jedem Schritt, den wir machten, kam das Geräusch näher und wurde lauter. Doch immer, immer umgab es uns von allen Seiten. Es ertönte hinter den Ahnenporträts an den Wänden, unter den steinernen Bodenplatten, über den Deckenbalken.
Tick-tick. Tick-tick.
Quentin sah mich im unsteten Schein der Kerze eindringlich an und begann stammelnd von neuem zu protestieren.
»Neville! Neville, so hör doch ... um Gottes willen ... du weißt doch gar nicht, worauf du dich da einläßt ... hör auf mich ... hör zu, bevor es zu spät ist ...«
Ohne auf seine Warnungen zu achten, hastete ich weiter, um mich nicht von meinem Entschluß abbringen zu lassen. Das beharrliche rhythmische Klopfen um uns herum wurde immer lauter. Es war, als wäre es in mein Hirn eingedrungen und klopfte im Innern meines Kopfes weiter.
Tick-tick. Tick-tick.
»Neville!« schrie Quentin abermals.
»Ist das die Tür?« fragte ich, als wir das Arbeitszimmer erreichten. Ich hob die Kerze höher und packte die eiserne Türklinke. Auf ein Nicken Quentins hin drückte ich sie nach unten. Die Tür ging nach innen auf.
Wir betraten einen kleinen Raum, und das Kerzenlicht streifte verhüllte Fenster, Bücherregale, einen mit Papieren übersäten Schreibtisch. Der unregelmäßige Atem der Flamme ließ die Gegenstände vor unseren Augen bald verschwimmen, bald wieder scharfe Konturen annehmen.
Tick-tick. Tick-tick.
Gefolgt von Quentin trat ich vorsichtig in den Raum. Was immer es war, es war hier – hier, oder ganz in der Nähe. Das Geräusch schien aus der Mitte des Raums emporzubeben. Jeder Muskel, jede Faser meines Körpers war zum Zerreißen gespannt. Die Flamme begann zu flackern, als sich meine Hand fester um die Kerze schloß, denn da war es wieder, das Geräusch.
Tick-tick.
»Wo?« stieß ich heiser hervor.
»Neville ...«
»Wo?«
Er deutete mit dem Kopf auf die Bücher an der Wand zu meiner Linken. »In diesem Regal«, antwortete er widerstrebend. Mit zwei Schritten hatte ich es erreicht. Es war ein hohes Möbel aus dunklem Holz, dessen Borde modrige Lederbände füllten. Unsicher streckte ich die Hand aus, um über die Buchrücken zu streichen. Quentin hinter mir protestierte weiter.
»Neville, laß uns umkehren, laß uns erst in Ruhe nachdenken, ich muß dir noch mehr darüber erzählen, viel mehr, als du weißt ...«
Ein Buch – ein dickes schwarzes Buch, dessen gerippter Rücken unbeschriftet war – gab unter meinen Fingern nach und rutschte nach hinten. Es ertönte ein Geräusch, als schnappte eine Verriegelung auf. Im selben Moment schien sich das ganze Bücherregal aus der Wand zu lösen. Mit einem knirschenden Quietschen schwang es mir auf einem verborgenen Drehgelenk entgegen.
Als ich es wie eine Tür aufzog, gab es den Blick auf eine schmale Wendeltreppe frei, die sich in tiefes Dunkel hinabwand.
Tick-tick. Tick-tick.
Gerade so, als würde es aus den Balken des Hauses, aus der Luft um uns herum, aus meinem eigenen Hirn herausgesogen, entschied sich das Geräusch nun endlich für einen einzigen Ausgangspunkt, einen einzigen Herkunftsort. Im steten, monotonen Rhythmus eines Trauermarsches stieg es aus dem Dunkel am Fuß der Treppe empor.
Tick-tick.
Ich schickte mich an, zu ihm hinabzusteigen.
»Nein, Neville, nicht!«
Quentins verzweifelte Warnungen schwangen sich in immer schrillere Höhen auf, als ich unter dem Ächzen der feuchten Dielen Schritt für Schritt die Treppe hinabstieg.
»Du weißt gar nichts, du hast nichts begriffen, du mußt mir glauben, ich habe wochenlang über diese Dinge nachgedacht, ich habe zu ergründen versucht ...«
Auf den tropfenden Steinwänden umsprang mich mein eigener Schatten in den bizarrsten Gestalten. Das Herz hämmerte mir in der Brust, und meine Kehle schnürte sich so fest zusammen, daß ich fast zu würgen begann.
Als ich meinen Fuß auf die unterste Stufe setzte, spürte ich, wie ein klammer Luftzug meine Beine umwehte. Die Kerzenflamme flackerte auf, und in ihrem heller werdenden Schein sah ich vor mir eine Tür aus vermodertem Holz, die an handgeschmiedeten Eisenbändern hing.
Tick-tick. Tick-tick.
Das Geräusch kam hinter der Tür hervor. Nervös auf meine Lippe beißend, zwang ich mich, die Hand nach dem Ring auszustrecken, der die Tür geschlossen hielt.
»Neville! Um der Liebe Gottes willen!« rief Quentin. »Es vergingen mehrere Wochen, bevor sie sich erhängte. Wochen, in denen sie nachts ihr Versteck verließ, um durch die Abtei zu streifen. Nächte, in denen sie einen Spaten benutzte, begreifst du denn nicht! In ihrer geistigen Verwirrung, einen gewöhnlichen Spaten, um sich durch den Stein zu graben! Sie suchte ...«
Knirschend schabte die Tür über den Boden. Sie ließ sich nur mit Mühe öffnen.
Tick-tick. Tick-tick.
Auf einmal trat Stille ein. Das Klopfen hörte auf. Die Kerzenflamme flackerte, stabilisierte sich, tauchte das Priesterloch in fahles, trübes Licht.
Aber der Raum war leer.
Quentin und ich standen gemeinsam auf der Schwelle und spähten in ein enges Verlies mit einer niedrigen Balkendecke und Wänden aus unbehauenen Steinquadern. Nichts rührte sich, und die Stille war so vollkommen, daß sie fast unnatürlich erschien. Nicht einmal eine Ratte huschte davon, als wir beide wie versteinert in den Raum starrten.
Doch dann stieß Quentin hervor: »Da! Schau!«
Ich hob die Kerze hoch. Ihr Schein breitete sich über den ganzen Raum aus. Mein Blick folgte Quentins Fingerzeig und fiel auf einen kleinen Haufen aus Splittern und Staub, der sich am Fuß einer Wand auf dem Boden gebildet hatte. Es war sofort ersichtlich, daß es sich dabei um winzige Absplitterungen von einem der Steine darüber handelte. An den Kanten, da, wo auf ihn eingeschlagen worden war, war der Stein kreidig und aufgerauht – gerade so, als habe ihn jemand mit einem Spaten bearbeitet. Ohne lange zu überlegen, ging ich darauf zu. Mit einer Hand hob ich die Kerze hoch, die andere streckte sich nach dem Stein aus. Quentin rief erneut meinen Namen, aber ich befühlte bereits die zerfurchte Kante, da, wo sich der Spaten in den Stein gegraben hatte. Ich bekam den Quader zu fassen und zog daran. Er ließ sich mühelos bewegen, kullerte aus seiner Fassung. Er glitt mir aus den Händen und schlug mit einem solch lauten Krachen auf den Boden, daß die Luft zu erzittern schien. Quentin schrie entsetzt auf. Ich schnappte nach Luft. Doch übertönt wurden diese Laute von einem unbeschreiblich grauenhaften Schrei, der gleichzeitig von überall und nirgends zu kommen schien: ein markerschütterndes Heulen, voll abgrundtiefer Verzweiflung und Pein, jenseits aller Tröstungen der Ewigkeit. Und während das entsetzliche Geheul immer weiter und weiter durch das unterirdische Verlies gellte, schien das Haus bis in seine Grundfesten zu erzittern.
Denn vor uns, in der winzigen Nische, die durch das Entfernen des Steins zum Vorschein gekommen war, lag, in der luftdicht abgeschlossenen Zelle so gut erhalten, daß die Haut so straff wie Pergament geworden war und dem weit aufgerissenen Mund und den leeren Augenhöhlen einen Ausdruck unendlichen Leids verlieh – vor uns lag mit aufgeschlitzter Kehle die Leiche eines kleinen Kindes, die unter unseren Blicken zu Staub zerfiel.
IIStorm hob seinentragischen Blick
1
Auf der anderen Seite des Raumes zerbrach ein Glas.
Storm hob seinen tragischen Blick – und sah eine Frau, für die es sich gelohnt hätte zu sterben.
Er hielt das Buch mit Geistergeschichten noch aufgeschlagen in seinen Händen. Hatte noch den allerletzten Halbsatz auf den Lippen – die unter unseren Blicken zu Staub zerfiel. Doch der Rest des Satzes, die ganze Geschichte waren ihm regelrecht aus dem Kopf geblasen. Von der Frau. Von ihrer Schönheit. Ihr bloßer Anblick hatte ihn von seinem Stuhl aufstehen lassen.
Was er, genauer besehen, ganz schön lächerlich fand. Was würde er als nächstes tun? Wie eine Cartoonfigur in die Luft springen, mit hängender Zunge, mit hervorquellenden Augen, mit einem Herzen, das wie auf einer Kitschpostkarte durch die Hemdbrust pochte? Er war schließlich nicht von gestern, er war durch und durch amerikanisch, ein echter Typ aus Hollywood. Ein realer Mensch mit Haaren in der Nase und psychischen Problemen und einem Anus. Das hier war das richtige Leben und kein Kinofilm. Es war also unmöglich – oder doch nicht? –, daß er sich eben auf den ersten Blick verliebt hatte.
Vielleicht nicht. Aber er starrte sie weiter an. Sie stand im Durchgang zum Wohnzimmer, gehörte zu den Gästen, die hereingekommen waren, als er vorzulesen begonnen hatte. Die große Fichte mit der bunten Weihnachtsbeleuchtung im Raum dahinter schien sie einzurahmen, noch stärker hervorzuheben. Ein Mädchen von, sagen wir mal, etwas über zwanzig. Nicht eins dieser magersüchtigen Starlets, wie er sie sonst gewohnt war, nicht eine seiner üblichen hirnlosen Tussis, vor Silikon und Ehrgeiz strotzend. Sie hatte eine richtige Figur unter dem tief ausgeschnittenen schwarzen Samt. Eine Taille und Hüften mit Substanz, beides extrem fraulich. Einen Busen aus den Zeiten, als ein Busen noch ein Busen war. Einen Schwanenhals, rosige Wangen, eine Haut wie Elfenbein, pechschwarzes Haar. Braune Augen, die hellsten braunen Augen, die man sich vorstellen konnte: intelligent, wach, lebendig. Wahnsinn, dachte er, einfach Wahnsinn.
Die Leute um sie herum – alle aus Bolts exklusivem Londoner Bekanntenkreis – hatten inzwischen begonnen, ihr lachend zu applaudieren. Sie stand immer noch wie versteinert da, die Hand, mit der sie das Glas gehalten hatte, ausgestreckt, ihr erschrockener Blick auf die Scherben am Boden geheftet. Scherben und schimmernde Splitter auf dem braunen Teppich. Ein größer werdender farbloser Fleck. Anscheinend war ihr das Glas einfach aus den Fingern geglitten und im Fallen gegen das Tablett des Butlers gestoßen.
»Oh«, sagte sie endlich. »Wie dumm von mir.«
Storm wurde ganz flau im Magen, und am liebsten hätte er sich an die Brust gefaßt. Was für ein Akzent, dachte er. Durch und durch britisch. Wie Julie Andrews in Mary Poppins. Er konnte sich noch sehr gut an einige seiner Kindheitsphantasien über Mary Poppins erinnern. An die Dinge, die sie ihm mit diesem Akzent vorgesungen hatte. Oh, Richard. Oh, junger Herr! Entschuldigung, wollte er schon laut sagen, es tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Es war doch nur eine blöde alte Geistergeschichte. Aber er kam bereits wieder zur Besinnung. Und außerdem war Bolt aus seinem Lehnsessel aufgestanden und trat zu ihr, und Bolt war schließlich der Gastgeber.
»Oh, Frederick, laß mich das wegmachen«, sagte sie zu ihm. »Wie ungeschickt von mir.«
»Nein, nein.« Er nahm sie am Arm. »Das übernehmen bereits meine getreuen Helferinnen.« Die beiden Frauen, die niedergekniet waren, um die Scherben aufzuheben, starrten böse zu ihm hoch. Ein Mann, der sich wie eine Bombe im Sturzflug seiner Lebensmitte näherte und der mit seinem breiten Gesäß und dem ausladenden Bauch in einem grünen dreiteiligen Anzug auch schon aussah wie eine Bombe. Dazu ein zynisches Schlangengesicht, von zu vielen Bell’s and Rothmans tief zerfurcht. Zottelige graue Haare, aus denen Schuppen fielen. Die Zigarette, von der Asche fiel. »Und außerdem habe ich die Wohnung nur gemietet«, sagte er und geleitete sie fürsorglich aus dem Raum. Storm beobachtete – niedergeschlagen –, wie die beiden den Flur hinunter verschwanden. Er konnte hören, wie ihre Stimmen leiser wurden.
»Es tut mir leid, Frederick, ich hätte gar nicht kommen sollen, ich bin doch ziemlich geschafft. Gestern war ich noch in Ohio, und letzte Woche in Berlin ...«
»Ich bitte dich! Ich lebe für deine Besuche. Ich werde die Scherben als Reliquie aufbewahren. Ich werde an der Stelle einen Schrein errichten ...«
Jemand schlug Storm beifällig auf die Schulter. Jemand anders sagte: »Gut gelesen. Ganz schön gruselig. Ihr haben Sie jedenfalls einen gewaltigen Schrecken eingejagt.«
»Wer ist sie?« murmelte Storm und starrte auf die Stelle, wo sie gestanden hatte.
Und jemand antwortete: »Oh, das – das ist Sophia Endering. Ihrem Vater gehört die Endering Gallery in der New Bond Street. Nicht übel, was?«
Storm nickte. Er blieb noch ein paar Augenblicke lang stehen und ließ den Blick ziellos durch den Raum wandern. Eine gemütliche Nische, eine Ansammlung von Stühlen, mittelmäßige pseudoviktorianische Drucke über niedrigen Regalen mit zerlesenen Taschenbüchern. Ein breiter Bogendurchgang, der in den länglichen Wohnraum führte, in dem der Weihnachtsbaum leuchtete, das Gasfeuer bullerte und die indirekte Beleuchtung Weißweinflaschen zum Schimmern brachte. Wo sich die Gruppe, die sich um ihn geschart hatte, um ihn lesen zu hören, nun wieder auflöste. Wo die Partygespräche wieder aufgenommen wurden.
In dem lauter werdenden Stimmengewirr hörte er die Eingangstür zufallen. Er konnte es spüren: Sie war fort. Langsam sank er in seinen Sessel zurück.
Sophia Endering, dachte er. Er saß da, das Buch lose auf seinem Oberschenkel, mit dem Daumen überflüssigerweise immer noch die Stelle eingemerkt. Sophia Endering.
Doch was tat das schon zur Sache? Das zählte jetzt nicht mehr. Er war nicht in sie verliebt. Er konnte nicht in sie verliebt sein. Er konnte in niemanden verliebt sein.
Er hatte sich wieder ganz in sein unglückliches Inneres verkrochen und saß stumm und zusammengesunken da.
2
Aber warum? dachte Harper Albright. Warum ist er so traurig? Von ihrem Platz aus – zwischen den bestickten Kissen auf der Fensterbank links von Storm – hatte sie alles beobachtet. Sie hatte gesehen, wie Storm beim ersten Blick auf Sophia aufgestanden war. Sie hatte gesehen, wie der Schmerz der Leidenschaft Leben in seine Züge brachte, hatte verfolgt, wie es wieder erstarb, wie alles Feuer in seinen Augen erlosch und erneut dem Ausdruck tiefer Verzweiflung Platz machte. Unwillkürlich mußte sie an eine bestimmte Art von Krabben denken, die ihre Scheren »abwerfen«, sich ihrer buchstäblich entledigen können, um sich dem Zugriff eines Feindes zu entziehen. Es schien ihr, als ob Storm – was für ein lächerlicher Name, aber sie mußte ihn wohl so nennen, und sei es nur aus Respekt vor dem amerikanischen Wunder der Selbst-Erfindung – es schien ihr, als habe Storm auf ganz ähnliche Weise sein Herz »abgeworfen«, sich seines Herzens entledigt, um sich dem Zugriff des Lebens zu entziehen.
Während sie dasaß und nachdachte, hatte sie ihre verwelkten Hände über dem geschnitzten hölzernen Drachenkopf ihres Gehstocks verschränkt. Sie war eine etwas unheimliche, seltsam aussehende Frau, diese Harper Albright. Keineswegs schon besonders alt, vielleicht sechzig, aber dennoch vom Alter gezeichnet. Mit leblosem grauem Haar, das zum Bubikopf geschnitten war und ihr in die gefurchte Stirn fiel. Schlaffe, hängende Wangen unter wulstigen grauen Tränensäcken. Und eine dicke Brille, durch die sie forschend spähte. Zwischen ihren vergilbenden Zähnen steckte eine Pfeife, aus deren Meerschaumkopf mit der Form eines Totenschädels gelblicher Rauch aufstieg. Das runde Kinn hatte sie auf die Handrücken gestützt. Und sie fragte sich: Warum sollte Richard Storm Sophia Endering nicht lieben? Natürlich war er älter als sie – mindestens vierzig. Aber er wirkte noch sehr jugendlich, sah gut aus. Großgewachsen, muskulös. Mit kurzem, aber dichtem rotblondem Haar und einem Gesicht, das so zerklüftet war wie der Westen Amerikas, aus dem er kam. Wahrscheinlich sogar stärker zerklüftet, wenn man berücksichtigte, daß er aus Los Angeles kam. Und Harper wußte, daß er unverheiratet war – das heißt, geschieden. Humorvoll, umgänglich und charmant zu Frauen. Sie war sich bewußt, daß sie bis zu einem gewissen Grad sogar zärtliche Gefühle für ihn entwickelt hatte, seit er zu ihr gekommen war. Möglicherweise. Bis zu einem gewissen Grad. Warum also diese betonte Distanz? Sophia gegenüber. Eigentlich allen gegenüber. Harper wollte und wollte keine Antwort auf diese Frage einfallen.
Trotz all seiner amerikanischen Liebenswürdigkeit, fand sie, steckte er doch voller Geheimnisse oder zumindest voller verborgener Abgründe. Ein Produzent, ein extrem erfolgreicher Produzent von Hollywood-Filmen – einige gute, einige, die sie gesehen hatte, viele, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigten wie sie. Weil sie mit dem Schrecken und dem Übernatürlichen zu tun hatten, mit Geistern, Werwölfen und dem einen oder anderen Gummidämon. Und doch hatte er diese lukrative Laufbahn vor einem Monat aufgegeben. Er war nach London gekommen, ein völlig Unbekannter, war ohne irgendwelche Empfehlungen vor ihrer Tür aufgetaucht und hatte ihr angeboten, als unbezahlter Assistent bei ihrer kleinen Zeitschrift Bizarre! mitzuarbeiten. Er habe es satt, erklärte er ihr, immer nur Filme über das Paranormale zu machen. Er wolle mit ihr arbeiten, um sich endlich einmal aus erster Hand einen Eindruck von diesen Dingen zu verschaffen. Und das war eigentlich auch schon alles, was er ihr erzählte. Dennoch folgte er ihr ohne ein Wort der Klage – und, wie gesagt, ohne Bezahlung – wie ein großer Setter überallhin und half ihr bei ihren journalistischen Recherchen über angebliche Fälle von Spuk, Hexerei, Vampirismus, Entführung durch Außerirdische und dergleichen mehr. Schon bald jedoch hatte sie zunehmend die Frage zu beschäftigen begonnen, worum es ihm wirklich ging – und was es mit seiner seltsamen Distanziertheit auf sich hatte.
Ihre Überlegungen wurden unterbrochen, als Bolt in den Raum zurückkam.
»Also«, knurrte er Storm gehässig an. »Gut gelesen haben Sie, das muß man Ihnen lassen.«
Das war es, was zu dem Zwischenfall geführt hatte. Die Geistergeschichte. Etwa vor einer halben Stunde hatte Bolt sich des langen und breiten über Geistergeschichten im allgemeinen ausgelassen: Weihnachten und Adventfeiern und Geistergeschichten und so weiter. Storm hatte erwähnt, er habe vor allem diese typisch englischen Gruselgeschichten schon immer geliebt. Er hatte tatsächlich geliebt gesagt, und das hatte den Ausschlag gegeben – dieser übertriebene Yankee-Enthusiasmus. Es war keineswegs so, daß Bolt etwas gegen Storm oder gegen Amerikaner im Allgemeinen hatte. Aber es gab so eine ganz bestimmte amerikanische Munterkeit, die er als ausgesprochenen Affront gegen seinen liebevoll gehegten Pessimismus empfand. Jedenfalls hatte Bolt daraufhin plötzlich gedacht, den Experten spielen zu müssen. Hatte sein Ton bis dahin nur etwas Salbaderndes gehabt, wurde er nun herablassend und belehrend. Und als Storm sagte, er finde die Oxford-Sammlung sensationell – er sagte sogar: absolut sensationell! –,hatte dies das Faß für den armen Bolt endgültig zum Überlaufen gebracht. »Damit mögen Sie durchaus recht haben«, hatte der Journalist entgegnet. »Vorausgesetzt, Sie stoßen sich nicht daran, daß man Thurnley Abbey nicht aufgenommen hat. Das soll nicht heißen, daß ich erwarte, eine Sammlung habe vollständig zu sein, aber immerhin haben wir es hier mit dem Oxford Book of English Ghost Stories zu tun, und damit übernimmt man meines Erachtens doch eine gewisse Verantwortung. Und dann wird Thurnley Abbey nicht in die Sammlung aufgenommen!«
»Ja, Thurnley Abbey, das war eine wirklich gute Geschichte«, pflichtete Storm ihm bei. »Ich glaube, sie ist in der viktorianischen Sammlung enthalten.«
»Pff!« zischte Frederick Bolt.
Und Storm wechselte nachsichtig das Thema. »Übrigens, haben Sie mal Black Annie von Robert Hughes gelesen?«
Diese Frage, fand Harper Albright, hatte er eindeutig gestellt, um einzulenken und einen Streit abzuwenden. Aber sie hatte die Sache nur schlimmer gemacht. Weil rasch klar wurde, daß Bolt Black Annie nicht gelesen hatte, daß er noch nie etwas davon gehört hatte. Und das hieß, die Geschichte konnte nichts taugen. Was er auch sagte.
»O nein, nein, da täuschen Sie sich!« rief Storm. Er erhob sich von seinem Stuhl und ging auf die Regale zu. Schlenderte mit einer Selbstverständlichkeit darauf zu, als sei es seine Wohnung und nicht die von Bolt. Und zog das Fourteenth Fontana Book of Great Ghost Stories heraus. »Sie steht hier drin. Sie sollten sie unbedingt mal lesen, sie ist wirklich gut.« Er hielt Bolt das Buch hin. Bolt sah es finster an. »Der vierzehnte Band! Der kann doch nur Ausschuß enthalten.« Aber Storm streckte ihm beharrlich das Buch entgegen. Bolts Lippen verzogen sich.
»Warum lesen Sie sie nicht vor?« zischte er. »Nur zu – Weihnachten am Kamin – eine Party – eine Geistergeschichte – wie wär’s mit einer Lesung, Storm?«
»Was, ich?«
»Muß das sein?« hatte Harper Albright gemurmelt. Bolt konnte manchmal unausstehlich sein.
Später begann sie sich allerdings zu fragen, ob er dem Amerikaner nicht vielleicht in die Falle gegangen war. Storm nahm das Buch mit zu seinem Stuhl und begann Black Annie vorzulesen – und Harper wurde sofort daran erinnert, daß sein Vater Schauspieler gewesen war. Das hatte er ihr erzählt. Er las die Geschichte auf eine originelle Art, aber so, daß ihr unheimlicher Charakter darüber nicht verlorenging. Und bis Quentin und Neville sich, nur von ihrer Kerze begleitet, auf den Weg durch die unheilvollen, finsteren Gänge von Ravenswood Grange machten, waren die meisten von Bolts Partygästen im Salon versammelt, und fast alle hörten gefesselt zu. Beim letzten Satz hatten sogar ein paar Gäste geräuschvoll den Atem ausgestoßen. Und die bezaubernde Sophia Endering hatte ihr Glas fallen gelassen.
»Gut gelesen war die Geschichte zweifellos«, räumte Bolt jetzt noch einmal ein. »Und uninteressant war sie auch nicht. Zwar nicht originell, und auch nicht ironisch gebrochen oder phantasievoll – oder gar literarisch. Aber niemand kann sagen, daß sie uninteressant war.«
Storm zuckte nur mit den Schultern und sprach mit solcher Aufrichtigkeit, daß Harper Albright fürchtete, Bolt würde auf der Stelle tot umfallen. »Ach, wissen Sie, als ich sie zum erstenmal las, war ich vielleicht zehn Jahre alt. Für mich war das wie eine Offenbarung, einfach Wahnsinn! Die englische Geistergeschichte schlechthin. In gewisser Weise hat sie mich auf den Geschmack gebracht. Auch was den ersten Film betrifft, den ich gedreht habe, vor zwanzig Jahren. Ich war damals ungefähr zweiundzwanzig. Er hieß Das Gespenst. Ich war nie in England gewesen. Ich schrieb das Drehbuch, führte Regie, nahm das Ganze in Kalifornien auf. Aber es spielte alles hier, wissen Sie, in einer typischen Black Annie-Welt, die ich mir anhand der Geschichte zusammenphantasiert hatte. Ich brachte sie immer in Verbindung – ich weiß nicht – ich brachte sie einfach immer in Verbindung mit dieser ...« Kopfschüttelnd brach er mitten im Satz ab. Na ja, er war Amerikaner, rief Harper sich in Erinnerung, und befand sich auf einer evolutionären Entwicklungsstufe, wo man es nicht mehr nötig hatte, in vollständigen Sätzen zu sprechen. Aber was er gesagt hatte – was er zu sagen versucht hatte–, brachte sie erneut zum Nachdenken. Sie paffte an ihrer Totenkopfpfeife, stützte sich auf ihren drachenköpfigen Stock und blinzelte durch ihre dicke Brille. Er liebt die englischen Geistergeschichten tatsächlich, der junge Storm, dachte sie.
Und vielleicht, dachte sie, würde das am Ende sogar alles erklären.
3
Währenddessen klapperten draußen, in der Trostlosigkeit der winterlichen Stadt, Sophia Enderings Absätze laut auf das Kopfsteinpflaster. Sie eilte die schmale, leicht ansteigende Gasse hinauf. Ihr Busen, den Storm so bewundert hatte, wogte heftig. Diese Geschichte, dachte Sophia. Dieser blöde Amerikaner und diese blöde Geschichte.
Unter einen Arm hatte sie sich die Handtasche geklemmt. Der andere schwang fast in Marschmanier weit aus. Ihr Blick war entschlossen nach vorn gerichtet. Sie spürte den Wind über ihre Wangen streifen, dazu Sprenkel eines schwachen, kühlen Regens. Tick-tick. Tick-tick.
Es war natürlich ein absurder Zufall. Diese Geschichte, dieses sich ständig wiederholende Geräusch, diese nächtliche Wanderung durch die Gänge des verwunschenen Hauses. Tick-tick. Doch wie sich das alles fast aufs Haar mit ihren Erinnerungen deckte! Ihren frühesten Erinnerungen. Ihren schlimmsten Erinnerungen ... Am Ende der Gasse, an der Kreuzung, blieb sie stehen und mußte in tiefen Zügen die kalte Nachtluft einatmen, um sich wieder zu beruhigen. Am Himmel zog eine rauhe Wolkensee, vom Vollmond erleuchtet, über sie hinweg und wälzte sich über die vor ihr aufragende Mauer aus Bäumen in die geheimnisvollen Gefilde des Holland Park.
Tick-tick. Tick-tick.
Gereizt – und beunruhigter, als sie zugab – hielt Sophia nach einem Taxi Ausschau. Es war ungewöhnlich still. Keine Autos. Keine Menschen, keine Schritte, kein Laut außer dem ihres eigenen Atems. Es muß schon spät sein, dachte sie, nach Mitternacht. Sie sah auf ihre Uhr. Es war sogar schon nach eins. In ihrem Rücken war die verlassen daliegende Gasse gegenwärtig. Rechts von ihr herrschte ungestörte Stille, unheimlich. Sophia blickte nach links die Straße hinunter, zur nächsten Kreuzung. Im Schein einer Straßenlampe küßte ein Jamaikaner mit Dreadlocks eine pockennarbige Blondine. Ein paar Autos rauschten vorbei. Eine Gruppe lärmender Jugendlicher kam vorbei. Ihr Gelächter tönte bis zu ihr herauf, dann verschwanden sie, und es erstarb. Ich gehe jetzt dort hinunter, dachte sie, zu der belebten Straße. Nehme mir ein Taxi. Bestimmt würde sie eines finden. Sie war eine Frau, bei der Taxis immer anhielten.
Tick-tick.
Sophia fuhr zusammen. Diesmal hatte es sich fast real angehört. War es womöglich real gewesen? Ein Ticken auf dem Kopfsteinpflaster hinter ihr? Sie nahm sich zusammen. Schaute über ihre Schulter. Drehte ihren Körper halb herum und wandte sich der Gasse zu.
Nein. Die Gasse zwischen den alten, efeuüberwucherten Backsteinmauern war leer. Nur noch in einigen der kleinen Häuser brannte Licht, und vor die wenigen erleuchteten Fenster waren dicke Vorhänge gezogen. Sophia schluckte. Das wurde ja immer schöner. Diese Geschichte! Diese seltsame innere Erregung! Vor aller Augen dieses blöde Glas fallen zu lassen. Der Amerikaner mit seinem theatralischen Getue ...
Mit einem letzten Blick auf die Gasse drehte sie sich wieder um. Und rief: »Oh!«
Direkt vor ihr stand ein Mann. Sein Gesicht schien aus dem Dunkeln auf sie herabzustoßen, so nah – viel zu nah – ragte er über ihr auf.
Ihr erster Gedanke war, an ihm vorbeizurennen. Nichts sagen. Nicht versuchen, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Sie zog den Kopf ein, machte einen Schritt nach vorn. Der Mann streckte die Hand aus. Sophia blieb fast das Herz stehen. Sie stand kurz davor, um Hilfe zu rufen.
»Halt«, sagte der Mann. »Miß Endering! Sophia. Haben Sie keine Angst.«
Das brachte sie davon ab. Die Tatsache, daß er ihren Namen kannte. Der Tonfall seiner Stimme. Das perfekte Englisch, allerdings mit einem leichten deutschen Akzent, distinguiert. Sie blieb stehen. Taxierte ihn. Ein ernster junger Mann, in einer blauen Seemannsjacke, den Kragen um den Hals hochgeschlagen. Sehr gutaussehend, sehr jung. Unglaublich ernst. Mit gewelltem blondem Haar und warmen Augen, die sie sogar in der Dunkelheit sehen konnte. Aber ein Fremder, dessen war sie ganz sicher. Er lächelte. »Nein, nein, Sie kennen mich nicht. Ich bin ein Resurrektionist.«
Die erste Überraschung war verflogen. Sophia hatte sich wieder im Griff. Natürlich war sie noch nervös – er so dicht vor ihr, und die Schatten ringsum so nah, und dazu war er noch einen bedrohlichen Kopf größer als sie, so nah, daß sie in der kühlen Luft die Wärme seines Körpers spüren konnte. Noch vor zwei Minuten hatte sie inmitten des Lichts und der Wärme und des Menschengewühls von Bolts Party gestanden. Umgeben von plaudernden, lachenden Menschen, den Geschmack von Wein auf den Lippen. Das alles vermißte sie im Moment sehr. Ganz allein mit diesem Mann in der Kälte. Dem Resurrektionisten.
Aber sie wußte, sie konnte sich darauf verlassen, daß ihre Stimme fest und gefaßt klingen würde. »Sie stehen zu dicht vor mir«, sagte sie. »Das empfinde ich als bedrohlich. Treten Sie ein wenig zurück, wenn Sie mit mir sprechen wollen.«
Das tat er sofort, schien aber nicht begeistert. Vielmehr fühlte er sich im helleren Licht der Straße offenbar unwohl. Er sah rasch in beide Richtungen. Als ein Taxi an ihnen vorbeifuhr, beobachtete Sophia, wie er das Kinn tiefer in den Kragen seiner Jacke zog, um sein Gesicht vor den Lichtkegeln der Autoscheinwerfer zu verbergen.
»Also schön«, sagte sie schließlich. »Nun mal los. Was wollen Sie?« Das Taxi war weg. Die Straße lag wieder still da. Der Mond war hinter einer Wolke verschwunden. Der junge Mann hob seinen ernsten Blick und sah sie an. Leckte sich nervös die Lippen. Über seiner Stirn, einer jungenhaft glatten Stirn, wippte eine Locke seines blonden Haares. In diesem Moment hatte sein Gesichtsausdruck etwas so Verletzliches, daß Sophia spürte, wie sie milder gestimmt wurde, fast gerührt.
»Ich werde heute nacht ermordet«, begann der junge Mann ohne Umschweife. Und als wäre ihm die Melodramatik dieser Ankündigung selbst peinlich, fügte er ihr ein kurzes schnaubendes Lachen hinzu. »Der Mann, der Die drei Weisen kauft, wird mich umbringen.«
Sophia öffnete zwar den Mund, nickte dann aber nur, vorsichtig. Schob verlegen die Hände in die Manteltaschen, preßte der Kälte wegen die Arme gegen die Seiten. Wandte den Blick von dem jungen Mann ab, starrte, um besser nachdenken zu können, ins Nichts.
»Miß Endering, Sie müssen ...«, begann der junge Mann erneut.
»Gehen wir zur Straße hinunter«, schlug Sophia vor. »Dort finden wir bestimmt ein Café, in dem wir uns in Ruhe unterhalten können.«
Der Deutsche machte eine Geste des Bedauerns. »Tut mir leid, aber mich darf niemand sehen. Und auch Sie darf niemand mit mir sehen. Das wäre sehr gefährlich. Es tut mir leid – aber ich möchte auf keinen Fall länger in diesem hellen Licht stehenbleiben.« Er war wieder ganz dicht vor sie hingetreten, fort aus dem grauen Schein der Straße. »Ich will Ihnen nichts zuleide tun. Bitte, helfen Sie mir. Ich möchte Ihnen nur möglichst schnell begreiflich machen, was ich Ihnen zu sagen habe, damit ich wieder gehen kann.«
Mit einem Seufzer sah Sophia zu ihm auf. Ihr Herz schlug rasend schnell, aber ihre Miene war gefaßt. »Na schön. Schießen Sie los. Worum geht es?«
»Mein Name ist Jon Bremer. Werden Sie sich das merken können?«
»Jon Bremer. Ja?«
»Und er wird Die drei Weisen kaufen.«
»Sie machen wirklich keine Witze?«
Der junge Mann legte ihr die Hand auf den Arm. Sogar durch den wollenen Ärmel ihres Mantels konnte sie die Dringlichkeit seiner Berührung spüren. »Er ist der Leibhaftige persönlich«, stieß er hervor, und seine Lippen zitterten dabei wie die eines Kindes. »Alle Resurrektionisten sind tot. Der Mann, der das Bild für echt erklärt hat: gefoltert – verstümmelt – ermordet. Das Paar, das den Laden im Osten entdeckte: das gleiche. Gefoltert, getötet. Sogar der Ladeninhaber – seine Leiche wurde drei Tage nach der Entdeckung des Bildes aus der Elbe gezogen. Seine Augen ... grauenhaft ... Das sind inzwischen fünf Menschen – fünf Menschen hatten Die drei Weisen in den Händen, Miß Endering. Vier sind tot. Ich bin der letzte.«
»Gütiger Gott«, entfuhr es Sophia. Sie wußte, es stimmte – und doch schien ihr die Unterhaltung unwirklich, alptraumhaft. Sie beide, wie sie am Rand der Gasse so dicht beisammenstanden. Die Wörter, die hastig, verstohlen, bedroht zwischen ihnen hin und her geworfen wurden. Einfach grotesk. Der Leibhaftige ...
»Also, dann sollten Sie am besten zur Polizei gehen«, sagte sie schließlich mit Nachdruck.
»Nein!« Entsetzt riß der junge Mann die Augen auf und warf den Kopf zurück. »Auch dort sitzen seine Leute. Sie sind überall. Sie sind die einzige, der ich trauen kann.« Sein Griff wurde fester. Sophia spürte, wie sich sein Daumen in ihren Oberarm bohrte. Es tat weh, aber es verdeutlichte ihr seine Angst, weckte ihr Mitleid. Sie taten ihr alle leid. »Nur Sie kommen dafür in Frage, Sophia«, fuhr er fort. »Es sind Die drei Weisen. Sie kennen alle Beteiligten. Sie können dabei sein und Fragen stellen, ohne daß jemand Verdacht schöpft. Wenn Sie sehen, wer es kauft, wenn Sie das wissen – dann – können Sie – aber vorsichtig ... dann können Sie die Behörden einschalten ... Ihre Freunde bei der Presse – irgendjemanden ...«
Einen Moment später nickte sie wieder, und er ließ sie los. Seine Stimme war nicht mehr so angespannt, und er sprach rascher. »Ich habe alle nötigen Schritte in die Wege geleitet, daß das Bild zugunsten einer gemeinnützigen Organisation versteigert wird – eine anonyme Spende, die Besitzrechte sind zweifelsfrei geklärt, alles ist geregelt. Mitte Januar kommt es bei Sotheby’s unter den Hammer. Ich habe veranlaßt, daß das Bild bis dahin zwischengelagert bleibt, deshalb dürfte es, glaube ich, so lange in Sicherheit sein. Genau das werde ich ihnen erzählen, wenn ...« Sie sah seinen Adamsapfel zwischen den Kragenenden der Jacke auf und ab hüpfen, »...wenn sie mich finden«, sprach er den Satz zu Ende. Dann fuhr er langsamer fort: »Er wird es kaufen, er wird jeden Preis dafür bezahlen. Verstehen Sie? Bei der Auktion wird er sich endlich zeigen. Verstehen Sie?«
Der Wind wurde stärker. Die Wolken wälzten sich vorbei. Über ihren zerzausten Rändern kam ein Teil des Vollmonds zum Vorschein. Pechschwarz, wie dürre Finger, reckten die Winterbäume ihre Äste in den Himmel.
»Nein.« Verständnislos und mit gerunzelter Stirn starrte Sophia zu ihnen hoch. »Nein, ich verstehe überhaupt nichts. Warum sollte er jeden Preis dafür bezahlen? Warum sollte er dafür einen Mord begehen? Das Bild ist nicht mehr als fünfundzwanzigtausend Pfund wert, vielleicht fünfzig, wenn Sie auch noch die anderen beiden finden. Woher glauben Sie so sicher zu wissen, was er tun wird? Ihre Leute -«
»Sind alle tot«, sagte der junge Mann. Inzwischen war seine Miene wieder von nacktem, eindringlichem Ernst geprägt. »Sie sind alle tot. Ich bin mir ganz sicher. In gewisser Weise kenne ich ihn sehr genau. Er fürchtet sich vor nichts. Er wird sich auf keinen Fall vertreten lassen. Er wird bestimmt selbst kommen.«
Jetzt trat er endlich von ihr zurück. Sophia hatte das Gefühl, als könne sie sich aus einer erstickenden Umarmung lösen. Der junge Mann blickte wieder die Straße hinauf und hinunter. Er schien sie bereits aus großer Entfernung anzusehen. »Ich weiß nicht, warum er dafür mordet oder warum er jeden Preis dafür bezahlt«, sagte er. »Aber er hat bereits gemordet, und er wird es kaufen. Er wird jeden Preis dafür bezahlen, mehr als irgendjemand anders. Deshalb: Derjenige, der das Bild kauft, ist der Mann. Der Leibhaftige. Das müssen Sie sich merken. Wer das Bild kauft ...« Er schien ihr zu entgleiten, in den Strom der Nacht davonzutreiben. Sie wollte ihn zurückhalten, wollte dem Spuk ein Ende machen. »Hören Sie«, sagte sie mit Nachdruck. »Sie sollten wirklich besser zur Polizei gehen. Ich kann nicht ...«
»Denken Sie daran«, sagte er – es kam heiser heraus, aber die Wörter drangen noch bis zu ihr herüber, obwohl er bereits die Straße überquerte –, »wer das Bild kauft, hat mich ermordet, hat uns alle ermordet. Wer Die drei Weisen kauft ...«