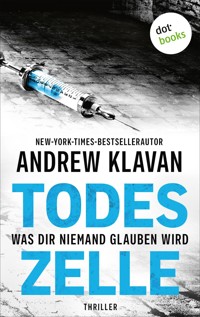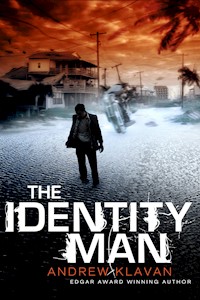9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Um ihre Tochter zu retten, würde sie alles tun: Der packende Thriller »Opferjagd« von Andrew Klavan jetzt als eBook bei dotbooks. Als der Jazz-Musiker Lonny in den nächtlichen Häuserschluchten Manhattans einer jungen, angsterfüllten Frau begegnet, die ihn um Hilfe bittet, kann er gar nicht anders, als ja zu sagen … und ahnt dabei noch nicht, auf was für einen Höllentrip er sich eingelassen hat. Carol ist keineswegs eine Prostituierte in Schwierigkeiten, wie er zunächst dachte, sondern auf der Flucht vor einem internationalen Konzern, der Jagd auf ihre Tochter macht. Die kleine Amanda besitzt etwas, das der skrupellose Edmund Winter und seine Männer unbedingt in ihre Hände bekommen wollen, koste es, was es wolle. Für Carol und Lonny beginnt eine gefährliche Flucht durch die USA, bei der sie alles riskieren müssen, um Winter zu entkommen – denn nicht nur Amandas Leben steht auf dem Spiel … »Andrew Klavan gehört zu den originellsten Krimiautoren Amerikas.« Stephen King Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der rasante Psychothriller »Opferjagd« von Andrew Klavan wird alle Fans von Michael Robotham begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als der Jazz-Musiker Lonny in den nächtlichen Häuserschluchten Manhattans einer jungen, angsterfüllten Frau begegnet, die ihn um Hilfe bittet, kann er gar nicht anders, als ja zu sagen … und ahnt dabei noch nicht, auf was für einen Höllentrip er sich eingelassen hat. Carol ist keineswegs eine Prostituierte in Schwierigkeiten, wie er zunächst dachte, sondern auf der Flucht vor einem internationalen Konzern, der Jagd auf ihre Tochter macht. Die kleine Amanda besitzt etwas, das der skrupellose Edmund Winter und seine Männer unbedingt in ihre Hände bekommen wollen, koste es, was es wolle. Für Carol und Lonny beginnt eine gefährliche Flucht durch die USA, bei der sie alles riskieren müssen, um Winter zu entkommen – denn nicht nur Amandas Leben steht auf dem Spiel …
Über den Autor:
Andrew Klavan wuchs in New York City auf und studierte Englische Literatur an der University of California. Danach arbeitete er als Reporter für Zeitungen und das Radio, bevor er sich ganz dem Schreiben seiner Spannungsromane widmete. Heute gilt Klavan als einer der großen Thriller-Experten der USA. Mehrere seiner Bücher sind mit dem begehrten Edgar-Award ausgezeichnet, für weitere Preise nominiert und/oder verfilmt worden.
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Todeszelle -Was dir niemand glauben wird«, »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen sein«, »Todeszahl – Was tief begraben liegt«, »Hilfeschrei – Die Dunkelheit in uns«, »Opferjagd«, »Totenbild« und »Todesmädchen«.
Die Website des Autors: andrewklavan.com/
Der Autor auf Facebook: facebook.com/aklavan/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »Hunting Down Amanda« bei bei William Morrow & Company, Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Jagd auf Amanda« im Diana Verlag, München/Zürich.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by Amalgamated Metaphor, Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe Ausgabe 2000 by Diana Verlag AG, München und Zürich. Der Diana Verlag ist ein Unternehmen der Heyne Verlagsgruppe München.
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Biland, Katai Rossatorn, Pavel L Photo and Video
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-209-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andrew Klavan
Opferjagd
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Karsten Singelmann
dotbooks.
PROLOG:Zwischen zwei Feuern
1
Diese Geschichte beginnt an einem Sommertag in der Hölle.
Es war der 13. Juli, um genau zu sein. Und die Hölle war eine kleine Stadt namens Hunnicut, Massachusetts.
Bevor es sich in die Hölle verwandelte, war dieses Hunnicut eigentlich ein recht nettes kleines Örtchen. Lebte von der Fischerei. Smaragdgrüne Wälder auf den Hügeln über sonnenbeschienenen Buchten. Propere Schindelhäuser in von Bäumen gesäumten Gassen. Eine restaurierte Main Street mit malerischen, auf den Tourismusbedarf abgestellten Läden und einigen anständigen Fischrestaurants mit Ausblick aufs Wasser.
An jenem Freitag war das Wetter schön, warm aber windig. Am Himmel segelten Wolken dahin, aber es waren Kumuluswolken, nicht sehr aufgebauscht, hoch und locker und weiß, zwischen ihnen große himmelblaue Lücken. Die Sonne stand noch recht weit oben, schien hell und klar.
Besucher wie auch Einheimische spazierten an den Läden vorbei, blieben hier und da stehen, um sich die Schaufenster anzusehen. Dekorative Fischernetze waren ausgestellt. Angemalte Ruder und feingeschnitzte Briefbeschwerer. T-Shirts mit Aufschriften wie ICH WÄR LIEBER BEIM ANGELN oder EIN FISCHER IST IMMER BEREIT, SEINE RUTE AUSZUWERFEN oder HUNNICUT HAT MICH AM HAKEN! und dergleichen Artigkeiten mehr.
Über dem verklinkerten Rathaus schnalzte das Sternenbanner. Unten im pittoresken Hafen tanzten die Trawler auf den schnörkeligen Wellen. Sonnenlicht glitzerte auf der windzerzausten Oberfläche des Ozeans.
Es war vier Uhr fünfzehn am Nachmittag, und das Leben in Hunnicut war soweit in Ordnung.
Noch ungefähr zwei Minuten blieb es so.
Dann, um sechzehn Uhr siebzehn, ertönte ein Grollen, wie Gewitterdonner. Eine weitere Warnung gab es nicht.
Wer sich draußen aufhielt, blickte leicht verwundert nach oben. Die in ihren Booten ausfahrenden Fischer legten die Köpfe zurück und schauten blinzelnd zum Himmel. Alle Leute – ein auf einem Segeltuchstuhl am Strand sitzender Mann; die in der Hauptstraße einkaufenden Hausfrauen; ein Staatspolizist, der von seinem Wagen zum Donut Hole hinüberschlenderte; die Kinder auf dem Spielplatz an der Hancock Street; ein oben auf einem Haus werkelnder Dachdecker, den Hammer zum Schlag erhoben – sie alle blickten beim Donnergrollen nach oben. Niemand hatte den Eindruck gehabt, daß es regnen würde.
Dann gab es eine halbe Sekunde Stille.
Als nächstes geschah folgendes:
Ein weißglühendes Licht überzog das Firmament – als würde der Himmel von einem blendenden Fleck ausgelöscht. Ein sternförmig zerplatzendes Orange brach aus diesem weißen Kern hervor. Und mit ihm setzte ein Dröhnen ein – ein quälendes, rauhes, ein ohrenbetäubendes Dröhnen, das aus jedem Schädel ein Nervenbündel machte, das den Boden unter den Füßen zum Erbeben brachte.
»Es klang«, so meinte Leonard Wallingford, ein Banker aus Boston, der seinen Vater besuchen wollte, »es klang, als wäre Gott in eine Bärenfalle geraten.«
Im nächsten Moment begann es Feuer zu regnen. Aus dem Äther, aus dem Nichts sprühten flüssige Flammen zischend auf die Bürgersteige, in die Bäume. Den Leuten blieb nur noch ein kleiner Augenblick, um ungläubig und offenen Mundes auf das Geschehen zu starren.
Und dann wurde es ganz unvorstellbar. Denn jetzt traf ein Flügelsegment auf, und das war praktisch noch voll mit Benzin.
Es knallte in ein Kornfeld, östlich neben der Michaels Street. Im selben Sekundenbruchteil barst die Erde, es bildete sich ein zwanzig Meter breiter Krater, aus dem ein Feuerball heraus nach oben schoß. Die Michaels Street führte durch eine Wohngegend mit zweistöckigen Schindelhäusern. Drei von diesen Häusern fielen einfach in sich zusammen. Zwei andere explodierten. Das Holz zersplitterte, die Splitter flogen. Töpfe und Pfannen, ein Bügeleisen, der Inhalt eines Werkzeugkastens – alles schoß durch die Gegend wie Feuerwerksraketen. Der Körper von Sharon Cosgrove, einer Grundstücksmaklerin, wurde hoch, hoch hinauf in die Luft getragen und plumpste dann wie eine Puppe in den brennenden Schutt zurück, wo ihre Kinder, Patricia und Sam lagen, zerrissen in unkenntliche Stücke.
Überall gingen die Lichter aus. Es floß kein Wasser mehr in den Leitungen. Weitere Häuser, weitere Wohnviertel fingen an zu brennen. Feuer loderten überall in der Stadt auf. Ringsum Menschen, die sich plötzlich in ein zerbrochenes Etwas verwandelt hatten; lauter verkrümmte, starrende, befleckte Dinge, die inmitten von gespaltenen Steinen und glimmender Asche lagen. Andere Menschen schrien, liefen, taumelten benommen über Rasenflächen und entlang den Straßen, vorbei an schwarzen Autoskeletten und knisternden, tanzenden Flammen, die aus den Fenstern schossen. Schwarzer Rauch, gewaltige, wirbelnde Schwaden von schwarzem Rauch tobten über allem, über den Menschen und über den brennenden Bäumen, den brennenden Häusern und draußen über dem Hafen und hoch oben im Himmel über dem Meer.
Und aus dem Himmel, durch den Rauch hindurch, ergoß sich der Regen der Wrackteile. Silbermetallplatten fielen. Ein Flugzeugmotor stürzte auf Hank’s Fischbude und zertrümmerte sie. Eine Rumpfspitze tauchte in Cutter’s Cove hinein wie ein gewaltiger ausgenommener Barsch. Münzen prasselten aufs Gras, auch Goldschmuck. Ein Rentner, Walter Bosch, wurde in seinem Garten von einer großen Flasche Bourbon erschlagen, die seinen Schädel zertrümmerte und dann völlig unversehrt neben seiner Leiche im Springkrautbeet liegenblieb.
Und Körper fielen herab, und Körperteile. Fleisch regnete hernieder auf Hunnicut – aus dem Himmel ins Feuer –, und auch das flüssige Feuer regnete noch immer durch den schwarzen Rauch. Es gab weniger Blut, als man vielleicht denken würde. Fast verschwunden war auf dem Flug durch die Luft, was Menschen zu Menschen gemacht hatte. Gleichwohl ... Ein Arm und ein Bein platschten zwischen die schreienden Leute in der Mitte der Hancock Street. Emma Timmerman – ihr Körper noch ganz intakt, angeschnallt auf ihrem Sitz – landete im Hof hinter Hunnicut Autobody und saß dort aufrecht zwischen Autoteilen und sonstigem Schrott, als sei sie von jemandem weggeworfen worden. Ein wie alte Wäsche zerfledderter Torso – die Überreste von Bob Bowen, einem High-School-Lehrer – flatterte herab, bis er am Ast eines Baumes hängenblieb. Der Kopf von Jeff Aitken, einem Studenten, krachte durch Sharon Kents Küchenfenster. Mrs. Kent verschlug es die Sprache beim Anblick des Dings in ihrer Spüle, dessen Mund offen und dessen Haar in Flammen stand.
Nach und nach, und es schien, als würde es ewig dauern, kam auch alles übrige heruntergeflutet; in die schwelenden Häuser und ins dampfende Wasser, in den Wald hinein, der knisternd in Flammen aufging. Auf die Leiber der Toten und der stöhnenden Verletzten in der Stadt. Zwischen die schreienden, weinenden Menschen. Der Flugzeugrumpf und die Verschalungen und die Inneneinrichtung kamen herunter, und die Vorräte und die Passagiere – alles, was vom European- Airways-Flug Nummer 186 übrig war.
Es war eine 747er auf dem Weg nach London gewesen, und sie war in 9750 Meter Höhe einfach auseinandergefallen.
Man hat nie herausgefunden, warum.
2
Die fünfjährige Amanda Dodson spielte zur selben Zeit im Hinterhof ihrer Babysitterin. Amanda war ein rundliches kleines Mischlingsmädchen von ruhiger, bedächtiger Art. Gelbbraune Haut, ein ovales Gesicht. Große, intelligente braune Augen. Lange, lockige, erstaunlich gelbe Haare.
Sie saß auf der untersten Treppenstufe der rückwärtigen Veranda, ihre pummeligen Arme und Beine schauten aus den hellblauen Shorts und dem gleichfarbigen T-Shirt hervor. Gerade war sie mit den Vorgängen in einem Phantasiekrankenhaus am Rasenrand beschäftigt. Amanda kannte sich mit Krankenhäusern und Krankheiten und sogar mit dem Tod aus, denn sie wußte, wie ihr Vater gestorben war. Der Patient, der gegenwärtig zur Untersuchung anstand, war jedoch ihre flauschige rote Elmo-Puppe. Und deren Zustand schien durchaus ernst zu sein. Zum Glück aber hatte Schwester Barbie gerade Dienst, kundig assistiert von einer Stoffpuppe namens Mathilda. Bevor der arme Elmo also gänzlich den Geist aufgeben konnte, breitete Dr. Amanda ihre Hände über ihm aus und »sprühte« ihm den Funken des Lebens ein, auf daß er wieder gesund würde.
Nun, daraufhin gab es natürlich eine große Feier: eine Teegesellschaft zum Zeichen des Dankes. Ein paar Steine, eine Milchkiste und ein Wagen dienten als Tisch und Stühle, und alsbald wurde das von Mrs. Shipman großzügig zur Verfügung gestellte Plastikgeschirr unter menschlichen, ausgestopften und aus Plastik bestehenden Feiernden herumgereicht.
Mrs. Shipman, das war die Babysitterin, eine untersetzte, fröhliche Witwe von einundsechzig Jahren. Sie hielt sich gerade im Haus auf, in der Fernsehecke. Strickte einen rosa Pullover für eine kleine Enkelin und sah zu, wie Larry Norton Personen interviewte, die Computersex im Internet betrieben. Durch das Panoramafenster zu ihrer Linken behielt sie Amanda im Auge.
Eine Uhr auf dem Kaminsims schlug die Viertelstunde: viertel nach vier. Mrs. Shipman schreckte auf, denn sie hatte die Zeit ganz vergessen. Für gewöhnlich rief sie Amanda um vier Uhr ins Haus, wo sie einen kleinen Imbiß bekam und ein Stündchen lang Zeichentrickfilme sehen durfte. Sie legte ihr Strickzeug über die Sessellehne und schickte sich an aufzustehen.
Das war der Augenblick, als es zur ersten Explosion in der Michaels Street kam, etwa einen halben Kilometer entfernt. Die Druckwelle war so stark, daß Mrs. Shipman aus ihrem Sessel gerissen wurde, kopfüber in den Fernsehapparat hinein. Der Bildschirm zerbrach, und das gezackte Glas riß Mrs. Shipman das Gesicht ab, als sei es ein Gummihandschuh. Sie war noch am Leben, eine Sekunde lang, dann sank das Haus über ihr zusammen, und sie wurde zu Tode gequetscht.
Die Explosion erschütterte die Erde und die Luft. Die kleine Amanda stand auf. Sie hielt ihre flauschige rote Elmo-Puppe an der Hand und begriff nicht, was geschehen war. Als das Haus zusammenbrach, konnte sie nur verdutzt zuschauen.
Jemand schrie – Mrs. Jenson, die nette Dame von nebenan, die manchmal mit Keksen zu Besuch kam. Ihr Kleid stand in Flammen, sie rannte über ihren Hinterhof und schrie entsetzlich. Blind rannte sie in die auf der Leine hängende Wäsche, verfing sich in einem Badehandtuch und fiel zu Boden, schreiend, brennend, sich hin und her wälzend.
Amanda stand unbeweglich da.
Auch Mrs. Jensons Haus brannte, wie sie sah. Genau wie einige der anderen Häuser im Block. Und da waren noch andere Leute, die rannten, und auch sie schrien. Und da war Frank Hauer – ein großer Junge schon, fand Amanda, zehn Jahre alt. Er lag auf dem Bauch unter seinem Basketballnetz. Er lag in einem See von rotem, rotem Blut.
Amandas Gesicht zuckte. Sie begann zu weinen. Sie umklammerte Elmos Hand ganz fest.
Der alte Ahornbaum in Mrs. Jensons Garten brach in Flammen aus. Mrs. Shipmans Pachysandrabeet explodierte, als ein großes Metallstück vom Himmel fiel und sich dort eingrub. Feuchte Erde und Blätter spritzten auf Amanda, die hilflos und weinend dastand. Das große Metallstück ragte hoch aus dem Boden und stand schrecklich drohend über ihr.
Benommen setzte Amanda sich in Bewegung. Sie wollte zu ihrer Mutter.
Plötzlich wurde ihr bewußt, daß sie über Hauptman’s Memorial Ballfield lief. Steif bewegte sie ihre pummeligen Beine, trottete über das Gras zwischen der First Base und dem Pitcherhügel. Sie hielt Elmo fest in den Armen und lutschte an ihrem Daumen. Weinend und schniefend. Sie wußte gar nicht mehr genau, wie sie hierhergekommen war.
Das Spielfeld grenzte westlich an Mrs. Shipmans Hinterhof. Eine lange Reihe von Bäumen stand am anderen Ende des Feldes. Amanda hatte sich immer vorgestellt, daß die Kneipe, in der ihre Mutter arbeitete, irgendwo hinter diesen Bäumen liegen müsse. Die Bäume bildeten die Grenze dessen, was sie sehen konnte vom Garten der Babysitterin aus oder durch das große Fenster, wenn sie vor dem Fernseher saß. Es erschien ihr logisch, daß ihre Mutter sich irgendwo dahinter aufhielt.
Tatsächlich lag die Bar, in der ihre Mutter arbeitete, in einer völlig anderen Richtung. Südöstlich nämlich, unten am Wasser. Die Bäume, auf die Amanda zulief, verdeckten lediglich eine alte Feuerschneise – inzwischen ein Fahrradweg – sowie die Häuser und das Sumpfland auf der anderen Seite.
Aber Amanda dachte, daß ihre Mutter dort sei. Und so ging sie weiter, stapfte über das Außenfeld auf die Bäume zu.
Einige der Bäume brannten, und der Humus um ihre Wurzeln schwelte zum Teil. Rauch stieg aus dem kleinen Wald empor. Und in dem Wald war jemand, der schrie.
Trotzdem ging Amanda weiter.
Sie gelangte an den Lattenzaun, der den Baseballplatz begrenzte, und duckte sich hindurch, Elmo fest an sich pressend. Vor dem Rauch rümpfte sie jetzt schon die Nase. Sie hustete, so daß sich die Wangen um ihren Daumen aufblähten.
Die Bäume erhoben sich über ihr. Sie standen überall, zu allen Seiten, große Ahornbäume, Eichen und Kiefern. Ihre Äste und Zweige hingen von oben herab, zeigten auf sie. Die Sonne strömte durch die Blätter auf sie herunter. Lange, feste Säulen von Sonnenlicht standen rings um sie herum, verschwammen, als der Rauch in sie hineinzog.
Amanda ging unter den Bäumen weiter, an den verschwommenen Säulen entlang. Der Rauch brachte sie immer mehr zum Husten. Das Schreien wurde lauter. Schreie einer Frau in kurzen Ausbrüchen, wieder und wieder, wie ein Autoalarm. Irgendwo prasselten Flammen. Amandas rosa Turnschuhe knirschten auf dem Waldboden. Sie sah auf ihre Schuhe hinab. Beobachtete, wie sie sich fortbewegten.
Dann blieb sie stehen.
Da war etwas vor ihr auf dem Weg. Eine große Gestalt, dunkel im ziehenden Rauch, dunkel und ganz bewegungslos. Amanda blieb ängstlich stehen, winzig unter den Eichen und Kiefern, den im Rauch verschwimmenden Säulen von Sonnenlicht. Sie rieb ihre Wange an Elmos rotem Pelz, lutschte an ihrer Daumenspitze und beobachtete mißtrauisch die Gestalt auf dem Weg.
Dann begriff sie, was es war. Und ging langsam darauf zu.
3
Unmittelbar davor, vor dem Absturz, bediente Amandas Mutter, Carol Dodson, an der Bar des Anchor and Bell. Es war eine Hafenbar. Hauptsächlich Fischer verkehrten dort. Carol arbeitete seit drei Monaten in dem Laden, nachdem es sie kurz zuvor in diesen Ort verschlagen hatte.
Die Kunden mochten Carol. Zum einen war sie hübsch. Jung, dreiundzwanzig, vierundzwanzig. Und sie war zäh, lustig und unverblümt, genau wie die Gäste. Manchmal, nach der Arbeit, nahm sie auch den einen oder anderen von ihnen mit nach oben und ging mit ihm ins Bett – für Geld. Nicht, daß sie eine Nutte gewesen wäre oder so. Aber wenn du ein Mann warst und dich anschicktest, für zwei oder drei Monate auf Fahrt zu gehen, und du warst entweder Single oder deine Freundin war irgendwie sauer auf dich, und du hattest ein wirklich echt dringendes Bedürfnis, und du warst meinetwegen am Abend vorher noch mit einem Freund im Anchor and Bell am Trinken gewesen und hattest dich über die Lage beklagt, tja, dann konnte es also passieren, daß dieser Freund sich vertrauensvoll an dich wandte und meinte: »Hör zu. Hast du Geld?« Und du sagtest dann: »Ja sicher, ein bißchen.« Und darauf dein Freund: »Probier doch mal die Neue aus, Carol.« Darauf du: »Carol, die Bardame? Ach, ist das so eine?« Und dein Freund: »Nein, nein, um Himmelswillen, sie ist ein nettes Mädchen. Aber, na ja, sie hat zu kämpfen, weißt du, sie hat ein Kind. Laß halt nicht den Freier raushängen, ja?« Selbstverständlich willst du überhaupt nicht den Freier raushängen lassen, keine Spur, und du hast auch mit Nutten überhaupt nichts am Hut, also gehst du an die Bar und unterhältst dich ein bißchen mit Carol, ganz natürlich. Und auf ganz natürliche Weise sagst du ein paar nette Sachen zu ihr, wie du es bei jedem Mädchen machen würdest, mit dem du ins Bett gehen möchtest. Und dann, später, wenn ihr oben seid und die Sache erledigt ist und du wieder gehen willst, dann sagst du möglicherweise beiläufig: »Na, Carol, wie war denn deine Woche so?« Und sie antwortet vielleicht: »Ach, weißt du, ist immer ein bißchen schwierig, mit dem Kind und so.« Worauf du dann sagst: »Tja, glaub ich gern. Aber hör mal, ich bin ganz gut bei Kasse. Laß mich dir ein bißchen aushelfen, ja? Nein, ganz im Ernst.« Dann geht es vielleicht noch ein bißchen hin und her. Aber am Ende gibst du ihr etwas.
So ungefähr lief das im Allgemeinen.
Heute also, an diesem Julitag, als das Flugzeug runterkam, herrschte ein recht reger Betrieb. Die meisten der anwesenden Männer hatten die Absicht, morgen oder am Montag an Bord zu gehen. Einige hockten zusammen an den großen Tischen, andere saßen mit ihren Frauen oder Freundinnen an den kleineren. Wieder andere hielten sich an der Bar auf und schauten sich das Spiel der Sox an, das ohne Ton auf dem Fernseher über dem Spiegel lief.
Und dann war da noch ein Typ, Joe Speakes, der an der Bar saß, sich das Spiel der Sox aber nicht ansah. Er unterhielt sich mit Carol. Sie wusch Gläser in der Spüle hinter der Bar, und er schwatzte über seinem Bier auf sie ein.
»Was hab ich da gehört?« sagte er zu ihr. »Jes Gramble meint, du willst uns eventuell hier im Stich lassen?«
»Ach, na ja, weißt du.« Carol hob mit angedeutetem Lächeln die Schultern. »Wenn du irgendwo zu lange bleibst, setzt du nur Rost an.«
»Ach wo«, sagte Joe. »Du bist doch grad erst hergekommen. Was ist los mit dir, biste auf der Flucht vorm FBI oder was?«
»Genau«, sagte sie. »Ich heiß nämlich in Wirklichkeit Kimble.«
»Hör auf. Bleib hier. Der Spaß fängt doch grad erst an.«
»Was denn ... Wirst du mich etwa vermissen, Joe?« fragte Carol Dodson.
»Ja, verdammt«, sagte Joe. »Gibt ja hier sonst nichts, was sich anzugucken lohnt.«
Carol trat lachend ein Stück von der Spüle zurück. Sie fuhr die Hüfte aus und nahm eine komödiantische Pose mit nach oben gerichteten Handflächen ein: tadaaa.
Joe nickte anerkennend. Seine Augen wanderten rauf und runter an ihr.
Carol hielt sich fit, und sie war stolz auf ihre Figur. Sie hatte ihr kastanienbraunes T-Shirt in die Jeans gestopft, so daß es eng anlag und ihre runden Brüste, ihre schmale Taille und ihren flachen Bauch zur Geltung brachte. Ihre Jeans spannte sich um die Rundung ihres Hinterns, und der Stoff verkeilte sich zwischen ihren Beinen auf eine Weise, die einen Mann schon mal tief und durchgreifend anrühren konnte.
Ihre Haare waren schulterlang, blond und ihrer Ansicht nach lockig, eigentlich aber, jedenfalls an den Enden, eher kraus. Ihr Gesicht war so oval wie das ihrer Tochter, allerdings weiß, und sie hatte die gleichen großen, sanften, intelligenten Augen, nur in Blau. Ihre Nase war klein und spitz und ihre Lippen, die sie fast silbern anmalte, waren lang und hübsch. Klein und schlank war sie und sah so aus, als würde sie sehr schön und gerade richtig in die Arme eines Mannes passen.
So war das also. Carol trat einen Schritt zurück und machte diese komisch gemeinte Geste. Und Joe Speakes betrachtete sie von oben bis unten.
Dann kam dieses höllenhafte Dröhnen, dieses Gott-in-einer-Bärenfalle-Dröhnen, das den Himmel erschütterte. Und die Michaels Street explodierte. Und die ganze Bar zitterte. Die Schnapsflaschen tanzten und klirrten gegen den Spiegel.
»Was um Himmels willen ...?« sagte Joe Speakes.
»O Scheiße«, sagte Carol. Sie wußte sofort, daß hier was Übles am Kochen war, und zwar ohne Scherz. Was immer das Gegenteil von einem Scherz sein mochte, das hier war’s.
Joe war von seinem Hocker geglitten. Er marschierte zur Tür. Die anderen Männer dicht hinterher. Eine Mauer von breiten Rücken verstellte bereits den Eingang. Die Frauen bildeten die Nachhut, drängten sich gegen die Männer. Carol schnappte sich ein Geschirrtuch und lief den anderen nach, während sie sich noch die Hände abtrocknete.
Dann standen sie draußen auf der Briar Street. Alles strömte auf die Briar Street, aus den Bars und Geschäften heraus. All die Trinker, all die Fischer, all die Kellnerinnen und Verkäufer eilten zur Ecke. Und jeder, der zur Ecke kam, stand einfach da und starrte nur die Martin Street hinauf nach Westen.
Sie waren vier Meilen von dem Feld entfernt, in dem das Flügelsegment explodiert war. Aber sie konnten es selbst von hier aus sehen: das Feuer am Horizont, das Feuer auf den Dächern, das Feuer, das vom Himmel fiel.
Carol sah es, als sie die Straßenecke erreichte. Sie stand in der sich drängenden, starrenden Menge. Rieb immer noch mechanisch die Hände an dem nassen Handtuch.
»Oh, mein Gott«, sagte sie.
Alle sagten sie das. »Oh, mein Gott!« »Heilige Scheiße!« »Jesus Christ!«
»Leck mich am Arsch«, murmelte jemand dumpf. »Es regnet Feuer.«
Es gab dann noch weitere Explosionen. Sie sahen, wie ein Haus einfach auseinanderfiel, einfach in tausend Splitter zerflog. Sie konnten Schreie hören, einen Chor von schluchzenden Rufen, die von überall zugleich kamen. Überall rannten Menschen herum wie Mäuse in einem Labyrinth. Polizeisirenen heulten auf, Feuersirenen und Autoalarmanlagen.
Dann fiel, keine drei Blocks entfernt, etwas Nasses und Schweres auf den Bürgersteig, das beim Aufprall Flüssigkeit verspritzte. Und glitzernde Spritzer von irgendwas kamen herunter. Und dann spuckte eins der Häuser an der Martin Street seine Fenster einfach in funkelnden Stücken aus.
Einige Männer eilten in die Richtung. Einige der Frauen schrien, schlugen die Hände vor den Mund.
Carol flüsterte: »Amanda.«
Und sie rannte zu ihrem Auto.
4
Dann fuhr sie, fuhr so schnell sie konnte zu Mrs. Shipmans Haus. Ihr Auto, ihr alter Rabbit, zuckte und röhrte wie ein betagter Jagdhund. Seine Achse geriet jedes Mal ins Wackeln, wenn es schneller als sechzig gehen sollte. Die Reifen kreischten bei jeder Kurve gequält auf. Carol rang mit dem Lenkrad, kämpfte grimmig mit Steuer und Straße.
Sie mußte zu Amanda. Sie mußte zu Amanda, und sie mußte hier durch – durch diese Hölle, die auf ihre Windschutzscheibe einstürmte, auf ihre Augen. Brennende Straßen. Brennende Häuser, ein Haus nach dem anderen. Rauchende Körper auf den Rasenflächen. Brennende Bäume. Die Umrisse von Autos unter züngelnden Flammen. Das Feuer am Himmel. Menschen, die sich wie Zombies bewegten. Kreischende Menschen. Menschen, die sie in der Stadt gesehen hatte, Gesichter, die sie kannte, blutig, zerschlagen.
Sie jagte das Auto an all dem vorbei, an ihnen allen. In ihrem Herzen war etwas Hartes und Unerbittliches gewachsen. Sie drückte heftiger aufs Gaspedal, um das Ruckeln des Rabbits zu überwinden. Sie weinte beim Fahren, aber sie merkte es gar nicht, es war ihr egal. Sie hatte die Zähne zusammengebissen. Die Augen starr nach vorn gerichtet. Sie mußte zu Amanda.
Eine Frau in Unterwäsche lief ihr vor den Kotflügel. Sie hielt ihren Kopf mit beiden Händen und hatte den Mund weit aufgerissen. Fluchend riß Carol das Auto herum. Ihr Herz war hart, und sie verfluchte die Frau und schleuderte um sie herum. Und als ein großer Tropfen zischenden Feuers ihre Scheibe traf, stieß sie nur ein schrilles Grollen aus und schaltete die Scheibenwischer ein.
»Runter da!« schrie sie weinend.
Sie kam an einem Spielplatz vorbei. Kinder lagen blutend auf der Erde. Andere saßen und heulten zum Himmel hinauf.
Carol öffnete den Mund, um heftiger weinen zu können, und sie trat noch stärker aufs Gas, nur weg von ihnen mit kreischenden Reifen, um die nächste Kurve herum. Unerbittlich.
Sie mußte Amanda finden.
Dann wurde sie langsamer. Da war Mrs. Shipmans Haus, genau vor ihr. Eine Sekunde lang konnte Carol nicht glauben, was sie sah.
Das Haus war ein gezacktes, eingeschlagenes Ding mit herausstehenden Holzteilen, eingehüllt in einen Nebel von Staub. Carol drehte sich beim Weinen der Magen um. Vor Anspannung und Angst war ihr übel.
Heraus aus dem Auto. Sie lief um das Haus herum. Sie dachte an die Imbißzeit. Dies war die Zeit für den Imbiß, dachte sie. Amanda spielte bis vier Uhr im Garten, und dann ging sie nach drinnen, um sich die nachmittäglichen Trickfilme anzusehen. Das war doch jetzt, oder? War jetzt nicht die Zeit für den Imbiß?
Lieber gnädiger Gott im Himmel, dachte sie, während sie in den Hinterhof rannte, lieber Christus, der am Kreuz gestorben ist, bitte mach, daß es nicht Zeit für den Imbiß war. Laß es noch nicht Zeit für den Imbiß gewesen sein.
Sie kam auf der anderen Seite des Hauses an. Sie sah die Veranda liegen, das Unterste zuoberst, die geborstenen Säulen. Sie sah das glänzende Stück des Flugzeugrumpfs aus einem Loch ragen, wo vorher die Pachysandra gewesen waren.
Von Weinkrämpfen geschüttelt blickte sie zu Boden, ohne überhaupt zu merken, daß sie weinte. Sie sah die Runde der Tassen und Teller auf der Erde. Die Stoffpuppe Mathilda saß immer noch aufrecht an ihrem Platz, gegen eine Milchkiste gelehnt, den Kopf wie in Trauer gesenkt.
Komm jetzt rein zu deinem Imbiß, Amanda.
Carol erkannte, daß es so gewesen war. Ihr Verstand war ganz klar. Sie konnte sich alles genau vorstellen. Ihre Sinne arbeiteten einwandfrei, und sie war sich der Explosion von Leid, die in ihrem Innern ausbrach, völlig bewußt. Es war, als sei sie eine wissenschaftliche Beobachterin bei einem Atomtest. Sie wußte, daß die sich ausbreitende Wolke des Schmerzes sie binnen kurzem ausfüllen, daß sie von ihr überwältigt würde. Sie würde sich den Brustkorb aufreißen müssen, um sie herauszulassen, oder einfach in Stücke gesprengt werden. Es würde über alles hinausgehen, was ein Mensch ertragen konnte.
Mit offenem Mund, das Gesicht von Tränen und Speichel bedeckt, hob sie den Kopf und hauchte ein leises, zitterndes »Oh«, den Laut, der ihrer Vernichtung Ausdruck gab.
Und dann sah sie einen hellroten Fleck auf Haupt- man’s Field.
Elmo.
Carol sah Elmos Bein unter Amandas Arm heraushängen. In ihren hellblauen Sachen war Amanda schwer auszumachen vor den grünen Bäumen, zwischen dem grünen Gras. Aber Carol erkannte Elmos Bein, und dann konnte sie ihre Tochter sehen.
Es war, wie keine Taufe je gewesen. Keine noch so schwarze Sünde war je so hinweggewaschen worden, wie die schwarze Wolke explodierenden Kummers nun aus ihrem Innern gespült wurde.
Sie sah, daß ihre Tochter sich auf den Wald zubewegte. Sie sah den Rauch, der ihr aus den Bäumen entgegenkroch. Und dann fing sie wieder an zu rennen.
Sie rannte über das Spielfeld. Sie schrie den Namen ihrer Tochter. »Amanda! Amanda!« Sie erstickte fast an ihren Schreien, war zu atemlos, um noch zu weinen.
Das Kind war sowieso außer Rufweite. Es war bereits unter dem Zaun hindurchgekrochen, hatte bereits die ersten Bäume erreicht. Carol zwang sich, seinen Namen noch einmal hinauszuschreien; rannte mit fuchtelnden Armen weiter, die Haare wehten, die Tränen flogen.
Dann begann Amanda ihrem Blick zu entschwinden. Sie bewegte sich in den Wald hinein. Sie verblaßte im Rauch. Der Rauch wurde immer dichter, immer schwärzer. Er brach in Schwaden aus den Bäumen hervor. Er breitete sich aus, hing in der Luft. Er verbarg das Kind vor dem Blick der Mutter. Das Kind verschwand in ihm.
Als Carol das Feld ganz überquert hatte, war Amanda nicht mehr zu sehen. Carol kroch durch die Mittellücke des Zauns. Ihr Fuß blieb an einer Latte hängen. Sie stolperte, fiel auf ein Knie, sprang auf, lief weiter.
Jetzt war sie zwischen den Bäumen, mitten im Rauch. Hatte einen Arm über den Mund geworfen. Hustete sich in die Faust. Spähte durch ihre Tränen hindurch, durch die rauchenden Säulen von Sonnenlicht.
Sie ließ den Arm sinken. »Amanda!« rief sie heiser. Dann mußte sie husten, riß den Arm wieder hoch, stolperte durch den Rauch.
Sie war orientierungslos, lief umher, hustete, rief, wie lange, wußte sie nicht. Dann spürte sie einen leichten Windhauch, und der Rauch wurde dünner. Carol blieb stehen und starrte angestrengt hinein, suchte die Gegend ab.
»Amanda!« keuchte sie heiser.
Und irgendein gewaltiges Wesen trat schwerfällig in den Nebel vor ihren Augen.
Es schien immer größer zu werden, eine klobige, dunkle Gestalt. Carol fuhr zurück. Was war das? Ein Bär?
Es schwankte auf sie zu. Carol ballte die Faust, bereit, zuzuschlagen.
Aber es war kein Bär. Es war ein Mann.
Er kam durch den Rauch auf sie zu. Er trat aus dem Rauch heraus, und Carol konnte ihn jetzt deutlich sehen. Es war ein Mann – und er trug ihre Tochter.
Amanda lag reglos in des Mannes Armen. Ihre Lippen waren geöffnet, die Augen geschlossen. Ihre Wangen hatten den Farbton von grauem Marmor. Und ein dünner Faden Blut tröpfelte aus ihrem Mundwinkel.
Aber sie lebte. Noch immer hielt sie Elmo fest. Sie drückte sich die Puppe gegen den Bauch. Elmo hob und senkte sich mit ihrem Atem – Carol konnte es genau sehen. Ihre Tochter war noch am Leben.
Sie schaute hoch zu dem Mann, und der Rauch wehte über sie beide hinweg, an ihnen vorbei. Für einen Moment war ihnen ein Stück klare Sicht beschert. Das Gesicht des Mannes war rußgeschwärzt, aber sein eines Auge strahlte weiß daraus hervor. Tränen wuschen seine Wange, legten das rosige, unversehrte Fleisch frei.
Er taumelte heran. Vorsichtig legte er das Kind in Carols Arme. Sie hielt Amanda fest, spürte das vertraute Gewicht, drückte ihre Wange an Amandas Stirn und fühlte die Fieberhitze. Jetzt begriff sie alles. Sie lachte und weinte zugleich. Und was sie dann sagte, schien überhaupt keinen Sinn zu haben.
Sie sagte: »O Gott. O Gott. Jetzt werden sie wieder hinter ihr her sein.«
5
Die Medien sprachen in der Regel von der Hunnicut-Katastrophe. Manchmal, wenn es ganz originell sein sollte, vom amerikanischen Lockerbie. Wie auch immer, es war die Sensationsstory jenes Sommers.
Die Reporter stürzten sich auf das Ereignis wie Fliegen auf den Misthaufen. Sie berichteten über die Opfer, über die Überlebenden, über die Zeugen. Sie befragten Experten, Offizielle, Psychologen. Sie hielten jede Träne fest, die über das Gesicht eines jeden Verwandten lief. Und dann berichteten sie über die Berichterstattung der anderen, und das schien der Aspekt der Story zu sein, der ihnen am allermeisten gefiel.
Es gab ein paar gute Geschichten. Wahre Geschichten, wichtige Geschichten. Aber im Laufe der Tage und Wochen, während die Cops und die offiziellen Stellen und alle möglichen Wichtigtuer das Wrack untersuchten, Hinweise sammelten, das Geschehen rekonstruierten, gab es auch jede Menge halbgares Geschwafel, das die Presse zusammenrührte, um die eher öde Zeit der Untersuchungen zu überbrücken. Es gab Gerüchte über einen Terroranschlag, über Vertuschungen seitens der Regierung, über Versäumnisse der Fluggesellschaft. Spekulationen wurden angestellt über Meteoriten und über militärische Laserstrahlen und über einzigartige, spektakuläre Vorfälle von Windabscherung. Dann legten sich die Boulevardblätter, die Supermarktzeitungen und die Seltsam-aber-wahr-Fernsehshows ins Zeug. Dem Vernehmen nach waren fünf oder sechs Körper, alle aus der Ersten Klasse, bemerkenswert intakt gelandet. Das war durchaus vorstellbar, und einige Wissenschaftler glaubten, daß ihr Abschnitt des Flugzeugs einen unabhängigen Tragflügel gebildet haben könnte, der ihren Fall gemildert hatte. Die Boulevardpresse dagegen meinte, daß es ein UFO gewesen wäre, das die Erwählten aufgefangen habe. Sie stellten sich vor, daß die Leichen von Engeln zur Erde geleitet worden seien, als ein von Gott gegebenes Zeichen der Hoffnung. Ein in News of the World auftretender »Augenzeuge« behauptete, das Jesuskind höchstselbst sei erschienen, habe einige der bekannten Zeichen und Wunder vollführt und sogar ein oder zwei prägnante Predigten zum Besten gegeben, bevor es fröhlich wieder seiner Wege gegangen sei.
Alles in allem wurde also, wenn man die Katastrophe in den Nachrichten verfolgte, für jeden Geschmack etwas geboten.
Doch für einen Mann – einen Mann, der jede Geschichte las, von der herzzerreißenden und authentischen bis zur lachhaft absurden – gab es noch etwas darüber hinaus. Dieser Mann war Vizepräsident von Helix-Pharmazeutik. Und für ihn hatte die Hunnicut- Katastrophe einen Aspekt, der wichtiger war als alles, wovon die Medien berichteten. Für ihn war in dieser Tragödie etwas vergraben, das schier unglaublich war. Das jedenfalls schier unglaublich gewesen wäre, wenn er nicht schon seit langer Zeit darauf gewartet – danach Ausschau gehalten hätte.
ERSTES KAPITEL:Seelenqualen
1
Vier Monate später. November, wieder ein Freitag. Manhattan, New York, New York. Ein junger Saxophonist namens Lonnie Blake spielt einen Gig in einem Laden an der Ninth Avenue.
Es war kein besonderer Laden. Es waren auch nicht mehr besonders viele Gäste da zu später Nachtstunde. Drei oder vier Leute saßen an der Holztheke. Vier oder fünf weitere lümmelten sich an den kleinen runden Tischen. Fast alle Anwesenden waren jung, wirkten aber durchweg ziemlich blaß und gespensterhaft, mit glasigem und umherschweifendem Blick, als seien sie irgendwie verlorengegangen auf dem Weg zum angesagten Geschehen. Ein Spinner, der in der Ecke saß, trug doch tatsächlich eine Sonnenbrille – er war ganz in Schwarz gekleidet und wippte mit dem Kopf, als würde ihn die Musik voll draufbringen. Mit anderen Worten, der Vorrat an Hipness war an diesem Ort recht knapp bemessen.
Der Laden nannte sich ›Renaissance‹. An den Wänden zog sich ringsum ein Wandgemälde von Florenz entlang. Die Freundin des Besitzers hatte es gemalt, genauer: abgemalt von einem Bild in einem Buch, das sie im Antiquariat gefunden hatte. Das Wandbild war, als sie es fertiggestellt hatte, gar nicht mal so schlecht gewesen; aber vor ungefähr sechs Monaten hatten sie und der Besitzer sich heftig gestritten. Sie war nach San Francisco abgehauen, und jetzt war ihr feines blaues Firmament am Abblättern, und die verschlungene Skyline in Weiß und Rot begann langsam zu verschmieren.
Vor diesem Hintergrund also, auf einer kleinen Bühne genau vor dem verschwimmenden Duomo, agierte die Band. Ein Trio: Keyboard, Baß, Saxophon. Fred Purcell, Arnie Cobb und Lonnie Blake.
Arthur Topp saß unterdessen an der Bar. Seit nahezu einer Stunde. Gönnte sich einen Scotch oder drei. Lauschte der Musik. Beobachtete Lonnie.
Das Trio spielte überwiegend Standards – Jurassic classics. »Night and Day«, »Always«, »Savoy«, diese Richtung. Sie schnippsten mit den Fingern und sagten andauernd »Yeah«, um das Publikum glauben zu machen, daß sie sich echt reinschafften. Aber bisher hatte Arthur noch nichts gehört, was ihn hätte begeistern können.
Arthur war ein Weißer. Klein und dünn, vierzig Jahre. Oben kahl, aber der Rest der schwarzen Haare lang gewachsen und zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Sein rotes Überziehhemd sah teuer aus und hob ihn von der hiesigen Umgebung ab. Abheben tat ihn auch seine Golduhr. Er hatte sie von seinem Vater geerbt. Seine Kleidungsstrategie zielte darauf, wohlhabender auszusehen als er war.
Er fuhr fort, Lonnie mit seinen flinken, dunklen Augen unter die Lupe zu nehmen. Mit der Hand klopfte er ungeduldig auf den Tresen.
Der Saxophonist konnte was. Das sah Arthur, das hörte er. Lonnie hatte schnelle Finger und einen geschmeidigen, kontrollierten Sound. Auch seine Improvisationen waren soweit ohne Makel; den Weg aus der Melodie heraus und wieder hinein fand er mit großer Präzision. Aber es war doch ziemlich uninspiriertes Zeug, fand Arthur. Die ewig gleichen, ausgelutschten Bar-Riffs. Dieselbe Leier, die man überall hören konnte.
Arthur warf einen Blick auf die Rolex seines Vaters. Fast ein Uhr. Der letzte Set neigte sich dem Ende zu. Die Band machte sich für den Feierabend bereit. Arthur war gewillt, die Sache abzuschreiben, seine Zeche zu bezahlen und zu verschwinden.
Aber in diesem Moment, gerade als er sich anschickte, dem Barkeeper ein Zeichen zu geben, passierte etwas.
Da war es. Letzter Song. »Haunted Heart.« Das Trio swingte in den Schlußabschnitt. Fred Purcell, der Keyboarder, nickte Lonnie zu, den Break zu übernehmen. Der Saxophonist blies sich in sein abschließendes Solo hinein. Nur der Baß stützte ihn noch mit einer aus drei Noten bestehenden Rhythmuslinie.
Arthur Topp hielt inne. Er hörte zu. Zuerst gar nichts. Immer wieder dasselbe Lied. Die Überleitung mit ein paar verwischten Verzierungen aufgemotzt, ein paar ornamentale Triller hinterher. Ein chromatisches Füllsel, wo eigentlich eine Pause hätte stehen müssen, um es wie einen echten Jam klingen zu lassen.
Der Spinner mit der Sonnenbrille war beeindruckt. Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Mann!« sagte er, den Kopf hin und her schaukelnd.
Arthur Topp drückte ein Gähnen in seine Faust. Lonnie Blake schlafwandelt sich durch die Sache, dachte er. Wie schon den ganzen Abend lang.
Dann – mit einem Mal – änderte sich das. Lonnie war dabei, auf einer angetäuschten Tonleiter emporzuschweben, routiniert eine Note nach der anderen abzuhaken, immer weiter rauf – und dann hielt er dort, hielt dumpf im unteren Bereich, als hinge er an einem unsichtbaren Strick fest. Ein Ton, stoßweise, gebunden und schleppend, unmittelbar davor, in ein elendes Brummen umzuschlagen ...
Und dann – abrupt – riß der Strick.
Plötzlich – Arthur sah ihm erstaunt zu – plötzlich war Lonnie da, zurückgebeugt vor dem gemalten Himmel, dem gemalten Dom. Das Saxophon emporgehoben, ein Selmer Mark VI, ein feines Gerät, das in seinen langen Fingern funkelte. Und er brachte das Teil zum Klingen. Er schaffte sich rein. Seine dunklen Lippen küßten das harte schwarze Gummi des Mundstücks. Er flüsterte über dem Rohrblatt in einer Art MilesDavis-Manier, die das weichblaue Tenorsax mit einem geisterhaften Nichts füllte ...
Und auf diesem leeren Atem flog er empor, glitt auf eine hohe Klippe von unglaublichen Coltrane-Sechzehnteln hinauf, um den Höhepunkt in einem nahtlosen Vibrato zu finden, kaum merklich zitternden Sprüngen von einer zur anderen Tonhöhe.
Oh, dachte Arthur Topp. Oh, oh, oh.
Dann kam ein weiterer gehaltener Ton, dieser aber singend, ein singendes es, das wie ein Yogi in einer nicht vorstellbaren Luft schwebte. Ein Schütteln dann, dieses schnelle Trillern mit den Lippen, und gerade als der Ton fallen mußte, noch ein Schütteln – und dann fiel er tatsächlich, er stürzte hinab, Wrumm, und wie eine warme Windbö glitten Keyboard und Saxophon unter ihn, und Lonnie wehte zurück – wehte einfach zurück – in die Melodie hinein. Und das Trio brachte den Song über die Bühne.
Purcell, ein grauhaariger älterer Typ, warf einen überraschten Blick von seinem Keyboard herüber. »Jawoll«, sagte er.
Arthur Topp klatschte und pfiff.
Der Spinner haute wieder auf den Tisch. Ein paar weitere Leute konnten sich lange genug von ihrem Drink trennen, um die Hände ein paarmal zusammenzubringen.
Purcell und Cobb, Keyboard und Baß nickten, deuteten ein Lächeln an.
Lonnie Blake kehrte allen den Rücken. Die Show war vorbei.
2
Er war ein noch junger Mann – dieser Lonnie –, keine dreißig, oder vielleicht gerade eben. Durchschnittlich groß, schlank, Hautfarbe ungefähr wie Milchschokolade; kompakte, kantige Gesichtszüge, fast katzenartig, unter sehr kurzen, wie auf den Kopf gestreuten schwarzen Haaren. An diesem Abend machte er ziemlich was her in seinem seidengrauen Anzug und dem weißen Hemd mit offenem Kragen.
Er packte sein Sax ein, kletterte von der Bühne. Blieb bei den Kleiderhaken an der Wand stehen, nahm einen schwarzen Mantel herunter und schlüpfte hinein.
Aber er ging nicht weg. Er kam zur Bar herüber. Stellte seinen Saxophonkoffer ab. Lehnte sich mit den Ellbogen gegen die Stange, gleich neben Arthur Topp.
»Bourbon and Seven«, sagte er zu dem Barkeeper.
Arthur beäugte den schwarzen Mann von der Seite, seinen Drink in der Hand haltend. Er war ziemlich nervös wegen dieser Sache, unsicher. Schließlich hatte er sich erkundigt über Lonnie Blake. Hatte Gerüchte gehört, er sei ein harter Junge, ein schlimmer Junge sogar, Mitglied einer Gang in seiner Jugend. Arthur wußte, daß dies nicht leicht werden würde.
Doch es bedeutete ihm eine Menge. Wenn er den Saxophonisten für sich gewinnen, wenn er seine Unterschrift kriegen könnte ... na ja, es wäre eine Chance, eine weitere Chance für ihn, dem Geist seines Vaters zu beweisen, daß mehr in ihm steckte als den Vermittler für Hochzeiten und Bar-Mizwas zu machen, daß er tatsächlich einiges an musikalischer Klasse besaß.
Er räusperte sich. »Uh, hey«, sagte er nach ein oder zwei Sekunden.
Lonnie warf ihm einen desinteressierten Blick zu.
»Äh, super, äh, bockstark«, sagte Arthur Topp. »Echt. Im Ernst. Keine Frage. Klasse gemacht. Echt.« Ausgezeichnet, Art, sagte er sich. Du klingst original wie ein alter Vollidiot.
Blake war offenbar auch dieser Ansicht. Er starrte Arthur an. Kein freundlicher Blick. Die Augen wirkten schwarz und ohne Tiefe. Dann gab er, indem er leicht das Kinn hob, einen Laut von sich, für den es keine exakte Benennung gibt: ein kurzes Zischen durch die Nasenlöcher. Ein Ausdruck der Verachtung.
Arthur grinste blöde. Er spürte, wie ihm der Schweiß zwischen den Schulterblättern ausbrach und war dankbar, als der Barkeeper einen großen Bourbon auf den Tresen stellte, als Blake diesem seine Aufmerksamkeit zuwandte und einen langen Schluck einfuhr.
Trotzdem – wenn überhaupt etwas, dann war er hartnäckig – blieb er am Ball. »Nein. Hören Sie. Ungelogen. Ich kenn Sie.«
Lonnie beendete seinen Schluck und holte Luft. Schüttelte langsam den Kopf. »Tun Sie nicht.«
Topps Lachen klang sogar in seinen eigenen Ohren verzweifelt. »Ich kenne Ihre Arbeit, meine ich. Ihre Musik. Machen Sie’s mir ein bißchen leichter, wie wär’s?«
Lonnie machte es ihm nicht leicht, er antwortete nicht einmal. Wieder setzte er den Drink an die Lippen. Er zog so heftig, daß das Eis klirrte. Während er das Glas absetzte, nickte er dem Barkeeper zu.
»Bourbon and Seven«, sagte der Barkeeper und schenkte schnell einen neuen ein.
»Ich hab dieses alte Demo gehört«, sagte Arthur Topp. »Jemand hat mir das alte Demo zugesteckt. ›Evolutions.‹ Stimmt’s? ›Evolutions?‹ Muß zwei oder drei Jahre alt gewesen sein. Ich meine, ich hab’s gehört – das ist schon ein paar Monate her. Ist mein Ernst. Ich such seit Monaten nach Ihnen.«
Der Saxophonist arbeitete an seinem zweiten Drink, arbeitete verbissen.
»Ich mein, Sie sind ja nicht oft zu sehen«, sagte Arthur zu seinem Profil.
»Ich bin gar nicht zu sehen«, sagte Lonnie Blake nach einer Weile. Sein Ton wurde hörbar gereizt. »Ich bin auch jetzt nicht zu sehen. Es sieht nur so aus, als wäre ich zu sehen. Lassen Sie sich nicht täuschen.«
»Okay.« Meine Güte, dachte Arthur. Meine Güte.Das sieht nicht gut aus. »Okay. Okay, aber zum Beispiel – ›Evolutions‹«, sagte er trotzdem. »Ich mein, das war einfach irres Zeug, Spitzenzeug, ehrlich. Die Oldies ... die alten Sachen ... Sie haben’s ihnen echt gegeben. Ich mein, das letzte Mal, daß ich das Zeug so frisch gehört hab’, war ... na, was? ›My Favorite Things?‹ Glaub schon. Ehrlich. Ungelogen. Im Ernst.«
Lonnie wandte sich ihm endlich wieder zu, sah zu ihm herüber, als habe er gerade ein unangenehmes Geräusch bemerkt.
»Echt«, wiederholte Arthur hilflos.
»Sind Sie andersrum?« fragte Lonnie ihn.
»Was?« Zu seinem eigenen Entsetzen stieß Arthur ein schrilles Kichern aus. »Nein! Ich mein, Herrje. Ich mein, andersrum, ja klar, in mancher Beziehung weiß Gott. Aber nein. Nicht in dem Sinn. Nein.«
»Was zum Teufel wollen Sie dann von mir, Mann?« fragte Lonnie Blake. »Ich versuch hier in Ruhe was zu trinken.«
Topp betrachtete dies als gute Gelegenheit. Er räusperte sich noch einmal, faßte sich, und leierte seine Nummer ab. »Mein Name ist Arthur Topp. Ich bin Agent. Für Künstler. Ich besorge ihnen Auftritte. Alles wo’s um Musik geht. Topp Music. Top in Sachen Pop.« Er zog eine Geschäftskarte hervor. Drückte sie in Lonnies Hand. Der Musiker sah sie an, als handele es sich um Auswurf. Stieß sie in seine Manteltasche, als wolle er sich die Hand abwischen. »Wir sind keine große Firma. Nur ich, genauer gesagt. Aber ich hab’ ein paar gute Leute, ehrlich, total gut. Das ist meine ... da steht alles drauf, Nummern, Adressen. Ich bin von acht bis acht im Büro, jeden Tag. Ab halb neun zu Hause, es sei denn, es läuft was, also, Talente unter die Lupe nehmen oder so. Zu Hause, Büro, ganz egal. Ich arbeite immer. Und ich bin immer über Handy erreichbar. Also ... ich mein, sehen Sie, ich halte immer Ausschau. Okay? Ich glaube, Sie könnten ... Ich glaube, Sie und ich, wir könnten – wirklich was auf die Beine stellen. Also echt jetzt. Mein voller Ernst.«
Na ja, es klang nicht grad nach Poesie, aber wenigstens war es ihm gelungen, es auszuspucken. Er wartete ab, während Lonnie ihn anstarrte.
Dann wandte sich Lonnie der Bar zu. Leerte sein zweites Glas. Knallte es auf den Tresen. »Mach’s gut«, sagte er. Und griff sich seinen Saxophonkoffer.
Arthur Topp wußte nicht genau, ob es Wut oder Verzweiflung waren, die ihn antrieben, aber jedenfalls hörte er sich herausplatzen: »Hören Sie, ich weiß, was passiert ist. Mit Ihrer Frau, meine ich.«
Das brachte Lonnie jedenfalls zum Innehalten. Der Mann erstarrte. Blickte sich um, die katzenartigen Gesichtszüge so unbeweglich und hart wie die Augen ohne Tiefe.
»Ja, Entschuldigung«, sagte Arthur Topp. »Ich mein, es ist tragisch. Eine tragische Geschichte. Sicher. Aber ich dachte ... wissen Sie – es ist über ein Jahr her, fast zwei Jahre.« Er fuchtelte mit der Hand. »Das Leben ... das Leben geht weiter.«
Lonnie Blake bedachte ihn mit diesem stummen Blick. »Tut es das?«
»Yeah. Na ja, ich mein ... ich will nicht sagen, daß es nicht tragisch ist, aber ...« Arthur wußte, daß er dummes Zeug daherredete. Aber er konnte sich einfach nicht bremsen. »Ich meine, immerhin, ein Mann wie Sie ... ich mein, ich kenne diese Studiogangster, aber Sie kommen doch aus dem Schützengraben, Mann, Sie kommen doch aus den voll harten Verhältnissen ...« Der Schweiß strömte ihm mittlerweile an den Schläfen herunter. Er fühlte, wie er ins Hemd lief, der nasse Baumwollstoff klebte in den Achselhöhlen. Und er dachte im Stillen: Halt’s Maul. Aber er konnte es nicht. »Und dann ... dann ziehen Sie sich da raus und machen Ihre Musik, Sie kriegen Ihre Frau und bringen ›Evolution‹ ins Rollen und alles, und dann ... Ja, ich mein, es ist wirklich eine Tragödie, aber ... aber Sie wollen doch das nicht alles wegwerfen, nicht alles vor die ... Das würde sie – ist doch so? – nicht wollen.«
Schließlich war er denn doch durch, gebot sich Einhalt, hielt den Mund. Und einen langen, einen endlosen Augenblick lang schwitzte er weiter vor sich hin, während Lonnie Blake ihn anstarrte.
Dann machte Lonnie wieder dieses Geräusch. Dieses kleine Schnauben der Verachtung. Er zeigte Arthur seinen Rücken und ging auf die Tür zu.
Topp sah ihm nach, das vertraute Gefühl des Scheiterns hüllte ihn ein. Und dann, ohne nachzudenken, sagte er: »Sie können’s in Wirklichkeit nicht mehr, stimmt’s?«
Lonnie Blake hielt auf seinem Weg zur Tür inne. Stand da, ohne sich umzudrehen.
»Spielen, meine ich«, fuhr Arthur fort. Sprach die Gedanken aus, während sie ihn anfielen. »Ich mein, ich hab Sie heute abend gehört und ... ›Evolutions‹ – das ist irgendwie vorbei für Sie, nicht wahr?«
Lonnie Blake setzte sich wieder in Bewegung.
»Das ist es doch, oder?« rief Arthur ihm nach. »Sie können nicht mehr richtig spielen, seit man sie umgebracht hat.«
Lonnie stieß die Tür auf und verließ die Bar.
3
Die Nacht war kalt. Lonnie stand vor der Bar auf der Ninth Avenue, sein Atem dampfte in der Herbstluft.
Idiot, dachte er. Und er verdrängte Arthur Topp aus seinen Gedanken.
Aber nicht die Wut. Unter dem Bourbon blubberte die vertraute Wut weiter, ein unaufhörliches Brodeln auf kleiner Stufe.
Auf der anderen Straßenseite hielt ein junger Mann, ein junger schwarzer Mann in Anzug und Krawatte, seiner Dame die Autotür auf. Sie war zwanzig und wunderhübsch, ihr Kleid hatte auf einer Seite einen Schlitz bis oben hin. Lonnie beobachtete, wie sie sich bückte und in den Grand Am setzte, wobei die braune Haut eines schönen Beines im Licht der Straßenlaterne aufblitzte. Der Anblick tat ihm weh, und seine Wut mischte sich mit etwas anderem, einer eher traurigen Sehnsucht. Seit achtzehn Monaten war er mit keiner Frau mehr zusammen gewesen.
Du kannst nicht mehr richtig spielen, seit man sie umgebracht hat.
Lonnie wandte sich ab und marschierte los.
Es war ruhig auf der Straße. Bei den vorbeibrausenden Autos handelte es sich meistens um Taxen. Unter den Laternen, zu Füßen der angemalten Ziegelhäuser, unterhalb ihrer Feuertreppen, kämpfte sich hier und da irgendein schlurfender Niemand über den Bürgersteig in Richtung Port Authority. Lonnie ging langsam weiter, das Saxophon in der einen Hand, die andere Hand in der Tasche. Die Augen ohne Tiefe waren starr, sein Blick ging nach innen.
Er schlenderte auf der Dreißigsten nach Osten. Es war eine dunklere Straße, die Häuser ragten höher; braune Gebäude, die sich zu beiden Seiten erhoben und deren große, leere Fenster dunkel waren. Der Herbstwind fegte stetig durch diese trostlose Schlucht. Im Schatten jenseits der Lampen trudelte Abfall unter den geparkten Autos hervor.
Lonnies Kiefer arbeitete beim Gehen. Seine Lippen bewegten sich ein wenig zu dem stillen Gemurmel in seinem Kopf. Er war jetzt ganz in sich versunken. Steckte in der Tretmühle seines alten Leids, kreiste wie ein Hamster um die alten Bilder herum. Die grinsenden jungen Weißen. Das rasende Auto. Seine gemordete Frau. Suzanne.
Die Wut machte ihn fertig, noch durch den Whisky hindurch. Nur die Bilder von ihr milderten den Schmerz, und doch taten auch diese Bilder weh. Er beschwor ihre schlanke, graziöse Gestalt herauf, die sich ihm von der Küchenspüle aus zuwandte. Ihr strahlendes, ungezügeltes Lächeln – und alles andere auch. Die weiche, braune Haut ihrer hohen Wangen und die sanften Tiefen ihrer Rehaugen und so weiter. Ihre Hand, die einen Drink in die seine drückte. Ihre Finger, die seine Schultern massierten. Wie war dein Tag? fragte sie.
Und so weiter.
Ein tiefer Laut entfuhr ihm, ein tiefer und schrecklicher Laut. Er blieb stehen. Er hatte die leere Straße zur Hälfte durchquert. Die rauhen Gebäude und die windige Stille drückten ihn von allen Seiten nieder.
Leicht den Kopf schüttelnd ging er entschlossen weiter, zwang die Bilder zurück ins Dunkel.
Er erreichte das Haus, in dem er wohnte. Es gab dort eine schmale Nische in einer breiten braunen Wand. Ein Lagerhauseingang mit einer schwarzen Holztür, die sich auf einen Vorraum öffnete. Lonnie zog seine Schlüssel aus der Tasche. Trat aus dem Licht der Straßenlaterne in die Nische hinein. Er spähte angestrengt ins Dunkel, um den Schlüssel ins Schloß zu schieben. Der Schlüssel glitt hinein.
Eine Hand streckte sich von hinten nach ihm aus. Packte fest seinen Ellbogen. Eine Frau flüsterte rauh zu ihm aus der Nacht.
»Hilf mir«, sagte sie.
4
Erschrocken warf Lonnie den Kopf herum. Es war eine weiße junge Frau, die ihn mit flehenden Augen anstarrte. Blaß war sie, und der vor ihrem Gesicht verdunstende Atem verlieh ihr ein beinahe geisterhaftes Aussehen. Sie hatte kurze schwarze Haare. Hübsches Gesicht, aber angemalt und billig. Der gegürtete schwarze Mantel endete weit oben auf Schenkelhöhe. Die sexy Beine steckten in schwarzen Strumpfhosen, die Füße in schwarzen, hochhackigen Schuhen.
Lonnie hielt sie für eine Prostituierte. Das hier war irgendeine Trickserei, dachte er. Aber in ihren Augen lag echte Furcht, so sah es aus. Und die kleine Hand auf seinem Ellbogen zitterte so stark, daß er es im ganzen Arm spürte.
»Ein Mann ist hinter mir her«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte ebenfalls. »Bitte. Laß mich rein. Ich schwöre ... Bevor er mich sieht. Schnell. Bitte.«
Sie warf einen raschen Blick zur Straßenecke. Lonnie folgte dem Blick. Er sah ein Auto über die Kreuzung huschen, dann noch eins. Das grüne Leuchten der Ampel verblaßte in der Dunkelheit.
Aber es kam niemand, keine Spur von irgendeiner Person.
Die Nutte zischte ihm zu: »Ach, bitte! Mein Gott!« Der Griff an seinem Arm wurde noch fester.
Lonnie zögerte einen Augenblick, erwog die verschiedenen Gesichtspunkte. Dann folgte er seinem Instinkt: drehte den Schlüssel, stieß die Tür auf.
Die Hure schoß an ihm vorbei. Er schlüpfte hinterher, ließ die Tür hinter sich zufallen.
Der Vorraum des Hauses war klein, eng, ungefähr so groß wie zwei nebeneinandergelegte Fahrstühle. An der hohen Decke hing eine Lampe, deren Licht auf dem weiten Weg bis zum karierten Linoleumboden immer trüber wurde.
Die Nutte lehnte sich zitternd gegen eine der farblosen Wände. Lonnie beobachtete sie, lauschte ihrem keuchenden Atem. Sie hob ihre rote Plastikhandtasche. Ließ sie aufschnappen. Wühlte darin.
Lonnie beobachtete auch dies, ausdruckslos. Dachte dabei: Wennse da ’n Messer rausholt, schlag ich ihr die Scheißfresse ein.
Sie holte eine Packung Marlboro Lites hervor. Hielt sie ihm entgegen. Er schüttelte den Kopf. Sie rüttelte eine Zigarette frei und zog sie mit den Lippen aus der Schachtel. Beugte sich mit der im Mund baumelnden Zigarette über ein Plastikfeuerzeug. Klick Klick Klick.
Sie bekam die Flamme nicht an mit ihren zitternden Händen.
Lonnie nahm ihr das Feuerzeug ab. Entflammte es, hielt es ihr hin. Sie beugte sich dem Feuer zu, umfaßte mit beiden Händen seine Faust. Dann neigte sie sich zurück, bis sie ihm in die Augen sehen konnte. Sie saugte den Rauch so gierig ein, daß Lonnie fast fühlte, wie er in ihre Lunge zog. Dann seufzte sie ihm die ganze Schwade entgegen.
»Danke«, sagte sie. »Tschuldigung für die Panik. Hab ’ne Allergie gegen diese Typen, weißt du.« Sie versuchte zu lachen. Es hörte sich nicht sehr überzeugend an. Sie hielt die Zigarette hoch. »Was dagegen?«
Lonnie ließ sein kurzes Schnauben hören. Die Nutte lehnte sich wieder an die Wand, nahm noch einen Zug. Schloß die Augen, hielt Zwiesprache mit dem Rauch.
Lonnie sah sie prüfend an. Die hohen Hacken, die bestrumpften Beine, der Minimantel aus Plastik, das knallige Make-up. Ohne Frage, sie war eine Hure. Aber hübsch unter dem ganzen Glump. Praktisch noch ein Kind. Kaum über zwanzig.
Sie erzitterte unter einem tiefen Atemzug. Öffnete die Augen. Ihre Augen waren groß und blau. Sie versuchte, ihnen einen sardonischen Ausdruck zu geben, doch es blieben Tümpel der Einsamkeit.
»Paß auf«, sagte sie. »Hast du was dagegen? Du kannst ruhig nach oben gehen, ehrlich. Ich kann hier unten warten. Ist mir egal. Ich schwör bei Gott, Mann, ich bin verschwunden, bevor es hell wird. Sobald Leute auf der Straße sind, bin ich nur noch eine verschwommene Erinnerung. Ehrenwort.«
Diese Augen hielten ihn fixiert, selbst als er wieder wegsah. Ich bin ja wohl total bescheuert, dachte er. Dann ließ er noch so ein Schnauben los. Reckte ihr einen Finger entgegen. »Das ist nicht meine Wohnung hier, verstanden? Sie gehört einem Freund. Ich darf sie benutzen, klar? Also, wenn ich dich hochlasse und du klaust irgendwas, dann nehm ich das persönlich. Verstehst du?«
Sie stieß sich von der Wand ab, beide Hände erhoben. »Du bist so gut. So gut.«
»Hast du mich verstanden?«
»Ich schwöre bei Gott«, sagte sie. »Hilf mir.«
»Also gut.«
Sie roch nach Veilchen und Tabak. Als sie im Fahrstuhl standen, mußte Lonnie an ihr vorbeilangen, um seinen Schlüssel in die Öffnung für den vierten Stock zu stecken. Sein Gesicht war dicht an ihrem schwarzen Haar, und er fing ihren Duft auf. Sie standen Arm an Arm, während der Käfig hinauffuhr, und er konnte die Nähe ihrer Haut fühlen.
»Das ist wirklich große Klasse von dir, ehrlich«, wiederholte sie. Sie saugte so fest an ihrer Zigarette, daß sie beim Sprechen zischte. Nickte beim Ausatmen. »Also, ich mein, im Ernst.«
Lonnie zog eine Grimasse, schaute nach oben zu den Zahlen über der Käfigtür. Wahrscheinlich die Polizei, die hinter ihr her ist, dachte er. Dauerte vermutlich noch zehn Minuten, dann waren sie hier und hatten sie beide am Arsch.
Der Fahrstuhl hielt im vierten Stock, ganz oben. Lonnie schob das Gitter beiseite und schloß die schwere Metalltür auf, die in sein Loft führte. Er stieß die Riesentür auf und atmete tief ein, als die Nutte sich an ihm vorbeidrückte. Veilchen und Rauchspuren.
»Warte. Mach noch nicht das Licht an«, sagte sie.
Er stellte sein Saxophon ab. Stand da und beobachtete sie im Dunkeln. Sie war ein kleiner wandernder Schatten in der großen Weite des Lofts. Vorsichtig bewegte sie sich nach links, zur Wand mit den hohen Fenstern. Trat an ein Fenster. Sah hinaus. Und dann fuhr sie zurück, als hätte sie sich verbrannt.
»Was ist«, sagte er. »Ist er da draußen?«
»Ja. Ja.«
»Laß sehen.«
Lonnie eilte durch den Raum auf die Fenster zu. Er merkte, wie sie an seinem Arm fingerte, als er an ihr vorbeikam, und bewegte sich langsamer, damit er nicht gesehen werden konnte. Er schmiegte sich dicht neben die Fensterbank. Blickte durch die Feuertreppe hindurch nach unten auf die Straße.
Der Mann war auf dem Bürgersteig. Er bewegte sich langsam unter einer Straßenlaterne, genau dort, wo sie eben noch gestanden hatten. Offensichtlich suchte er nach jemandem, blickte sich forschend in alle Richtungen um.
Lonnie hatte ihn gut im Blick. Ein großer, kräftiger Weißer im offenen Trenchcoat. Er hob den Blick, um die Gebäude abzusuchen, die Fenster. Lonnie zog sich ein wenig hinter den Vorhang zurück. Spähte hinaus und sah das Gesicht des Mannes. Es war ein Trumm von einem Gesicht, die Haut sah aus wie Kies. Dicke schwarze Augenbrauen, die ironisch hochgezogen waren. Schwarze Haare, deren Ansatz über der hohen, rauhen Stirn spitz zulief.
Der Mann schien zu fluchen. Geschmeidig glitt seine Hand in die Manteltasche.
Neun-eins-eins, dachte Lonnie. Mit Sicherheit ein Cop. Sie hatten den Mädels von der Straße das Leben in letzter Zeit ziemlich schwergemacht. Er mußte unwillkürlich ein wenig lächeln. Tja, Officer, dachte er, sieht so aus, als wäre Ihnen die hier durch die Lappen gegangen.
Er beobachtete weiter. Der Mann zog etwas aus der Tasche. Ein Walkie-Talkie oder Handy. Er sprach hinein, während er weiterging, aus dem Lampenlicht hinaus in Richtung Neunte.
Kurze Zeit später hielt ein Auto neben ihm, ein langes und schwarzes. Der kiesgesichtige Mann öffnete die Wagentür. Er glitt auf den Beifahrersitz. Das Auto fuhr ab.
»Sayonara, fünf-null«, murmelte Lonnie. »Alles klar, er ist ...« Aber das Mädchen war nicht mehr da. Einen Moment lang konnte er sie nicht finden. Dann entdeckte er sie im Schatten, sah ihre glühende Zigarettenspitze. Sie saß vornübergebeugt in einem der Ledersessel. »Er ist weg«, sagte Lonnie.
»Ja? Biste sicher?« Ihre Stimme klang seltsam. Dünn und angespannt.
»Ein Auto hat ihn mitgenommen. Sie sind weggefahren.«
Sie berührte ihre Wange mit dem Handballen. »Scheißkerle«, sagte sie. Lonnie bemerkte, daß sie wohl geweint hatte. »He, hast du hierfür einen Aschenbecher?«