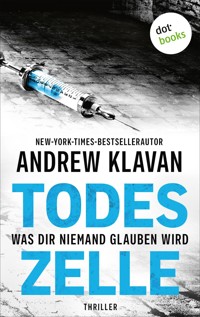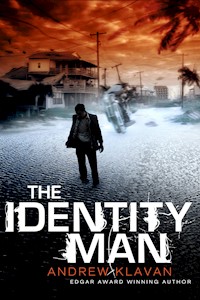5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Was tust du, wenn dein Leben sich plötzlich als Lüge herausstellt? Der packende Thriller »Todesmädchen« von Andrew Klavan jetzt als eBook bei dotbooks. Als Nancy Kinkaid am Halloween-Morgen zur Arbeit kommt, scheint sie plötzlich niemand mehr wiederzuerkennen. Kurze Zeit später findet sie eine Pistole in ihrer Handtasche und ein Bettler prophezeit ihr, sie würde um Mitternacht einen Menschen ermorden … Spielt jemand ein böses Spiel mit ihr – oder ist sie wirklich nicht, wer sie glaubt zu sein? Auf ihrer ziellosen Flucht durch New York trifft sie auf den gebrochenen Dichter Oliver, der auf der Suche nach seinem verschwundenen Bruder ist. Auf rätselhafte Weise scheinen die Schicksale der beiden miteinander verbunden und gemeinsam machen sie sich auf die Jagd nach Antworten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Mitternacht rückt immer näher und das Leben zahlloser Unschuldiger steht auf dem Spiel … »Andrew Klavan manövriert den Plot seines Thrillers mit unwiderstehlicher Geschicklichkeit und lässt seine Leser gebannt zurück.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Psychothriller »Todesmädchen« von Bestsellerautor Andrew Klavan wird alle Fans von Michael Robotham und Robert Ludlum begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als Nancy Kinkaid am Halloween-Morgen zur Arbeit kommt, scheint sie plötzlich niemand mehr wiederzuerkennen. Kurze Zeit später findet sie eine Pistole in ihrer Handtasche und ein Bettler prophezeit ihr, sie würde um Mitternacht einen Menschen ermorden … Spielt jemand ein böses Spiel mit ihr – oder ist sie wirklich nicht, wer sie glaubt zu sein? Auf ihrer ziellosen Flucht durch New York trifft sie auf den gebrochenen Dichter Oliver, der auf der Suche nach seinem verschwundenen Bruder ist. Auf rätselhafte Weise scheinen die Schicksale der beiden miteinander verbunden und gemeinsam machen sie sich auf die Jagd nach Antworten. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Mitternacht rückt immer näher und das Leben zahlloser Unschuldiger steht auf dem Spiel …
Über den Autor:
Andrew Klavan wuchs in New York City auf und studierte Englische Literatur an der University of California. Danach arbeitete er als Reporter für Zeitungen und das Radio, bevor er sich ganz dem Schreiben seiner Spannungsromane widmete. Heute gilt Klavan als einer der großen Thriller-Experten der USA. Mehrere seiner Bücher sind mit dem begehrten Edgar-Award ausgezeichnet, für weitere Preise nominiert und/oder verfilmt worden.
Die Website des Autors: andrewklavan.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/aklavan/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Todeszelle -Was dir niemand glauben wird«, »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen sein«, »Todeszahl – Was tief begraben liegt«, »Hilfeschrei – Die Dunkelheit in uns«, »Opferjagd«, »Totenbild« und »Todesmädchen«.
***
eBook-Neuausgabe August 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1993 unter dem Originaltitel »The Animal Hour« bei Pocket Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1994 unter dem Titel »Die Stunde der Schatten« im Bertelsmann Verlag, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1993 by Trapdoor Inc.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Pavel L Photo and Video und AdobeStock/Mendy Za
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-168-1
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andrew Klavan
Todesmädchen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristian Lutze
dotbooks.
Widmung
Dieses Buch ist für Spencer
Mein Dank gilt Dr. med. Erica Newton
für ihre fachliche Beratung und die Führung
durch Bellevue; Barney Karpfinger
für seinen klugen Rat und unerschütterliche
Unterstützung; und meiner Frau
Ellen – wie immer – für alles.
1. Teil:Nobody’s Sweetheart
»Wohin führt mein Weg?
Ich kann es nicht sehn.
Was macht es schon aus,
wohin Leute gehn?«
A. A. Milne
Kapitel 1: Nancy Kincaid
Es würde ein beschissener Tag werden. Da war sie sich sicher, schon bevor sie verschwand.
Zum einen fühlte sie sich mies. Angeschlagen wie kurz vor einer Grippe. Die U-Bahn schaukelte und klapperte in Richtung Downtown, und ihr Kopf fühlte sich an wie ein Akkordeon, das auseinandergezogen und wieder zusammengepreßt wurde. Außerdem war Rushhour. Montag morgen acht Uhr fünfundvierzig. Jeder Sitz in dem Zug war besetzt. Auch im Gang standen die Pendler dicht gedrängt und drückten sich platt gegen die Türen. Sie stand zwischen ihnen, ihre Handtasche unter den Arm geklemmt. Mit der freien Hand hielt sie eine Metallstange umklammert. Graue Schultern, schwarze Gesichter, Lippenstift-bemalte Münder bedrängten sie. Und diese Gerüche: beißendes Duftwasser, blumiges Parfüm, Schweiß, Schampoo und eklig süßliches Deodorant. Sie mischten sich in ihrer Nase. Verklebten ihr das Hirn. Der Zug schwankte. Fremde Körper rempelten sie an.
O Mann, dachte sie. Das wird die Hölle.
Der Zug hielt an der Prince Street. Die Türen glitten auf und gaben den Blick auf die vergilbten Wände des langen Bahnsteigs frei. Ein kurzes Handgemenge zwischen Wartenden und Fahrgästen war die Folge. Über den Lärm hinweg hörte sie von ferne eine Dixieland-Kapelle. Durch die Tür konnte sie sie auch kurz sehen. Ein Weißer blies mit geblähten Backen in eine Trompete.
Painted lips, painted eyes.
Wearin’ a bird of paradise ...
Das Lied kenne ich, dachte sie. Dad hat dieses Lied manchmal gesungen.
Einen Moment lang fiel ihr der Titel nicht ein.
Dann war es die Trompete, die die Erinnerung wiederbrachte:
»Nobody’s Sweetheart.«
It all seems wrong somehow,
Cause you’re nobody’s sweetheart now.
Die Türen glitten zu, und der Zug ruckelte weiter. Die Musik hatte sie traurig und nostalgisch gemacht: wie das kurze Aufblitzen eines Sonnenstrahls eine Gefangene in ihrer Zelle. Sie schloß die Augen, während der Zug schaukelte und die Menschen sich an sie drängten. O Gott, betete sie ohne große Hoffnung; o Gott, mach, daß es Wochenende ist. Ja? Ich werde einfach meine Augen öffnen und peng, ist es Samstag. Okay? Komm schon, du Spinner, du Gott, du. Laß die Woche einfach dahinsausen. Das kannst du doch. Du bist doch der große Macher. Fertig. Eins, zwei, drei. Peng.
Sie öffnete ihre Augen. Dieser Gott. Hatte einiges zu erklären, wenn man sie fragte.
Sie streckte die Zunge heraus und würgte, ein Geräusch, das im Gerappel des Zuges völlig unterging.
Sie lehnte sich gegen ihre Stange und dachte weiter ans Wochenende. Nur noch fünf Tage. Dann war Freitag abend. Sie würde mit Maura ins Village gehen. Sie würden sich verrucht anziehen. Alle beide. Irgendwas Enges, Schwarzes. In irgendeiner Bar sitzen, vielleicht im Lancer’s. Espresso trinken und so tun, als ob es ihnen schmecken würde. So tun, als hätten sie ihre Unschuld nicht gerade erst gestern verloren. So tun, als würden sie vielleicht ein paar Typen treffen. Oder vielleicht trafen sie ja wirklich welche. Man konnte nie wissen. Vielleicht setzte sich ein verwegener Village-Künstler auf den Barhocker neben sie, ein Dichter oder so. Ein Poet mit zottigem Haar, ausgezehrtem Gesicht und ausgeleiertem Pullover ...
»Canal Street!« sagte der Fahrer über Lautsprecher. »Türen schließen selbständig. Vorsicht bei der Abfahrt.«
Sie wurde von den Wellen der ein- und aussteigenden Pendler hin und her gerissen, faßte ihre Handtasche fester und umklammerte die Stange. Der Zug setzte sich spuckend wieder in Bewegung. Hinter den Fenstern flüsterten die schwarzen Tunnel. Sie starrte auf halber Distanz ins Leere. Sie begann, die Idee mit dem Dichter weiterzuspinnen. Sie konnte ihn förmlich vor sich sehen. Ein Grizzlybär von einem Kerl mit breiter Brust, der mehr tapste, als daß er ging, in kehligen Lauten sprach und ständig fluchte. Doch mit diesen warmen braunen Augen, die nur ihr galten – ein richtiger Knuddelbär, wenn er sie an den Schultern faßte, auf sie herabblickte. Man mußte ihn einfach lieben, trotz allem.
Sie starrte ins Leere, während die U-Bahn dahinraste. Brumm, dachte sie.
Spätnachts würde sie in dem kleinen Bett in seinem Dachstudio aufwachen. Sie würde ganz ruhig daliegen, nackt unter dem einzigen Laken. Oh, Mom würde schlicht ausflippen, wenn sie zu Hause nackt schlafen würde. Aber Mom – dieses gesetzte, kleine Pummelchen von einer Mom – war weit weg. Sie saß in dem verwohnten Gramercy-Park-Apartment, und ihr silberhaariger Dad hatte die Nachrichten auf dem Kabelkanal abgeschaltet, war aufgestanden, hatte sich gestreckt und gemeint: »Nun denn, es ist wohl zwecklos, noch länger zu warten, daß sie kommt.« Und dann würde er sein Bier mit ans Bett nehmen.
Aber ihr Dichter war immer noch wach. Saß in seiner mitternächtlichen Mansarde an seinem Schreibtisch. Während sie, nackt unter dem Laken, auf der Seite lag und so tat, als würde sie schlafen, beobachtete sie ihn heimlich. Er hockte mit fiebrig glänzenden Augen im Schein der Lampe über seine Kladde gebeugt, während sein Stift fieberhaft über das Papier huschte.
»Dies ist die Stunde der Schatten«, würde er schreiben.
Dies ist die Stunde der Schatten.
Wo träge Oktober-Fliegen
lebenstrunken auf Veranda-Stühlen
ins Scherbenlicht der Sonne blinzeln.
Wo Blau und immer tieferes Blau
ins Tageshell des Himmels bricht ...
Und sie würde unter dem dünnen, schmutzigen Laken warten und wachen, bis er schließlich müde wurde. Endlich legte er dann seinen Stift beiseite und stützte seinen Kopf in die Hände. Und sie würde sich rühren und ihm zuflüstern: »Komm jetzt ins Bett, Liebling.« Und sie würde das Laken zurückschlagen ... Oh, Mom würde definitiv ausrasten, wenn sie das sehen würde. Und selbst er – ihr Dichter – lachte darüber und erhob sich auf seine tapsige Art. »Als ich dich getroffen habe, da warst du so ein artiges, kleines, verklemmtes, irisch-katholisches Mädchen«, würde er sagen. »Was habe ich nur aus dir gemacht?« Und dann würde er auf sie zugetapst kommen, um es noch einmal mit ihr zu machen.
»City Hall!« verkündete der Fahrer.
Mit einem dämlichen Grinsen tauchte sie wieder auf. O Mist, dachte sie seufzend. Nancy Kincaids Romantische Phantasie Nummer 712. Der Zug hielt. Die Türen sprangen auf. Die Passagiere strömten auf den Bahnsteig, und sie ließ sich mitreißen.
Benommen und noch immer vage von ihrem Dichter träumend, schloß sie sich der Parade an. Der Rush-hour-Marsch der New Yorker. Graue Anzüge, adrette Kleidchen, Beine, die im Gleichschritt den Bahnsteig hinabmarschierten, die Betonstufen hinauf, Knie nach oben, durch die überwölbten Gänge unter dem Municipal Building. Ein untersetzter Zeitungsverkäufer beugte sich, Zeitungen schwenkend, in ihr Blickfeld.
»Mutter ißt Baby!« brüllte er. »Heute in der Post!«
Sie blinzelte, und ihr Tagtraum war wie weggeblasen. Vielen herzlichen Dank, dachte sie und wich der kreischenden Kröte aus, bahnte sich einen Weg zwischen den gedrungenen Säulen, bis sie ans Tageslicht vorstieß.
O ja, das tat gut. Frische Luft. Sie saugte sie gierig ein, während sie darauf wartete, daß die Ampel umsprang. Kühle, grüne Luft. Oktoberluft. Der Himmel über ihr war weit und blau. Wagen schossen an dem ausladenden Säulengang des imposanten Bauwerks vorbei. Hier und da erhoben sich marmorne Gerichtsgebäude über der Straße. Gegenüber leuchtete die City Hall weiß zwischen den roten Blättern der Eichen und den gelben Blättern der Ahornbäume im Park.
Die Ampel sprang um. Wagen hielten, drängten schnaubend auf Weiterfahrt. Sie hastete über die Straße auf die City Hall zu.
Sie nahm den Weg durch den Park, den schmuddeligen, alten Park. Betonpfade schlängelten sich durch vollgemüllte Rasenflächen. Obdachlose kauerten auf grünen Bänken. Männer in Anzügen eilten an ihr vorbei Richtung City Hall. Polizisten rannten die Treppen hinauf, unter den Reihen von Bogenfenstern, der abblätternden Kuppel und der Justitia-Statue mit ihrer Waage. Der Wind wehte, und von den Ahornbäumen regneten Blätter auf sie herab, raschelten und kräuselten sich auf den Wegen, sausten und tuschelten um ihre Füße wie kleine Disney-Eichhörnchen. Die frische Luft hatte ihren Kopf ein wenig klarer gemacht, doch erneut stieg diese nostalgische Wehmut in ihr auf.
When you can’t walk down the avenue,
I just can’t believe it’s you ...
Es war erst – was? – fünf Monate her, dachte sie. Vor fünf Monaten war sie noch auf dem College gewesen. Noch im Mai. Statt durch diesen Park war sie über den kleinen Campus auf der West Side geeilt. Sie konnte sich noch an das Gewicht ihrer Tasche über der Schulter erinnern, das Gefühl des Trikots unter ihrer Kleidung. Hatte sie wirklich geglaubt, eine Tänzerin zu werden? Die Tagträume – wie sie zum Vortanzen gehen und Rollen bekommen würde. »Du da. Das Mädchen mit den blauen Augen. Du hast die Rolle.« Das Gefühl kräftiger Hände, die sich im Scheinwerferkegel um ihre Hüften legten, bis alles im Rampenlicht verschwamm, während sie hochgehoben wurde. Das Geräusch von Applaus. Langanhaltender, stürmischer Applaus. Hatte sie je wirklich geglaubt, daß irgend etwas davon wahr werden könnte?
Nein. Wohl nicht. Sie war sich zumindest nicht mehr sicher. Sie konnte sich einfach nicht mehr erinnern.
It all seems wrong somehow,
Cause you’re nobody’s sweetheart now ...
Sie kam an der City Hall vorbei und erreichte, den Park verlassend, den Broadway. Das Bürogebäude lag direkt gegenüber. Ein schmaler, hoher Turm aus weißem Stein, verziert wie ein Altarbild. Filigraner Stuck rankte sich um die Bogenfenster. Geifernde Steinfratzen linsten über die hohen Vorsprünge und grinsten teuflisch.
Jedenfalls hatte sie bei der ersten sich bietenden Gelegenheit den Job bei Fernando Woodlawn angenommen. Sie war noch keine Woche aus dem College gewesen. Ihr Vater meinte, Woodlawn würde eine Assistentin brauchen, und sie hatte einem Vorstellungsgespräch ohne Zögern zugestimmt. Kein Vortanzen, nicht ein einziges. Nicht einmal Tanzkurse, die sie ursprünglich belegen wollte. Und was das »Du da. Das Mädchen mit den blauen Augen« anging, das konnte sie wohl getrost vergessen. Oh, natürlich warf sie nach wie vor einen Blick in die entsprechenden Zeitungen, sagte sich, daß sie nächste Woche, nächsten Monat mit ihren Kursen anfangen, daß sie bald – wirklich bald – zu Vortanzterminen gehen würde. Aber im Grunde wußte sie, daß sie das nicht tun würde. Im Grunde war sie die persönliche Assistentin eines Anwaltsfreundes ihres Vaters geworden, und damit hatte es sich schon so ziemlich. Himmel, dachte sie, als sie die Straße erreicht hatte, ich bin nicht einmal von zu Hause ausgezogen. Ihre Mutter hatte gesagt: »Du kannst so lange bei uns wohnen bleiben, bis du was anderes gefunden hast.« Und obwohl sie einmal an einem Sonntagnachmittag nach einer Wohnung gesucht hatte, hatte sie bald festgestellt, daß ihr dafür nicht genug Zeit blieb und daß sie natürlich auch ihr Geld sparen wollte und, nun ... da saß sie nun.
Nancy Kincaids grausame Selbsterkenntnis! Feigheit frisst Zukunft! Heute in der Post!
Sie betrat die Fahrbahn, stürzte sich in eine Lücke im Verkehr auf dem Broadway, rannte auf die gegenüberliegende Seite. Im Erdgeschoß des Bürogebäudes gab es einen kleinen Lebensmittelladen. Die Schaufenster waren für Halloween mit Kürbislaternen und Skelett-Mobiles dekoriert. Auf einer Seite verdunkelte eine riesige schwarze Fledermaus mit phosphoreszierenden Augen die Scheibe. Darin konnte sie ihr Spiegelbild sehen und blieb stehen, um ihre Erscheinung zu überprüfen.
Sie war eine kleine, schlanke Frau mit einer noch fast mädchenhaften Figur. Auch ihr Gesicht hatte noch sehr viel Mädchenhaftes. Es war ein rundes, offenes Gesicht, zu breit und zu flach, dachte sie. Mit einem zu ausgeprägten Kiefer, auch wenn das rotbraune Haar, das in Locken auf ihre Schultern fiel, den Effekt ein wenig abmilderte. Und ihre Augen – sie waren nicht nur von einem zarten Kobaltblau, sondern wirkten auch überaus offen und direkt. Ihre Freundin Maura sagte immer, mit ihren Augen würde sie intelligent und ehrlich wirken.
Die U-Bahnfahrt hatte sie reichlich ramponiert. Sie bürstete ihr zerzaustes Haar, glättete ihren Trenchcoat aus Kamelhaarimitat und rückte die grüne Baskenmütze auf ihrem Kopf zurecht. Intelligent und ehrlich, dachte sie. Nicht so gut wie, sagen wir, glühend und geheimnisvoll, aber es mußte doch ein paar Typen geben, die intelligent und ehrlich mochten. Irgendwo. Vielleicht.
Sie stieß einen Seufzer aus. Auf dem Weg ins Gebäude zückte sie ihren Taschenspiegel aus ihrer Handtasche und stieß gleichzeitig mit der Schulter die Tür auf. Während sie auf den Aufzug wartete, zog sie ihre Lippen nach und tupfte ein wenig verschmiertes Mascara ab.
Painted lips, painted eyes.
Wearin’ a bird of paradise.
Oh, it all seems wrong somehow ...
Die verschnörkelte Stahltür des alten Fahrstuhls öffnete sich, und sie betrat die kleine Kabine. Kurz bevor die Tür wieder zuglitt, nahm sie ihre Baskenmütze ab und stopfte sie in ihre Manteltasche. Wirkte geschäftsmäßiger. Weniger studentisch.
Sie fuhr in den elften Stock und betrat den Empfang der Kanzlei Woodlawn, Jesse und Goldstein mit seinen blaugrünen Sofas und dem Couchtisch mit diversen Ausgaben des Law Journals. Die Frau hinter dem Tresen blickte kaum auf, als sie mit Summer die niedrige Absperrung aus Holz öffnete.
Dahinter erstreckte sich ein breiter Flur mit Büros auf beiden Seiten. Metallschreibtische und dunkelbraune Drehstühle hinter Glaswänden und vor dunklen Holzvertäfelungen, alles begraben unter Bergen von Papier, Aktenordner und –mappen stapelten sich in jeder Ecke, offene Aktenschränke, windschiefe Bücherregale, alles in allem eine ziemlich schmuddelige Angelegenheit. Nancy wußte noch, wie entsetzt sie gewesen war, als sie es zum ersten Mal gesehen hatte. Wie konnten das die Büroräume des großen Fernando Woodlawn sein?
Seit sie ein Kind war, hatte sie von Woodlawn reden gehört. Jedes Mal wenn sein Name in der Zeitung auftauchte, hatte Dad ohne Ende von ihm geschwärmt. Ich wußte immer, daß er zu Höherem bestimmt war! War ein echter Erfolgsmensch! Ein wahrer juristischer Kopf!
Armer Dad, dachte sie. Eigentlich der reizendste, gütigste Mann auf Erden, aber als Jurist hatte er es nie weiter gebracht als bis zum Testamentsaufsetzer. Und als Politiker war er regelrecht stolz darauf, für seine geliebten Demokraten die Briefmarken zu lecken. Sein ganzer persönlicher Ruhm beschränkte sich auf die Tatsache, daß er an der Brooklyn Law School ein Kommilitone von Fernando gewesen war. »Hab mit dem Mann zwischen zwei Vorlesungen das eine oder andere Bierchen gestemmt.« Darauf war Dad bis heute stolz. Er verfolgte Fernandos großzügige Immobiliengeschäfte mit einem Gefühl persönlicher Befriedigung, seine Treffen mit dem Bürgermeister, seine Auseinandersetzungen mit dem Gouverneur. Sogar mit den Gefälligkeitsjobs, die Fernando ihm zugeschanzt hatte, wenn er sie brauchte, prahlte er noch herum. »Ich mußte nur sagen, ›ich bin in diesem Quartal ein wenig knapp, Fernando‹, und, bei Gott, binnen einer Woche hatte ich mehr Steuersachen auf dem Tisch, als ich wegschaffen konnte.«
Armer Dad.
Bald, dachte sie auf dem Weg zu ihrem Büro am Ende des leeren Flurs, bald würde Dad Anlaß zu noch größerem Stolz haben. Sie hatte es ihm bis jetzt nicht erzählen dürfen, aber es schien eine ausgemachte Sache zu sein, daß Fernando auf dem Weg in die Landeshauptstadt Albany war. Der amtierende Gouverneur hatte abgewirtschaftet, da war man sich weithin einig. In den Meinungsumfragen war er seit einem Jahr langsam, aber sicher in den Keller gerutscht, und die neuen Steuererhöhungen, die er brauchen würde, um seinen Etat auszugleichen, würden ihm den Rest geben. Wenn die Demokraten an der Macht bleiben wollten, mußte er im kommenden Jahr freiwillig abtreten, wollte er das Risiko einer demütigenden Niederlage auf seinem eigenen Nominierungsparteitag vermeiden. Das Feld war also offen – und wer lungerte am Starttor herum? Wenn er im Lauf der Woche die offizielle Zustimmung zu dem neuen Ashley-Towers-Projekt bekam, war Fernando in der Lage, genügend juristische Mandate an die diversen Parteiführer zu verteilen, um sich seine Nominierung schon vorweg praktisch zu sichern. Und da sich die Republikaner im Bundesstaat New York mehr oder weniger in einem Zustand der Auflösung befanden, wurde ein Gouverneur Fernando immer wahrscheinlicher.
Nancys Schädel pochte, als sie daran dachte. Diese Woche würde die Hölle werden, genau wie die letzte. Das ständig läutende Haustelefon, die geflüsterten Gespräche, die plötzlichen Ausbrüche, das Brüllen: »Ich will es! Sofort! Los! Los!« Sie hatte angefangen, in ständiger Panik vor dem nächsten scharfen Zischen aus ihrer Gegensprechanlage zu leben. »Nancy! Kommen Sie! Ich muß mit Ihnen sprechen!«
An Fernandos Wand hing ein Foto, das sie im Vorbeigehen durch die Glasscheibe sehen konnte. Eine Doppelseite aus einem Artikel, den das Downtowner-Magazin vor etwa vier Monaten gebracht hatte. Es war das erste Interview, in dem Fernando seine Absicht hatte durchblicken lassen, für den Posten des Gouverneurs zu kandidieren. »Den Ballon steigen lassen«, hatte er es genannt, und damit hatte der ganze Wahnsinn angefangen. Der Fotograf der Zeitschrift war ins Büro gekommen und den ganzen Tag hinter Fernando hergelaufen. Und Fernando hatte den Jungen nach Kräften hofiert. Schulterklopfen, flotte Sprüche; er hatte ihn und seine Freundin am Ende des Tages sogar zum Essen eingeladen. Das Ergebnis war dieses Foto, praktisch ein Wahlkampfplakat. Fernando beugte sich über seinen Schreibtisch, während sich hinter ihm das Panorama von Downtown Manhattan erstreckte. Er hatte die Hemdsärmel bis zu den Ellenbogen aufgekrempelt, seine Unterarme waren knochig, und die Adern traten hervor, während er sich in den Vordergrund schob. Seine ganze sehnige Gestalt wirkte angespannt, bereit, über den Schreibtisch in die Linse der Kamera zu springen. Und sein schmales Gesicht, die messerscharfen Züge glühten wie ein Laserstrahl vor Machtdurst und Siegesfreude. So sah er aus, der Gouverneur Fernando. Und der Anblick des Fotos ließ Nancys Magen im Vorbeigehen tatsächlich vor Angst und Nervosität rumoren.
Mit einem weiteren Seufzer – fast einem Stöhnen – wandte sie sich ihrem Büro zu. Ihr Metallschreibtisch war natürlich picobello aufgeräumt, die Tastatur ihres Computers parallel zur Schreibtischkante ausgerichtet. Sogar der Monitor neigte sich erwartungsvoll ihrem Stuhl entgegen.
Sie warf ihre Handtasche auf den Schreibtisch und trat direkt ans Fenster. Ihr war wieder schwindlig geworden, und sie sehnte sich nach ein wenig mehr von dieser frischen Luft. Sie packte den schwarzen Fensterrahmen am unteren Ende und schob ihn klappernd nach oben. Dann streckte sie ihren Kopf in den Geruch von modernden Blättern und Auspuffabgasen.
Aus dem elften Stock hörte sie die Autos unten auf der Warren Street leise hupen, und ihr war, als könne sie auch die synchronisierten Schritte auf dem Bürgersteig vernehmen, den Montagsmorgenmarsch zur Arbeit. Sie blickte nach links. Auf dem Mauervorsprung direkt neben ihr stand eine der steinernen Gestalten, ein clownesker Gnom aus weißem Stein mit spitzem Hut, den Blick über den Vorsprung auf die Straße gerichtet. Seine Züge waren zu einem unfreundlichen, wildäugigen Lachen erstarrt. Sie wandte sich ab und blickte nach rechts. Wenn sie den Hals reckte, konnte sie gerade noch den Broadway erkennen, die eng beieinanderstehenden Ahornbäume im Park, die weiße Kuppel der City Hall, Justitia, die ihre Waage über die gelben Blätter hielt.
Dankbar und mit aufgerissenen Augen sog sie die Luft ein, bevor sie sich erneut in die andere Richtung wandte.
Der steinerne Gnom hatte den Kopf gedreht und grinste sie jetzt direkt an, seine verzerrte Fratze keine zwanzig Zentimeter vor ihrem Gesicht.
»Yak!«
Sie zog den Kopf blitzschnell zurück und wich, die Hände auf die Brust gepreßt, vom Fenster zurück. Sie spürte, wie ihr Herz gegen ihre Finger pochte. Dann blieb sie stehen, schüttelte mit offenem Mund den Kopf und lachte.
»Oha«, sagte sie laut.
Was für eine sonderbare Erscheinung! Himmel noch mal! Sie legte ihre Hand auf die Stirn. Vielleicht bekam sie Fieber.
»Mann o Mann«, flüsterte sie.
Und dann ging sie schnurstracks wieder zum Fenster und steckte den Kopf erneut hinaus. Eine Sekunde lang hatte sie Angst, das Ding könne sie wirklich anstarren.
Oder auf sie zukriechen. Oooh, dachte sie.
Glücklicherweise ruhte die Gestalt wieder auf ihrem angestammten Platz und grinste auf die Straße hinab. Unbeweglich, wie man es von einem Stück Stein erwarten konnte. Sie lächelte ihr zu.
»Verzeihung. Kann ich Ihnen helfen?«
Die Stimme ertönte plötzlich hinter ihr, so daß sie zusammenzuckte und sich den Kopf am Fensterrahmen stieß.
»Aua. Verdammt«, sagte sie. Sie fuhr herum, während sie sich fest den Kopf rieb. In der Tür zu ihrem Büro stand eine Frau.
Es war eine Schwarze, schlank, mit großem Busen, in einem modischen roten Kleid, dessen Wirkung durch ihre dunkle Haut und den roten Lippenstift noch betont wurde. Eine Aktenmappe unter den Arm geklemmt, sah sie Nancy mit einem erwartungsvollen Lächeln an.
Einen Moment lang war Nancy jedoch noch vollauf damit beschäftigt, ihre Beule zu reiben. »Hallo«, sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen. »Junge, Junge, das hat echt weh getan.«
Die schwarze Frau verharrte regungslos, ihr Lächeln hing in der Luft. »Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?« fragte sie erneut.
»Äh ... nein«, erwiderte Nancy ein wenig verwirrt. »Ich glaube nicht.« Schließlich ließ sie den Arm sinken. »Warum fragen Sie?«
»Also, ich ... ich meine, warten Sie auf jemand?« fragte die schwarze Frau.
»Äh ... nein. Nein. Ich gehöre hierher. Sie sind wahrscheinlich neu hier. Dies ist mein Büro.«
Das quittierte die schwarze Frau mit einem ratlosen kleinen Lachen. »Also, das ist es, offen gesagt, nicht«, meinte sie. »Ich glaube, Sie irren sich.«
Nancy starrte sie leeren Blickes an.
When you walk down the avenue ...
Sie blinzelte. »Ähm ... Verzeihung? Tut mir leid? Was soll das heißen?«
»Das soll heißen, daß Sie wohl einem Irrtum unterliegen«, sagte die schwarze Frau. »Dies ist ganz bestimmt nicht Ihr Büro.«
Nancy ließ ihren Blick langsam durch den Raum wandern. Hatte sie die falsche Tür genommen? »Ich bin mir ... ziemlich sicher, dieses Zimmer zu kennen«, erklärte sie zögernd. »Das ist doch Nancy Kincaids Büro, oder nicht?«
I just cant believe it’s you ...
Die schwarze Frau starrte sie lange an. Ihr Blick wirkte düster, abgründig, leer.
Oh, it all seems wrong somehow ...
»Nun ... ja schon«, sagte sie nach einer Weile. »Ja, dies ist Nancy Kincaids Büro.« Und dann schüttelte sie den Kopf. Einmal. Ganz langsam.
»Aber Sie sind nicht Nancy Kincaid.«
Kapitel 2: Avis Best
Das Telefon klingelte. Das Baby fing an zu weinen. Der Scheißkerl begann, gegen die Tür zu hämmern.
Einen Moment lang wußte Avis nicht, wohin sie sich wenden sollte. Sie stand in der Mitte des kahlen weißen Wohnzimmers, eine kleine gelähmte Gestalt unter der nackten Glühbirne an der Decke. Die Hände hatte sie in die Luft gestreckt, die Finger gespreizt. Ihr niedliches blasses Gesicht wirkte wie eingefroren.
Das Telefon klingelte wieder und wieder. Das Baby brüllte weiter nach ihr. Der Scheißkerl pochte mit Macht gegen die Tür und fing jetzt auch noch zu schreien an.
»Avis! Avis, ich weiß, daß du da drinnen bist! Mach die verdammte Tür auf, Avis! Du bist immer noch meine beschissene Frau, Avis, also mach jetzt sofort die verdammte Tür auf!«
Avis fuhr sich mit der Hand ins Haar – kurze verwaschene blonde Locken. Sie blinzelte einmal hinter ihren großen, viereckigen Brillengläsern.
»Avis! Ich sag’s noch mal! Ich weiß, daß du da drinnen bist!« Das Baby weint, dachte sie. Kümmer dich um das Baby.
Sie konnte seine rhythmischen Schreie aus dem Schlafzimmer hören: »Aah! Aah! Aah!«
Mittendrin schrillte das Telefon in der Kochnische. Und rums! rums! rums! machte die Faust des Scheißkerls.
»Es ist auch mein Baby, Avis! Du kannst mir nicht den Zugang zu meinem eigenen verdammten Kind verwehren!«
Doch Avis stand einen weiteren Augenblick lang einfach nur fassungslos da. Es war alles zu schnell gegangen.
Vor nur dreißig Sekunden hatte sie noch still in dem leeren Zimmer gesessen. Hatte auf dem Klappstuhl vor dem Falttisch gehockt. Hatte die Hände auf der Tastatur ihrer tragbaren Olivetti liegen gehabt und auf das Blatt gestarrt, das sich von der Walze schälte. Es war die letzte Seite ihres Gutachtens über Thirty Below, einen hier in New York City spielenden Thriller. Von solchen Gutachten lebte sie. Sie las Romane und schrieb Inhaltszusammenfassungen. Dann gab sie ihre Meinung dazu ab, ob die Handlung der Romane einen guten Filmstoff hergeben würde. Diese Gutachten schickte sie an das Büro von Victory Pictures, damit die Victory-Manager so tun konnten, als hätten sie die Romane gelesen und sich eine Meinung darüber gebildet. Für jedes Gutachten bekam sie sechzig Dollar.
In diesem Gutachten, auf dieser Seite hatte sie gerade getippt:
»Dieser spannende Großstadt-Thriller – der streckenweise an Marathon Man erinnert – könnte einen guten Stoff für einen Dustin-Hoffman-Film abgeben.« Sie hatte auf dem Klappstuhl gesessen und auf den Satz gestarrt.
Dustin Hoffman, hatte sie gedacht. Ein guter Stoff für einen Dustin-Hoffman-Film. Ich weiß nicht, wovon ich die nächste Miete bezahlen soll, schreibe aber über gute Stoffe für Dustin Hoffman. Womit soll ich die Windeln für mein Baby bezahlen, Dustin Hoffman? Erklär mir das mal, du blöder, millionenschwerer Hund. Wahrscheinlich sitzt du gerade an irgendeinem Pool und nippst an deinem Champagner! Mein kleines Baby hat nichts anzuziehen, Mr. Dusty, Mr. Dustman, und wenn der Kleine in Flammen stehen würde, würdest du ihn wahrscheinlich NICHT MAL ANPISSEN, UM IHN ZU LÖSCHEN, UND mein Leben ist Scheisse. Du Filmstar-Arschloch! Was soll ich nur machen? '
Das hatte sie gedacht, und hinter ihren Brillengläsern war die Welt in Tränen verschwommen. Und sie hatte darüber nachgedacht, daß sie im nächsten Jahr in Kenyon Examen gemacht hätte, wenn sie den Scheißkerl nicht geheiratet hätte. Und dann wäre sie nach New York gegangen, als Produktionsdesignerin anstatt als Frau eines abgebrannten Schauspielers. Und sie hätte nie zugelassen, daß sie schwanger wurde, bevor ihr Mann auch nur eine einzige bezahlte Rolle bekam. Und sie hätte nie erfahren, was es für ein nettes Mädchen aus Cleveland, Ohio, heißt, zusammengerollt auf dem Küchenfußboden zu liegen und ihren Unterleib mit den Armen zu schützen, während ihr Mann immer wieder auf ihren Kopf einschlägt, weil alles ihre Schuld war, alles ihre Schuld, alles, alles ...
Ein guter Stoff für einen Dustin-Hoffman-Film, hatte sie gedacht. Was für eine gequirlte Scheiße.
Und dann hatte das Telefon angefangen zu klingeln. Das Baby war aufgewacht und hatte zu schreien begonnen, und der Scheißkerl hatte gegen die Tür gehämmert.
»Wenn ich reinkomme, Avis, wird es dir leid tun, hörst du mich? Wenn du nicht sofort die Tür aufmachst ...«
Endlich löste sich ihre Lähmung. Sie ging Richtung Schlafzimmer, um das Baby zu holen.
»Scher dich zum Teufel, Randall!« rief sie über die Schulter. »Ich laß dich hier nicht rein. Verpiß dich einfach!«
»Avis! Verdammt!« Er schlug hart gegen die Tür – dem Geräusch nach hatte er sie mit der Schulter gerammt. Das Kettenschloß gab klappernd ein wenig nach.
Das Telefon klingelte weiter.
»Aah! Aah! Aah!« kreischte das Baby.
»Ich komme, Liebes.« Avis stieß die Tür zu dem Durchgangszimmer auf und rannte ins Schlafzimmer.
Es war genau wie in The Wizard of Oz. Wenn sie aus dem Wohnzimmer ins Schlafzimmer ging, war es genau wie in der Szene aus The Wizard of Oz, wo Dorothy aus ihrem ganz in Grau gehaltenen Haus in Kansas in die farbige Welt des zauberhaften Wunderlandes tritt. Das Wohnzimmer war Kansas. Die abblätternden weißen Wände, der ausgebleichte Parkettfußboden; der Faktisch, der Klappstuhl, die nackte Glühbirne an der Decke. Das Schlafzimmer – das Kinderzimmer – war Oz oder das zauberhafte Wunderland oder was auch immer. Die reinste Orgie an Farben und Dekorationen, die Wände mit Mickeys, Goofys und Kermits tapeziert, der Fußboden mit Spielzeug und Kissen, Einhörnern und Regenbogen übersät. Und so viele baumelnde Mobiles – Elefanten-Mobiles, Lamm-Mobiles, Flugzeug-Mobiles –, daß Avis sie aus dem Weg schieben mußte, als sie zu dem Kinderbett vor dem hellen Fenster rannte.
Meine Wohnung, dachte sie panisch. Würde eine gute Kulisse für Judy Garland abgeben. Sie erreichte das Bettchen.
Dort stand das Baby schon und wartete auf sie, die Hände um die Oberkante des Gitters gekrallt. Es war ein kräftiger, zehn Monate alter Junge mit sandfarbenem Haar und blauen Augen. Er hatte seine selbstgenähte Decke zur Seite gestrampelt und sprang jetzt zwischen seinen bestickten Kissen auf und ab. Als er sie sah, hörte er sofort auf zu weinen. Sein verzerrtes Gesichtchen glättete sich und erstrahlte in einem breiten, noch fast zahnlosen Babylächeln.
»Dii-ii-ii«, sagte er.
»Oh!« hauchte Avis. »Da ist ja mein Baby! Will das Baby hallo sagen? Hallo, Baby!«
»Agga, agga, agga, agga«, sagte das Baby.
»Laß den Mist, Avis!« Sie konnte den Scheißkerl durch das andere Zimmer hindurch noch immer brüllen hören. »Du kannst mich nicht einfach aussperren! Das ist gegen das Gesetz!« Und – rums\ Es klang, als sei er diesmal mit dem ganzen Körper gegen die Tür gekracht.
Das Telefon klingelte beharrlich weiter.
»Agga, agga, agga, agga«, sagte das Baby.
»Oh, mein Baby.« Sie hob ihn aus dem Bettchen und drückte ihn an die Schulter.
»Ich tret die Scheißtür ein, Avis, das ist mein Ernst!«
Wieder krachte er mit Wut gegen das Holz. Das Telefon klingelte.
»O Gott«, flüsterte Avis.
Behutsam stützte sie den Kopf des Babys, während sie aus Oz zurück ins Wohnzimmer rannte. Sie blinzelte heftig, als die nackten Wände von Kansas vor ihren tränenden Augen verschwammen. Sie lief in die Küche, zum Telefon an der Wand.
»Avis!« Jetzt trommelte er mit den Fäusten gegen die Tür: bum- bum-bum-bum-bum-bum, ohne Pause. »A-vis!«
»Ich ruf die Polizei, Randall!« rief sie unter Tränen. »Das ist mein Ernst.«
»Mach doch!« Die Faust hämmerte weiter. »Die werden mir recht geben! Und das weißt du auch! Also mach schon!«
Das Baby an ihrer Schulter gab einen kleinen verschreckten Laut von sich. Im Laufen streichelte sie seinen Kopf. »Ist ja gut«, flüsterte sie atemlos.
»Avis!« Bum-bum-bum.
Das Telefon an der Wand klingelte wieder, als sie es erreichte. Sie riß den Hörer von der Gabel und preßte ihn ans Ohr.
Erst hörte sie nichts. Dann ein Freizeichen. Der Anrufer hatte schließlich aufgelegt.
»O Scheiße!«
Sie knallte den Hörer wieder auf die Gabel. Der Scheißkerl warf sich so heftig, so laut gegen die Tür, daß sie herumfuhr. Und noch einmal. Die Füllung schien sich nach innen zu wölben. Sie wich bis zur Wand zurück und starrte zur Tür. Wo, verdammt noch mal, war Dustin Hoffman jetzt?
»Hörst du mich, Avis?«
Das Baby begann ängstlich zu wimmern.
»Schsch«, sagte sie und streichelte es. Dann hielt sie den Atem an. Ihr war, als hätte sie das Geräusch von berstendem Holz gehört.
»Avis, verdammt noch mal!«
»Also gut!« schrie sie. Und das Baby fing wieder an zu weinen. Sie streichelte es und rannte im Zimmer auf und ab. »Also gut, jetzt reicht’s!« schrie sie.
Der Scheißkerl trommelte wie wild. Die Tür knackte und bog sich in ihrem Rahmen.
»Avis!«
»Es reicht!« brüllte sie. »Hör sofort auf, oder ich schwöre bei Gott, daß ich es tue! Ich rufe Perkins!«
Das Gehämmer hörte schlagartig auf. Das Gebrüll erstarb. Der Raum versank bis auf die zögerlichen Schreie des Babys in tiefes Schweigen. Avis drückte den Jungen an ihre Schulter, wiegte ihn auf und ab. »Ist ja gut. Schsch.« Sie schniefte, wischte sich mit der Hand die Nase und sagte etwas lauter: »Hast du mich gehört, Randall?«
Das Schweigen dauerte noch einen Moment. »Verdammt, Avis«, sagte er dann. Aber er brüllte nicht mehr. Er sagte es leise. »Verdammt.«
»Das ist mein Ernst«, sagte Avis und lief mit dem Baby auf und ab. »Ich meine es wirklich ernst. Ich werde ihn auf der Stelle anrufen.«
»Verdammt«, kam die Stimme – die plötzlich kleinlaute Stimme – von hinter der Tür. »Hör zu ...« Und dann: »Verdammt ... verdammt noch mal, Avis, warum mußt du jetzt wieder mit so einer Scheiße kommen?«
»Ich meine es ernst«, rief Avis zurück. »Ich hab den Hörer schon in der Hand. Mach, daß du wegkommst, Randall. Ich hab den Hörer schon in der Hand.«
»A-vis«, jammerte der Scheißkerl. »Komm schon. Laß doch den Mist. Wirklich.«
»Ich wähle seine Nummer. Ich wähle jetzt die Nummer von Perkins.«
Das Baby hatte den Kopf von ihrer Schulter gehoben und sah sich mit großen Augen interessiert um. »Pah?« fragte es leise. Das Baby mochte Perkins.
»Hör mal, Avis, können wir nicht einfach nur reden?« sagte Randall durch die Tür.
Sie biß die Zähne zusammen. Sie haßte das, die Art, wie er jetzt klang, die Demütigung in seiner Stimme. Sie wollte, daß es aufhörte. Sie wollte ihm einen Rest von Stolz lassen. Vielleicht konnte sie ihn tatsächlich hereinlassen, dachte sie. Selbst wenn er ein Scheißkerl war. Vielleicht könnten sie einfach reden, vielleicht auch bloß bei vorgelegter Kette durch die Tür. Nur eine Minute. Sie schloß die Augen und holte tief Luft. Sie zwang sich, die Sache durchzuziehen. »Das Telefon klingelt, Randall«, rief sie.
»Scheiße«, sagte er leise durch die Tür. Aber er machte noch einen Versuch. »Weißt du, Avis, ich rufe sofort meinen Anwalt an, noch heute, gleich wenn ich nach Hause komme.«
Sie preßte, vom Mitleid fast überwältigt, die Lippen aufeinander. Sie wußte, daß Randall keinen Anwalt hatte. Sie wußte, daß das ein Spruch war, den er jedes Mal brachte, wenn er sich hilflos und schwach fühlte. Die Tränen, die sich hinter ihren Brillengläsern angesammelt hatten, rannen jetzt in kleinen Bächen über ihre Wangen. Und trotzdem zwang sie sich weiterzumachen. »Es klingelt, Randall. Es klingelt in diesem ... Hallo! Perkins! High, ich bin’s, Avis.«
»Schon gut, schon gut«, sagte Randall rasch. Sie konnte hören, wie er sich von der Tür entfernte und seine Stimme schwächer wurde. »Schon gut, aber es ist mein Ernst, Avis. Du wirst in dieser Sache von meinem Anwalt hören. Das kannst du nicht machen. Ich habe Rechte. Ich habe auch Rechte, verstehst du.«
Doch dann hörte man seine Schritte auf der Treppe. Hörte ihn hastig die Stufen hinabstolpern, beinahe rennen. Sie stellte sich vor, wie er einen panischen Blick über seine Schulter warf, als er an Perkins Tür einen Stock tiefer vorbeihuschte.
»Pah?« sagte das Baby und sah sich mit großen Augen um.
Avis hielt es mit ausgestreckten Armen so, daß sie ihm ins Gesicht blicken konnte. Es starrte sie verwundert an.
»Pah!« sagte sie und blies ihm ins Gesicht.
Das fand das Baby urkomisch und lachte mit strampelnden Beinen laut los.
Direkt neben ihnen schrillte das Telefon. Avis fuhr zusammen. Auch das fand das Baby zum Totlachen. Das Telefon klingelte erneut. Avis atmete aus und schüttelte den Kopf. Das Baby lachte noch immer.
»Ah-ha-ha!«
»Sehr witzig«, meinte Avis.
Beim dritten Klingeln nahm sie ab. Sie klemmte den Hörer zwischen Kinn und Schulter. Hielt das Baby in die Luft und zog zwischen ihren Tränen eine Grimasse. Das Baby zappelte fröhlich.
»Hallo«, sagte sie schniefend.
»Oh, Avis«, erwiderte die Stimme am anderen Ende, die zitternde Stimme einer alten Frau. »Oh, Avis. Dem Himmel sei Dank, daß ich dich endlich erreiche. Hier ist Ollies Nana, Liebes. Ich brauche ihn. Ich bin verzweifelt. Es ist etwas Schreckliches passiert.«
Kapitel 3: Nancy Kincaid
»Was soll das heißen?« fragte sie. Sie lachte. »Was meinen Sie damit – ich bin nicht Nancy Kincaid? Wer bin ich denn dann? Soll ich vielleicht raten?«
Aber die schwarze Frau in der Tür lachte nicht. Sie lächelte nicht einmal mehr. Sie stand einfach nur da, selbstsicher und schick, die Aktenmappe unter dem Arm, die Hüfte unter ihrem roten Kleid ein wenig vorgestreckt. Ihr Blick war leer und noch immer unergründlich. Nancy (denn sie war sich sicher, daß sie tatsächlich Nancy war) ertappte sich dabei, wie sie ihr Gewicht nervös von einem Fuß auf den anderen verlagerte und sich mit der Hand durchs Haar fuhr.
»Also«, sagte sie, »jetzt mal ganz ernsthaft. Wo liegt das Problem?«
Die schwarze Frau hob eine Hand. Es war eine reife, professionell wirkende Geste. »Hören Sie«, sagte sie. »Sie können hier nicht bleiben ohne Erlaubnis. Klar? Mehr weiß ich auch nicht. Wenn Sie draußen beim Empfang warten wollen, können Sie die Sache vielleicht mit Nancy besprechen, wenn sie kommt, ansonsten –«
»Aber ich bin Nancy. Dies ist mein Büro. Himmel noch mal, ich werd doch noch wissen, wer ich bin.«
»Tja – tut mir leid. Aber wer immer Sie sein mögen, Sie können hier nicht bleiben.« Die schwarze Frau blieb unnachgiebig. Ihr Blick blieb unnachgiebig. »Sie müssen ins Wartezimmer gehen. Bitte.«
»Ich faß es nicht.« Mit offenem Mund sah sich Nancy nach Unterstützung um. Durch die gläsernen Trennwände konnte sie die Reihe Büros überblicken. Sie sah eine ältere Frau, die ihren Mantel an einen Kleiderständer hängte. Ein Mann mit aufgerollten Hemdsärmeln setzte sich an seinen Schreibtisch und öffnete seinen Aktenkoffer. Die Menschen schickten sich an, ihrer Arbeit nachzugehen. Nur sie als einziges von Gottes Kindern wurde von dieser verteufelten Zimtzicke von Sekretärin verfolgt. Sie drehte sich wieder zu der schwarzen Frau um. »Ich glaube nicht, daß ich Sie kenne. Arbeiten Sie hier?«
»Miss, dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Wenn Sie bitte –«
»Arbeiten Sie hier?« fragte Nancy. »Ich meine, das ist doch völlig lächerlich. Warum belästigen Sie mich?«
»Albert.« Die Frau hatte sich umgedreht und den Namen in den Flur gerufen. Nancy blickte nach links und sah, wie der Mann mit den Hemdsärmeln den Kopf hob. Es war ein junger Mann mit adretten braunen Haaren. Er trug ein blaugestreiftes Hemd, eine rote Krawatte und lustige rote Hosenträger.
»Hast du mich gerufen, Martha, mein Schatz?« sagte er.
»Albert, kannst du bitte mal kurz kommen?«
Herrgott. Diese Frau gibt einfach nicht auf dachte Nancy, mußte jedoch gleichzeitig ärgerlich feststellen, daß sich ihr Magen angstvoll zusammenkrampfte. Als ob sie eine Schülerin wäre, die ins Zimmer des Rektors zitiert worden war. »Hören Sie, kann ich jetzt vielleicht bitte einfach mit meiner Arbeit anfangen?« sagte sie leicht verzweifelt. »Ich meine, das ist doch lachhaft. Ich hätte mein Büro gern für m –«
»Albert.« Der junge Mann stand jetzt neben der schwarzen Frau in der Tür. Die schwarze Frau – Martha – zeigte mit einem roten Fingernagel auf Nancy.
»Ja, bezauberndste aller Kolleginnen«, flötete Albert.
»Diese Frau ist unbefugt hier eingedrungen.« »Schockierend!«
»Sie behauptet, sie wäre Nancy.«
»Was?« Zu Nancys Entsetzen sah dieser Albert sie jetzt an und stieß ein überraschtes kleines Lachen aus. »Sie behauptet, sie wäre Nancy?«
»Nancy Kincaid?« sagte Nancy und spürte, wie sie rot wurde. »Persönliche Assistentin von Fernando Woodlawn? Himmel noch mal, ihr zwei! Ich weiß zwar nicht, was hier los ist, aber ...« Als sie bemerkte, wie Martha und Albert sie anstarrten, hielt sie inne. Hinter ihnen waren zwei weitere Personen aufgetaucht. Eine große Frau mit gefärbtem Haar. Und ein teigiger Kloß von einem Mann in einem grauen Anzug. Sie standen auf Zehenspitzen und linsten über Marthas und Alberts Schultern hinweg. Nancy blickte von einem zum anderen, von einem Starren zum nächsten. Ihr Satz war unvollendet geblieben, ihr Mund stand immer noch offen, und dann begriff sie endlich, was los war. »Oh. Oh, sehr witzig. Wirklich sehr witzig, Leute.« Ihre Wangen glühten jetzt dunkelrot, ja, sie hatte das Gefühl, am ganzen Körper zu erröten, und sie dachte: Der Mistkerl! »Also gut«, sagte sie. »Wo ist er? Wo ist Fernando? Was soll das Ganze, ist es eine Art Scherz, den ihr jedes Jahr zu Halloween macht? Feuertaufe für die Neue oder so? Versteckt er sich unter dem Schreibtisch und nimmt alles auf oder was? Kommt schon. Ihr habt mich reingelegt. Ich fühle mich gedemütigt, hurra. Aber jetzt reicht’s.«
Sie versuchte krampfhaft, Haltung zu bewahren, nicht zu zeigen, wie peinlich und ärgerlich ihr die Szene war. Aber das war etwas, was sie an ihrem stets liebenswerten Boß wirklich nervte: sein Humor, der wirklich pubertär war. Für ihn war die Tatsache, daß sie ein überbehütetes katholisches Mädchen war, der weltbeste Witz schlechthin. Es war aber auch zu komisch. Fast täglich suchte er einen Anlaß, in ihrer Gegenwart irgendeine Körperfunktion oder so zu erwähnen. Als ob sie noch nie davon gehört hätte. Dann brüllte er regelmäßig los: »Sieh an. Die katholische Schule wird rot.« Und dann wurde sie natürlich rot. Und dann wurde von ihr erwartet, daß sie lachte und die Augen verdrehte, um zu demonstrieren, daß sie einen Spaß vertragen konnte.
»Ihr hattet euren Spaß«, sagte sie jetzt, bemüht, ihre Stimme unter Kontrolle zu kriegen. Ihr wurde von Sekunde zu Sekunde heißer, sie fühlte sich zunehmend lächerlicher und gereizt. »Ihr könnt alle zu Fernando rennen und ihm erzählen, daß ich rot geworden bin und dumm aus der Wäsche geguckt habe, okay? Und jetzt habe ich jede Menge Arbeit zu erledigen, wenn ihr also nichts dagegen habt ...«
Aber die Leute in der Tür sagten nichts. Alle vier erwiderten ihren Ausbruch stumm, antwortete allein mit diesen Blicken. Leeren und unergründlichen Blicken, starr wie von Wachspuppen. Nancy spürte, wie sie sich weiter verkrampfte. Sie spürte, wie sich ihr ganzer Körper vor schierer Frustration verspannte. Vor Frustration – und etwas anderem. Wieder diese nagende Angst, dieser kalte Klumpen in ihrem Bauch.
It all seems wrong somehow ...
Sie schluckte. Sie stemmte die Hände in die Hüften. Sie spürte, wie die Stille sich zog. Die leisen Straßengeräusche, die durch das offene Fenster in ihrem Rücken von der Warren Street heraufkamen, drangen in ihr Bewußtsein. Sie wußte, daß sie einfach nur dastand und ihren vier Widersachern das Kinn entgegenreckte. Sie wußte nicht, was sie sonst noch hätte sagen sollen.
»Was ist denn hier los?«
Die Stimme durchbrach den Moment. Es war eine laute Stimme, tief und voller Autorität. Die Menschenansammlung in der Tür löste sich langsam auf. Ein Neuankömmling bahnte sich zwischen Martha und Albert einen Weg in das Zimmer.
Bei seinem Anblick rief Nancy: »Oh!« Sie verspürte eine warme Woge der Erleichterung. »Henry! Gott sei Dank!«
Henry Goldstein, der Junior-Partner der Kanzlei, stand jetzt auf der Schwelle des Büros. Er war ein kleiner, aber breitschultriger Mann in einem grauen Anzug, der seinen kräftigen Körper betonte. Er hatte volles silbernes Haar und ein feingeschnittenes Gesicht, das zu seiner Stimme paßte: Er strahlte Autorität aus. Er blickte sich um und erwartete eine Erklärung. Schließlich sah er Nancy an.
»Hör zu, Henry«, platzte sie los, »würdest du bitte die Fernando-Brigade hier dazu bewegen, ihren urkomischen Sketch etwas abzukürzen, damit ich mit meiner Arbeit anfangen kann? Wir haben später ein Treffen mit Vertretern der Stadt, und Fernando bringt mich um, wenn ich ihm nicht bis Mittag die Unterlagen vorbereitet habe.«
Sie nahm sich zusammen, um nicht einfach weiterzuplappern, sondern wartete. Henry Goldstein runzelte die Brauen und neigte den Kopf. »Verzeihung?« sagte er. Unsicher sah er sich zu Martha um.
»Sie behauptet schon die ganze Zeit, sie wäre Nancy Kincaid«, erklärte die schwarze Frau schulterzuckend. »Sie ist hier unbefugt eingedrungen und sagt jetzt, sie wäre Nancy Kincaid und dies hier wäre ihr Büro. Sie weigert sich, den Raum zu verlassen.«
Langsam senkte Goldstein sein stolzes Kinn, so als wolle er sagen: Ah, ich verstehe, jetzt verstehe ich alles. Er wandte sich wieder an Nancy. Sie hielt den Atem an, als sie die Vorsicht, die Sorge bemerkte, mit denen seine haselnußbraunen Augen sie jetzt musterten.
»Henry …?« setzte sie an.
»Ganz ruhig, Miss«, erwiderte Goldstein und streckte seine Hand aus.
Er will mich beruhigen! dachte sie. Er versucht, mich zu beruhigen.
»Niemand will Ihnen weh tun«, fuhr er fort.
Nancys Mund klappte auf. Sie wich vor ihm zurück. Vor allen von ihnen. Und alle starrten sie weiter nur an. Martha mit ihren leeren braunen Augen. Der junge Albert mit seinem wachen Gesicht. Die Frau mit den gefärbten Haaren und der kugelrunde Mann – ihre neugierigen Blicke ruhten auf ihr wie Scheinwerfer.
Was, zum Teufel, geht hier vor?
Sie machte einen weiteren Schritt zurück und spürte die kühle Luft von dem offenen Fenster um ihre Waden streichen.
»Niemand will Ihnen weh tun«, wiederholte Goldstein. »Wir möchten nur, daß Sie sich nach draußen zum Empfang begeben. Dort können wir über alles reden. Okay?«
Nancy schüttelte den Kopf. »Ich ... ich ... ich verstehe nicht. Ich meine ...« Diese Benommenheit – dieser fiebrige Dunst, der sie den ganzen Morgen begleitet hatte, stieg erneut in ihr auf. Sie hatte das Gefühl, ihr Kopf würde platzen. Sie blinzelte, als sich ihre Gedanken zu trüben begannen. »Ich ... ich meine ... Kennen Sie mich nicht? Wissen Sie, ähm, wissen Sie nicht, wer ich bin?«
Der untersetzte kleine Goldstein machte einen kleinen Schritt auf sie zu. Dabei hielt er weiter die Hand vor den Körper, jetzt wohl auch zur Abwehr. »Das können wir alles draußen besprechen, Miss. Direkt draußen im Wartezimmer. Okay? Wir reden alle gemeinsam darüber und klären die Sache zusammen auf. Niemand will Ihnen weh tun.«
Nancy fuhr sich mit der Hand über die Stirn, als wolle sie Klarheit in ihrem Kopf schaffen.
»Wir sind alle Ihre Freunde«, sagte Goldstein.
Also, dachte sie panisch, das ist wirklich sehr beruhigend.
Jetzt trat auch Albert vor. Er machte einen langen, energischen Schritt um den Metalltisch herum. »Passen Sie auf, hinter sich«, sagte er. »Kommen Sie nicht zu nah ans Fenster.«
»Hören Sie ... hören Sie, ich bin ein wenig durcheinander, ich ... ich weiß nicht, was los ist ... Ich kam hierher, weil ich ... ich meine ...« Sie schüttelte den Kopf. Nebel breitete sich darin aus. Sie konnte nichts dagegen tun. Ich rede wirr, dachte sie. Hör auf zu faseln. »Hören Sie, ich bin nur, ich fühle mich heute irgendwie nicht ganz wohl ... Wenn Sie einfach ...« Sie brachte den Satz nicht zu Ende.
»Niemand will Ihnen weh tun«, sagte Goldstein und kam unauffällig näher. »Wir bringen Sie nur nach draußen.«
»Hören Sie, wenn Sie einfach ... ich meine, ich bin Nancy Kincaid!« sagte sie matt.
Irgendwie war jemand neben sie getreten. Sie hörte seine Stimme, eine neue Stimme, eine weiche, warme Stimme direkt neben sich. »Hey«, sagte er, »das ist doch lächerlich. Warum erschießt du ihn nicht einfach?«
Entsetzt fuhr sie herum, um ihn anzusehen. »Was soll das heißen, ihn erschießen? Ich werde ihn nicht erschießen, wie könnte ich ...?«
Sie hielt inne. Da war niemand. Kein Mensch stand dort. Nur der Aktenschrank in der Ecke. Das offene Fenster. Der Vorsprung über der Warren Street. Das leise Plätschern des Verkehrs. Das leise Rascheln der herabfallenden Blätter aus dem Park am Broadway. Und kein Mensch ...
Nancy blieb wie angewurzelt stehen. Sehr lange stand sie einfach nur da: halb abgewendet, mit offenem Mund. Sie starrte den Aktenschrank an und das Fenster. Ihre Augen schossen hin und her, dann zur Wand und auf den Boden, auf der verzweifelten Suche nach jemandem, irgendjemandem, irgend etwas, das zu ihr gesprochen haben könnte.
Eine Stimmet Der Gedanke blinkte in ihrem Kopf auf wie eine Neonreklame, während sie weiter vor sich hin stierte. Eine Stimme, die mir sagt, ich soll ihn erschießend Habe ich das wirklich gehört? O Scheiße, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
»Martha«, sagte Goldstein. Sie hörte, wie er langsam und befehlsgewohnt mit der Sekretärin sprach. »Martha, ich möchte, daß Sie die Polizei rufen. Aus meinem Büro. Sofort. Gleich jetzt.«
»In Ordnung.«
Langsam – und noch immer mit aufgerissenen Augen vor sich hinstarrend – drehte sich Nancy (denn sie war doch Nancy, verdammt noch mal. Oder etwa nicht?) wieder zu ihnen um. Tastete sich an der Kante ihres wohlaufgeräumten Schreibtisches entlang. Albert kam von der anderen Seite zentimeterweise auf sie zu. Inzwischen standen noch mehr Menschen auf der Schwelle ihres Büros und einige auch im Flur, ein regelrechtes Publikum hatte sich versammelt. Und dort war auch Martha in ihrem roten Kleid. Sie drehte sich gerade um, um sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. Riß ihren ängstlichen Blick von Nancy los, um sich einen Weg zu dem Telefon in Goldsteins Büro zu bahnen. Um die Polizei anzurufen.
»Das – das wird nicht nötig sein«, hörte Nancy sich flüstern. Sie brachte die Worte kaum an dem Knoten vorbei, der in ihrem Hals saß. Ihr Kopf begann erneut zu pochen. All ihre Gedanken schienen sich in einem dichten Nebel aufgelöst zu haben, der über ihrem Kopf hing, über allem. Sie schluckte hart, aber ihre Kehle war trocken. Ihre Lippen waren trocken und rissig. »Das ist nicht nötig«, sagte sie etwas lauter.
Martha blieb stehen und warf einen fragenden Blick zu Mr. Goldstein.
»Ich werde ... ich werde einfach gehen«, sagte Nancy hastig. Sie mußte hier raus. Mußte an die frische Luft, um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können. Was zum Teufel ... Was zum Teufel ...? »Ich werde einfach ... einfach gehen, okay? Lassen Sie mich einfach gehen.« Ihn erschießen?
Goldstein streckte die Hand nach ihr aus. »Sind Sie sich sicher, daß wir nicht doch jemanden für Sie anrufen sollen? Ich glaube, Sie könnten Hilfe gebrauchen, Miss.«
Ihn erschießen? »Nein, nein, mir geht’s ...« Sie biß sich auf die Lippe, kämpfte mit den Tränen. »Mir geht’s gut«, sagte sie. Sie konnte ihn nicht anschauen. Sie starrte auf die Schreibtischplatte vor sich. Sie konnte keinen von ihnen anschauen, keinen der Blicke erwidern. »Ich fühle mich nur im Moment ein wenig unwohl, es ... es tut mir leid. Ich ... ich fühle mich nicht wohl.«
Alle starrten sie an. Sie wußte, daß sie sie alle anstarrten, und sie fühlte sich nackt. Mein Gott! dachte sie. Mein Gott, ich meine ... Ich meine: Gott im Himmel! Sie griff hektisch nach ihrer Tasche auf dem Schreibtisch und preßte sie wie zum Schutz gegen ihre Brust. »Ich fühle mich nur nicht besonders«, sagte sie. »Ich werde einfach gehen. Das ist alles. Bitte.«
Sie trippelte eilig los. Die Menge teilte sich für sie. Ja, sie sprangen regelrecht zur Seite, um ihr Platz zu machen. Sie konnten gar nicht schnell genug aus dem Weg kommen. Sie eilte durch sie hindurch. Vage bemerkte sie, daß Goldstein ihr folgte. Daß er und Albert sich links und rechts an ihre Fersen geheftet hatten und ihr Geleitschutz gaben, als sie aus dem Büro stürmte. Sie eskortierten sie den Flur entlang. Vorbei an den schmuddeligen Büros hinter den Glaswänden. Vorbei an dem Foto von Fernando vor dem Panorama der Stadt. Wieder hinaus durch das niedrige Gatter und den Empfangsbereich. Und alle waren sie hinter ihr, alle starrten sie an, beobachteten ihren Abgang.
Was ...? dachte sie immer wieder, als sie dem Fahrstuhl zustrebte, als sie vor der Tür stand, die Tasche umklammert, den Kopf gesenkt wie ein Bittsteller mit dem Hut in der Hand. Der Aufzug brauchte unerträglich lange, und als er endlich kam, dachte sie, was ...? Was ist das? Was ist hier los?
Als die Türen schließlich aufglitten, stürmte Nancy in die Kabine. Sie fuhr herum und drückte sich mit dem Rücken gegen die Stahlwand. Sie waren noch immer da, direkt jenseits der Fahrstuhltür. Sie standen alle im Empfang versammelt und weiter bis hinter das niedrige Gatter. Goldstein und Albert und Martha in ihrem roten Kleid. Alle starrten sie an, wie sie verschüchtert in ihrer Zelle hockte. Fixierten sie mit ihren leeren Wachsfigurenblicken. Und sie umklammerte ihre Handtasche und betete, daß die Tür zugehen möge.
Und dann ging die Tür zu. Mit einem lauten Klacken. Nancys Knie wurden weich, und sie sackte zusammen und streckte die Zunge heraus, während sich ihr der Magen umdrehte. Sie sank halb zu Boden und blieb zusammengekauert liegen, das Gesicht verzerrt, die Zähne aufeinandergebissen, die Augen voller Tränen.
Der Lift setzte sich Richtung Erdgeschoß in Bewegung. »Was?« flüsterte sie.
Dann hustete sie einmal kurz und fing an zu weinen.
Kapitel 4: Oliver Perkins
Perkins taumelte zur Toilette. Er griff nach der Lampenschnur neben ihm und riß daran. Die Badezimmerbirne, die kahl von der Decke herunterbaumelte, ging an. Perkins stand nackt über der Toilettenschüssel und blinzelte verschlafen auf seinen Penis, während er aufs Pissen wartete.
Der Grund der Schüssel war mit einer braunen Kruste bedeckt, die das Wasser verdunkelte, so daß er sein Gesicht darin sehen konnte. Die Strahlen der Glühbirne umgaben seine Silhouette wie ein goldener Heiligenschein. Der Lichtkranz um seine zerzausten Haare verlieh seinem Spiegelbild etwas Christusähnliches.
Sieh nur, Ma, dachte Perkins, ich bin ein Halbgott.
Dann konnte er die Pisse nicht mehr halten. Sie platschte in das Toilettenwasser, und sein Spiegelbild verschwand.
Perkins stieß eine Art Schnauben aus, während es aus ihm herausströmte. Er verzog einen Mundwinkel zu einem Lächeln. Selbst durch den Dunst seines Katers hindurch erkannte er das Gedicht, das darin lag: das widergespiegelte Christus-Ich ins Vergessen gepißt. Obwohl sich sein Verstand in groben Sand aufgelöst zu haben schien, wußte er, daß es ein gutes Gedicht war. Er spürte es in sich aufsteigen, als er in die Schüssel starrte. Zunächst war es nur ein wortloser Rhythmus. Noch kein Gedicht, nur der Klang, der Beat eines Gedichts. Er spürte, wie weiß und rein es war. Wie es sich in ihm ausbreitete, Flügeln gleich, um sich aus ihm zu erheben. Er spürte, wie die Worte an Bord kletterten, die Rhythmen zu Silben wurden. Da ..., dachte er. Da ...
Aber das Gedicht war schon wieder in sich zusammengesunken. Löste sich auf. Die Flügel zerfielen zu Staub. Das feste Weiß schmolz dahin.
Und auch der Strom seiner Pisse versiegte, tröpfelte geräuschvoll im Wasser aus. Perkins versuchte, sein Gedicht festzuhalten, aber es nützte nichts. Es stürzte ab. Fiel von der Kante seines Körpers ins Nichts. Ganz plötzlich war es verschwunden. Er war leer. Er sprühte ein paar letzte Spritzer in die Schüssel.
Nun denn, dachte er beiläufig. Keine guten Gedichte mehr für dich, mein Junge.
Doch in Wahrheit fühlte er sich schwarz und einsam, wie er so nackt dastand auf den moosigen Badezimmerfliesen, sein Gedicht verloren. Er empfand eine riesige, sehnsuchtsvolle allumfassende Einsamkeit. Als ob er im Tal eines Canons stünde und zwischen den Felsen nach einer anderen Menschenseele suchte.
Er nahm seinen Schwanz in die Hand und schüttelte den letzten Tropfen ab. Gleichzeitig ließ er ein paar der Katerblähungen entweichen, die auf seinen Magen drückten.
Seit fast zwei Jahren hatte es jetzt keine guten Gedichte mehr gegeben, dachte er. In diesem Monat waren es zwei ganze Jahre. Er hatte nichts geschrieben, was einer Veröffentlichung wert gewesen wäre, seit dem Haus am Fluß. Seit Julia und den Oktoberabenden.
Er bückte sich, um die Spülung der Toilette zu betätigen. Das Wasser floß rauschend ab, doch der braune Dreck blieb. Es gab noch immer Tage, an denen er es irgendwie romantisch fand, ein verwahrloster Greenwich-Village-Poet zu sein. Dann gab es Tage wie diesen: wo er glaubte, kotzen zu müssen, bis ihm das Blut aus den Ohren quoll. Er zerrte an der Schnur, um die Badezimmerlampe auszumachen, und tapste, nachdem er ein letztes Tröpfchen aus seinem Schwanz gewrungen hatte, zurück in das andere Zimmer.
Avis Best war da. Sie kam, ihr Baby unter dem Arm, gerade durch das Fenster geklettert. Perkins winkte ihr mit halb geschlossenen Augen müde zu. Er stolperte zu der Matratze auf dem Boden und ließ sich stöhnend fallen.
Inzwischen stand Avis neben dem Fenster. Sie starrte mit offenem Mund ins Zimmer. Hinter ihr konnte man durch das Geländer der Feuertreppe einen Streifen blauen Himmel sehen. Sie trug das Baby auf der Hüfte. Das Baby spielte mit ihrem Gesicht, während sie weiter mit offenem Mund dastand.
»Mein Gott, Perkins«, sagte sie.
Perkins rollte sich auf der nackten Matratze auf den Rücken. Er warf die Arme vor seine Augen. Er fühlte sich schwarz und einsam und ausgetrocknet. Sein ganzer Körper war wie mit körnigem Sand ausgestopft. »Oh, Avis«, sagte er jämmerlich. Auch sein Kopf schmerzte, und er fühlte Übelkeit in sich aufsteigen.
»Also wirklich«, sagte Avis. »Hast du was dagegen, mir mal zu erklären, was du dir da versuchst, selbst anzutun?«
Er schüttelte vorsichtig den Kopf. »Ich weiß es nicht mehr. Aber es muß etwas wirklich Grausames sein.«
»Sieht ganz so aus.«
»Ich hoffe nur, daß ich es nicht verdiene.«
»Pah! Pah! Pah!« rief das Baby. Es hatte die nackte Gestalt auf dem Bett entdeckt. Es zerrte am Arm seiner Mutter und streckte seine Ärmchen aus, um zu dem Mann zu gelangen.
»Also gut.« Avis stieß die Luft aus, bevor sie sich einen Weg durch das Chaos bahnte. »Sieh dich doch mal um.« Selbst im düsteren Licht des nach Westen liegenden Fensters konnte sie erkennen, daß es die reinste Katastrophe war.
Es war ein Studio, nur ein großer Raum. An der Wand klebte ein U-Bahn-Plan. Daneben hing eine gerahmte Zeichnung von Whitman. Ein Poster mit dem Keats-Haus, das ihm eine seiner Freundinnnen aus Rom mitgebracht hatte. Es gab einen Schreibtisch mit einem spartanischen Holzstuhl. Ein paar Klappstühle, ein paar Stehlampen. Die nackte Matratze auf dem Boden.
Vor allem aber gab es Bücher. Überall waren Bücher, grau und verstaubt. Sie standen stapelweise an den Wänden, in Einer-, Zweier-, Dreier- oder Viererreihen. Weitere Stapel erhoben sich wie Stalagmiten wahllos in der Mitte des Raums. Bücher bedeckten den Schreibtisch und sämtliche Stühle. Sogar das Bücherregal – Avis meinte, sich daran zu erinnern, hier irgendwann mal ein kleines Bücherregal gesehen zu haben – war unter Büchern begraben.
Und dann der Rest. Das Bettzeug war überall im Zimmer verteilt. Seine Jeans hingen über einer Stuhllehne, sein Pullover lag auf einem zusammengestürzten Haufen Dostojewskis. Seine Unterhose war um eine der Lampen geschlungen.
Muß das sein, dachte Avis genervt.
Und auf jedem freien Fleck Bierflaschen der Marke Sam Adams. Leere braune Glasflaschen, wohin das Auge blickte. Sie stieß mit dem Zeh gegen eine davon, als sie das Bett erreichte, und die Flasche kullerte mit einem Klink gegen eine illustrierte Ausgabe von Don Quijote.
Sie ging in die Hocke und setzte sich neben Perkins auf die Matratze. Perkins ließ seinen Arm sinken und sah sie von unten mitleiderregend an. Sie versuchte, nicht auf seinen nackten Körper zu starren, aber sie konnte nicht anders. Er war ein stämmig gebauter Mann mit einer kräftigen, behaarten Brust und muskulösen Armen. Er hatte lange schwarze Haare und ein kantiges Gesicht, das mit seinen einunddreißig Jahren schon leicht aufgedunsen und von tiefen Falten durchzogen war. Und sie fand seine Augen – seine braunen Augen – verführerisch traurig.