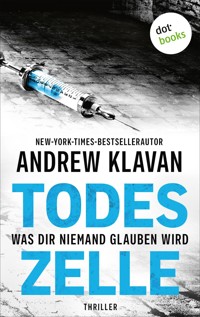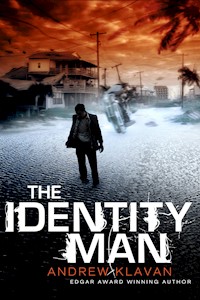0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Welches schreckliche Geheimnis nistet in ihrem Kopf? Der packende Psychothriller »Todeszahl – Was tief begraben liegt« von Andrew Klavan jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Fall wie dieser lässt selbst den erfahrenen Psychologen Dr. Nathan Conrad nicht kalt: Die psychisch labile Elizabeth soll einen Mann angefallen und schrecklich verstümmelt haben. Nach einem kurzen Gespräch ist Nathan klar, dass die junge Patientin schizophren und nicht schuldfähig ist. Damit ist seine Arbeit eigentlich getan – doch kurz darauf verschwindet seine Tochter Jess plötzlich spurlos und ein Mann droht ihm am Telefon: »Wenn Sie ihr Kind wiedersehen wollen, fragen sie Elizabeth: Wie lautet die Zahl?« Für Nathan beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und während er alles daran setzt, Jess zu finden, wird ihm klar, dass der Schlüssel zur Rettung seiner Tochter nur an einem Ort zu finden ist: Im Gedächtnis der verstörten jungen Frau … »Durch ein ausgeklügeltes Spiel mit der Zeit und eine raffinierte Vorliebe fürs Detail steigert dieser Superthriller den Nervenkitzel ins schier Unermessliche.« Brigitte Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der nervenaufreibende Thriller »Todeszahl – Was tief begraben liegt« von Bestsellerautor Andrew Klavan wird alle Fans von Michael Robotham und Alex Michaelides begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 554
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Fall wie dieser lässt selbst den erfahrenen Psychologen Dr. Nathan Conrad nicht kalt: Die psychisch labile Elizabeth soll einen Mann angefallen und schrecklich verstümmelt haben. Nach einem kurzen Gespräch ist Nathan klar, dass die junge Patientin schizophren und nicht schuldfähig ist. Damit ist seine Arbeit eigentlich getan – doch kurz darauf verschwindet seine Tochter Jess plötzlich spurlos und ein Mann droht ihm am Telefon: »Wenn Sie ihr Kind wiedersehen wollen, fragen sie Elizabeth: Wie lautet die Zahl?« Für Nathan beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit und während er alles daran setzt, Jess zu finden, wird ihm klar, dass der Schlüssel zur Rettung seiner Tochter nur an einem Ort zu finden ist: Im Gedächtnis der verstörten jungen Frau …
Über den Autor:
Andrew Klavan wuchs in New York City auf und studierte Englische Literatur an der University of California. Danach arbeitete er als Reporter für Zeitungen und das Radio, bevor er sich ganz dem Schreiben seiner Spannungsromane widmete. Heute gilt Klavan als einer der großen Thriller-Experten der USA. Mehrere seiner Bücher sind mit dem begehrten Edgar-Award ausgezeichnet, für weitere Preise nominiert und/oder verfilmt worden.
Die Website des Autors: andrewklavan.com/
Der Autor bei Facebook: facebook.com/aklavan/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine Thriller »Todeszelle – Was dir niemand glauben wird«, »Angstgrab – Die Schuld wird nie vergessen sein«, »Todeszahl – Was tief begraben liegt«, »Hilfeschrei – Die Dunkelheit in uns«, »Opferjagd«, »Totenbild« und »Todesmädchen«.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »Don’t Say a Word« bei Pocket Books, a division of Simon & Schuster, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Die Augen der Nacht« bei Lübbe, Bergisch Gladbach.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1991 by Andrew Klavan
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 by Gustav Lübbe Verlag, bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Alina Filatova
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-279-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Todeszahl« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Andrew Klavan
Todeszahl – Was tief begraben liegt
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Michael Kubiak
dotbooks.
Für Richard Friedmann
Den folgenden Personenbin ich außerordentlich zu Dank verpflichtet
Maureen Empfield, M.D., und Howell Schrage, M.D.,die mich großzügig mit Informationen über dieBehandlung von Geisteskrankheiten, die Verwaltungeiner psychiatrischen Institution, die Anwendungvon Psychopharmaka und so weiter versorgt haben;
Tim Scheid, einem der besten und rührigstenRadioreporter New Yorks, der mir Zutritt zu einigengewöhnlich nicht zugänglichen Stättenin New York verschaffte;
Richard Schofield, M.D.,für seine Freundlichkeit, literarischen Figurenkostenlosen medizinischen Rat zu geben;
meiner Frau Ellen, wie immer, für ihre Geduldund ihre Ratschläge.
PROLOG
Der Mann namens Sport
Das geeignete Apartment zu finden war schwierig, darum ermordeten sie die alte Dame. Der Mann namens Sport klopfte an ihre Tür. Er war mit einem grünen Overall bekleidet, so daß er aussah wie ein Installateur. Maxwell stand ein Stück entfernt neben ihm, im toten Winkel des Türspions der alten Dame. Maxwell war ebenfalls mit einem grünen Overall bekleidet, aber er sah überhaupt nicht aus wie ein Installateur. Niemand würde für Maxwell seine Tür öffnen.
Sport hingegen konnte sich sehen lassen. Er war jung, und sein glattes braunes Haar fiel ihm in einer jungenhaften Tolle in die Stirn. Er zeigte gerne sein strahlendes, freundliches Lächeln, und er hatte intelligente braune Augen.
Die alte Dame hieß Lucia Sinclair. Als sie Sports Klopfen hörte, öffnete sie die Tür nicht.
»Wer ist da?« erkundigte sie sich. Sie hatte eine hohe, flötende Stimme. Es war die Stimme einer reichen Frau. Sport gefiel sie überhaupt nicht. Damals, in Jackson Heights, als er noch ein Kind war, hatte er samstags als Laufbursche für den A-&-P-Supermarkt gearbeitet. Lucia Sinclair hatte die gleiche Stimme wie die Frauen damals, wenn sie ihm befahlen, die Einkaufstüten in die Küche zu stellen. Manchmal sahen sie ihn nicht einmal an.
»Hier ist der Installateur«, antwortete Sport gutgelaunt.
Er hörte, wie der kleine Stahldeckel vom Türspion geschoben wurde. Er zeigte Lucia Sinclair sein gewinnendes Lächeln.
Er hörte, wie die Klappe des Türspions geschlossen wurde. Dann wurde das Kettenschloß entriegelt. Er sah zu Maxwell hoch. Maxwell lächelte erwartungsvoll. Maxwell geriet allmählich in Erregung.
Die Tür öffnete sich, und da stand Lucia Sinclair. Gar nicht schlecht für eine alte Krähe, dachte Sport. Sie war klein und schlank. Sie hatte ein herzförmiges Gesicht; die Wangen waren schmal, aber nicht schlaff und faltig. Ihr kurzes silbergraues Haar trug sie in einer altmodischen Frisur. Bekleidet war sie mit einer weitgeschnittenen Flanellbluse und hellblauen Jordache Jeans. Teure Jeans, wie bei den Frauen, denen er früher immer die Einkaufstüten nach Hause brachte. Sie beugten sich immer über ihre Portemonnaies und zeigten ihre Hintern her. »Stell die Tüten in die Küche«, sagten sie. Dabei würdigten sie ihn keines Blickes.
Prima, dachte Sport. Mit der müßte Maxwell eigentlich seinen Spaß haben.
Lucia Sinclair trat zurück, um Sport hereinzulassen. Sie lächelte und ordnete ihre Frisur.
»Ich fürchte, ich sehe etwas unordentlich aus«, sagte sie. »Ich hab’ ein wenig im Garten gearbeitet.« Sie vollführte eine anmutige Geste. Am anderen Ende des langen Salons standen gläserne Schiebetüren offen. Sie führten auf einen kleinen Balkon hinaus. Auf dem Balkon standen mehrere Topfpflanzen und Blumenkästen. »Es ist zwar nur ein winziger Garten, muß ich zugeben«, zwitscherte Lucia Sinclair weiter. »Aber man macht sich genauso schmutzig wie ...«
Sie verstummte. Es belustigte Sport, wie ihr die Worte geradezu auf den Lippen einfroren. Sie stand da, und ihr Mund klappte auf. Ihr Blick wurde starr, und Sport sah in ihren Augen graue Flecken der Angst. Sie blickte Maxwell an.
Maxwell kam herein und schloß die Tür hinter sich. Sport konnte sich noch gut daran erinnern, wie er Maxwell zum ersten Mal gesehen hatte. Es war in der Strafanstalt für Männer auf Rikers Island gewesen. Sport hatte dort als Angestellter des Strafvollzugs gearbeitet; er war Gefängniswärter. Es war früher Nachmittag, und er ruhte seine Füße aus. Er saß in einem Holzsessel, den er in der Nähe von Schlafsaal C gegen die unverputzte Wand des Wärterreviers gelehnt hatte. Als sie Maxwell hereinführten, klappte Sports Mund halb auf. Sports Sessel kippte nach vorne, bis die Vorderfüße auf den Betonfußboden knallten.
»Ach du Scheiße«, flüsterte er.
Und er dachte: Das ist ein Mann, den du zum Freund haben willst.
Maxwell war über eins achtzig groß. Seine Schultern fielen nach vorne, und seine muskulösen Arme hingen an den Seiten herab. Er hatte die Figur eines Grizzlybären: eine massige, unförmige Gestalt; dazu der schlurfende Gang, vor Kraft strotzend. Den Kopf hatte er vorgeschoben wie ein Bär oder ein Höhlenmensch. Seine mächtige Brust spannte seinen Gefängnisdrillich. Er erweckte den Eindruck, als würde er jeden Moment aus seinen Sachen herausplatzen.
Und sein Gesicht ... Das war es, was Sports Aufmerksamkeit auf Anhieb fesselte. Seine Miene. Das Gesicht war klein, quadratisch, mit dünnem blondem Haar, das in die Stirn hing. Eine große, breite Nase wie bei einem Neger und auch die entsprechenden wulstigen Lippen und dazu tiefliegende Augen – braune Augen, so weit eingesunken, daß sie einen aus den schattigen Höhlen irgendwie traurig anblickten, als wären sie darin gefangen.
Mein Gott, dachte Sport, das ist überhaupt kein männliches Gesicht. Nicht das Gesicht eines Menschen und auch nicht das eines Tiers. Es war wie ein Säuglingsgesicht, das jemand auf diesen massigen Bärenkörper gesetzt hatte. Ein Berg vernichtender Kraft.
Denn in diesem Moment, als er den Saal betrat, hatte Maxwell Angst. Sport erkannte es. Er hatte Angst, weil er im Gefängnis war. Die Mundwinkel waren herabgezogen, als würde er gleich weinen.
Seine Blicke wanderten hin und her über die Reihen von Betten und Spinden – und über die Männer, vorwiegend Farbige, die sich zu ihm umwandten und ihn mit bösen, argwöhnischen Augen anstarrten.
Er war, wie sich nachher herausstellte, das erste Mal im Gefängnis. Er hatte sich gerade sechs Monate dafür eingehandelt, daß er sich auf einem Kinderspielplatz unsittlich entblößt hatte. Sein Anwalt hatte es geschafft, den Vorwurf der Unzucht zu entkräften.
Und Sport erkannte auf den ersten Blick, daß in diesem Mann sehr viel mehr steckte als nur das.
Lucia Sinclair stand da und sah Maxwell jetzt an und brachte keinen Ton hervor. Sport las in ihren Augen die dämmernde Erkenntnis, daß sie einen Fehler gemacht hatte. Er konnte ihre Gedanken geradezu hören: Wenn ich doch nur nicht die Tür geöffnet hätte, hätte ich es doch niemals getan.
Zu spät, Fotze, dachte Sport.
Er lächelte wieder freundlich. »Wenn Sie uns jetzt mal Ihr Badezimmer zeigen würden, Ma’am.«
Lucia Sinclair zögerte, während sie krampfhaft nach einem Ausweg suchte. Die Haut um ihre Lippen zitterte. »Ja, natürlich«, sagte sie schließlich. »Ich will nur eben ...«
Sie drehte sich zur Wohnungstür um, machte einen Schritt. Versuchte, sich an Maxwell vorbeizudrängen, streckte die Hand nach dem Türknauf aus.
Maxwell packte ihr Handgelenk. Hielt es fest.
»Nehmen Sie Ihre Hände -« begann sie den Satz.
Dann riß sie vor Schmerz den Mund auf. Tränen füllten ihre Augen. Maxwell umklammerte ihr dünnes Handgelenk. Er drehte ihren Arm langsam von der Tür weg. Ein knappes, seltsames, verträumtes Lächeln spielte um seine Lippen.
Lucia Sinclair brachte kaum ein Hauchen zustande. »Bitte ...«
Maxwell ließ sie los. Sie stolperte rückwärts und stürzte. Auf dem Boden rutschte sie von ihnen weg bis zur Wand. Sie stand nicht auf. Sie blieb auf den Knien. Sport gefiel das. Jetzt war sie kein eingebildetes Luder mehr. Sie kauerte dort und massierte die gerötete Haut an ihrem Handgelenk. Sie starrte zu Maxwell hoch. Maxwell beugte sich über sie. Er atmete schwer; seine mächtigen Schultern hoben und senkten sich.
Sports Stimme klang ganz ruhig. »Vielleicht könnten Sie ihm jetzt das Badezimmer zeigen, Ma’am.«
Die alte Frau drehte sich zu Sport um. Ihre Augen waren weit aufgerissen. »Bitte«, sagte sie. Der flötende Ton war verschwunden. Jetzt war es nur noch die gebrochene, zittrige Stimme einer alten Frau. »Bitte, Sie können mitnehmen, was Sie wollen.«
»Max«, sagte Sport.
Lucia Sinclair stieß einen Schmerzensschrei aus, als Max sich bückte und sie ergriff. Er packte sie mit einer einzigen riesigen Hand unter der Achselhöhle. Die alte Frau mußte sich mühsam auf die Füße kämpfen, um zu vermeiden, daß Max ihr den Arm auskugelte. Sie schaute zu Sport, flehte ihn an. Sie mußte begriffen haben, daß Bitten bei Maxwell nichts ausrichteten.
»Bitte«, sagte sie wieder. »Tun Sie mir nichts. Er soll mir nicht weh tun.«
Sport hob eine Hand. Er sprach mit einem leisen, beruhigenden Murmeln. »Er tut Ihnen nicht weh, Ma’am. Gehen Sie nur mit ihm ins Badezimmer.«
»Bitte«, sagte Lucia Sinclair. Sie weinte jetzt. Tränen glänzten auf ihren Wangen. Ihre Lippen bebten. Ihr ganzes Gesicht schien eingesunken zu sein und hatte sich grau verfärbt.
Max zog sie hinter sich her durch die kurze Diele zur Badezimmertür. Sie redete noch immer mit Sport.
»Bitte. Ich kann Ihnen doch nichts tun. Ich rufe nicht einmal die Polizei.«
Max erreichte die Badezimmertür. Er stieß sie grob durch die Öffnung. Er folgte ihr hinein.
Sport hörte sie noch einmal wimmern. »Bitte.« Und dann drang ein heiserer Schrei tief aus ihrer Kehle: »O Gott!«
Und die Badezimmertür fiel langsam ins Schloß.
Natürlich gab es nichts mehr, was Maxwell jetzt noch hätte aufhalten können. Nicht wenn er diesen Ausdruck im Gesicht hatte, dieses verträumte Lächeln. Das war das besondere an Max: Er tat es gerne; es machte ihn richtig scharf. Genauso wie damals, als sie den Freak erledigten. Max hatte einen Ständer gehabt, eine richtige Erektion, nur weil er dem Burschen die Kehle durchschnitt. Der Freak wand sich auf dem Fußboden, zuckte umher und gab gurgelnde Laute von sich. Er faßte sich an den Hals, und das Blut spritzte zwischen seinen Fingern hervor. Und da war Maxwell; er beugte sich über ihn, die Augen funkelnd, die Lippen halb geöffnet, während ihm der Speichel vom Kinn troff- und in der Hose ein echter Ständer wie ein Fahnenmast. Sport war überzeugt, daß Max ihn am liebsten gleich ausgepackt hätte. Um sich einen runterzuholen, während der Kerl unter ihm herumrutschte und zitterte. Aber Sport packte Maxwells Schulter und brüllte ihm ins Ohr. »Wir müssen abhauen! Los, komm schon!« Schließlich nickte Maxwell mit einem dümmlichen Grinsen und fuhr sich mit der Hand durch sein dünnes blondes Haar.
Trotzdem harrte er noch einen Moment lang aus. Er blieb zurück, um zuzusehen, wie der Freak starb.
Während Max mit der alten Dame im Badezimmer war, schlenderte Sport durch das Wohnzimmer. Es war schon eine eindrucksvolle Bleibe, die die alte Dame hatte. Sehr elegant. Sehr gediegen. Kaum direkter Sonnenschein, aber jede Menge frühherbstliches Tageslicht, das durch die gläsernen Balkontüren hereindrang. Wunderschöne kupferrote Teppiche auf dem Parkettfußboden. Ein Eßtisch aus Glas mit silbernen Kerzenständern darauf. Schwere Sessel aus altem Holz mit verschnörkelten Armlehnen und Füßen und Polsterbezügen mit einem Muster aus Früchten und Blumen. Bücherschränke aus altersdunklem Holz mit alten, voluminösen Büchern darin. Und Regale und Vitrinen aus echtem Rosenholz mit wertvollem Nippes hinter den Glastüren: silberne Kelche; Bierseidel aus Zinn; kleine Elfenbeinskulpturen von Pferden und Buddhas; Fotos in silbernen Rahmen von einem lächelnden Paar, einem Haus in ländlicher Umgebung, einem kleinen, fröhlich lachenden blonden Mädchen, einem kleinen wuschelhaarigen Jungen.
Sport blieb vor den Vitrinen stehen, als er durch den Raum wanderte. Er beugte sich vor, die Hände auf dem Rücken verschränkt, und betrachtete den Schnickschnack hinter dem Glas. Das war wahre Klasse, und wie, dachte er. Hier ist alles echt.
Als er draußen in Heights noch ein Junge war, hatte er immer Sänger werden wollen. Nicht einer von diesen schwulen Rock-Schreihälsen, sondern ein richtiger Nachtclubsänger. Ein Julio Iglesias oder ein Tom Jones oder gar ein Sinatra. Er träumte davon, in einem Smoking aufzutreten und Balladen zu singen. Das Mikrofon in der einen Hand zu halten und die andere dem Publikum entgegenzustrecken. Die Frauen seufzten und kreischten. Der Rauch der Zigarette hüllte ihn ein. Und dies war die Wohnung, von der er damals ebenfalls geträumt hatte. Eigentlich hatte er sich eher ein Haus vorgestellt, einen Wohnsitz in Hollywood, in der gleichen Straße, in der auch Johnny Carson wohnte. Aber auch genauso vornehm wie diese Wohnung mit eleganten, reichverzierten Möbeln, die die Leute bewunderten.
Sport verharrte vor dem Bücherschrank und beugte sich zu einer Ausgabe von Little Dorrit mit einem braunen, gerippten Ledereinband hinab. Dann richtete er sich mit einem Seufzer wieder auf.
Unglücklicherweise hatte er es niemals geschafft, einen Smoking zu tragen oder in einem Nachtclub mit einem Mikrofon aufzutreten. Und die einzige Frau, die er in seinem Leben schreien gehört hatte, war seine Mutter gewesen. Er konnte sich manchmal daran erinnern – gelegentlich spürte er es sogar –, wie der fleckige Mond, dem ihr Gesicht glich, auf ihn eindrang. Er spürte ihren heißen Atem und roch den sauren Bierdunst, der über sein Gesicht strich.
»Ich furze ja besser, als du singen kannst«, hatte sie ihm mal erklärt, und ihre Stimme klang dabei wie die einer Katze, die in den Küchenmixer geraten war. Und dann hatte sie es ihm demonstriert. »Hörst du das? Das bist du, wenn du singst. So gut singst du!« Sie hatte erneut einen Furz gelassen. »Ich singe auch«, hatte sie gekreischt. »Hört alle gut zu! Ich singe mit dem Arsch!« Und ihr gackerndes Gelächter hüllte ihn ein in eine Wolke aus stinkendem Bierdunst.
Ein Geräusch im Badezimmer riß Sport aus seinen Überlegungen. Sport blickte über die Schulter in die Diele. Er war sich nicht sicher, was für ein Geräusch es gewesen war. Ein dumpfer Schlag; vielleicht war etwas hingefallen. Oder ein hohles, wortloses Grunzen; ein Stöhnen. Er wurde an etwas erinnert, das Maxwell ihm erzählt hatte, als sie sich draußen auf Rikers etwas besser kannten. Eines Nachts, als sie nach dem Löschen der Lampen zusammen auf der Toilette hockten und sich flüsternd unterhielten, hatte Maxwell ihm ein schüchternes, fast rührendes Geständnis gemacht. Am liebsten schneide er Katzen die Zunge heraus, meinte er, und bräche ihnen die Beine und höre ihnen zu, wenn sie zu schreien versuchten.
Sport schüttelte den Kopf und lächelte, als er weiterging. Dieser Maxwell. Ein verrückter Kerl.
Er schlenderte jetzt zu den Glastüren zum Balkon. Er blieb davor stehen und schaute hinaus. Er federte auf den Füßen vor und zurück und hatte die Hände wieder auf dem Rücken verschränkt.
Der eigentliche Balkon war sehr klein. Nicht viel mehr als ein dreieckiger Betonsims. Die wenigen Pflanzen und Blumenkästen, mit denen die Dame sich beschäftigt hatte, nahmen den größten Platz ein. Von seinem Standort aus konnte Sport über die Balustrade blicken und den Hof fünf Stockwerke tiefer sehen. Es war ein länglicher, schmaler Rasenstreifen mit einigen künstlich angelegten und mit Büschen bepflanzten Hügeln darauf. Hier und da waren Holzbänke aufgestellt worden. Und es gab einen mit Steinplatten ausgelegten Weg, der durch die Parklandschaft führte. Der Weg erstreckte sich von einer Baumgruppe auf einem kiesbestreuten Platz unter einem mit wildem Wein umrankten Spaliergitter auf der linken Seite bis zu einem rechteckigen Fischteich rechts von Sport. Die vierte Begrenzungsmauer des Hofs wurde von der Rückwand der Kirche gebildet. Ihre Klinkerwand mit den Buntglasfenstern grenzte direkt an den Fischteich.
Sport löste seinen Blick von dem Hof. Er schaute hinüber zum gegenüber liegenden Gebäude. Lucia Sinclairs Apartment befand sich im hinteren Teil des Gebäudes in der Fünfunddreißigsten Straße Ost. Das Haus jenseits des Hofs stand in der Sechsunddreißigsten. Es war nicht weit entfernt, höchstens zwanzig Meter. Auf jeden Fall nahe genug.
In diesem Moment erklang hinter ihm ein Klirren. Die Nippessachen erzitterten in ihren Vitrinen. Maxwell, so dachte er, leistete offenbar schwere Arbeit. Er wandte sich um und betrachtete wieder die Wohnung. Schwere Arbeit, dachte er, diese Behausung zu mieten.
Es war ein Trick, den Sport von einem Drogendealer auf Rikers übernommen hatte. Ein absoluter Spitzenmann; ein wahrer Könner namens Mickey Raskin. Mickey hatte Sport mit der raffinierten Kunst der kurzfristigen Wohnungssuche bekannt gemacht. Zuerst, meinte Mickey, lies die Todesanzeigen. Such dir einen Toten, am besten ohne Hinterbliebene. Dann mach dich an den Hauseigentümer oder den Verwalter heran und steck ihm einen Umschlag mit der Jahresmiete zu. Erklär ihm, daß du die Wohnung für einen, höchstens zwei Monate brauchst und keine dummen Fragen beantworten willst. Das einzige Risiko, sagte Mickey, bestünde darin, daß man auf einen ehrlichen Vermieter trifft. Mit anderen Worten, das System war narrensicher.
Es war eine gute Methode, gab Sport zu. Aber die Vorbereitung mit den Todesanzeigen war etwas mühsam. Sport brauchte nicht irgendeine Wohnung. Er brauchte genau diese oder eine direkt daneben. Daher konnte er nicht auf das Erscheinen einer Todesanzeige warten, sondern er mußte sozusagen selbst für eine sorgen. Und einen Tag oder zwei, nachdem die »Todesanzeige« erschienen wäre, würde er in dem Haus auftauchen und um ein Gespräch mit dem Verwalter bitten. Ich habe in der News von dem schrecklichen Mord an der alten Dame gelesen, würde er sagen, und ich möchte ihre Wohnung für einen Monat mieten, wenn die Polizei ihre Untersuchungen abgeschlossen hat. Zuerst würde der Verwalter mit Abscheu reagieren, vielleicht sogar mit einem gewissen Mißtrauen. Aber dann würde Sport ihm einen Briefumschlag in die Hand drücken. Und wenn der Verwalter dann darauf blickte und sähe, wie dick der Umschlag war, dann fände er es überhaupt nicht mehr ekelhaft, und auch sein Mißtrauen würde verfliegen. Und wenn die Polizei fertig wäre – in einer Woche, höchstens in zwei –, gehörte die Wohnung ihm.
Sport hörte, wie die Badezimmertür geöffnet wurde. Schwere Schritte erklangen. Maxwell erschien in der Tür am Ende des Wohnzimmers.
Die Brust des massigen Mannes hob und senkte sich heftig. Sein vorgeschobener Kopf nickte auf und nieder. Das Lächeln hatte seine dicken Lippen verlassen, und seine Augen waren glasig und leer. Die schweren Arme pendelten an seinen Seiten. Die dicken Finger waren dunkel von Blut. Er zupfte verlegen am Stoff seines Overalls herum. Der Overall war ebenfalls mit dunklen Flecken übersät. Maxwell ließ den Kopf hängen und scharrte schüchtern mit einem Fuß auf dem Boden herum.
»Alles klar, mein Junge?« fragte Sport mit einem fröhlichen Grinsen.
Maxwell nickte scheu und antwortete atemlos: »Ja.«
Ehe er zu ihm ging, wandte Sport sich um und warf einen letzten Blick durch die Glastüren. Er nickte. Es war wirklich perfekt. Mit einem anständigen Feldstecher würde er durch die Fenster genau gegenüber blicken können.
Direkt in die Wohnung von Dr. Nathan Conrad.
ERSTER TEIL
Der Psychiater der Verdammten
Dr. Nathan Conrad war allein. Er legte die Hände auf die Armlehnen des Ledersessels. Er lehnte sich zurück. Er schaute hinauf zu der Zierleiste, die zwischen Decke und Wand verlief. Er dachte: Scheiße.
Kopfschmerzen kündigten sich an. Rote Punkte blitzten auf und flossen wie Tintenkleckse vor seinem defekten rechten Auge auseinander. Sein Magen fühlte sich hohl und schwer an. Es bestand kein Zweifel: Es war eine deprimierende Sitzung gewesen.
Wieder mal Timothy. Timothy Larkin. Siebenundzwanzig Jahre alt. Ein begabter Choreograph mit einer vielversprechenden Karriere vor sich. Er hatte bereits als Assistent bei zwei Broadwayshows gearbeitet. Und vor einem Jahr hatte er den Posten des Chefchoreographen für eine Freiluft-Tanzdarbietung innerhalb des Sommerprogramms des World Trade Centers bekommen. Etwa einen Monat danach hatte er festgestellt, daß er an aids litt.
Während der vergangenen sechs Monate hatte Conrad zusehen müssen, wie der junge Mann allmählich verfiel. Die Figur des Tänzers, einst geschmeidig und muskulös, wurde zittrig und zerbrechlich. Das ausdrucksvolle, markante Gesicht war schlaff geworden und in sich zusammengesunken. Er hatte sich Strahlentherapien gegen seine verschiedenen Krebsarten unterzogen, und sein volles schwarzes Haar war ihm längst ausgefallen.
Conrad massierte sein Auge, um die roten Wolken zu vertreiben. Seufzend erhob er sich mühsam aus seinem Sessel. Nach einer Stunde im Sitzen war sein lädiertes Bein, das rechte, steif geworden. Er mußte durch das winzige Büro zu dem kleinen Tischchen neben der Toilettentür humpeln. Eine Mr.-Coffee-Maschine stand auf dem Tischchen. Sein geliebter Mr. Coffee. Der Ehrenwerte Mr. Coffee. Sir Coffee. Saint Coffee.
Seine Tasse stand neben der Maschine. Es war eine schwarze Tasse mit einer weißen Aufschrift: geniesse dein leben, es ist später als du denkst. Er nahm die Kaffeekanne aus der Halterung. Er schüttete den Rest aus der Kanne in den Rest in seiner Tasse. Er stellte die Kanne weg und trank.
»Aah! « seufzte er laut.
Es schmeckte wie Kaffeesatz. Er schüttelte den Kopf und kehrte mit der Tasse in seinen Sessel zurück. Es war an diesem Morgen die dritte Tasse von dem Zeug. Er konnte kaum glauben, daß die Uhr erst viertel nach neun zeigte.
Conrad hatte Timothy auf Bitten der Gay and Lesbian Health Alliance angenommen. Die Internistin der Alliance, eine Frau namens Rachel Morris, hatte ihn überwiesen.
»Wissen Sie, ich kann mir euch nicht mehr leisten«, hatte Conrad ihr gesagt.
»Schön, aber Sie haben Ihren Namen in die Liste eingetragen, Nathan«, sagte sie.
»Ja, und Sie haben mir nicht verraten, daß das Blatt für die Namen ansonsten leer war.«
Sie lachte. »Was soll ich dazu sagen? Sie haben sich bei den städtischen Hilfsdiensten für die schwierigeren Fälle einen gewissen Ruf erworben.«
»Ach ja? Und was ist mein Ruf? Jetzt will ich was Schönes hören.«
»Man nennt Sie den Psychiater der Verdammten.«
Conrad hielt den Telefonhörer in der einen Hand und stützte den Kopf in die andere. »Ich bin geschmeichelt, Rachel. Zutiefst gerührt. Aber ich bin jetzt ein gefragter Gehirnschlosser von der Upper East Side. Ich habe eine Frau und ein Kind und einen Mercedes Benz, die ich am Leben erhalten muß.«
»O Nathan, das haben Sie nicht.«
»Na schön, ich habe Frau und Kind. Und ich hätte längst einen Mercedes, wenn ihr endlich aufhören würdet, mich ständig anzurufen.«
»Und Ihre Frau kann sich selbst ernähren.«
»Kann sie das? Kann sie mir einen Mercedes kaufen?«
»Nathan!« hatte Rachel schließlich ausgerufen. »Er hat kein Geld, seine Versicherung übernimmt diese Kosten nicht. Er ist selbstmordgefährdet und weiß nicht, an wen er sich sonst wenden soll. Er braucht Sie.«
Conrad überlegte noch einen Moment lang. Dann stimmte er ein verzweifeltes Geheul an.
Conrads Büro befand sich in einem verschachtelten gotischen Apartmenthaus an der Central Park West zwischen Zweiundachtzigster und Dreiundachtzigster Straße. Er hatte sein Büro im hinteren Teil im Parterre. Sein einziges Fenster ging auf den düsteren Lichtschacht hinaus, den sein Gebäude sich mit dem verschachtelten gotischen Apartmenthaus an der Ecke Dreiundachtzigste teilte. Das Fenster hielt er stets mit Holzläden verschlossen. Kein Tageslicht drang hindurch – man konnte kaum feststellen, daß überhaupt ein Fenster existierte. Das Büro sah immer irgendwie kahl aus, fade und künstlich.
Das Büro war in ein Wartezimmer und in ein Behandlungszimmer unterteilt. Beide waren klein. Das Wartezimmer war nicht mehr als ein rechteckiges Handtuch. Dort gab es gerade genügend Platz für zwei Bücherregale, zwei Stühle und einen kleinen Beistelltisch, auf dem Conrad für seine Patienten Exemplare der New York Times und von Psychology Today bereitlegte. Er selbst las keine der beiden Publikationen.
Das Behandlungszimmer war etwas größer, aber es war überfüllt. Es gab ein Fenster in der Nordmauer und ein Bad mit Toilette an der Südseite. Dafür war jede verfügbare freie Wandfläche mit Bücherregalen bedeckt, in denen verwitterte Ausgaben von Sexualität im Kindesalter, Psychopharmakologie und Sigmund Freuds Gesammelte Werke in mehreren Bänden standen. Es gab auch in einer Ecke ein Rollpult. Dieses war geöffnet, und seine Schreibfläche war mit Schriftstücken und Fachzeitschriften bedeckt. Irgendwo unter diesem Durcheinander waren das Telefon und der Anrufbeantworter versteckt. An der äußersten Ecke stand ein Reisewecker.
Schließlich gab es noch die unentbehrlichen Möbel: Conrads Platz – der lederne Lehnsessel –, die Couch für die Patienten und der große gelbe Sessel für die Patienten, die sich in einer Therapie befanden.
Als Timothy heute in diesem Sessel saß, hatte dieser ihn schier erdrückt. Seine dünnen Arme lagen müde auf den Armlehnen. Seine knochigen Hände zitterten leicht. Sein Kopf schwankte, als könnte sein Hals ihn nicht mehr tragen. Eine Baseballmütze der Mets, mitleiderregend groß, saß schief auf seinem Kopf; sie sollte seinen kahlen Schädel bedecken.
Während er ihn betrachtete, mußte Conrad sich selbst durch eine Wolke von Mitleid kämpfen. Mußte er seinem traurigen und niedergeschlagenen Gesicht einen gleichgültigen Ausdruck verleihen. Er atmete langsam, drückte die Luft mit seinem Zwerchfell heraus. Er wartete darauf, daß sein Geist in jenen ruhigen, dumpfen Zustand der konzentrierten Rezeption abglitt. Keine Urteile, keine Interpretationen. Die Verbindungen sollten von selbst Zustandekommen. Der Weg des Tao ist einfach, zitierte er in Gedanken, trenne dich von all deinen Überzeugungen.
»Wissen Sie«, sagte Timothy leise, »die Schuld ist schlimmer als die Angst. Ich meine damit, wenn man es genau betrachtet, dann komme ich mir eher schlecht vor ... aber ich fürchte mich eigentlich nicht vor dem Sterben.«
Conrad hörte schweigend zu. Timothy sprach schon seit einigen Wochen darüber: über die Schuld und die Scham, die genauso schwer auf ihm lasteten wie das Wissen um den nahen Tod. Er kannte bereits deren Ursachen. Nun versuchte er zu einer Erklärung für diese Erkenntnisse zu gelangen.
Er hob müde den Kopf. Sah Conrad eindringlich mit seinen großen, eingesunkenen schwarzen Augen an. »Was ich hasse, ist dieses Gefühl, daß ... Gott mich bestraft. Daß aids eine Art Gottesurteil ist. Eine Strafe für meine Sünden.«
Conrad veränderte etwas seine Haltung im Lehnstuhl.
»Welche Sünden sollten das denn sein, Tim?« fragte er leise.
»O ... das wissen Sie.« Timothy holte tief und mühsam Luft. »Die altbekannten Sünden. Mein Leben, mein Lebensstil. Meine Sexualität.« Und dann, mit einiger Anstrengung: »Ich denke, das ist es nun mal, womit man bestraft wird, weil man mit Männern Sex macht, oder?«
Und Conrad fragte: »Ist es das?«
Die Augen des jungen Mannes füllten sich mit Tränen. Er blickte zur Decke. »Ich habe das Gefühl, als steckte irgendwo in meinem Geist eine Art fundamentalistischer Prediger, wissen Sie das? Wie in diesem Woody-Allen-Film. Es ist so, als ob ein Geistlicher in meinem Bewußtsein lebt und mir gelegentlich mit dem Finger droht und sagt: ›Siehst du? Gott läßt seiner nicht spotten, Timothy. Das hast du nun davon, daß du mit anderen Jungen schlimme Dinge tust.‹«
Conrad lächelte mit aller Liebenswürdigkeit, die er aufbringen konnte. »Ich möchte jetzt nicht wie ein Psychiater klingen«, sagte er, »aber dieser Prediger – er sieht nicht zufälligerweise aus wie Ihr Vater, oder doch?«
Ohne zu lachen, nickte Timothy matt. »Ich glaube, er würde tatsächlich so denken. Mein Vater, meine ich. Wenn ich mit ihm redete, dann würde er es wahrscheinlich nicht laut aussprechen, aber ich bin überzeugt, er würde meinen, daß ich dafür ... bestraft würde, schwul zu sein.«
»Das ist ein interessanter theologischer Aspekt«, sagte Conrad. »Wenn AIDS eine Strafe für Homosexualität ist, als Strafe wofür könnte man dann die Leukämie bei Kindern ansehen? Daß sie ihr Spielzeug nicht mit anderen teilen wollen?«
Timothy antwortete wieder mit einem leisen Lachen.
»Wenn es regnet, dann immer auf die Gerechten und die Ungerechten«, sagte Conrad sanft.
»Oh, prima.« Stöhnend legte Timothy den Kopf nach hinten auf den Sessel. »Wer hat das gesagt? Sigmund Freud?«
»Wahrscheinlich. Bestimmt einer von uns cleveren Juden. «
Für einen weiteren langen Moment saß Timothy so da, seine dürre Gestalt im Sessel ausgestreckt, den Kopf auf der Rückenlehne. Dann sah Conrad, wie Tränen an seinen Schläfen herabrannen. Sie tropften auf die Sessellehne, befeuchteten den gelben Polsterbezug und hinterließen dunkle Flecken.
Conrad schaute zur Uhr auf dem Rollpult. Es war 9:13. Gott sei Dank, dachte er. Gott sei Dank, es ist bald vorbei.
Für einen Augenblick spürte er, wie Mitleid in ihm hochwallte. Er konnte es kaum ertragen. Mit Macht verdrängte er dieses Gefühl.
Er sah wieder auf seinen Patienten. Timothy blieb in seiner Haltung sitzen, hatte den Kopf zurückgelegt und ließ seinen Tränen freien Lauf. Beeil dich, Timbo, dachte Conrad, du bringst mich noch um.
Und schließlich richtete der Tänzer seinen Blick wieder auf den Psychiater. Die Tränen waren versiegt. Er preßte die Lippen zusammen. Erschüttert verfolgte Conrad, wie die Augen des jungen Mannes hart wurden.
»Ich bin froh, daß ich die Menschen, mit denen ich zusammen war, geliebt habe«, sagte Timothy. »Ich möchte nicht mit Scham sterben. Ich bin sehr froh.«
Dann zitterten seine Lippen, gaben nach. Er begann wieder zu weinen.
Conrad beugte sich vor und redete mit sanfter Stimme. »Unsere Zeit ist abgelaufen«, sagte er. »Wir müssen jetzt Schluß machen.«
Timothy wird sich bald besser fühlen, dachte Conrad. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und inhalierte den aus der Kaffeetasse aufsteigenden Dampf. Wenn er Zeit hätte, sich intensiv darum zu kümmern, dann würde Timothy mit seiner Schuld und seiner Krankheit ins Reine kommen. Er würde sich auf wundervolle Art erfrischt fühlen; im Frieden mit sich selbst.
Und dann würde er sterben – langsam, qualvoll, schrecklich, allein.
Scheiße. Conrad schüttelte den Kopf. Eine tolle Einstellung, Nathan, lieber Freund. Und es war erst zwanzig nach neun. Er konnte es sich nicht leisten, schon jetzt so deprimiert zu sein. Da war immer noch June Fefferman zu überstehen: eine reizende, völlig unselbständige kleine Maus von einer Frau, deren Ehemann, ein Flugzeugpilot, im vergangenen Jahr bei einem Autounfall auf der Rückfahrt vom Flughafen ums Leben gekommen war. Dann, nach ihr, käme Dick Wyatt, ein vor Leben sprühender fünfundvierzigjähriger leitender Angestellter, der eines Morgens in der Vorhalle seines Apartmenthauses in Brooklyn ausgerutscht und seitdem vom Hals an abwärts gelähmt war. Und dann, vielleicht der schlimmste Fall von allen, war da noch Carol Hines, deren fünf Jahre alter Sohn an einem Gehirntumor gestorben war. Conrads Tochter, Jessica, war ebenfalls gerade fünf. Er beschäftigte sich höchst ungern mit Carol Hines.
Conrad kniff krampfhaft die Augen zu. Er gab einen Laut von sich, halb Seufzer, halb Stöhnen. Psychiater der Verdammten, dachte er. Mein Gott, wo waren denn all diese wohlhabenden Allerweltsneurotiker der Upper West Side, von denen er soviel gehört hatte? Das Beste, was er für seine Patienten tun konnte, war, ihre Wahnvorstellungen zu kurieren, damit sie ihre Alpträume ausleben konnten.
Er hörte, wie draußen knarrend die Wartezimmertür geöffnet wurde, sich dann mit einem dumpfen Laut schloß. Er sah auf die kleine Uhr: 9:25. Mrs. Fefferman und ihr toter Ehemann waren fünf Minuten zu früh gekommen. Fünf Minuten. Er hatte noch etwas Zeit, sich zu entspannen, ehe die Sitzung begann. Er faßte dankbar den Henkel seiner Tasse an. Er führte sie an die Lippen. Atmete den Geruch ihres Inhalts ein.
Das Telefon klingelte. Ein Blatt Notizpapier balancierte darauf, rutschte herab und segelte auf den Fußboden. Das Telefon war ein schwarzes Tastenmodell. Es klingelte wieder: ein lautes, schrilles Scheppern.
»Ach – was willst du schon wieder?« murmelte Conrad. Das Telefon klingelte erneut.
Fluchend rollte Conrad mit dem Sessel zum Schreibtisch. Er stellte seine Kaffeetasse auf seinen in Arbeit befindlichen Aufsatz über Kummerreaktionen bei Kindern. Dann nahm er den Hörer ab.
»Dr. Conrad«, meldete er sich.
»Hallo, Nate. Jerry Sachs hier.«
Conrad krümmte sich. Damit war seine Pause wieder mal zum Teufel.
»Hi, Jerry«, sagte er so freundlich er es vermochte. »Wie geht’s?«
»Na, du weißt ja. Ich mach zwar nicht das dicke Geld wie einige Leute auf der Central Park West, aber ich komme zurecht. Und wie ist es mit dir?«
»Ach«, meinte Conrad. »Gut, danke.«
»Hör mal, Nate«, kam Sachs zur Sache, »ich habe hier etwas, das meines Erachtens in dein Gebiet fällt.«
›Nate‹ schüttelte den Kopf. Er konnte sich Sachs am anderen Ende der Leitung vorstellen. Wie er hinter seinem überdimensionalen Schreibtisch in der Impellitteri Municipal Psychiatrie Facility saß. In seinem Sessel lümmelnd, die großen Füße auf den Tisch gelegt und mit der freien Hand auf seinen Bauch klopfend. Dabei hatte er den riesigen eiförmigen Schädel so weit nach hinten geneigt, daß seine schwarzen Brillengläser das Licht der Deckenlampe reflektierten. Und vor ihm stand das schwarze Onyxschild: jerald sachs, m.d., Direktor. Das Schild war mindestens einen Meter lang.
Doch dann sagte sich Conrad, daß Sachs es verdient hatte. Die Beförderung auf den Posten des Direktors war das Ergebnis fast zehn schwerer Jahre der Arschkriecherei bei Ralph Juliana, dem Präsidenten der Verwaltung von Queens. Conrad hatte Juliana in den Fernsehnachrichten gesehen: einen stämmigen Parteistrategen mit einem teuren Maßanzug und einer billigen Zigarre. Vor ihm Männchen zu machen konnte unmöglich angenehm gewesen sein. Sachs hatte den größten Teil der zehn Jahre damit verbracht, über die Witze dieses Knilchs zu lachen. Zu seinen Partys zu gehen. Bei ihm den »angesehenen Psychiater« zu spielen, mit dem er bei seinen Freunden Eindruck machte. Ganz zu schweigen von seinen Gutachten in Gerichtsprozessen, an denen Juliana ein besonderes Interesse hatte. Und schließlich hatte er cs geschafft, zum Direktor von Impellitteri ernannt zu werden. Stolzer Herrscher über die grün gestrichenen Backsteinmauern, die sparsam möblierten Krankensäle, die tristen Aufenthaltsräume. Der furchtlose Anführer eines Stabes weggelobter Ärzte und halbgebildeter Therapiehelfer und kampferprobter Krankenschwestern mit finsteren Mienen. Die Königspython in der Schlangengrube der City.
Und für all das war Conrad ihm einiges schuldig. Er hatte Sachs vor rund fünfzehn Jahren kennengelernt, als sie beide am nyu Medical Center arbeiteten. Damals hatte er ihn auch nicht besonders gemocht. Aber vor fünf Jahren behandelte Conrad einen manisch-depressiven Teenager namens Billy Juarez. Billy war völlig mittellos und zunehmend gewalttätig. Er hatte bereits einen Lehrer verprügelt, der ihn nach einer Entschuldigung für sein Fehlen gefragt hatte. Er redete häufiger davon, sich eine Pistole zu kaufen. Billy mußte in ein Krankenhaus eingewiesen und behandelt werden, und er hatte kein Geld, um das zu bezahlen. Conrad fürchtete, daß er deshalb in einer der öffentlichen Institutionen landen und dort untergehen würde. Dann begann der Staat mit einem Testprogramm, in dessen Verlauf Patienten von Impellitteri in ein angenehmes Privatsanatorium in der Nähe von Harrison verlegt wurden. Das Programm sah außerdem eine Behandlung mit Lithium vor. Conrad hatte Jerry Sachs angerufen und ihn an ihre gemeinsame Zeit erinnert. Er hatte um einen Platz für Billy Juarez gebeten, und Sachs hatte entsprechende Schritte unternommen.
Daher war er ihm etwas schuldig. Und so meinte er: »Etwas auf meinem Gebiet, häh?« Er schaffte es nicht, seine Stimme begeistert klingen zu lassen, aber er machte in der Richtung weiter. »Also das interessiert mich, Jerry. Ich bin zwar im Augenblick beschäftigt, aber ich -«
»Komm schon, Nate!« meinte Sachs in einem barschen, kumpelhaften Ton, den Conrad verabscheute. »Du kannst doch nicht dauernd da drüben auf der cpw hocken und nur die reichen Schnepfen behandeln, denen es zu langweilig ist, ihr Geld zu zählen. Obgleich ich so eine Ahnung habe, daß ihr Privatgelehrten für solche Fälle genau die richtige Therapie wißt.«
Ja, genauso wie ihr politischen Speichellecker wißt, was man gegen Berufsethos tun muß, dachte Conrad. Aber er schwieg. Nach einer Weile hörte Sachs auf, über seinen eigenen Witz zu lachen, und fuhr fort.
»Aber mal ernsthaft, Nathan, es geht um eine aufregende Sache. A 330-20.«
»Eine gerichtliche Angelegenheit?«
»Sie ist gerade durch die Zeitungen und durchs Fernsehen gegangen.«
»Aha«, sagte Conrad freudlos. »Sie war also schon in den Zeitungen und so weiter.«
»Ja, natürlich. Vor etwa drei Wochen. Erinnerst du dich an den Elizabeth-Burrows-Fall? Erzähl mir nur nicht, daß du schon so weit darüberstehst, daß du noch nicht mal mehr die Schlagzeilen liest, oder?«
»Äh ...«
»Also, das Gericht hat sie uns für dreißig Tage zur Beobachtung geschickt, um zu prüfen, ob ihr der Prozeß gemacht werden kann. Sie ist achtzehn. Die Diagnose lautet auf paranoide Schizophrenie. Sie leidet unter auditiven Halluzinationen, schweren Wahnvorstellungen, und außerdem neigt sie zu Gewaltausbrüchen.«
»Das klingt mir nach einer Drogensüchtigen.«
»Wir können nichts Derartiges feststellen.«
»Tatsächlich. Aber sie ist gewalttätig.«
»Und wie.« Sachs stieß einen leisen Pfiff aus. »Und jetzt hör zu. Ich fange also an, ihr Fragen zu stellen, klar? Alles läuft prima, besser als prima. Sie mag mich, sie hört gar nicht auf zu reden. Und dann, plötzlich, der große Knall. Sie bekommt, wie es so schön heißt, einen manischen Schub. Das heißt, sie flippte völlig aus, Mann. Stürzte sich auf mich. Erwürgte mich fast, ehe jemand mir zu Hilfe kam und sie ruhigstellte. Dabei ist sie nur eine kleine Frau, Nate. Wirklich, du würdest ihr diese Kraft niemals zutrauen. Vier Leute waren nötig, sie wegzubringen und einzuschließen, plus zwei weitere, um sie zu fesseln. Als wir sie wieder rausließen, war die ganze Zeit zur Sicherheit eine Helferin bei ihr, ein Brocken von zweihundert Pfund Lebendgewicht, und selbst die hatte eine heillose Angst vor der Kleinen. Schließlich, nachdem wir genügend Drogen in unsere Miss Crazy Lady gepumpt haben, um einen Elefanten schlafen zu legen, bringe ich sie in eine dieser forensischen Einzelzellen. Und was passiert? Sie wird schlagartig katatonisch. Bewegt sich nicht mehr, redet nicht, sitzt nur da und starrt vor sich hin ...«
Conrad schnaubte. »Prima, Jerry. Ich komme sofort mit meinem Großen Wahnvorstellungs-Vernichter vorbei. Mal ernsthaft, was soll ich mit ihr machen?«
»Nichts. Wir versuchen nicht, sie zu heilen, Mann. Wir brauchen jemanden, der sie zum Reden bringt. Der entscheidet, ob sie vor Gericht gestellt werden kann, und der darüber einen Bericht schreibt.«
»Dann schick doch einen deiner forensischen Typen zu ihr. Dafür sind die doch da. Hör mal, in einer Minute habe ich eine Patientin. Können wir nicht ...?«
»Ach, sag ihr, sie soll ihr Höschen noch für einen Moment anbehalten«, sagte Sachs. Er kicherte. »Nein, im Ernst. Wirklich ... Du warst doch an den Untersuchungen an der Columbia Press vor drei Jahren beteiligt, nicht wahr? Über Katatoniker. Gleiche und ähnliche Fälle; du hast tolle Ergebnisse erzielt. Die Science Times hatte darüber geschrieben, Nathan. Du hast einen hervorragenden Ruf ...«
Eine Pause entstand. Conrad saß schweigend da und schüttelte den Kopf.
Dann meinte Sachs: »Es ist ein großer Fall, Nate. Was meinst du denn, warum ich damit befaßt bin? Die Bosse beobachten mich. Die Zeitungen ebenfalls. Du hast den Namen, der der Angelegenheit in deren Augen ein ganz anderes Gewicht verleiht.« Und als Nathan noch immer nicht antwortete, sagte Sachs: »Du würdest mir einen Gefallen tun, Nate. Ganz bestimmt. Wirklich.«
Conrad sah wieder auf die Uhr: 9:34. Mrs. Fefferman wurde sicherlich schon unruhig. Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Weshalb, äh ... wegen was wurde sie verhaftet?«
Sachs brach in lautes Gelächter aus – halb triumphierend, halb erleichtert. »Junge, du liest wirklich keine Zeitungen, was? Der Burrows-Fall. Elizabeth Burrows? Sie hat einen Mann umgebracht. Hat ihm die Kehle durchgeschnitten. Gütiger Himmel, sie hat das arme Schwein regelrecht zerlegt.«
Agatha
Conrad war ein zierlicher Mann, klein und dünn mit abfallenden Schultern. Er hatte ein rundes, melancholisches Gesicht: tiefe, sanfte braune Augen und kräftige, an den Winkeln nach unten gezogene Lippen, die ihm einen nachdenklichen und ernsten Ausdruck verliehen. Ein paar Strähnen strohblonden Haares lagen schlaff quer über seinem Kopf, doch die meisten Haare waren längst verschwunden. Er war vierzig Jahre alt.
Er spürte diese Jahre, jedes einzelne. Abgesehen von seinem einstündigen Fußweg jeden Morgen zur Arbeit betätigte er sich niemals körperlich. Er fühlte sich oft müde; als knirschten seine Gelenke. Nach einem Leben, in dem er stets gut gegessen hatte, ohne zuzunehmen, entwickelte er nun einen deutlichen Bauch. Und manchmal – nun, sehr oft – na ja, so gut wie fast jeden Tag – ertappte er sich dabei, wie er in seinem Lehnsessel einschlief, nachdem er den Joghurt und die Nüsse verzehrt hatte, die seine Frau ihm immer zum Mittagessen einpackte.
An einem Tag wie diesem konnte es besonders hart sein. Angefangen mit Timothy, hatte er von acht Uhr morgens bis halb acht abends fast ständig nur in seinem Lehnsessel gehockt. Er hatte den ganzen Tag ohne nennenswerte Pausen dazwischen seinen Patienten zugehört. Das hatte ihn geschafft.
Nach dem Essen hatte er zwei Aspirin geschluckt. Daraufhin hatte das Blinken in seinem Auge aufgehört, und der Kopfschmerz war verflogen. Aber sein rechtes Bein: das hatte zu schmerzen begonnen. Als er Feierabend machte und das Gebäude verließ, humpelte er.
Er ging zum Gehsteigrand und wartete auf ein Taxi. Der Verkehr floß zügig über die Central Park West. In der Kühle des Oktoberabends funkelte das Grün der Verkehrsampeln die ganze breite Straße hinauf. Auf der anderen Straßenseite, im Park, schüttelten die Äste der Platanen ihr welkendes Laub gegen den Himmel. Einige Blätter fielen auf den Gehsteig oder taumelten und tanzten über der Parkmauer durch die Luft. Conrad hielt inne und schaute ihnen zu.
Die Schmerzen in seinem Bein waren wieder schlimm, dachte er. In seinem Knie pochte es. Er mußte daran denken, tagsüber öfter aufzustehen, herumzugehen, es zu strecken.
Es war eigentlich Agathas Schuld, dieses Knie, dachte er. Sie war es, die ihn derart zum Krüppel gemacht hatte.
Aber der Gedanke daran ließ ihn lächeln, während er den fallenden Blättern zusah.
Er hatte Agatha kennengelernt, als er siebzehn war. Damals hatten sie zum ersten Mal seine Mutter abgeholt. Mutter war gerade mit einer vollen Einkaufstüte aus der Grand Union gekommen. Sie war über irgendetwas gestolpert – vielleicht war sie auch zusammengebrochen. Egal wie, auf jeden Fall war sie hinter dem Parkplatz auf den Gehsteig gestürzt. Dabei hatte sie die Einkaufstüte fallengelassen. Rote Tomaten, gelbe Zitronen und silberne Thunfischdosen waren herausgepurzelt und funkelten in der Sonne. Eine andere Frau und die Kassiererin aus dem Eisenwarenladen nebenan waren herausgelaufen, um ihr zu helfen. Aber Mom hatte nur dagelegen und gezittert. Ihr Mund klaffte auf, Speichel rann an der Seite heraus, und sie starrte in die braune Papiertüte, die auf dem Bürgersteig vor ihr lag. Sie starrte auf den Eierkarton darin. Sie sah die zerbrochenen Eierschalen herausbaumeln. Sie sah, wie das Eigelb auf dem braunen Papier auseinanderfloß. Und sie begann zu schreien.
Die Hausfrau versuchte sie zu beruhigen. Die Kassiererin versuchte sie festzuhalten. Aber Mom wand und krümmte sich und schrie und stöhnte furchtbar. Als sie in die Tüte blickte, hatte sie einen Karton voller Augen gesehen. Sie hatte gesehen, wie diese Augäpfel vor ihr aufgeplatzt waren. Blut war aus ihnen herausgelaufen – zähflüssig, rot –, gefolgt von schwarzen Spinnen, die aus den zerbrochenen Pupillen kletterten. Mom schrie und schrie. Sie war mit solchen Dingen nicht vertraut. Soviel sie auch in den vergangenen zwölf Jahren getrunken hatte, dies war das erste Mal, daß sie das Delirium tremens erlebte.
Der siebzehnjährige Nathan erschien als erster im Krankenhaus. Er war gerade erst aus der Schule gekommen, als er angerufen wurde. Er hatte noch nicht einmal Zeit gehabt, seinen Mantel auszuziehen. Er sprang sofort wieder in seinen uralten Chevy, für den er den ganzen Sommer lang gearbeitet hatte, und raste zum Krankenhaus. Er war es auch, der dann am Bett seiner Mutter saß und ihr zuhörte, als sie vor Angst und Scham weinte. Er saß da und strich ihr das Haar aus dem grauen Gesicht – diesen schmalen, einst edlen Zügen mit der schlanken, geraden Patriziernase. Sie war so stolz auf ihre Nase. Es war keine jüdische. »Mein Vater hat es nicht zugelassen, daß wir unter Juden lebten«, sagte sie würdevoll. Und sie reckte dabei ihr Kinn in die Luft, zeigte ihren schwanengleichen Hals und ihre schlanke Gestalt.
Nathan hielt ihre Hand. Ihre Haut war so blaß, daß er die dunkle Nadel der intravenösen Kanüle in ihrer Vene sehen konnte. Sie weinte in einem fort, während Nathan bei ihr saß.
Der gute alte treue Nathan. So nannte sein Vater ihn immer. Sein Dad – der sich eine Stunde lang nicht blicken ließ. Nathan vermutete, daß Dad sich bewußt Zeit ließ, seine Praxis zu verlassen. Er war ein vielbeschäftigter Mann, ein Zahnarzt, aber dennoch ... Dad erwartete von Nathan, daß er bereits die wichtigsten Dinge geregelt hatte, ehe er selbst am Ort des Geschehens erschien. So könnte Dad dann, wenn er endlich eintraf, erleichtert lächeln und Nathan auf die Schulter klopfen. »Na siehst du, so schlimm ist es ja gar nicht«, würde er sagen. Dabei würde sein blasses Gesicht ein Grinsen zeigen, und seine kleinen Augen würden hinter den großen Brillengläsern funkeln. »Kein Grund zur Panik, nicht wahr?«
Und Nathan würde krampfhaft schlucken und erwidern: »Stimmt schon, Dad.« Und Dad würde wieder müde lächeln und sich dann traurig abwenden.
Nach einer Stunde traf Dad schließlich ein. Nathan ließ ihn an Moms Bett zurück und ging in die Krankenhauscafeteria, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Er setzte sich an einen Tisch in einer Ecke und starrte brütend auf den fleckigen Becher aus dem Automaten. Nach etwa zehn Minuten hob er den Kopf. Und da war Agatha.
Sie trug die rot-weiß gestreifte Tracht der freiwilligen Krankenhaushelferinnen. Und als reichte ihre lebhaft gemusterte Kleidung nicht aus, hatte sie auch noch eins der fröhlichsten Gesichter, die Nathan je gesehen hatte. Runde Wangen, die sich röteten, während sie lächelte, und strahlend blaue Augen, die noch stärker leuchteten. Ihr braunes Haar hatte sie unter ihre rot-weiße Haube gesteckt, doch Nathan konnte erkennen, wie kräftig und voll es war. Er konnte sich vorstellen, wie es ihr Gesicht einrahmte und ihren Teint hervorhob, der genauso rot und weiß war wie ihre Kleidung.
Nathan war ein schüchterner Junge; manche hätten ihn sogar für verschlossen gehalten. Er hatte nur einen einzigen Freund – Kit, seinen treuen Gefährten seit der Grundschule. Er hatte noch nie eine Freundin gehabt. Er hatte sich einige Male hintereinander mit Helen Stern verabredet und war mit ihr ausgegangen, doch sie hatte die Beziehung abgebrochen, als er es ›zu ernst‹ meinte. Im Großen und Ganzen hielt er die Vertreterinnen des anderen Geschlechts für ziemlich albern und mehr als unzuverlässig.
Er hatte Agatha noch nie gesehen, und er hatte keine Ahnung, was sie so interessiert betrachtete. Ihr Lächeln und der offene Blick dieser Augen verunsicherten ihn. Beinahe hätte er über die Schulter geschaut, um sich zu vergewissern, daß sie nicht doch jemand anderen ansah.
Aber Agatha – so lautete der Name auf dem schwarzen Schild auf ihrer Brust, das er kaum zu betrachten wagte, aus Angst, daß sein Blick dann wie festgesaugt auf der vollen Wölbung ihrer rot-weißen Bluse hängenblieb –, aber Agatha sprach ihn direkt an.
»Weißt du, du kannst sie nicht retten«, sagte sie. »Niemand erwartet von dir, daß du das schaffst.«
Die Worte trafen so genau ins Schwarze, daß er den inneren Drang verspürte, ihre Richtigkeit zu leugnen. Er starrte auf seine Plastiktasse und murmelte dumpf: »Ich versuche ja gar nicht, irgendjemanden zu retten.«
Zu seiner Überraschung streckte sie eine Hand aus und legte sie auf sein Handgelenk. Ihre Finger waren kühl und weich. »Du versuchst jeden zu retten«, sagte sie leise. »Ich habe dich schon oft gesehen. Ich gehe auch auf die North. In die elfte Klasse. Ich habe dich im letzten Semester mit Mr. Gillian über diesen Jungen diskutieren hören, der im Sport durchgefallen ist.«
»Ach, Gillian ist ein Widerling«, murmelte Nathan. »Er hat den Jungen fast zum Weinen gebracht.«
»So, wie du ihn beschimpft hast, hättest du von der Schule fliegen können. Und dann habe ich dich auch auf dem Hof beobachtet – kurz vor den Osterferien –, da hast du zwischen Hank Piasceki und einem viel kleineren Jungen gestanden. Hank Piasceki ist mindestens doppelt so groß wie du. Und er kann gut boxen.«
Nathan mußte gegen seinen Willen lächeln. Das war von ihm tatsächlich sehr tapfer gewesen. Aber er versuchte es als unbedeutend abzutun. »Ich hatte nicht vor, mich mit ihm zu prügeln. Piasceki kann mich gut leiden. Ich hab’ ihm im vergangenen Jahr bei der Biologieprüfung geholfen.«
Agatha lächelte ihn wieder an, und in ihren blauen Augen schien ein Funke zu tanzen. »Siehst du, was ich meine?« fragte sie.
Nathan sah sie an. Sie lachte. Er lachte auch.
Conrad wuchs in Great Neck auf Long Island auf, etwa fünfzehn Meilen von Manhattan entfernt. Es war ein sauberer und hübscher Vorort mit ausgedehnten grünen Rasenflächen und großen weißen Häusern. Die meisten Menschen, die dort wohnten, waren wohlhabend und Juden, so wie er. In ihren politischen Ansichten waren sie gemäßigt liberal und verhielten sich im Großen und Ganzen konservativ. Was freie Liebe, Drogen und die Antikriegsbewegung betraf, so drangen diese Erscheinungen erst ganz zaghaft durch die ersten Risse der Gesellschaft herein, obgleich man sich in der Mitte der Sechziger Jahre befand. Sie waren anfangs nur für einige Rebellen interessant, für Problemkinder, Ausgestoßene, mehr nicht.
Nathan interessierte sich jedoch nicht dafür. Er wollte nichts davon wissen. Er wollte Arzt werden – Chirurg. Er hatte keine Zeit für irgendwelche Modeerscheinungen oder anderen Unfug. Als er zum ersten Mal einen älteren Studenten in Jeans mit ausgestellten Hosenbeinen sah, grinste er spöttisch und schüttelte abfällig den Kopf und blickte hilfesuchend zum Himmel – und eilte dann nach Hause und setzte sich hinter seine Bücher. Die meisten seiner Klassenkameraden dachten und verhielten sich genauso – zumindest vorerst.
Aber Agatha war anders. Zum einen war sie keine Jüdin. Und zum anderen war sie bei weitem nicht so wohlhabend. Ihr Vater arbeitete im städtischen Straßenamt, und die Familie wohnte in der Steamboat Road. Die Steamboat war eine lange, kurvige Zeile aus heruntergekommenen Baracken, kleinen Geschäften, Läden für Autoersatzteile, Bars und ähnlichem. Die Hausmädchen der Stadt wohnten dort, sehr viele von ihnen, und die Tankstellenhelfer, die Gärtner: kurz, die Neger. Und am Ende, unweit des Kings Point Park, hatte sich eine kleine Enklave von polnischen und irischen Familien zusammengefunden. Dort stand Aggies grünes, zweistöckiges, mit Schindeln gedecktes Haus.
Nathan achtete damals wenig auf kulturelle Unterschiede. Alle Kinder gingen zur Schule und waren für ihn im Großen und Ganzen gleich. Es war auch nicht so, daß er eins von ihnen besonders gemocht hätte. Daher dauerte es mehrere Monate, bis ihm bewußt wurde, daß Agathas Nachname O’Hara lautete und sie wahrscheinlich irische Vorfahren hatte. Der Gedanke ging ihm kurz durch den Kopf und war gleich wieder vergessen.
Aber was ihm auffiel, war, daß das Leben bei den O’Haras in der Steamboat Road nicht genauso war wie das Leben bei den Conrads in der Wooley’s Lane. Aggies ältere Schwester, Ellen, war zum Beispiel tatsächlich von der High School abgegangen. Sie hatte einfach aufgehört und wohnte nicht mehr zu Hause und arbeitete als Kosmetikerin in der Middle Neck Road. Und Mr. O’Hara, ein massiger rauher Bursche mit silbernem Haar, meinte manchmal, wenn er ein oder zwei Bier getrunken hatte, daß Mr. President Lyndon Johnson nichts anderes sei als ein mieses, verlogenes Arschloch und daß John F. Kennedy, möge er in Frieden ruhen, auch nicht viel besser gewesen sei! Woraufhin Mrs. O’Hara dann schrie – sie schrie tatsächlich aus der Küche: »Unterlaß das unflätige Gerede vor den Kindern!« Und ihr Mann brüllte dann zurück: »Wer hat dich denn gefragt?« und stürmte aus dem Haus und knallte die Verandatür hinter sich zu.
Nathan summte der Kopf. Weiß Gott, seine Mutter trank eine Menge. Aber niemand in seiner Familie brüllte jemals. Oder brach einfach die Schule ab. Oder wählte die Republikaner. In was war er da hineingeraten?
Und dann war da Agatha selbst. Wenn sie nicht ihre gestreifte Tracht trug, dann zog sie, wie sich herausstellte, nicht nur Jeans an, sondern auch batik-gefärbte T-Shirts. Und Wildlederwesten, die ihren Bauch freiließen. Und manchmal nicht mal einen Büstenhalter, obgleich ihre Brüste groß und rund und schwer waren und er ihre nackten Brustwarzen sehen konnte, die sich, um Himmels willen, durch den Stoff ihrer Bluse drückten.
Sie rauchte Zigaretten – mit sechzehn, direkt vor ihren Eltern. Und mit ihm allein in dem kleinen Apartment über der Familiengarage, in dem sie wohnte, bot sie ihm seine erste Kostprobe Marijuana an – die Nathan entschieden ablehnte.
Aber er reagierte nicht so tugendhaft, als sie, während er ihr den ersten Gutenachtkuß gab, seine Hand in ihre Bluse schob. Oder als sie, nur zwei Monate, nachdem sie angefangen hatten, sich regelmäßig zu sehen, vorschlug, miteinander zu schlafen.
Sie waren beide noch unberührt. Aber Aggie hatte eine Menge Erfahrung und eine ältere Schwester, die sie aufgeklärt hatte. An jenem ersten Nachmittag, oben in ihrem Garagenapartment, war sie sehr ruhig – gelassen –, während sie sich vor ihm auszog. Nathan saß auf der Kante eines alten Sessels und hatte die Hände zwischen die Oberschenkel geklemmt. Er erschauerte, als er ihr zusah.
Agatha war ein kleines Mädchen, sogar noch kleiner als er. Doch sie war stämmig und rund, mit breiten Hüften und diesen Brüsten, wundervollen Brüsten, mit lachsfarbenen Warzenhöfen, groß wie Silberdollars. Bis zu diesem Tag konnte Conrad sich an die fließende Weichheit ihres Fleisches und an den Geruch von Ammens Babypuder und ihre kleinen, einladenden Küsse erinnern. Er entsann sich jenes Nachmittags in allen Einzelheiten – und an all die anderen Nachmittage ihres ersten gemeinsamen Frühlings. An das kleine Zimmer mit der niedrigen Decke. An das alte Klappsofa, das sich in ein Bett verwandeln ließ. An die Schreie, die sie mit dem Handrücken erstickt hatte. An das Gezwitscher der Spatzen, die sich auf der rostigen Schaukel im kleinen Hof versammelten.
Vorwiegend jedoch erinnerte er sich an das Klappsofa. An diese verdammte Bettcouch.
Es war ein Castro-Modell; uralt, wie es schien, noch aus grauer Vorzeit. Die Matratze war schmuddelig. Sie war dünn. Sie knarrte und war durchgelegen. Nathan konnte die Sprungfedern und die stählernen Stützstangen des Klappmechanismus deutlich spüren. Vor allem spürte er die Stahlstange, die sich direkt durch die Mitte des Möbels spannte. Ganz gleich, wo Aggie lag – egal, wie er sie verschob oder wohin er sie drehte –, sobald er sich auf sie rollte, schnitt diese Stange in sein Knie.
Es schien nur ein geringer Preis zu sein, den er zahlen mußte. Für die Berührung dieser Lippen, für die Süße dieser Brüste. Für das Gefühl intensiver Wärme in dem vibrierenden Tal zwischen ihren Beinen. Manchmal war sein Knie so wund, daß er es kaum schaffte, die kurze Treppe zu der kleinen Wohnung hinaufzusteigen. Aber er brachte es doch immer wieder fertig. Und nur wenige Augenblicke später lag er schon wieder auf ihr, in ihr, stieß zu, während sie aufschrie, und er achtete nicht mehr darauf, daß er, ganz gleich, wie er es arrangiert hatte, in die einzige Position gerutscht war, die die alte Matratze erlaubte, nämlich mit dem Knie auf der gottverdammten Stange.
Dreiundzwanzig Jahre später, als das Taxi vor ihm am Bordstein hielt, mußte Dr. Nathan Conrad sich rückwärts in den Sitz sinken lassen und das rechte Bein nachziehen.
Das Taxi fädelte sich in den zügig fließenden Verkehr ein. Der Fahrer, ein dunkelhäutiger Mann mit verkniffenen Lippen, sah ihn durch den Rückspiegel fragend an.
»Sechsunddreißigste«, sagte Conrad. »Zwischen Park Avenue und Madison.«
Conrad lehnte sich müde zurück und schaute aus dem Fenster. Er sah die Parkmauer vorbeihuschen und die spinnenartigen Äste der Bäume darüber. Geistesabwesend massierte er sein schmerzendes Knie. Er versuchte es zu strecken, bewegte seinen Fuß in dem begrenzten Raum, der ihm zur Verfügung stand, vor und zurück. Er mußte wirklich daran denken, öfter aufzustehen und umherzulaufen. Es wurde immer dann so schlimm, wenn er den ganzen Tag im Sessel zubrachte.
Er hatte sich einfach nicht von Agatha fernhalten können, das war der Punkt. Er hatte das Bett nicht austauschen können. Er hatte kein anderes Zimmer gefunden. Oder etwas anderes tun können, das die Zeit verkürzt hätte, die er mit ihr verbrachte.
Am Ende, kurz vor seinem achtzehnten Geburtstag, war sein Knie angeschwollen. Als er endlich seine Scham überwand und zum Arzt ging, hatte es die Größe eines kleinen Kürbisses und wuchs noch weiter. Der gute alte Dr. Liebenthal. Er hatte Nathan schon immer behandelt – hatte ihm bei seinen ersten Zähnen geholfen, ihm die Platzwunde an der Stirn genäht, als er aus seinem Tarzanbaumhaus abgestürzt war, und so weiter. Er hatte sich das Knie angeschaut und das Kinn gerieben und ratlos den Kopf geschüttelt.
»Das sieht aus wie eine ganz schlimme Schleimbeutelentzündung«, hatte er gesagt. »Allerdings findet man so etwas meistens bei älteren Leuten. Leuten, die häufig knien, wie zum Beispiel Putzfrauen oder Handwerker, weißt du? Und du meinst, du hast keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist?«
Und Nathan hatte die Hände gespreizt und den Kopf geschüttelt. »Es ist mir ein totales Rätsel, Doc.«
Später hatten er und Aggie auf dem Fußboden gesessen und gelacht, bis sie Bauchschmerzen hatten. Und dann waren sie wieder ins Bett gekrochen und hatten sich erneut aufeinander gestürzt.
Das Taxi gelangte zum Ende des Parks. Conrad gewahrte die marmorne Columbia – eine heroische Frauengestalt, die im Bug eines Schiffs stand –, wie sie ihn grüßte, als er am Maine Memorial vorbeifuhr. Dann rollte das Taxi durch die dunkle Einfahrt in den Broadway, ein kurzes, schäbiges Straßenstück vor dem gleißenden Neongewitter des Times Square.
An der Dreiundfünfzigsten Straße stoppte das Taxi vor einer roten Ampel. Conrad, der sein Kinn in eine Hand stützte, betrachtete geistesabwesend durch das Fenster ein Prostituiertentrio. Eine war schwarz, die beiden anderen weiß. Alle drei trugen Lederröcke, die kaum die Oberschenkel bedeckten. Alle trugen sie auch hautenge, glitzernde T-Shirts, die, wie Conrad es vorkam, für das kühle Herbstwetter viel zu dünn waren. Farouk blickte hoffnungsvoll in den Rückspiegel.
»Hey, Mister«, sagte er. »Wollen Sie ’ne Nummer machen?«
Conrad betrachtete weiterhin die Nutten. Er dachte an Agatha. Er lächelte.
»Ja, das möchte ich«, sagte er leise. »Fahren Sie mich nach Hause.«
Jessie
Das Taxi setzte ihn in der Sechsunddreißigsten Straße Ost ab. Es war ein eleganter Block zwischen Madison und Park Avenue. Die nördliche Seite wurde von der J.-P.-Morgan- Bibliothek eingenommen. Es war ein langgestreckter, stattlicher tempelähnlicher Bau mit einem palladianischen Portalvorbau, der von steinernen Löwinnen flankiert wurde. Seine Scheinwerfer, die soeben eingeschaltet worden waren, verstärkten in der Abenddämmerung den reliefartigen Charakter der Fassade. Friese und Skulpturen leuchteten durch die Platanen, die den Gehsteig säumten.
Conrad betrat das gegenüberliegende Gebäude auf der anderen Straßenseite: einen verwitterten, vor dem Krieg erbauten Klinkerturm, einen halben Block lang und vierzehn Stockwerke hoch. Der alte Portier erhob sich mühsam von seiner Bank, als Conrad durch die Glastüren trat.
»Guten Abend, Doc.«
Conrad lächelte und humpelte an ihm vorbei. Am Ende der Halle sah er, daß eine der Fahrstuhltüren offenstand.