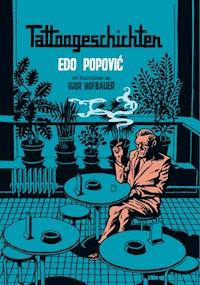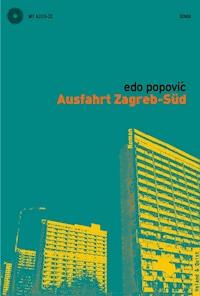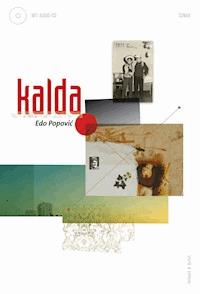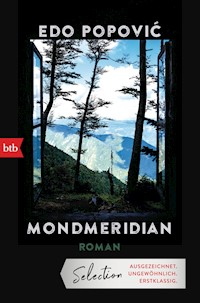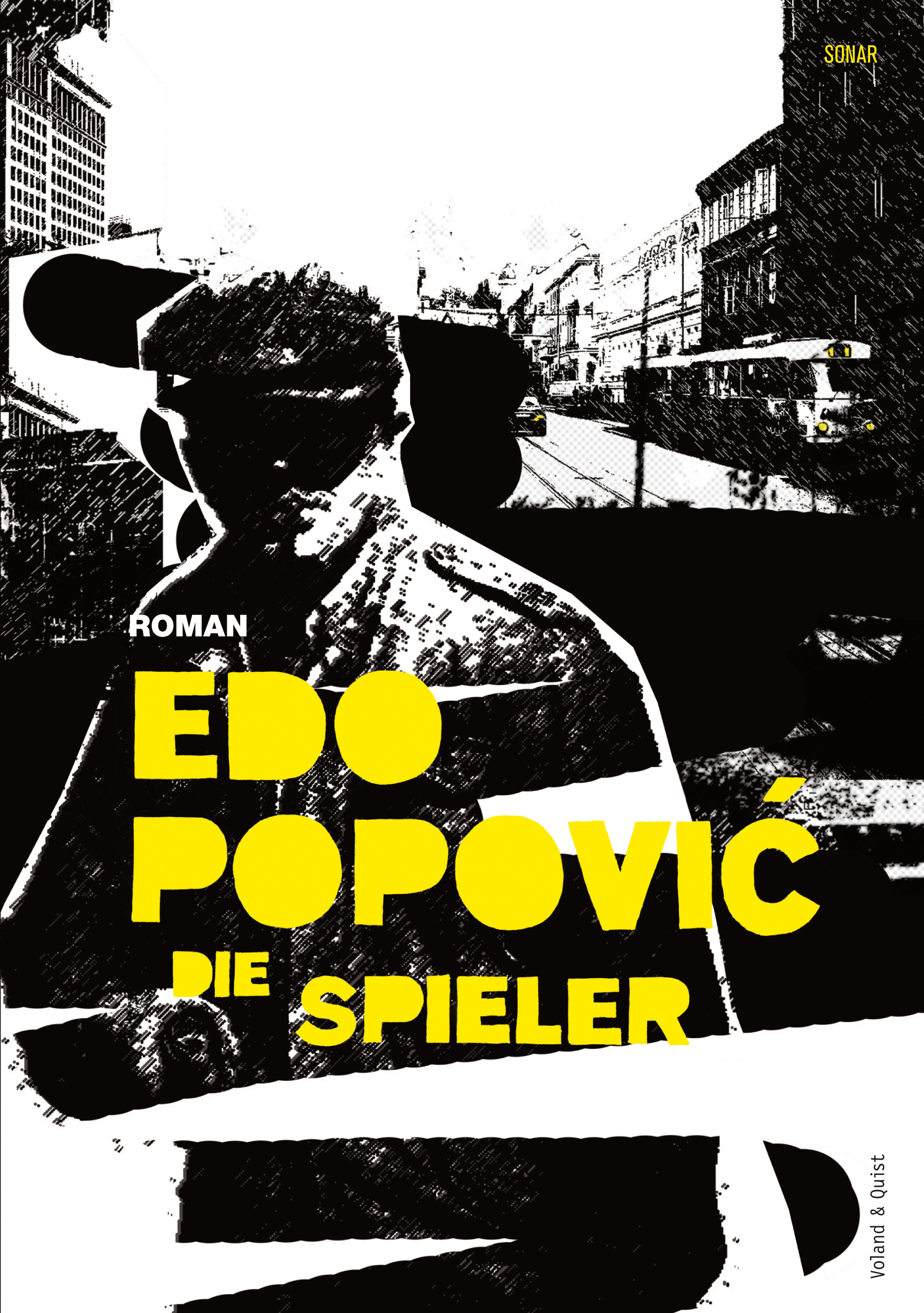13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Ein poetischer Ratgeber, der uns lehrt, was wir selbst und die Welt zum Überleben brauchen
»Beim Gehen werden wir die eigenen Schritte hören und auch den eigenen Atem und das eigene Herz, und wenn wir uns vollständig entspannen, werden wir auch unsere eigenen Gedanken hören.« In seinem poetisch-philosophischen Essay »Anleitung zum Gehen« versammelt Edo Popovic´ alles, was er in fünfzig Jahren an Weisheit über die Menschheit und ihr oft selbstzerstörerisches Wesen zusammengetragen hat. Über uns, die wir uns benehmen wie Hamster im Laufrad. Die wir rennen, so lange wir Kraft haben, um irgendwann einfach zu erlöschen. Wir sind in Eile. Und wir beschleunigen ständig. Wer nicht beschleunigt, ist verdächtig.
Edo Popovic beschreibt diesen ständigen Drang zur Selbstoptimierung als einen Hunger, der uns verunstaltet, uns in Automaten zum Verdienen und Verbrauchen verwandelt hat. Von diesem Hunger befreien seine klugen, erfahrungsreichen Texte. Und sie lehren uns: Das, was wir tatsächlich brauchen, wird nicht beworben, es findet sich nicht in Schaufenstern und ist nicht mit Geld zu kaufen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Ähnliche
Aus dem Kroatischen von Alida Bremer
Luchterhand Literaturverlag
In seinem poetisch-philosophischen Essay Anleitung zum Gehen versammelt Edo Popović alles, was er in fünfzig Jahren an Weisheit über die Menschheit und ihr selbstzerstörerisches Wesen zusammengetragen hat. Über uns, die wir uns benehmen wie Hamster im Laufrad. Die wir rennen, solange wir Kraft haben, um irgendwann einfach zu erlöschen. Wir sind in Eile. Und wir beschleunigen ständig. Wer nicht beschleunigt, ist suspekt.
Edo Popović beschreibt diesen ständigen Drang zur Selbstoptimierung als einen Hunger, der uns verunstaltet und uns in Automaten zum Verdienen und Verbrauchen verwandelt hat. Von diesem Hunger befreien seine klugen, erfahrungsreichen Texte. Und lehren uns: Das, was wir tatsächlich brauchen, wird nicht beworben, es findet sich nicht in Schaufenstern und ist nicht mit Geld zu kaufen.
Edo Popović, geb. 1957, lebt in Zagreb. Mit seinen Romanen Mitternachtsboogie, Der Aufstand der Ungenießbaren, Ausfahrt Zagreb-Süd und Stalins Birne, seinen Erzählbänden und Essays wurde Edo Popović zu einem der aufregendsten osteuropäischen Erzähler.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel Prirucnik za Hodace bei Naklada LJEVAK, Zagreb.
Der Verlag dankt dem Ministerium für Kultur der Republik Kroatien für die Unterstützung der Übersetzung.
Luchterhand Literaturverlag
© 2009 by Edo Popović
© 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Fotos: Edo Popović
Illustration: Carla Nagel
Satz: Andrea Mogwitz
E-Book-Umsetzung: Lorenz & Zeller, Inning a. Ammersee
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-15558-2V002
www.luchterhand-verlag.de
www.facebook.de / luchterhandverlag
www.twitter.com / luchterhandlit
Inhalt
Der erste Schritt
Beschleunigung
Das Parzellieren der Welt
Die Zeit
Liste überflüssiger Dinge
Die Stille
Notizen über das Verschwinden
Dem eigenen Schatten folgen
Das Velebit-Gebirge
Begegnungen mit der Wolke
Erdorgel
Pferde und Schmetterlinge
Der Meister Namenlos
Das Wasser
Die Karte der Wirklichkeit
Quellen
Literatur für Wanderer
Danksagung
Das Material für dieses Buch habe ich an Orten gesammelt, an denen ich mich in den letzten fünfzig Jahren aufgehalten habe. Auf einem Holzboot auf dem überfluteten Feld von Livno, Livanjsko Polje, als wir zu Beginn eines Frühlings wilden Gänsen die Eier gestohlen haben, an den Maksimir-Seen, wo wir in den Sechzigern gebadet und Ringelnattern gefangen haben, im Lärm und Rauch der Jugendklubs, Discos, Bars und Cafés, in nächtlichen Straßenbahnen, im Duft der Fichtenwälder, in den Wolken, die der Maestral-Wind zu den Gipfeln des Velebit-Gebirges emporhebt, in winzigen Hotelzimmern mit angeketteten Schwarz-Weiß-Fernsehern, an den mit schwarzen Kieselsteinen bedeckten Gestaden des Ägäischen Meeres, bei einer Nachtwache unter eisigem Mond, an den Wasserfällen von Krka und Zrmanja, deren sprühende Wassertropfen feinem Staub gleichen, im flimmernden Licht der U-Bahnen, im beißenden Geruch der Desinfektionsmittel in Krankenzimmern, im Frühlingswind, der vom Irischen Meer aufkam, in Warteräumen auf Bahnhöfen, auf Bergwiesen, in den Cafés der Duty-Free-Zonen, auf den welligen Teppichen aus Bergwacholder und Bergkiefern, immer entlang der trügerischen Grenze zwischen Meer und Festland, Himmel und Erde, Traum und Wachen, Leben und Tod. Immer das Gehen fortsetzend, denn – wie ich irgendwo gelesen oder gehört habe – der Tod folgt nur einen Schritt nach dem Leben.
Geschrieben habe ich dieses Buch in meiner Wohnung in Zagreb, in der Villa Cerrini in Graz und in der Küche der Einzimmerwohnung meiner Eltern in Münster in Westfalen. Ich hatte gute Arbeitsbedingungen, so dass ich keine Entschuldigung für seine Schwächen habe. Die Schwächen sind Bestandteil dieses Buchs.
Für Sven und Ljilja
»Wir sind alle verschieden und dennoch kommen wir alle zum Ziel.«
Ljuba Popović1
»Der Weg führt zu allen Orten, durch die er führt.«
Allan Watts2
Der erste Schritt
Es ist noch nicht lange her, dreieinhalb, vielleicht vier Millionen Jahre, dass sich in Laetoli, im heutigen Tansania, eine Kreatur auf ihre hinteren Gliedmaßen stellte und sich, stark gebeugt, auf den Weg machte. Sie wusste weder, wohin sie geht, noch was in der Zukunft auf sie warten würde. Sie lief nur.
Damals bestimmten die Sonne und der Mond den Rhythmus aller lebenden Wesen. Deshalb ist anzunehmen, dass Tag war, als der Gebeugte sich aufrichtete und losging. Es war nicht ratsam, nachts herumzuirren, denn nachts waren draußen größere und gefährlichere Wesen unterwegs. Eigentlich gab es damals noch kein »draußen« und »drinnen«. Der Gebeugte war kein Baumeister, er konnte sich noch nicht durch Mauern von der Umgebung abtrennen oder wenigstens einen Unterstand bauen. Er schlief irgendwo – im Gebüsch, unter einem Felsen, in einer mit Blättern abgedeckten Mulde. Er war noch nicht fähig, die Wesen und Dinge, die ihn umgaben, zu benennen, aber er konnte das Lebende vom Nicht-Lebenden unterscheiden, das Essbare vom Nicht-Essbaren. Er konnte auf hundert Meter Entfernung ein Nashorn oder einen Machairodus wittern und das Aufkommen eines Unwetters vorausahnen. Er zitterte, wenn er fror. Er schwitzte, wenn ihm warm war.
Sein Leben verlief eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn er Hunger hatte, aß er. Er fand Nahrung in der Natur. Er ernährte sich von Pflanzen, Früchten und Wurzeln, von Schnecken und Insekten, er jagte Reptilien und kleine Nagetiere, und wenn er Glück hatte, fielen ihm die Reste eines Festmahls größerer Jäger in die Hände. Den Rest des Tages hatte er für sich – er verdaute, er lauste und kraulte sich. Wenn er schlafen wollte, schlief er. Er jaulte, wenn er Schmerzen hatte. Oder wenn Hyänen und Raubkatzen ihn angriffen. Eine Überschwemmung, einen Blitz oder einen Vulkan fürchtete er wie den Teufel selbst – er hatte keine Ahnung, wie er mit diesen Erscheinungen umgehen sollte. Genauso wenig wie mit seiner Angst.
Anderthalb Millionen Jahre später lief der Gebeugte immer noch gebeugt, er war noch immer behaart, er jaulte noch immer und versteckte sich nachts noch immer in natürlichen Unterschlüpfen, wobei er Höhlen mied, da diese für vierbeinige Jäger reserviert waren. Doch er hatte die Zeit nicht vollständig vergeudet. Inzwischen hatte er gelernt, mit einem Stein auf einen anderen zu schlagen, damit verdiente er sich die Bezeichnung Mensch. Der geschickte Mensch. Homo habilis.
Vom Geschickten zum Aufgerichteten vergingen weitere vierhunderttausend Jahre. So lange dauerte es, bis das Gehirn des Geschickten das Gewicht von einem Kilogramm erreicht hatte. In dieses Kilogramm passten Speer, Feuer, ein Lederumhang und gebratenes Fleisch. Der Aufgerichtete wurde zum Jäger. Er war immer noch behaart, jaulte bei Schmerzen und schlief immer noch unter freiem Himmel.
Es sollten eine Million dreihunderttausend weitere Jahre vergehen, bis der Aufgerichtete zum Vernünftigen wurde. Das heißt, bis er begann, sein Gehirn für Dinge zu nutzen, die komplizierter als das Jagen waren (interessanterweise benutzen die Menschen bis heute einen großen Teil ihres Gehirns, das inzwischen anderthalb Kilogramm wiegt, um von ihrem Hochsitz aus durch ein Visier auf das Wild zu zielen und zu schießen. Das verlangt keine größere mentale Anstrengung als der Umgang mit einem Speer mit Steinspitze. Allerdings ist es physisch viel leichter, vom geringeren Risiko ganz zu schweigen). Der Vernünftige hatte bereits die Kunst des Sprechens entwickelt, er hat nähen gelernt und verstand es, sich in Höhlen zu verstecken, aber er jaulte immer noch, wenn er Angst und Schmerzen verspürte.
Die nächsten dreihunderttausend Jahre brauchte der Vernünftige, um säen zu lernen, sich mit Wolle und Baumwolle zu bedecken, Unterschlüpfe zu bauen, schreiben zu lernen und die Kraft des Wassers und des Wasserdampfes nutzbar zu machen.
So ist es auch heute.
Vier Millionen Jahre nach jenem paläolithischen Morgen in Laetoli, am Anfang des dritten Milleniums nach Christus, läuft der Nachkomme des Gebeugten immer noch auf der Erde herum, ohne zu wissen, wohin er geht oder was ihn in der Zukunft erwartet. Im Unterschied zu seinem Ahnen nimmt er die Nahrung nicht mehr aus der Natur, sondern tauscht sie gegen acht oder mehr Stunden schwere Arbeit pro Tag. Er hat meist seinen eigenen Unterschlupf, für den er Miete und Nebenkosten entrichtet oder Kredite abbezahlt. Er wacht morgens früh auf, aber seinen Rhythmus bestimmen nicht mehr Sonne und Mond, sondern seine Vorgesetzten. Er hat keine Zeit zum Verdauen, zum Entlausen, zum Kraulen. Auch er jault wie sein Vorfahre, aber nicht mehr nur dann, wenn er Schmerzen und Angst empfindet, sondern auch, wenn er wütend, verbittert, frustriert, verzweifelt oder erniedrigt ist. Der Vernünftige hat in den letzten paar Tausend Jahren so viele neue Gründe für das Jaulen gefunden und perfektioniert, dass es einen erstaunen kann. Er zittert noch immer, wenn ihm kalt ist, er schwitzt, wenn ihm warm ist, und er hat immer noch Angst. Auch in dieser Beziehung hat der Vernünftige seinen Vorfahren übertroffen: Außer vor Hyänen, Raubkatzen, Nashörnern, Bären und Blitzen fürchtet er sich vor der Zukunft, vor Kündigung, vor Gerichtsvollziehern und dem Tod.
Er hat außerdem die Fähigkeit zum Vorausschauen erworben. Er kann mit hundertprozentiger Sicherheit voraussagen, dass er auch morgen und auch an jedem weiteren Tag Hunger verspüren wird. Und dass er seine Notdurft verrichten muss. Allerdings hat er nicht gelernt, Erdbeben, Vulkaneruptionen und Tsunamis vorherzusehen oder die Kraft des Sturms und die Energie des Blitzes nutzbar zu machen.
Dafür hat er gelernt zu hasten. Immer schneller und schneller zu leben. Homo celer.
Beschleunigung
Wir sind in Eile. Und wir beschleunigen ständig. Das ist ein gesellschaftlich erwünschtes Verhalten. Wer nicht beschleunigt, ist verdächtig. Unproduktiv. Ein Parasit.
Die Beschleunigung existiert nicht erst seit gestern, sie wirkt seit 15 Milliarden Jahren. Die Evolution ist eine Geschichte der Beschleunigung – vom Urknall und den ersten Wasserstoff- und Heliumatomen, von den ersten thermonuklearen Explosionen der Sterne, die im Weltall neue Elemente und die ersten Galaxien ausspuckten, bis hin zu schnellen Bakterien, Geparden, bis zu Kimi Räikkönen und den Überschallflugzeugen.
Um was für eine Beschleunigung es sich handelt, können Sie sehr einfach erkennen – besuchen Sie eine Videothek und leihen Sie sich zwei James Bond-Filme aus. Dr. No von 1962 mit Sean Connery in der Hauptrolle und Casino Royale von 2006 mit Daniel Craig als Agent 007, zum Beispiel. Schauen Sie sich beide Filme genau an. In Casino Royale hat Bond es so eilig, das Ende des Films zu erreichen, dass er nicht einmal Zeit dafür hat, in Ruhe seinen trockenen Martini zu trinken. Shaken, not stirred. Die Szenen wechseln schnell, allein durch Augenzwinkern versäumt man so viele, dass man am Ende überhaupt nicht begreift, worum es geht.
Falls es dabei überhaupt um irgendetwas geht.
In der Natur ändern sich die Dinge mehr oder weniger schnell, alle Wesen haben ihren eigenen Rhythmus, und niemand hat es besonders eilig. Die Natur ist entspannt. Wann habt ihr je ein Tier in nervöser Eile und im Stress gesehen? Die Wesen der Natur beschleunigen ihren Bewegungsrhythmus nur in Extremsituationen, wenn sie jagen, wenn sie in Gefahr sind oder wenn sie durchdrehen.
Der Mensch ist ständig auf der Jagd oder in Gefahr oder dabei, durchzudrehen.
Der Mond, verwandelt in einen Hasen auf einem Waldweg in Lomska Duliba.
Das Leben und die Bedürfnisse des Hasen, den ich Ende Mai 2007 in Lomska Duliba auf dem Berg Velebit getroffen habe, haben sich seit der Zeit des Gebeugten nicht verändert. Er stand in der Kurve eines Waldweges, nur zwanzig Meter von mir entfernt, unbeeindruckt von dem Geräusch meines Autos, ohne jede Absicht zu fliehen.
Woher kommst du so früh, Freundchen? Der Hase ist ein Wesen der Nacht. Er sucht des Nachts nach Nahrung und Gesellschaft – die alten Kulturen zeigen ihn als einen geheimnisvollen Gefährten des Mondes, er taucht auf und verschwindet leise wie ein Schatten, auch der Mond selbst verwandelt sich manchmal in einen Hasen – wahrscheinlich hat eine ernsthafte Not ihn heute Morgen aus seinem Bau vertrieben. Der Hase weiß, wann er beschleunigen muss, wann er gelassen herumhüpfen und wann er sich ausruhen kann; wenn er das nicht wissen würde, wäre er an diesem Morgen nicht hier gewesen. Er schätzte die Situation offenbar als ungefährlich ein. Darum blieb er ruhig, hielt seine Ohren aber in Habtachtstellung.
Ich stellte den Motor ab und stieg aus. Der Hase bewegte sich nicht. Er blieb hocken in seinem eine Million Jahre alten Pelz, mit seinen eine Million Jahre alten Gewohnheiten und Bedürfnissen. Auf der anderen Seite stand ich. Dank der Sprache, der Schrift, der tausendjährigen Ansammlung von Erfahrungen, Wissen, Informationen und anderem Kleinkram stand ich nicht in einem uralten Pelz da, sondern in einer einige Jahre alten Windjacke, in geflickten Jeans und Wanderschuhen, mit einer Digitalkamera mit 10 Megapixel in der Hand, mit Bedürfnissen und Gewohnheiten, die sich von Jahr zu Jahr ändern, und zwar immer schneller. Als ich uns so betrachtete, war ich nicht sicher, wer von uns beiden auf dem langen Marsch namens Evolution das bessere Los gezogen hat.
Ein anderes Tier hatte es eilig, wahrscheinlich ein Bär auf der Flucht vor unseren Stimmen, der alles vor sich niederwalzte im Dickicht des nördlichen Velebit, unweit der Stelle, an der ein Abzweig vom Premužić-Wanderweg nach Gromovača führt. Mein Kollege Gordan Nuhanović und ich standen dort an diesem spätsommerlichen Morgen und lauschten dem Lärm aus der tiefen Talmulde, die mit Bergkiefern und Buchen bewachsen war. Wir sahen nichts, und ehrlich gesagt waren wir auch nicht von dem Wunsch getrieben zu erfahren, wer da unten so einen Lärm machte. Im Gegenteil, wir setzten mit hastigen Schritten unseren Weg nach Süden in Richtung des Veliki Alan-Passes fort.
Oder etwa jenes Veilchen, das in einer Felsspalte auf dem Čepuraši wuchs. Der Felsen, 60 Millionen Jahre alt, und die Pflanze, einen Monat alt. Der Felsen, der Dutzende Millionen Jahre dafür benötigte, um auf eine Höhe von über 1500 Meter über dem Meeresspiegel anzuwachsen und der immer noch nach oben strebt, und die Pflanze, die ihren Zyklus in einigen Monaten absolviert. Man sagt, dass wir dort, wo das Ewige dem Vergänglichen begegnet, den verborgenen Sinn des Lebens erkennen. Haben wir jedoch die Zeit, in solchen Momenten innezuhalten und über das, was wir sehen, nachzudenken?
Wir sind im Zustand einer ständig beschleunigenden Besorgnis. Die Situation ist absurd – je perfekter die Technologie, desto mehr arbeiten wir, unsere Verpflichtungen häufen sich, Fristen verkürzen sich. Wir verlieren den Verstand. In Eile hasten wir aneinander vorbei, tauschen Grimassen und zerfetzte Phrasen aus und verabschieden uns, ohne uns umzudrehen. Die Gelegenheiten für Treffen, für ruhige Gespräche, für gemeinsames Kaffeetrinken, die wir versäumt haben, werden nicht wiederkommen. Der morgige Tag ist nicht die Reprise des heutigen Tages.
Wie oft hat euch ein Freund gesagt, dass er euch nicht zu einem Ausflug begleiten kann, nicht mit euch trinken oder ins Kino gehen kann, weil er keine Zeit habe. Keine Zeit haben! Wer steuert unsere Zeit?
Der Zen-Lehrer Kōdō Sawaki hat in einer Rede lakonisch festgestellt: »Wenn du sagst, dass du keine Zeit hast, bedeutet das, dass du dich von etwas Äußerem versklaven lässt.«3
Im Wesentlichen benehmen wir uns wie Hamster im Laufrad. Wir rennen, solange wir Kraft haben, und am Ende erlöschen wir einfach. Unser ewiger Wunsch, anderswo zu sein und etwas anderes zu tun und eben das so schnell wie möglich zu erreichen, treibt uns zum ständigen Herausfahren aus unserer eigenen Haut. Da unsere Möglichkeiten begrenzt sind, der Wunsch aber stark, benötigen wir Hilfsmittel.