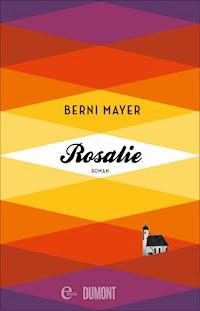19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Wie ich lernte, mit dem Verlust zu leben – und ein anderer wurde.« Als Berni Mayers Tochter Olivia an einem Gehirntumor stirbt, ist der Schmerz allumfassend. Das Gefühl der Trauer sickert in alle Bereiche seines Lebens. Wie kann man mit einem derartigen Verlust leben? Der Autor schildert hier seine Odyssee durch die Trauer, mit der er am Ende eine Art Waffenstillstand schließt, um weiterleben zu können. Er zeigt, was ihm geholfen hat und was nicht. So erfahren die Leser:innen, dass man Trauer auch mal wegtanzen kann, Ernährung oder Fitnesstraining unterstützend wirken und wie Therapien und manchmal auch Psychopharmaka helfen können. Und Berni Mayer erlebt, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist und welchen Anteil Meditation und buddhistische Philosophie am inneren Frieden haben. ›Anleitung zum Traurigsein‹ veranschaulicht, dass und wie man lernen kann, konstruktiv mit Verlusten umzugehen. Es bietet eine Art Blaupause fürs Trauern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
»Wie ich lernte, mit dem Verlust zu leben – und ein anderer wurde.«
Als Berni Mayers Tochter Olivia an einem Gehirntumor stirbt, ist der Schmerz allumfassend. Das Gefühl der Trauer sickert in alle Bereiche seines Lebens. Wie kann man mit einem derartigen Verlust leben?
Der Autor schildert hier seine Odyssee durch die Trauer, mit der er am Ende eine Art Waffenstillstand schließt, um weiterleben zu können. Er zeigt, was ihm geholfen hat und was nicht. So erfahren die Leser:innen, dass man Trauer auch mal wegtanzen kann, Ernährung oder Fitnesstraining unterstützend wirken und wie Therapien und manchmal auch Psychopharmaka helfen können. Und Berni Mayer erlebt, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist und welchen Anteil Meditation und buddhistische Philosophie am inneren Frieden haben.
›Anleitung zum Traurigsein‹ veranschaulicht, dass und wie man lernen kann, konstruktiv mit Verlusten umzugehen. Es bietet eine Art Blaupause fürs Trauern.
© Birte Filmer
Berni Mayer, geboren 1974 in Bayern, studierte Germanistik und Anglistik und arbeitet heute als Autor, Journalist, Übersetzer und Podcast-Produzent in Berlin. Bei DuMont sind seine Romane ›Rosalie‹ (2016), ›Ein gemachter Mann‹ (2019) und ›Das vorläufige Ende der Zeit‹ (2023) erschienen.
Berni Mayer
ANLEITUNG ZUM TRAURIGSEIN
Wie ich gelernt habe, mit der Trauer zu leben
Von Berni Mayer sind bei DuMont außerdem erschienen:
Rosalie
Ein gemachter Mann
Das vorläufige Ende der Zeit
E-Book 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Redaktion: Kerstin Thorwarth
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-6085-2
www.dumont-buchverlag.de
1
Luxustrauer
Ich wäre gerne viel öfter traurig.
Ich meine die Traurigkeit, wie man sie auch aus der Populärkultur kennt. Aus Filmen, Serien und Büchern. Bei der jemand verzweifelt alles aus sich rausheult. Bei der es jemanden grässlich sticht in der Herzgegend. Bei der man sofort begreift: Dieser Mensch ist traurig, und man weiß auch, warum.
Eine situative, komprimierte Traurigkeit mit konkretem Anlass – so eine Traurigkeit würde ich gerne öfter empfinden.
Ich würde gerne öfter eine Stunde lang auf meiner Couch vor mich hin weinen und vielleicht dabei melancholische Popsongs wie »Funeral« von Phoebe Bridgers oder »This Life« von Vampire Weekend hören. Oder auch nachts im Bett liegen, über den Verlust unserer Tochter nachdenken und irgendwann unter Tränen einschlafen. Und doch gelingt mir das höchstens zweimal im Jahr.
Für mich ist eine zielgerichtete und zeitlich begrenzte Trauer ein seltener Glücksfall. Ein Erfolg meiner Trauerarbeit. Dann ist meine Trauer isoliert, dann habe ich sie im Griff. Dann liefert sie eine unmittelbare Katharsis und endet in erlösender Erschöpfung. Und dann geht es mir für kurze Zeit tatsächlich besser.
Das ist die Luxustrauer. Das ist nicht die Trauer, die mir im Alltag zu schaffen macht. Die mich lähmt und belastet. Die ich überwinden muss, um in Kontakt mit meinem Sohn, meiner restlichen Familie, meinem Umfeld und mir selbst zu bleiben. Die Luxustrauer ist eine willkommene Auszeit. Während sie anhält, muss ich nichts machen, ich kann einfach nur traurig sein. Die alltägliche Trauer ist tückischer, auf keinen Moment festlegbar, sie schleicht sich in alle Vorgänge und Gedanken. Um sie geht es in diesem Buch.
Mit dieser Trauer muss ich die meiste Zeit leben. Oft erkenne ich sie nicht mal auf den ersten Blick als Trauer. Sie erschöpft mich und höhlt mich wie eine chronische Erkältung aus. Sie tritt als Angespanntheit und Wut in Erscheinung, als scheinbar grundloser Frust und Defätismus. Als Müdigkeit, die sich bemerkbar macht, wenn ich mit meinem Sohn für die Klassenarbeit Bruchrechnen lerne und ungehalten auf seine falschen Antworten reagiere oder existenziell mit meiner Freundin streite, selbst wenn es dabei nur um die Konsistenz von Porridge geht. Wenn ich Fahrradfahrer anschreie, die mir die Vorfahrt nehmen. Wenn ich manchmal mitten am Tag erschöpft auf der Couch einschlafe, obwohl ich eigentlich früh im Bett war. Wenn mir Konflikte buchstäblich auf den Magen schlagen und womöglich den kleinen Riss in meiner Speiseröhre verschlimmern. Wenn mein Zahnfleisch auch mit der neuen Krone nicht aufhört zu schmerzen. Wenn ich in Stresssituationen plötzlich dieses Pfeifen im Ohr habe.
Das ist die Art von Trauer, die ich gerne wieder loswerden will. Die ich unbeschadet überstehen will, auch wenn es dafür vermutlich zu spät ist.
Der argentinische Autor und Psychiater Jorge Bucay schreibt in seinem Buch der Trauer:
Ich habe den Eindruck, das Geheimnis, mit unseren Verlusten zurechtzukommen, besteht genau darin, dass wir uns dazu durchringen, die Trauer auszuhalten, sie als Teil des Weges zu verstehen (…).1
In diesem Buch möchte ich beschreiben, was ich unternommen habe, um die Auswirkungen von Trauer auf mein Leben zu erfassen und in Schach zu halten. Doch ein Teil dieses Wegs besteht nach wie vor im geduldigen Aushalten eines Zustands. Oder um es weniger passiv zu formulieren: im Beobachten, wie sich dieser Zustand langsam verändert. Manchmal über Jahre hinweg.
Bucay schreibt auch, Trauer sei keine Krankheit, sondern »ein Prozess, der zur Überwindung eines Verlusts«2 notwendig sei. Also ein Heilungs-, aber vielleicht noch mehr ein Verständnisprozess.
Ich habe nie eine völlige Heilung, eine Wiederherstellung angestrebt; ich habe recht schnell erkannt, dass es keinen Weg zurück in den Zustand vor dem Verlust gibt. Ich habe auch nichts gegen das Traurigsein, ich bin sogar gerne traurig. Aber ich will verstehen, was die Trauer mit meinem Geist und Körper macht, wo sie mir schadet und wo sie mir vielleicht sogar nützt. In der Psychotherapie spricht man auch vom Dual Process. Dieser Theorie zufolge sind unsere Gedanken das Ergebnis zweier verschiedener Prozesse: eines impliziten, also automatischen und unbewussten Prozesses und eines expliziten, also kontrollierten und bewussten Prozesses. In meinem Fall handelt es sich um ein Oszillieren zwischen Alltag und Ausnahmezustand, eine gleichzeitige Anwesenheit von Trauer und Klarkommen. Das ist das Verständnis von Trauer, das diesem Buch zugrunde liegt. Doch die Prozesse kann man verstehen lernen, man kann sich das diffus im Innern Wirkende bewusst machen und einen gesünderen aktiven Ausdruck dafür suchen. Und derartige Aktivitäten, mit denen wir unsere Trauer ausdrücken oder auch nur besser aushalten können, ermöglichen letztlich eventuell doch so etwas wie Linderung. So ist der Kern meiner »Anleitung zum Traurigsein« eine Kombination aus Bewusstmachen, Verstehen und Aktivität.
Spätestens jetzt sollte ich erklären, warum ich überhaupt traurig bin, oder? Was ist mein konkreter Anlass? Dazu komme ich gleich, doch genau genommen empfinde ich schon lange eine subtile, unkonkrete Trauer. Mindestens seit ich zwölf war. Damals habe ich nachts Tolkiens Herr der Ringe gelesen und nebenbei heimlich Radio gehört, denn ich durfte als Kind nicht lange aufbleiben. Im Radio lief »All You Zombies« von den Hooters oder »Kayleigh« von Marillion. Melancholische Songs, die eine Seite in mir ansprachen, die vielleicht schon mit zwölf geahnt hat, dass das Leben eine mindestens sehr emotionale und vermutlich verlustreiche Angelegenheit werden könnte. Diese Songs schienen das anzuerkennen. (So funktioniert Popmusik ja ohnehin. Man hört sie und fühlt sich in seiner Lebenswirklichkeit gesehen.)
Im ersten Teil vom Herrn der Ringe durchqueren die Gefährten des larmoyanten Ringträgers Frodo und der zen-artige Superzauberer Gandalf irgendwann die Minen von Moria. Man weiß natürlich, dass etwas Schlimmes passieren wird, doch merkwürdigerweise habe ich vor allem in der Antizipation der Katastrophe, auf jenen Buchseiten, bevor alles den Bach runtergeht, Trost gefunden. Denn es ist ja noch nicht so weit, noch singen die Hooters in meinem Kopfhörer, noch greifen die Orks nicht an, noch lebt Gandalf. Diese vorgewitterliche Stimmung, die Ruhe vor dem großen Desaster hat sich damals zu einer Art emotionaler Grundhaltung bei mir herauskristallisiert. Noch mag alles in Ordnung sein, alles da sein, wo es hingehört, aber die Veränderung ist längst im Gange. Ein Verlust steht bevor.
Im Japanischen gibt es den Ausdruck mono no aware, den man vereinfacht mit »Traurigkeit der Dinge« übersetzen könnte. Gemeint ist das Wissen um die Vergänglichkeit allen Seins, die Fähigkeit, darin Schönheit zu erkennen, und eine Empfindung, die Freude, Trauer und Hinnahme vereint. Im englischen Wikipedia-Eintrag dazu ist das sehr treffend mit »transient gentle sadness«3, also einer »vorübergehenden sanften Traurigkeit« beschrieben.
So habe ich schon als Teenager empfunden – wenn auch damals eher unbewusst – und tue es heute noch. Vermutlich ist auch Selbstschutz Teil dieses Konzepts: Erwarte das Schlimmste, und freu dich über den wesentlich glimpflicheren Ausgang.
Schlimmes ist mir aber zunächst weder in meiner Jugend noch in meiner Zeit als junger Erwachsener zugestoßen. Mit vierzehn hatte ich mal einen Mofa-Unfall, nach einer Party mit viel zu viel Alkohol für einen Vierzehnjährigen. Dabei habe ich mir einen Schädelriss zugezogen, doch nach ein paar Wochen Kopfverband und Hausarrest war das ausgestanden.
Mein größtes Unglück war lange Zeit der Liebeskummer – bis heute eins meiner chronischen Leiden, eins, das ich am dringendsten loswerden will. Ich lasse mich auch nicht mehr von seiner Ästhetisierung durch die Popkultur blenden, ich kann Liebeskummer auf den Tod nicht ausstehen. Nicht nur, weil er zermürbend ist, sondern auch, weil er und mein begleitendes Selbstmitleid oft dringlichere Probleme beiseitewalzen. Oder mich taub machen für die Probleme anderer.
Als ich Anfang zwanzig war, starb meine Oma mütterlicherseits, die ich wirklich sehr gernhatte, und ich habe mich regelrecht geschämt, weil ich keine ordentliche Trauer empfinden konnte, dafür aber den ganzen Tag lang über eine Ex-Freundin nachdenken musste. Erst bei der Beerdigung erinnerten mich das bleiche Gesicht meiner Mutter und die Tränen meines Onkels an den Verlust, den wir alle gerade erlitten hatten.
Bis zum Tod meiner eigenen Kinder überforderte der Verlust von Menschen mich derart, dass ich eigentlich fast gar nichts empfunden habe. Liebeskummer hingegen konnte ich immer deutlich fühlen.
Ich weiß bis heute nicht genau, was ich davon halten soll, dass mich Trennungen oder Beziehungskrisen in so marianengrabentiefe Ratlosigkeit und Trauer stürzen. Glaubt man dem, was ich mal auf der Website einer Krankenkasse gelesen habe, dass die durch Liebe und Drogensucht ausgelösten Empfindungen im selben Bereich des menschlichen Hirns angesiedelt seien, dann bin ich vielleicht ein Emotionssüchtiger, und der Entzug ist die Hölle. Möglicherweise steckt auch nur eine Art Narzissmus dahinter.
Zumindest kann ich diesen leidigen Zustand mittlerweile als eine Art Maßangabe für Trauer benutzen. Als unsere Tochter ihre Krebsdiagnose bekam, konnte ich mit Bestimmtheit sagen: Das fühlt sich nicht an wie schlichter Liebeskummer, sondern wie Liebeskummer im Quadrat. In gewisser Weise war ich dankbar für diesen scheinbar profanen Vergleich, weil ich die Trauer dadurch einordnen konnte.
Aber ich wollte ja darüber schreiben, was der konkrete Anlass für meine Trauer und damit für dieses Buch ist.
2016 war ein schwieriges Jahr. Meine Ehe wies etliche Sollbruchstellen auf, wir hätten uns intensiv damit auseinandersetzen müssen, im Idealfall via Paartherapie, aber mindestens in Gesprächen und womöglich mit neuen Strategien des Zusammenlebens. Dazu kam ein Bandscheibenvorfall, der mich ein paar Wochen lang außer Gefecht setzte. Meine Familie bestand zu der Zeit aus meiner Frau und mir, unserem fünfjährigen Sohn Ludwig und unserer anderthalbjährigen Tochter Olivia, und ich war einigermaßen erstaunt darüber, wie stressig das Leben mit zwei Kindern geworden war, hatte mich doch beim ersten die Euphorie über Unannehmlichkeiten wie wenig Schlaf und ein Übermaß an Kindergarten-Viren locker hinweggetragen. Meiner Frau ging es ähnlich, und so kann man zusammenfassend konstatieren, dass wir beide im Sommer 2016 nicht gerade im Vollbesitz unserer physischen und mentalen Kräfte waren.
Irgendwann fing Olivia an, den Kopf schief zu halten und beim Laufen auffällig oft zu stolpern. Doch erst als sie sich ein paar Tage in Folge morgens auf nüchternen Magen übergab, wurden wir nervös und brachten sie nach mehrmaligen Kinderarzt-Besuchen schließlich zur Untersuchung in eine Klinik. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mit meinem Sohn an jenem Tag stundenlang durch Berlin lief, vom Einkaufszentrum zum Comicladen, während ich ängstlich auf den Anruf meiner Frau wartete. Auf die Nachricht, was denn nun los war mit Olivia. Der Anruf kam gegen acht Uhr abends, und ich hatte kein gutes Gefühl, als ich ihn entgegennahm. Zu lange schien mir das in der Klinik zu dauern für ein Happy End. Doch dann war es schlimmer als alles, was ich mir ausgemalt hatte: Im Krankenhaus wurde eine extrem aggressive und womöglich unheilbare Hirntumorart festgestellt.
Mithilfe einer Notoperation konnte man den Tumor zunächst komplett entfernen, und das sogar ohne sichtbare Schäden und Folgeerscheinungen. Olivia kam nicht nur schnell wieder auf die Beine, sondern fühlte sich auch bald sichtlich besser als zuvor. Erst nach und nach hat stellte sich heraus, dass ihr und unserer Familie die größten Herausforderungen und der größte Verlust noch bevorstanden.
Nach einem kräftezehrenden Jahr mit Chemotherapie, Bestrahlung, endlosen Klinikaufenthalten und Blutkontrollen, nach einer Phase ihrer totalen Isolation zu Hause ohne Kita wegen des fehlenden aktiven Immunsystems und nach einer kompletten Restrukturierung unseres Alltags kehrte im Sommer 2017 endlich wieder so etwas wie Normalität ein. Olivia konnte aufs Neue in den Kindergarten gehen und größer, anstrengender, lauter, witziger und liebenswerter werden. Und sich die Haare lang wachsen lassen. Nachdem sie schon einmal alle verloren hatte, war ihr das sehr, sehr wichtig.
Und doch haben meine Frau und ich uns genau am Anfang jenes Sommers getrennt. Unsere Eheprobleme hätten Reserven gebraucht, die wir nach dem vergangenen Jahr einfach nicht mehr hatten. Unsere gesamte restliche Energie galt jetzt den Kindern. Trotz aller Fortschritte hatten wir immer noch eine chronisch krebskranke Tochter und einen ziemlich verunsicherten Sohn, der gerade erst eingeschult worden war. Dazu kam jetzt eine Trennung mit all ihren logistischen Implikationen. Ich zog zum Glück nur ein paar Häuser weiter in eine neue Wohnung, und so teilten wir uns von Anfang an die Zeit mit den Kindern gerecht auf, ohne dafür durch die halbe Stadt fahren zu müssen.
Nach anderthalb Jahren, in denen es Olivia erstaunlich gut gegangen war, wurde ein neuer Tumor gefunden. An einer anderen Stelle. Das bedeutete, dass der Krebs nicht unter Kontrolle zu bringen war. Ab diesem Zeitpunkt wurde Olivia palliativ behandelt. Bereits nach der ersten Diagnose hatte man ihr eine kurze Lebenserwartung attestiert, aber ihre gute Verfassung lenkte uns lange davon ab und ließ uns zwischendurch auf eine Art Wunder hoffen. Zwar wurde auch dieser zweite Tumor so vollständig wie möglich operativ entfernt – und eine Kurzzeitbestrahlung erlaubte uns 2018 ihren vielleicht schönsten Herbst –, doch jetzt war das Ende in Sicht. Wir versuchten, das Beste aus der ihr noch verbleibenden Zeit zu machen: Sie fing mit Ballettunterricht an, wir unternahmen zahlreiche Ausflüge und feierten ihren Geburtstag und Weihnachten mit einer neuen Intensität.
Im Frühjahr 2019 verursachte das Rezidiv dann eine Gehirnblutung, und unsere Tochter starb unerwartet schnell und schmerzfrei. Das Bild von einer friedlich eingeschlafenen, äußerlich noch vital wirkenden Olivia im Gedächtnis behalten zu können, ist womöglich überlebenswichtig für mich gewesen.
Unmittelbar nach ihrem Tod trat ein seltsamer Effekt ein: Ich fühlte mich erleichtert. Frei. Dachte Dinge wie: Du musst dich jetzt nur noch um ein Kind kümmern, das wird kein Problem. Du musst dein Leben nicht mehr nach diesen furchtbaren MRT-Terminen ausrichten, die schon Monate vorher alles überschatten. Du bist endlich raus aus diesem Unheil antizipierenden Dauerzustand, du kannst mit deiner Freundin ins Museum oder ins Kino gehen, ohne Angst zu haben, dass nachts das Telefon klingelt und du ins Krankenhaus musst. Du kannst Urlaube und Reisen planen. Du kannst wieder darauf hoffen, dass es irgendwann besser wird.
Dieser hoffnungsvolle Zustand hielt ungefähr drei Wochen lang an. Was danach kam, war ein wilder Ritt, um es milde auszudrücken. Innerhalb von Tagen verwandelte sich die Aufbruchseuphorie in ein Gefühl tiefster Sinnlosigkeit, neue Kraft in absolute Erschöpfung – und dann ging das Ganze wieder rückwärts und noch mal von vorne los.
In den nächsten vierzehn Kapiteln folgt der Versuch, nachzuvollziehen, was ich alles unternommen habe, um mich meiner eigenen Trauer anzunähern, mich mit ihr zu verständigen, mit ihr zu leben. Es ist womöglich eine andere Art von Trauerarbeit als die, die viele Kolleginnen und Kollegen in der Trauerliteratur beschreiben, denn sie stellt keine Theorien auf und gibt keine allgemeingültigen Tipps. Sie resultiert aus meiner persönlichen Biografie und meinen individuellen Bedürfnissen, sie zeigt, was mir geholfen hat, und versucht zu ergründen, warum. Ich hoffe aber stark, dass man ihr als Leserin und Leser brauchbare Mechanismen entnehmen kann, die zu einem integrativeren und wohlwollenderen Umgang mit der eigenen Trauer führen, zu einer »transient gentle sadness«, die nützt, statt zu schaden.
Selbst wenn das Buch auf meiner Geschichte und der meiner Familie beruht, kann man es dennoch als Ratgeber lesen. Wenn ihr ebenfalls Verlust und Trauer erfahren habt, dann werden euch vermutlich viele Strategien bekannt vorkommen, und ihr werdet auf die eine oder andere Art auf meine Erlebnisse reagieren. Vielleicht erkennt ihr euch wieder, seid sogar inspiriert, vielleicht schlagt ihr aber auch gegenteilige Wege ein. Im besten Fall lässt sich durch mein Buch der eigene Weg leichter identifizieren. Ich gehe hier einfach mal voraus, und ihr folgt mir, wenn ihr mögt. Und seid versichert: Zwischenzeitlich setze ich mich auch mal auf meine Couch und weine.
2
Good Mourning: Kleine Kulturgeschichte der Trauer
Es gibt unterschiedliche Versionen von Kleopatras Tod. In den meisten vergiftet sie sich, um der römischen Gefangenschaft zu entgehen, manchmal mit, manchmal ohne Schlange. In einer aber zerkratzt sie sich den Oberkörper so stark, dass er sich entzündet und sie am Wundfieber stirbt. Aber warum tötet sie sich überhaupt? Glaubt man der Geschichtsschreibung, ist das eine Reaktion auf den Tod ihres Geliebten Marcus Antonius, der sich in sein eigenes Schwert gestürzt hat. Doch warum hat er sich getötet? Es war seine Reaktion auf die Nachricht vom Tod Kleopatras. Die sich allerdings als Gerücht herausstellte.
Sieht man davon ab, dass die Reaktionen der beiden sicher nicht nur mit dem vermeintlichen Ableben der Lebenspartnerin und dem tatsächlichen des Lebenspartners zu tun haben, sondern auch mit einem jähen Ende der politischen Vita und dem voraussichtlichen Ende des eigenen Lebens via Kaiser Augustus, handelt es sich bei solchen Verhaltensweisen um sogenannte ritualisierte Trauer.
Nein, sagt ihr jetzt womöglich, Kleopatra war einfach nur völlig außer sich vor Schmerz, deshalb hat sie sich die Brust zerkratzt. Doch der Historiker und Ägyptologe Stefan Pfeiffer hat mich darauf hingewiesen, dass etwa das Zerkratzen der Brust eine ritualisierte Trauerhandlung bei Frauen darstellte. Die man beim Verlust eines hochrangigen Ehemanns durchaus erwarten durfte. Selbstverletzungen als äußeres Zeichen von Trauer waren aber weder den alten Ägyptern noch generell den Menschen der Antike vorbehalten, es gibt sie auch immer noch bei indigenen Völkern der Gegenwart, zum Beispiel in Nordamerika.
Egal, wer letztlich das schwerere Los gezogen hat, der Mann, der sich ins Schwert stürzt, oder die Frau, die an Fieberkrämpfen stirbt, in beiden Fällen entspringt die Trauer nicht ausschließlich der individuellen Gefühlswelt, sondern sie wird geradezu vorgeschrieben.
Wie und warum man trauert, definiert bis heute die Gesellschaft; es gibt seit Anbeginn unserer Kultur spezielle Erwartungen an Trauernde. Und damit auch eine konkrete Vorstellung von Trauerarbeit.
Im Deutschen ist der Begriff der Trauer womöglich etwas schwammig. Das Englische unterscheidet zwischen grief und mourning. Während grief die persönliche und emotionale Trauer meint, bezieht sich mourning auf den soziokulturellen Aspekt, also eher auf das Ritual und die kollektive Trauer.
Diese Unterscheidung wird gleich noch wichtig, aber man kann zunächst festhalten, dass es ohne mourning weniger archäologische Funde in die Gegenwart geschafft hätten. Die soziokulturelle Trauer gibt es seit Aufzeichnungsbeginn der Menschheit. Von der persönlichen Trauer, grief, lesen wir erst viel später; sie hat kulturgeschichtlich deutlich weniger Relevanz.
Ritualisierte Trauer drückt sich archäologisch gesehen vor allem in Grabstätten aus – in Monumenten (das Wort leitet sich vom lateinischen Verb monēre für »erinnern« ab). Dazu gehören auch die ägyptischen Pyramiden.
Natürlich drücken die Pyramiden eine Menge mehr als nur Trauer über den menschlichen Verlust aus, vielleicht ist das sogar der marginalste Aspekt. Und doch ist der ausschlaggebende Moment für ihre Erbauung der Tod eines Mitmenschen (auch ein Pharao oder eine Pharaonin gilt als Mitmensch). Jegliche Form der ritualisierten Bestattung hat etwas mit der Anerkennung des Verlusts menschlichen Lebens zu tun, ganz egal, ob man auf ein anschließendes Weiterleben im Jenseits setzt oder von der Endgültigkeit des Todes ausgeht. Zunächst erkennt man an, dass diese Form der Existenz – nennen wir sie »irdisch« – zu Ende ist. Eine solche Akzeptanz ist womöglich die Urdefinition von »Trauer«.
Zu den ältesten Artefakten der Sepulkralkultur zählen sogenannte Höhlengräber, sie gehen zurück bis in die Zeit der Neandertaler. Eine Ruhestätte für Tote sagt oft mehr über eine Kultur aus als eine Tonvase oder ein Löffel. Ein Todesereignis hat mehr gravitas als der Alltag. Grabbeigaben sind daher aussagekräftige Zeitzeugen – sie sind Hinterlassenschaften einer Kultur, die damit bis in die Gegenwart sprechen will. Denn der Tod muss immer auch eine Message haben, eine Bedeutung. Die Sinnlosigkeit ist seit jeher der ärgste Feind der Erinnerungs- und Trauerkultur. Die meisten von uns wollen, dass sich jemand an uns erinnert.
In Nordpalästina liegt die Kebara-Höhle, in der man 1983 das Skelett eines männlichen Neandertalers und damit einen Hinweis auf einen Bestattungskult gefunden hat, der laut Wikipedia mehr als 60000Jahre alt ist. Ob die Neandertaler nun in unserem Sinne getrauert haben oder ähnlich wie die Ägypter hauptsächlich eine Behausung für das nächste Leben schaffen wollten – der Anlass bleibt derselbe. Die Gemeinschaft wird dezimiert. Für den Sozialverbund ist so ein Verlust in der Regel eine unerfreuliche Angelegenheit; er erzeugt eine Lücke, die man füllen muss. Im Fall der Kebara-Höhle fehlte plötzlich ein Clanchef, ein Handlanger, ein Jäger, ein Sammler, ein Familienmitglied. Wie dieser Tod von den einzelnen Mitgliedern der Gemeinschaft individuell interpretiert wurde, ist nicht überliefert. Gesichert ist nur, dass man dem Verstorbenen ein Grab und höchstwahrscheinlich eine Zeremonie spendiert und damit das Lebensende offiziell anerkannt hat. Mit der Akzeptanz des Verlusts bahnt sich bereits ein Weg an, heraus aus einer diffusen Emotionalität, dem Schock über den Tod. Man verleiht dem Verlust Form und Protokoll – für Trauernde traditionell die erste große Hilfestellung. Indem man die Toten beerdigt, leitet man gewissermaßen eine neue Phase im Leben ein: die Trauerzeit.
Das sogenannte Trauerjahr suggeriert bis heute eine zeitliche Limitierung ritualisierter und womöglich auch individueller Trauer. Historisch betrachtet existieren seit Jahrtausenden Bemühungen und Vorschriften, Trauer zeitlich zu begrenzen oder sie im Extremfall zu stoppen.
Ein Trauerjahr lässt sich zum Beispiel für das antike Rom belegen, es gilt allerdings nur für Witwen. Dort folgt auf die Bestattung eine neuntägige Trauerzeit, die mit einem Totenmahl (cena novemdialis) endet. Erst danach kehrt die engere Familie des Verstorbenen wieder in den Alltag zurück.
Im Judentum findet sich eine Entsprechung in der Schiv’a (hebräisch für »sieben«), der siebentägigen Trauerphase. Sie beginnt mit der Bestattung, danach bleiben die Trauernden – beinahe wie in Quarantäne – eine Woche lang zu Hause und lassen sich von Verwandten und Freunden besuchen und verpflegen. Das Ritual setzt mit dem Verzehr eines Hühnereis, das mit Asche bestrichen ist, ein; darauf folgt das Schiwesitzen: Sieben Tage lang darf nicht gearbeitet und dürfen keine Lederschuhe getragen werden, man zieht sich nicht um, sitzt nur auf niedrigen Stühlen oder am besten gleich auf dem Boden.
Die Schiv’a findet sich in ähnlicher Form auch in der islamischen Kultur, wo man sich für sieben aufeinanderfolgende Tage im Haus des oder der Verstorbenen versammelt, den Koran rezitiert und die betroffene Familie versorgt, tröstet und unterhält. Am siebten Tag revanchieren sich die Hinterbliebenen dann mit einem ausgiebigen Mahl.
In den großen Weltreligionen existieren noch zahlreiche weitere Trauerfristen. Der Koran schreibt einer Frau vor, nicht länger als drei Tage um einen Verstorbenen zu trauern, außer es handelt sich um ihren Ehemann, dann sind vier Monate und zehn Tage angebracht. In anderen Gesellschaften werden manchmal dreißig Tage genannt, häufig ist auch die Rede von zwölf Monaten – dem angesprochenen Trauerjahr, das wir offensichtlich von den Römern geerbt haben. Rechtsgeschichtlich bedeutete das in Deutschland bis zum Jahr 1998, dass Witwen nicht vor Ablauf einer Frist von zehn Monaten wieder heiraten durften und noch ein Jahr lang die Bezüge des Gatten oder der Gattin erhielten, sofern dieser oder diese im Staatsdienst tätig gewesen war.
Nur noch selten sieht man in Westeuropa Witwen in ausschließlich schwarzen Kleidern und/oder schwarzem Schleier – und noch seltener ein ganzes Jahr lang. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an meine Kindheit in einem kleinen katholischen Ort in Niederbayern, als eine entfernte Verwandte noch Jahre nach dem Selbstmord ihres Mannes nur in Schwarz anzutreffen war und dementsprechend von manchen »schwarze Witwe« genannt wurde.
Queen Victoria hat aus dem Trauerjahr ein halbes Trauerjahrhundert gemacht. Als ihr Mann, Prince Albert, 1861 verstarb, legte sie die schwarze Trauerkleidung an und bis zu ihrem Lebensende 1901 nicht mehr ab. Gleichzeitig musste Alberts Zimmer unverändert bleiben, wobei sie Handtücher und Bettzeug wechseln ließ, so als wäre das Zimmer noch in Benutzung. Ihre Trauer wurde vom persönlichen Ausdruck zum Ritual und am Ende vielleicht sogar zur Manie.
Schwarz ist keineswegs die universelle Trauerfarbe. Im alten Ägypten trauerte man in Gelb, im Buddhismus und in vielen asiatischen Ländern bevorzugt man Weiß. In manchen Ländern gibt es dagegen keine spezifische Trauerkleidung. Zuweilen reicht der »Trauer-Look« über die Kleidung hinaus: Einige rasieren sich den Bart ab, andere lassen sich ihn wachsen, einige gehen zum Friseur, andere verzichten eine Weile aufs Haareschneiden. Manche Trauernde wollen sich ihre Trauer ansehen lassen, manche auf gar keinen Fall, vielen sieht man sie so oder so an.
Zu meiner Oma väterlicherseits hatte ich in ihren letzten Jahren wenig Kontakt. Mir war bewusst, dass sie an Alzheimer erkrankt war, und in dem Zustand, umsorgt von meinem Großvater, habe ich sie auch zuletzt gesehen. Die Nachricht von ihrem Tod hat mich nicht besonders berührt, muss ich ehrlich zugeben, das Ereignis war irgendwie nicht greifbar. Erst auf der Beerdigung sah ich (wie schon auf der meiner anderen Oma) die Manifestation ihres Todes – diesmal im Gesicht meines Vaters, als ich ihm die Hand schüttelte. Er hatte sich nämlich seinen Vollbart abrasiert, den er zehn Jahre lang getragen hatte, und wirkte dadurch seltsam weiß und wachsartig. Brüchig. Es war eine Version meines Vaters, die ich bis dahin noch nie gesehen hatte. Mit der Beerdigung seiner Mutter war die Härte aus seinem Gesicht verschwunden. Wie rituell seine Entscheidung zur Rasur war, weiß ich nicht. Obwohl ich keinen besonderen Draht zur Großmutter hatte, konnte ich durch das bartlose Wachsgesicht meines Vaters das Ereignis besser begreifen. Und selbst ein bisschen trauriger sein.
Trauernde nehmen in vielen Kulturen eine besondere gesellschaftliche Stellung ein, die sich nicht nur in der Farbe ihrer Kleidung äußert oder in einem Riss darin – ein jüdischer Brauch namens Kria, bei dem nahe Verwandte der Toten ihre Gewänder sichtbar beschädigen. Womöglich wollen die meisten Hinterbliebenen in der ersten Zeit auch als Trauernde wahrgenommen werden: Sie signalisieren ihre Ausnahmestellung und Nichtteilnahme an den üblichen gesellschaftlichen Ereignissen, und die anderen können sich in Nach- und Rücksicht üben und im Idealfall helfen.
Und doch kann Trauer ab einem gewissen Zeitpunkt zum Stigma werden – der Umgang mit Trauernden wird irgendwann als mühevoll empfunden. »Der muss jetzt auch langsam mal über den Tod seiner Frau hinwegkommen« ist ein Satz, den man vielleicht schon einmal gehört hat.
Ich habe neulich mal den Ausdruck »in Sack und Asche gehen« nachgeschlagen und Folgendes gefunden: Laut Altem Testament legten Trauernde ein besonders grobes, sackartiges Gewand an, schütteten sich Asche auf den Kopf oder setzten sich auf den staubigen Boden. Und freuten sich vermutlich, wenn zufällig vorbeikommende Freunde fragten, wie es ihnen gehe.
Eine der extremsten Formen der ritualisierten Trauer wird vereinzelt noch heutzutage in Indien vollzogen, obwohl sie mittlerweile verboten ist: Bei der Witwenverbrennung (Sati) wird die lebendige Ehefrau zusammen mit ihrem toten Gatten verbrannt. In die Weltliteratur ist dieser Brauch durch Jules Vernes Reise um die Erde in 80Tagen eingegangen. Die junge Aouda soll mit ihrem greisen, eben erst verstorbenen Ehemann auf dem Scheiterhaufen eingeäschert werden, aber Passepartout und Phileas Fogg wissen das zu verhindern. Auch in Nepal, Bali, Skandinavien, China und Griechenland hat man Belege für diese Tradition gefunden. Warum ausgerechnet Frauen (in dem Fall auf Anordnung von Männern) so exzessiv trauern, dass sie im Zweifelsfall das eigene Leben hingeben, wäre sicher ein eigenes Buch wert. Bleibt die Frage, ob Trauer eine weibliche Domäne ist. Und falls ja, warum das so ist, welches Kultur- und Rollenverständnis dahintersteckt. Die ars moriendi, die »Kunst des Sterbens«, gaben schon im Mittelalter natürlich die Männer der christlichen oder islamischen Mystik vor. Aber zu trauern hatten dann gefälligst die Frauen. Ich musste selbst im Rahmen meiner eigenen Recherchen feststellen, dass die meisten Trauergruppen aus Teilnehmerinnen bestehen.
Als ich einem Freund und Nachbarn zum ersten Mal davon erzählte, dass ich ein Buch über Trauer schreibe, fiel ihm sofort das Stichwort »Phasen der Trauer« und fälschlicherweise auch der Name Elisabeth Kübler-Ross ein. Diese bekannte Sterbeforscherin hat in ihrem Buch On Death and Dying zwar auch ein Phasenmodell beschrieben, aber dabei geht es um sterbende Patienten und fünf signifikante Phasen des Sterbens, die allerdings den Phasen des Trauerns nach Verena Kast nicht ganz unähnlich sind.
Die Schweizer Psychologin Kast benennt folgende Stufen: die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, der aufbrechenden Emotionen, des Suchens und Sich-Trennens sowie die des neuen Selbst- und Weltbezugs.
Man findet Kasts Thesen häufig in stark komprimierter Form auf Websites, die sich mit Trauer beschäftigen, gerne auf denen von Kirchengemeinden und Bistümern. Ich will weder Frau Kast noch der Kirche die Kompetenz in Bezug auf die Trauerarbeit absprechen, sondern nur festhalten: In der Verkürzung einer so komplexen Angelegenheit wie Trauer auf Phasen und Stichworte zeigt sich verständlicherweise das menschliche Bedürfnis nach Ikea-Anleitungen. Der Wunsch, einfach irgendwo anfangen zu können mit dieser komplexen Aufgabe. Und irgendwo auch wieder aufzuhören. Verena Kast ist eine feinfühlige und smarte Frau, die selbst darauf hinweist, dass ihr Modell weder streng linear noch unantastbar ist. In Interviews updatet sie bis heute ihre Vorstellung von Trauerarbeit.
Es schadet nicht, ihre Phasen für dieses Buch im Hinterkopf zu behalten; es macht aber auch nichts, wenn man sie sofort wieder vergisst. Denn zum einen ist die hier im Buch beschriebene Trauerarbeit stark autobiografisch geprägt und oft mehr Erzählung als Workshop, und zum anderen kommt man in der modernen Trauerforschung ohnehin zum Ergebnis, dass Trauer zu individuell ist, um sie schematisch zu behandeln.
2022 wurde die Diagnose »anhaltende Trauerstörung« von der WHO in die elfte Version der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-11) aufgenommen. In einem Interview mit dem SPIEGEL definiert Rita Rosner, Professorin für Biologische Psychologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, die anhaltende Trauerstörung als Folge des »Verlusts einer geliebten Person, nach der man sich intensiv sehnt«.4
Rosner bezieht den »Verlust« zwar auf einen Todesfall, aber mir stellt sich die Frage: Ist Verlust nicht auch mit dem Ende einer Beziehung, einer Freundschaft oder dem endgültigen Bruch mit einem Familienmitglied gleichzusetzen? Kann nicht eine Trennung jeglicher Art gemeint sein?
Jorge Bucay zählt in seinem Buch der Trauer auch die Scheidung zu den Verlustphänomenen und schreibt, sie »inmitten von Totentrauer und Sterbefällen« zu erwähnen, »mag sonderbar anmuten. Und doch ist die Scheidung, wie wir zuvor in der Statistik belastender Ereignisse gesehen haben, gar nicht so weit von der katastrophalen Erfahrung entfernt, den Partner durch Tod zu verlieren.«5
Gemeinsam ist Trennung/Scheidung und Tod der Faktor Zeit. Denn abstrakt betrachtet ist das Vergehen der Zeit tatsächlich die Wurzel aller Trauer. Mit der Zeit führt jedes Miteinander zwangsweise zum Verlust, sei es durch Tod, Persönlichkeitsveränderung oder eben Trennung.
Die Trauer über Trennungen, über den Verlust der Liebe, im speziellen Fall auch »Liebeskummer« genannt, hat einen steilen Aufstieg in der Menschheitsgeschichte hingelegt. Kulturell war Trauer jahrtausendelang ausschließlich mit Tod verbunden. Erst das Konzept der romantischen Liebe hat dem Menschen die Rechtfertigung erteilt, sich todunglücklich zu fühlen, obwohl der/die Verlorene noch am Leben ist.
Für die Wissenschaft mag Liebe in erster Linie ein biochemischer Prozess sein – eine teils messbare Mischung aus Hormonen, Adrenalin, Sex und merkwürdigem Gerede (das man früher einmal »Süßholzraspeln« genannt hat). Für manche Psycholog:innen ist sie eine Wechselwirkung gegenseitiger Abhängigkeiten und Bedürfnisse, deren Ursache oft in der Kindheit zu suchen ist, für andere ein lebensnotwendiger Kitt, für alle »ein komplexes Phänomen zwischenmenschlicher Zuneigung (…), dem biologische, emotionale und kognitive Aspekte innewohnen«.6 Für die meisten von uns ist es am schönsten, wenn die Liebe da ist, und am schlimmsten, wenn man sie verliert.
Eine exakte Formel, wie Liebe entsteht, hat die Wissenschaft noch nicht gefunden; ihr Ende ist deutlich leichter erklärbar. Sie hört auf, wenn mindestens eine Seite das Vertrauen in das Konzept verliert.
Die Idee der freien Partnerwahl existiert seit ungefähr 250Jahren, Liebeskummer und romantische Literatur (samt ihrem Hang zur Tragik) gibt es wesentlich länger. Ziemlich sicher existierte schon in der Steinzeit ein Konstrukt aus Frau, Mann, Sex und Loyalität. Um noch ein letztes Mal in diesem Buch zu Kleopatra zurückzukehren: Römische Klatschkolumnisten wie Plutarch fieberten geradezu auf ein tragisches Ende der Liebesbeziehung zwischen der Ptolemäer-Königin und ihrem Marc Anton hin. Als würde die große Liebe erst durch den tragischen Verlust legitimiert. Liebe und Verlust waren immer schon alles andere als ein Gegensatzpaar.
Für die antiken Griechen war die Liebe in ethischer Hinsicht deutlich höher angesiedelt als der Eros – die profane körperliche Verbindung zwischen Mensch und Mensch. Leute wie Platon plädierten für die Philia, eine tiefe und intensive freundschaftliche Form der Liebe, die Aristoteles nicht nur bei Liebenden, sondern auch bei lebenslangen Freunden, politischen Wegbegleitern, Arbeitskollegen und Soldaten erkennen konnte. Voraussetzung ist immer die »reziproke Beziehung«, also ein Geben und Nehmen. Gerät die Beziehung aus dem Gleichgewicht, stirbt die Philia, und Trauer ist nicht nur erlaubt, sondern angebracht.