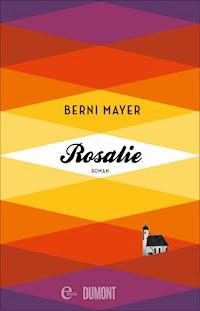19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der verlassene jüdische Friedhof Słubice gehört zu Frankfurt an der Oder, liegt aber auf polnischem Staatsgebiet. An diesem besonderen Ort begegnet die Archäologin Mi-Ra zum einen dem Friedhofswärter Artur, zum anderen Horatio Beeltz, einem seltsamen, aus der Zeit gefallenen Verleger, der nicht nur alles über den Friedhof weiß – sondern sich auch sehr für Mi-Ra und Artur und ihre Geschichte interessiert. Mi-Ra hat ihre traumatische Kindheit und eine brutale Beziehung bloß halb überwunden; Artur lebt nach dem Tod seiner kleinen Tochter wie betäubt in einer nahezu wortlosen Ehe. Dann eröffnet ihnen Horatio Beeltz Ungeheuerliches: Er habe auf dem Friedhof in Słubice einen Zeitriss entdeckt, über den es möglich sei, in die eigene Vergangenheit zu reisen. Falls sich Mi-Ra und Artur dazu entschlössen, könnten sie an bestimmten Stellen in ihrem früheren Leben eine andere, vielleicht bessere Entscheidung treffen und den Dingen eine neue Wendung geben. Berni Mayer zeigt in seinem originellen, ebenso lakonisch wie berührend erzählten Roman, dass es nicht immer die offensichtlichen Fehlentscheidungen sind, die die Welt ins Unglück stürzen, und dass es manchmal Umwege braucht, um die Wunden zu heilen, die das Leben schlägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der verlassene jüdische Friedhof Słubice gehört zu Frankfurt an der Oder, liegt aber auf polnischem Staatsgebiet. An diesem besonderen Ort begegnet die Archäologin Mi-Ra zum einen dem Friedhofswärter Artur, zum anderen Horatio Beeltz, einem seltsamen, aus der Zeit gefallenen Verleger, der nicht nur alles über den Friedhof weiß – sondern sich auch sehr für Mi-Ra und Artur und ihre Geschichte interessiert. Mi-Ra hat ihre traumatische Kindheit und eine brutale Beziehung bloß halb überwunden; Artur lebt nach dem Tod seiner kleinen Tochter wie betäubt in einer nahezu wortlosen Ehe. Dann eröffnet ihnen Horatio Beeltz Ungeheuerliches: Er habe auf dem Friedhof in Słubice einen Zeitriss entdeckt, über den es möglich sei, in die eigene Vergangenheit zu reisen. Falls sich Mi-Ra und Artur dazu entschlössen, könnten sie an bestimmten Stellen in ihrem früheren Leben eine andere, vielleicht bessere Entscheidung treffen und den Dingen eine neue Wendung geben. Berni Mayer zeigt in seinem originellen, ebenso lakonisch wie berührend erzählten Roman, dass es nicht immer die offensichtlichen Fehlentscheidungen sind, die die Welt ins Unglück stürzen, und dass es manchmal Umwege braucht, um die Wunden zu heilen, die das Leben schlägt.
© Birte Filmer
Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, arbeitet als Autor und Journalist in Berlin. Bei DuMont sind seine Romane ›Rosalie‹ (2016) und ›Ein gemachter Mann‹ (2019) erschienen.
Berni Mayer
Das vorläufige Ende der Zeit
Roman
Von Berni Mayer sind bei DuMont außerdem erschienen:
Rosalie
Ein gemachter Mann
eBook 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8285-4
www.dumont-buchverlag.de
Für Ludwig & Olivia
Den jüdischen Friedhof in Słubice
und Zeitreisen gibt es wirklich,
Prolog
Horatio Beeltz steht auf dem alten Grenzmarkt und überlegt, sich die Haare schneiden zu lassen. Oder sich neue Zähne zu kaufen. Ein exotisches Instrument wie die chinesische Guzheng zu erlernen oder ein Studium der Perimortalen Wissenschaft zu beginnen. Irgendwas zu unternehmen gegen diese grauenhafte Langeweile.
Letzte Woche hat er das Licht in seinem Büro in der Kantstraße gelöscht und beschlossen, auf Wanderung zu gehen. Hat seinen alten Ulster aus schwerem schwarzen Tweed herausgesucht und einen Spazierstock mit Gargoyle-Knauf und ist losgelaufen. Nach hundert Kilometern hat ihm der untere Rücken wehgetan, und zwar so richtig. Was ungewöhnlich ist. Als Haltbarer kennt er eigentlich keine gesundheitlichen Beschwerden. Er ist vielmehr die personifizierte Gesundheit. Natürlich hat er alle paar Jahre mal Schnupfen oder leichtes Fieber, und er hat sich sogar schon mal das linke Schlüsselbein gebrochen, wenn er es richtig in Erinnerung hat. Aber Krebs, Multiple Sklerose, Aneurysmen oder andere schwere Krankheiten sind ausgeschlossen. Denkt er. Oder er hat sie bisher nur nicht bemerkt, weil sein Körper womöglich nur leichtes Fieber angezeigt hat, wo andere schon in die Grube gefahren wären.
Er hat Ärzte immer gescheut, aus Angst aufzufliegen. Auch die Kosmologen haben ihm eingebläut, möglichst nicht zum Arzt zu gehen. Vielleicht ist es ja in Wirklichkeit die tödlichste Ebola, wenn er einen leichten Hustenreiz verspürt, und wenn ihm vom Wandern der Rücken wehtut, springen ihm in Wirklichkeit sämtliche Bandscheiben aus der Wirbelsäule. Er will es gar nicht wissen.
Horatio Beeltz hat ursprünglich vorgehabt, von Berlin bis ans Kaspische Meer zu wandern, von dort aus nach Kasachstan, in die Hungersteppe, einer seiner liebsten Orte. Wenn er die Saiga-Antilopen mit ihren langen gewundenen Hörnern und der rüsselartigen Spaltschnauze in der Ferne traben sieht, kommt er sich vor wie auf einem fremden Planeten, auf dem er sich nicht wie ein Fremder fühlt. Denn er ist genauso aus der Zeit gefallen wie die Saiga-Antilopen, die es schon seit dem Paläolithikum gibt und die in ihrer Unsterblichkeit nur niemandem so richtig aufgefallen sind. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als ein seltsames Bakterium vor ein paar Jahren fast ihre gesamte Population auszurotten drohte. Pasteurella multocida – ein bakteriell bedingtes Massensterben, an dem er sich nicht ganz unschuldig fühlt, denn es wäre nicht das erste Mal, dass er von seinen vielen Reisen seltsame Bakterienarten oder exotische Viren unbeabsichtigt irgendwo eingeschleppt hat. Vielleicht kommt er auch deshalb immer wieder zurück zu den Saigas. Aus schlechtem Gewissen. Weil es ihn beruhigt, sie immer noch traben zu sehen. Die riesigen Hörner der Männchen, die grotesken, aber extrem feinen Nasen, die mit so vielen Haaren und Schleimdrüsen besetzt sind, dass sie nicht nur kilometerweit riechen können, sondern im Sommer durch die Nasenschleimhaut ihr eigenes Blut abkühlen und im Winter damit die kalte Atemluft vorwärmen.
Er hat die Route von Berlin aus über Frankfurt an der Oder geplant, weil er Frankfurt kennt und gut leiden kann, er hat dort länger gelebt und gearbeitet. Hat mal an der Universität gelehrt, als Assistent von Wünsch, der ihn auch in die Loge Zum Aufrichtigen Herzen eingeführt hat, deren Mitglied er heute noch ist, auch wenn er sich regelmäßig als sein eigener Nachfahre ausgeben muss.
Trotz oder gerade wegen der relativen Bedeutungslosigkeit der Stadt ist er immer gern in Frankfurt gewesen. Die krummen Uferbänke, die in den Flusslauf hineinwachsen wie aufsässiges Unkraut, die vielen Halbinseln und Arme der Alten Oder – es ist, als hätte sich der Fluss immer gegen die Zeit gewehrt.
Es ist nicht so, dass nie etwas los gewesen wäre in Frankfurt an der Oder. Das Feuer der Hussiten, die Eröffnung der alten Universität, der kurze Ärger mit Luther, die Schlacht gegen die Schweden, Purmanns Bluttransfusion, die Nazis, die Abtrennung der Dammvorstadt, ein paar ehrgeizige Bauprojekte zur DDR-Zeit. Aber alles war schnell wieder vorbei, und dann ist Frankfurt an der Oder wieder in Bedeutungslosigkeit versunken. Die Stadt ist wie eine Schlafsüchtige, denkt er. Eine, die man immer wieder zu wecken versucht, nur um sie ein paar Minuten später wieder in tiefem Schlaf vorzufinden. Irgendwann gibt man das Wecken auf.
Horatio Beeltz peilt jetzt doch das kleine Zelt mit dem Frisör an. Seine Haare wachsen langsam, aber sie wachsen. Danach will er einen Kaffee trinken, und vielleicht sucht er sich drüben in Frankfurt ein Hotel. Und wenn er schon kurz hier haltmacht, dann will er auch den jüdischen Friedhof in Słubice besuchen. Nicht lang bevor die Juden preußische Staatsbürger werden durften, hat man dort den Junggesellen Salman Prausnitz beerdigt, einen guten Freund. Mit dem er das erste Mal im Leben Absinth probiert hat. Das Zeug war damals ganz neu aus Frankreich gekommen. Leider hat sich Prausnitz damit in einen so schlimmen Zustand gesoffen, dass er aus dem Fenster seines Stadthauses in der Rosenstraße gefallen ist und sich das Genick gebrochen hat.
Nachdem er die zwei Kilometer vom Polenmarkt vorbei am alten Stadion bis zum Friedhof gewandert ist, stutzt er. Der Eingang ist verschwunden, die Einfahrt auch, der Friedhof ist abgeriegelt, und überall stehen Bäume, ein Wald ist entstanden. Über das aufgebogene Zaungitter an der Westseite verschafft er sich Zutritt, der offensichtlich nicht gewünscht ist.
Als er eine Weile unentschlossen im Friedhofswald umhergewandert ist und keinen einzigen Grabstein mehr da vorgefunden hat, wo er einst stand – schon gar nicht den von Prausnitz –, und jetzt am erhöhten Kopfende steht, wo einst die Selbstmörder lagen, fällt ihm etwas auf. Erst kann er es nicht genau benennen, doch dann wird es deutlicher.
Da ist etwas. Etwas Neues. Beeltz war unzählige Male auf diesem Friedhof, aber so etwas hat er selbst im Ansatz noch nie hier bemerkt. Es befindet sich zwischen Beile, Frau des Kalman, und Esther, Tochter des Schlomo Pollack. Nicht mehr als ein kaum sichtbarer Lichtfaden, als hätte man zu lang in die Sonne geschaut. Und da ist ein Geruch. Müsste er ihn beschreiben, würde er sagen: ein bisschen nach Zitrone und ein wenig nach kandierten Walnüssen. Der typische Geruch einer temporalen Fraktur, nach Dr.Rosens Theorie zumindest. Er will es nicht ganz glauben, doch all die Indizien sind vorhanden – es ist ein Riss. Was soll es sonst sein?
Horatio Beeltz’ Hand umklammert den Knauf seines Spazierstocks so fest, dass ihm die Handfläche schmerzt. Wenn Anna jetzt nur hier wäre. Er hat ihr ja gesagt, dass er irgendwann einen findet. Einen, den die anderen übersehen haben. Die feine Genfer Wurmloch-Gesellschaft und die allwissenden Kosmologen. Wenn es das ist, was er glaubt, braucht er die jetzt nicht mehr. Ach, er hat sie vermutlich nie gebraucht. Dann ist jetzt seine Zeit. Die Hungersteppe und die Saigas müssen warten.
1
Mi-Ra macht die Augen auf, weil sie jemand stößt.
»Entschuldigung.«
Es ist der Rucksack eines jungen Mannes, der sie am Ellenbogen getroffen hat. Der Mann ist groß, bärtig, aber jung und wirkt auf eine nicht unsympathische Surfer-Art leicht verwildert. Mit zwanzig hätte er ihr gefallen. Er setzt sich einfach neben sie, stellt den Rucksack zwischen seine Beine. Vermutlich hat er gefragt, ob hier noch frei ist, vielleicht auch nicht. Sie war gerade nicht hier, hat nichts gehört, war unter Wasser.
Der Regionalzug nach Frankfurt an der Oder ist voll, der Mann braucht einen Sitzplatz, es ist okay für sie. Sie macht sich ein bisschen kleiner, als sie ohnehin ist, lächelt kurz und schmal, dreht den Kopf wieder zum Fenster. Sie haben an irgendeinem namenlosen Bahnhof gehalten, zumindest kann sie kein Schild sehen, ihr Wagen steht am Ende des Bahnsteigs – sie müssen immer noch irgendwo in Berlin sein, es ist noch nicht genug Zeit seit dem Hauptbahnhof vergangen.
Es ist ein guter Job, eine gute Reise, sagt sie sich, aber eigentlich weiß sie auch: In Wirklichkeit ist sie noch nicht wieder bereit für die Arbeit. Für die Welt hier unten.
Sie wünscht sich auf den Berg, in ihr Exil hoch über dem Alpensee, zurück in das Zen-Kloster, in das sie zweimal im Jahr reist, um sich zu reinigen, auch wenn das bedeutet, Janni bei ihrem Ex zu lassen. Wo sie arbeitet, für die Gemeinschaft kocht, Gemüse schneidet, Kräuter erntet, die Tiere füttert und die Gruppenräume säubert. Meditativ die Toiletten putzt. Hauptsache Ruhe vor den brüllenden Erwartungen anderer Menschen.
Mi-Ra schließt erneut die Augen, spürt, wie der Zug sich in Bewegung setzt, wie die Fliehkraft sie in den Sitz drückt, wie die Räder des Zugs sich mit den Gleisen verbinden und mit zunehmender Geschwindigkeit nahezu eins mit ihnen werden. Sie spürt alles. Die ganze Zeit. Sie kann ihre Sensoren nicht ausschalten, außer wenn sie schläft. Es ist ein Overkill an Achtsamkeit, scherzt sie manchmal. Es ist definitiv mehr Fluch als Segen.
Sie denkt an stundenlange Wanderungen durch die marsartige Landschaft auf der Südflanke. An die schwarzen, abgestorbenen Bäume auf verblichenen Wiesen, aus denen kuriose Gesteinsformationen ragen, als wären dort Lebewesen spontan versteinert, wie nach einem Vulkanausbruch, einem Ascheregen. Dort oben auf dem Berg hat sie deutlich weniger gespürt als hier unten, auch ihre Sensoren haben offensichtlich Urlaub gemacht. Sie hat nichts vermisst. Nicht den Job, nicht die Wohnung. Und auch nicht Janni, um ehrlich zu sein, auch wenn der Gedanke wehtut. Es ist das Einzige, das ihr den Aufenthalt dort erschwert hat: dass sie kein schlechtes Gewissen gehabt hat, sich allem zu entziehen. Auch ihrem eigenen Kind. Ihn so viele Wochen bei ihrem Ex zu lassen.
Sie hofft sehr, dass Janni nicht wie sein Vater wird. Oder sogar schon ist.
Die Entfremdung hat angefangen, als er sechs wurde. Immer mehr hat er sie an den Ex erinnert und immer weniger an ihr eigenes Kind. Es ist ihr immer leichter gefallen, ihn bei ihm abzugeben. Und sie schämt sich dafür. Fast einen ganzen Monat lang ist Janni jetzt beim Ex. Solange sie in Frankfurt arbeitet, sieht sie ihn nicht. Obwohl sie jedes Wochenende zurück nach Essen fahren könnte.
Einerseits schätzt sie ihre zunehmende Fähigkeit, sich von Gefühlen abzukapseln, andererseits fürchtet sie die Gleichgültigkeit. Fürchtet, dass die somatischen Marker für ihre Emotionen immer weniger werden. Dass sie sich irgendwann an nichts Körperlichem mehr orientieren kann. Zum Beispiel an so was wie Liebeskummer, der in der Magengegend sticht. Oder Freude, die ihr einen Schauer den Rücken hinunterjagt, so blöd das klingt. Sie befürchtet, dass ihre Autarkie den Preis hat, weniger zu empfinden. Aber sie hat auch lange gedacht, das sei es wert, weil nur so der andauernde Schmerz aufhört. Jetzt ist sie sich nicht mehr so sicher.
Während der Regionalexpress Fürstenwalde ansteuert und den Stadtforst durchpflügt, spürt Mi-Ra immerhin eine Neugier aufkommen. Als Archäologin hat sie nur selten die Gelegenheit, völlig unabhängig und allein zu arbeiten. Meistens ist sie in größere Teams eingebettet, und ihre Vorgesetzten und Projektleiter sind aus der Zeit gefallene, behäbige Altakademiker oder geltungsbedürftige Wissenschaftler mit erheblichem Karrieredruck. In beiden Fällen Männer. Und auch jetzt ist es ein Mann, der sie losgeschickt hat, der ihr die Gelegenheit verschafft, als Erste seit der Wende den alten jüdischen Friedhof in Słubice zu erforschen.
Jost hat sie beauftragt. Chefredakteur der Antiken Welt, und Jost ist selbst irgendwie antik. Von antiker Höflichkeit. Und Besonnenheit. Er ist die Ausnahme. Er ist freundlich, wach und großzügig. Er hört zu und redet nie ungefragt. Vielleicht schläft sie deshalb hin und wieder noch mit ihm. Seine Besonnenheit ist echt, während meine nur antrainiert ist, denkt sie.
Jost hat ihr auch das buddhistische Bergkloster in der Schweiz empfohlen, er kennt den Mönch dort, dem das alles gehört. Den Mönch, der mit psychedelischen Substanzen und Microdosing Erleuchtung gefunden hat und auch in die entsprechende Forschung investiert.
Jost findet sie erfrischend. Klar, sie ist ja auch gute zwanzig Jahre jünger als er. Doch nie wirkt er anhänglich, geschweige denn scharf auf sie. Er bietet ihr Dinge an – ein Abendessen, einen Ausflug, und sie kann annehmen oder nicht. Wenn nicht, zieht er vollkommen ungekränkt seiner Wege. Das ist beruhigend.
Jost kennt den Friedhof in Słubice schon lange, kennt die jüdische Interessengemeinschaft in Frankfurt an der Oder, war damals dabei, als die Rabbiner aus den USA kamen und sich selbst ein Bild von den Ungeheuerlichkeiten verschafften, die dort vor sich gingen. Jost hat ihr die Mittel und die Zeit verschafft, auf diese Reise zu gehen, zahlt ihr ein ansehnliches Gehalt für ihre Arbeit, für einen einzigen Artikel. Damit übergeht er vielleicht ihre Kollegen in Berlin, doch sie ist ja auch besser. Moderner, schlagfertiger, zuverlässiger. Zahllose Artikel hat sie für die Antike Welt verfasst, viele über verlassene Friedhöfe. Letztes Jahr ist sie in Heilbronn gewesen, wo sie und ein paar Kollegen ein 4500Jahre altes Areal aus Gräbern entdeckt haben. Unter ihrer Leitung. Jost nennt sie die beste Nekropolistin Deutschlands. Das gefällt ihr, auch wenn sie sich sonst jedem eitlen Gedanken verweigert.
In wenigen Minuten fahren sie in Frankfurt ein. Manche stehen schon auf, manche starren weiter auf ihr Telefon.
Sie selbst hat kein Smartphone. Aber eins mit Tastatur: einen alten Blackberry, den sie seit dem Studium besitzt. Es sei ein archäologisches Wunder, dass der Akku noch funktioniert, sagt Jost.
Der Frankfurter Bahnhofsvorplatz erinnert sie an den Marktplatz eines dieser Orte an der Ruhr, die sie in der Jugend manchmal mit ihren Eltern besucht hat. Jeden Sonntag nach dem koreanischen Gottesdienst ein Ausflug mit ihren Eltern. Jeden Sonntag eine Burg, Kaffee, Kuchen und ein Spaziergang am Fluss. Nie hat sie den Eindruck gehabt, es mache ihren Eltern Spaß. Es wirkte eher so, als schauten sie sich diese langweiligen Spaziergänge von den Deutschen ab, um an einem Sonntag nicht weiter aufzufallen. Genauso wie sie am Samstagabend den Musikantenstadl im Fernsehen sahen und sie und ihren Bruder zwangen, ebenfalls zuzuschauen.
Mit ihrem Rucksack und einer ledernen Reisetasche macht sie sich auf den Weg zu ihrem kleinen Hotel. Runter in Richtung Fluss. Zur Alten Insel heißt die Pension. Dort lässt sie sich von einem jungen Mann mit kurz rasierten Haaren den Zimmerschlüssel geben.
Es ist Anfang Mai, sie öffnet die Balkontür, der Geruch von brackigem Wasser macht sich im Zimmer breit, und es ist ein bisschen zu kalt für die Jahreszeit. Von ihrem Zimmer aus kann man hinüber auf die Insel Ziegenwerder schauen, auf der es mal eine große Gartenausstellung gegeben hat, hat sie gelesen. Das Doppelbett ist so riesig, dass für nichts anderes mehr Platz im Zimmer ist. Nur ein kleiner Sekretär presst sich gerade so neben einen Heizkörper an die Wand, als wollte er nicht weiter unangenehm auffallen. Sie setzt sich vor dem ungeheuerlichen Doppelbett auf den Boden und schließt die Augen, taucht unter Wasser, die Geräusche von der Oberfläche verschwinden.
2
»Die Frage war an Sie gerichtet.«
Die Therapeutin zieht ein bisschen zu energisch den linken Ärmel ihres Wollpullovers hinunter.
Artur schaut zu seiner Frau, die ihm mit einem müden Augenaufschlag bedeutet, sie nicht schon wieder anzuschauen.
»Könnten Sie die Frage wiederholen?«, bittet er die Therapeutin mit den halblangen weißen Haaren.
Sie trägt eine runde Brille und diesen beigen Wollpullover, dessen Saum weit über einen schwarzen Kunstlederrock reicht. Nur die Ärmel scheinen ihr zu kurz zu sein.
»Natürlich, Herr Arkadiusz. Ich will wissen, wo Sie Ihre Trauer lassen«, fragt sie erneut auf Polnisch.
»Also.« Er will jetzt nichts sagen, was Carolina sauer macht. »Ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine konkrete Trauer habe. Meistens werde ich nur müde, wenn ich an sie denke.«
»Und wann genau denken Sie an sie?«
»Also. Ich weiß nicht so genau. Vielleicht wenn ich am Sonntag mit dem Hund spazieren gehe.«
»Könnten Sie das präzisieren? Was passiert an so einem Sonntag?«, fragt die Therapeutin und zieht jetzt an dem anderen Ärmel. »Warum denken Sie an einem Sonntag an sie?« Die Therapeutin ist ungeduldig, außerdem scheint sie heute auf Carolinas Seite zu sein.
»Also«, sagt er, »da ist dann oft ein anderer Vater mit seiner Tochter, die ungefähr im selben Alter ist, wie sie jetzt wäre. Und dann sticht es manchmal. Da.« Er richtet den Blick auf seinen Bauch, traut sich aber nicht, darauf zu deuten. Carolina beobachtet ihn, was ihm unangenehm ist.
»Dieses Stechen ist schlimmer als die Müdigkeit?«, fragt die Therapeutin.
»Nein, das Stechen ist mir fast lieber als die Müdigkeit. Es geht auch schneller wieder vorbei. Die Müdigkeit kommt immer dann, wenn ich anfange, über sie nachzudenken. Wie sie war. Und wie sie noch geworden wäre. Dann bleibt die Müdigkeit oft den ganzen Tag, als hätte ich eine halbe Valium genommen«, sagt er.
»Und erzählen Sie Ihrer Frau, dass Sie müde sind? Oder sagen Sie ihr, wenn es sticht? Wenn Sie einen anderen Vater mit seiner Tochter sehen?«
Er wirft Carolina einen Hilfe suchenden Blick zu. Sie hat jetzt Tränen in den Augen. Er zögert mit der Antwort. »Nein«, sagt er dann.
»Was ist der Grund dafür? Warum erzählen Sie es ihr nicht?«, fragt die Therapeutin.
»Weil. Also. Weil ich sie nicht noch mehr belasten will.«
Seine Frau weint jetzt leise.
»Frau Arkadiusz«, sagt die Paartherapeutin und reicht ihr die mit Tropenvögeln illustrierte Box, in der die Papiertaschentücher sind. »Teilen Sie Ihre Trauer mit Ihrem Mann?«
Seine Frau schüttelt den Kopf.
»Woran könnte Ihr Mann erkennen, dass Sie trauern?«
Carolina tupft sich die Augen ab, und er hat jetzt das Gefühl, ihr etwas Zeit verschaffen zu müssen. »Sie hängt überall Bilder von ihr auf«, sagt Artur. »Es werden immer mehr.« Was eine Information sein sollte, klingt plötzlich wie ein Vorwurf, der ihn selbst erschreckt. Er sieht sie nicht dabei an.
»Ich muss noch mal auf den Friedhof«, sagt er zu Carolina, als sie sich draußen eine Zigarette anzündet. Seit Mila weg ist, raucht sie wieder. Er raucht lange nicht mehr.
Słubice ist kein Ort für Nichtraucher. Überall wirbt das Logo von Tobacco Man mit seinem Slogan »Feuerwasser, Friedenspfeife, Muntermacher«, und überall schwärmen Schriftzüge und Banner von »den billigsten Zigaretten« und »24h Zigaretten und Alkoholgetränken«, meist in deutscher Sprache. Es gibt Tabakläden an nahezu jeder Ecke und gleich mehrere auf dem Grenzmarkt. Allein auf dem Weg von ihrem Haus zum Friedhof sind es sechs. Das müsse man als Grenzstadt in Kauf nehmen, es habe Słubice in den Neunzigern viel Geld aus Deutschland eingebracht, sagt ihr Vermieter. Nur jetzt kaufen nicht mehr die Deutschen die meisten Zigaretten, sondern die Polen selbst. Die deutschen Busse kommen nicht mehr so häufig, die Zigaretten sind teuer geworden und haben dieselben Schockbilder wie in Deutschland mit faulig schwarzen Lungen und Menschen, die Blut aushusten. Und diejenigen, die wegen der Zähne oder einer Haartransplantation kommen, sind meistens nicht so sehr an Zigaretten oder Tabak interessiert.
»Ich geh schon mal nach Hause«, sagt sie und hält die Zigarette in der Hand, ohne zu ziehen. So als wollte sie noch etwas hinzufügen. »Wie lange bist du unterwegs?«, fragt sie tatsächlich ein paar Sekunden später und zieht dann erst an ihrer Menthol.
»Ein paar Stunden. Ich muss noch das Unkraut beim Lapidarium entfernen. Kannst du den Hund mitnehmen?« Er hält ihr die rote Leine hin, an deren Ende eine Jack-Russell-Hündin wie gebannt auf etwas im Boden starrt, das nur für sie sichtbar ist.
»Nein«, sagt sie. »Wenig Zeit heute.«
Er nimmt die Ausrede wortlos hin, fragt sich aber einmal mehr, was sie macht, während er auf dem Friedhof arbeitet. Was sie den ganzen Tag über macht. Sie hat noch nicht wieder die Kraft gefunden, sich eine Arbeit zu suchen, und vermutlich wird auch niemand sie einstellen, solange sie einen derart fragilen Eindruck macht. Sie behauptet, sie gieße die Blumen, kümmere sich um den Garten und die Küche, aber damit vergeht noch lange kein ganzer Tag, denkt er. Und die Erde der Palmen und kleinen Bambussträucher im Wohnzimmer ist oft trocken. Wer weiß, vielleicht hat sie ja eine Affäre.
In Warschau ist es besser für Carolina gewesen. Sie hat viel mehr Resonanz bekommen. Nicht nur beruflich. Sie ist immer noch sehr gut aussehend, nur die Ringe unter den Augen gehen jetzt tiefer in die Haut, das Schwarz darin ist schwärzer geworden. Und ihre durchtrainierten Beine sehen auch immer noch sehr gut aus. Obwohl sie nur noch selten laufen geht.
In Warschau haben sie viele Bekannte gehabt. Sein Team, ihr Mütterkreis. Beata und Paul, Simon, Alicja und Karlo, Marcel und Zofia.
In Słubice gibt es niemanden. Zumindest für Carolina. Er hat noch ein paar alte Schulfreunde hier, auch wenn die sich nicht wirklich für ihn interessieren, seit er nicht mehr schwimmt. Peter ausgenommen. Ansonsten gibt es hier keine Leute für einen Kino- oder Spieleabend und schon gar nicht für eine Affäre. Oder?
»Ich lass dir den Wagen hier, ich gehe zu Fuß«, sagt Artur und gibt ihr den Schlüssel.
Sie nimmt ihn wortlos entgegen. Mit den Fingerspitzen, als wäre der Schlüssel dreckig.
»Ich komm bald heim«, sagt er, aber läuft schon den Schwarzen Kanal hinunter, zieht die Hündin hinter sich her, die sich nur schwer von dem unsichtbaren Ding im Boden verabschieden kann.
Vermutlich steht Carolina noch eine Weile so da mit dem Autoschlüssel zwischen den Fingerspitzen und der abgebrannten Menthol. Er will es gar nicht wissen.
Sie haben eigentlich gern in Warschau gelebt. Zumindest bis zu Milas Tod. Bis man ihm den Job als Friedhofswärter in Słubice angeboten hat. Nachdem seine Karriere als Leistungssportler zu Ende war, hat er sich wieder seinem alten Ausbildungsberuf, Garten- und Landschaftsbauer, gewidmet. Mit Freude eigentlich. Schon in Warschau hat er sich in Teilzeit um den jüdischen Friedhof in der św. Wincentego gekümmert, wenn er nicht gerade mit dem Schwimmverein unterwegs war. Diese organisierte Ruhe auf Friedhöfen hat ihm immer gefallen, und nach Milas Tod hat er mehr denn je eine verordnete Stille gesucht.
Seine Freunde haben ihn damals spöttisch den »schwimmenden Totengräber« genannt, als er noch gar keine Gräber ausgehoben, sondern sich nur um die Pflanzen gekümmert hat. Und auch jetzt ist Gräberausheben nur ein kleiner Teil seiner Arbeit, außerdem hat er dafür seinen Assistenten. Die Wartung der Maschinen und die Rasenpflege, die Bepflanzung des Friedhofs gehören genauso zu seinen Aufgaben wie das Wässern der Gräber, das Arrangieren der Gestecke, das Vergeben der Grabstellen und die Beratung der Familien. Die Leitung der Trauerfeiern.
Auf Milas Beerdigung sind viele Leute gewesen. Zahllose Hände, die er geschüttelt hat, Arme, die ihn gepackt haben. Verschwommene Gesichter mit wässrigen Augen und warmen Händen. Eine schwarze Masse aus Händen und Mänteln, die sich um das Grab versammelt hat, während der Kindersarg aus hellem Birkenholz mit Seilen hinabgelassen wurde. Es ist eine große Gemeinsamkeit und Verbindlichkeit von dieser Gruppe ausgegangen, egal ob die Leute sich selbst leidgetan haben, weil sie an ihren eigenen Tod oder den ihrer Familie gedacht haben, oder ob sie tatsächlich mit ihnen gemeinsam um Mila getrauert haben. Es war ein schönes Erlebnis. Er hat sich verbunden mit den Leuten gefühlt, tatsächlich sogar ein wenig getröstet von der Menge. Er leitet gerne Trauerfeiern.
Carolina hat es als beinahe pervers empfunden, dass er nach Milas Tod hauptberuflich als Friedhofswärter arbeiten wollte. Der schwimmende Totengräber. Der schon lange nicht mehr schwimmt, noch nicht mal in seiner Freizeit. Er ist jetzt nur noch Totengräber. Und das in Słubice, fünf Autostunden von Warschau entfernt. Fünf Stunden von Milas Grab entfernt. Das Gehalt ist ein Argument gewesen, die günstige Miete in Słubice ein weiteres. Vielleicht auch die Nähe zu seinen Eltern. Ein wirklich gutes Argument hat er in Carolinas Augen sicher nie gehabt. Am ehesten noch, dass sie beide das Gefühl hatten, in Warschau nicht mehr richtig atmen zu können.
»Wir hätten schon früher weggehen sollen«, hat er zu ihr gesagt. »Die Stadt hat Mila nicht gutgetan. Vielleicht hat Warschau sie sogar krank gemacht. Die Abgase dort. Der Lärm. Wer weiß.«
»In Warschau gibt es Ärzte und Therapien. Sie hätte sonst gar nicht so lange gelebt«, hat sie geantwortet.
Er weiß, dass sie recht hat. Warschau ist nicht der Grund gewesen. Vielleicht ist es ihre Verbindung. Vielleicht ist das der Fehler, vielleicht hat genau ihre Verbindung diese Krankheit ergeben, die schon bei ihrer Geburt in Mila gelauert hat. Vielleicht hat das Kind nie eine Chance gehabt, weil es ihr Kind war. Dennoch bedauert er mittlerweile, dass sie es nie in Heidelberg versucht haben. Der Oberarzt vom Marie Curie hat ihnen von der alternativen Therapie in Heidelberg abgeraten, zu viel Geld für zu wenig Resultat, zu wenig nachgewiesene Langzeiterfolge, hat er gesagt. Es tut Artur mittlerweile leid, dass er auf ihn gehört hat. Gegen den Willen Carolinas. Jede Woche mehr mit Mila wäre jedes Geld wert gewesen. Es ist seine Schuld.
Der Weg zum katholischen Friedhof von Słubice führt vorbei am obszönen Grenzbasar, den die Deutschen Polenmarkt nennen. Vorbei am alten Stadion mit seiner Nazi-Tribüne. 1932 hat Hitler hier eine Festrede gehalten, in der er etwas von einer Gemeinschaft der deutschen Stämme gefaselt hat. Das steht auf einer Informationstafel am Zuschauereingang. Ostmarkstadion hat es da noch geheißen. Die steinernen Zuschauertribünen sind dem Deutschen Stadion im Berliner Grunewald nachempfunden und halbwegs gut erhalten. Auch das steht auf der Informationstafel.
Manchmal schaut er hier den Amateurfußballern von Słubice zu, diesem völlig bedeutungslosen Verein, der beinahe heimlich unter den riesigen Arkaden spielt, in denen sich vor dem Zweiten Weltkrieg Cafés und Läden befanden.
Neben dem Stadion, auf demselben Hang, liegt der Kommunalfriedhof, auf dem er arbeitet. Auf dem Judenberg. Darunter, vis-à-vis der viel befahrenen DK29, befindet sich der alte jüdische Friedhof, der ursprünglich zur Stadt Frankfurt gehörte, aber nach dem Krieg an Polen gefallen ist. Auch für den ist er zuständig. Er ist völlig verwahrlost, kann noch nicht einmal mehr besichtigt werden. Doch er muss sich manchmal kümmern, zum Beispiel wenn jemand mit dem Auto in den Zaun fährt oder sich im Sommer ein paar Obdachlose dort niederlassen. Vorletzte Woche hat er das aufgebogene Zaungitter an der Westseite notdürftig mit Stacheldraht geflickt, so unschön der Anblick auch ist.
Angeblich standen früher bis zu tausend Grabsteine auf dem Areal. Und eine imposante Leichenhalle. Jetzt ist da ein Wald. Letztes Jahr hat er verwitterte jüdische Grabsteine aus dem Lapidarium zu Fuß nach unten auf den jüdischen Friedhof getragen, den Abhang hinunter, und in Gegenwart eines Historikers genau dort aufgestellt, wo der Historiker es wollte. Der Historiker hat ihn gebeten, eine Kippa aufzusetzen. Derselbe Historiker, der jetzt auf ihn wartet.
Sein Kommunalfriedhof ist im Gegensatz zum jüdischen Friedhof tadellos gepflegt. Allerheiligen, wenn die Innenstadt wie ausgeleert ist und sich lange Prozessionen von Fußgängern und Schlangen von Autos den Berg hinaufschieben, ist sein großer Tag. Der Tag, an dem er am stolzesten auf seine Arbeit ist. Der Tag, an dem er allen in Słubice und Umgebung seinen Friedhof zeigen kann. Er ist der Galerist und Allerheiligen seine große jährliche Vernissage, sagt er sich. Trotz der mühsamen Vorbereitungswochen, trotz des überfüllten Friedhofs und der kreuz und quer parkenden Autos überkommt ihn an Allerheiligen eine Zufriedenheit, die er sonst nur aus seinen früheren Wettbewerben kennt. Eine finale Gelassenheit nach Monaten des Trainings und der Vorbereitung. Diese Gelöstheit, kurz bevor er den Startschuss hört. Kein Überlegen mehr, kein Abwägen. Kein Hinfiebern und keine Zweifel mehr, ob man sich richtig vorbereitet hat. Keine Alternativen. Doch selbst als er damals in Berlin Vierter bei der Weltmeisterschaft geworden ist und Konrad Czerniak ihn persönlich beglückwünscht hat, ist er nicht so erfüllt gewesen wie an Allerheiligen auf seinem Kommunalfriedhof. Noch nicht mal Sydney hat ihm das gegeben. Wenn er auf dem überdachten Vorweg der neu gebauten Kapelle steht und in der Entfernung beobachtet, wie sich der Friedhof mit Hunderten von Leuten füllt, empfindet er eine große Zufriedenheit. Die Zufriedenheit darüber, es selbst in der Hand zu haben.
Heute ist der Friedhof leer. Selbst der Assistent hat frei. Auf dem Hauptweg steht sein 14-Uhr-Termin im beigen Anorak und hellblauen Schal. Herr Baran hat nachdenkliche, wässrige Augen. Als wäre er andauernd gerührt. Artur spürt, wie der Jack Russell vibriert und gleich bellen wird. »Psst, Jackie«, macht er präventiv.
»Hallo, Herr Baran«, sagt Artur auf Deutsch.
»Wir können bei Polnisch bleiben, meine Mutter hat ohnehin Angst, dass ich es verlerne«, sagt Herr Baran auf Polnisch und lockert seinen Schal. Er ist vermutlich noch keine vierzig, aber strahlt eine uralte Ruhe aus. Er organisiert und leitet die historischen Rundgänge in Słubice und Frankfurt, zu denen auch ein Besuch des jüdischen Friedhofs gehörte, als man noch aufs Gelände durfte. Sein historischer Verein hat das Lapidarium errichten lassen, das die deutschen Grabsteine beherbergt. Sein Verein war es auch, der beim historischen Niedrigwasser der Oder auf der polnischen Seite die Grabsteine der Deutschen geborgen und hierhergebracht hat. Ein paar Angler haben die Steine aus dem Wasser ragen sehen, und Baran hat schnell reagiert.
»Die Polen brauchten nach dem Krieg Platz für ihre eigenen Toten. Da haben sie die Deutschen in den Fluss geworfen«, hat Baran damals bei der Rede zur Einweihung des Lapidariums gesagt, und man hat nicht genau bestimmen können, ob er das lustig fand oder nicht. Das kann man nie bei ihm.
Jackie O bellt genau einmal, dann hört sie auf.
»Sie brauchen mal wieder meine Hilfe?«, fragt Artur, und sein Blick fällt auf Barans Wildlederschuhe. »Welche Grabsteine soll ich diesmal den Berg hinunterrollen?« Es sollte gar nicht so sarkastisch klingen, es tut ihm augenblicklich leid.
Doch Herr Baran lächelt. »Dieses Mal ist es eine schönere Arbeit. Signifikant schöner.«
Artur lächelt säuerlich zurück. »Es ist trotzdem sicher wieder etwas, mit dem man sich bei den Słubicern unbeliebt macht.«
»Ach nein, das würde ich so nicht sagen.« Kurze Pause. »Na ja, vielleicht ein kleines bisschen. Sie wissen ja, wie es ist, wenn man auf dem alten Friedhof da unten herumstöbert. Eigentlich müssten sich die Toten gestört fühlen. Stattdessen tun es die Lebenden, die sich das ganze Jahr nicht für die Toten interessieren.«
Artur zuckt mit den Schultern, kann nicht ganz folgen.
»Sie bekommen Besuch, lieber Artur.« Baran sieht ihn an, als wollte er, dass er sich freut.
»Ich?«, fragt Artur.
»Eigentlich wir beide. Aber ich bin die nächsten Tage auf einer Konferenz, deshalb müssen Sie an meiner Stelle Fremdenführer spielen, zumindest bis ich wieder da bin. Natürlich nur, wenn Sie wollen und können.«
»Und wer kommt?«
»Eine sehr beeindruckende Person, Artur. Sie werden mir zustimmen.«
3
»Kann ich bei Ihnen zahlen?«, fragt ein älterer Mann mit einer Halskette, an deren Ende eine Brille hängt, als Mi-Ra vom Klo kommt.
»Ich arbeite hier nicht«, sagt sie und setzt sich an ihren Tisch. Es ist nicht das erste Mal, dass ihr das in einem Restaurant passiert. Doch es ärgert sie am meisten, dass sie nach wie vor zu perplex für einen guten Konter ist.
Während sie mit den Einweg-Stäbchen in ihren Nudeln herumkramt, liest sie einen Zeitungsartikel über Umbauarbeiten des Freibads in Słubice, dessen für Mitte Mai geplante Eröffnung sich verschieben wird. Auf dem Foto ist ein Becken mit Kindern und einer mutmaßlichen Schwimmlehrerin zu sehen, dahinter eine Tribüne und Arkaden, die man so in einem Freibad nicht vermuten würde.
»Das ist unser Amphitheater«, sagt jemand.
Ein Mann mit sanften Gesichtszügen, ohne Bart, kurzes graues, dichtes Haar, lange Wimpern. Jeansjacke.
»Ja, man fühlt sich sofort in die Antike zurückversetzt«, sagt Mi-Ra. »Sie sind vermutlich Herr Arkadiusz?«
»Genau, aber bitte sagen Sie doch Artur.« Er hat einen Akzent, und auf keinen Fall wird sie ihm sagen, dass sein Deutsch gut ist.
»Dann sagen Sie doch bitte Du. Ich bin Mi-Ra Kim. Aber ab jetzt Mi-Ra. Betonung auf der zweiten Silbe.«
»Ich merke mir das.«
»Das wär schön. Es kommt nicht oft vor, dass sich Leute merken, wie man meinen Namen richtig ausspricht.«
Artur nickt, als könnte er das nachvollziehen. »Bin ich zu früh? Mein Wagen steht unten im Parkhaus.«
»Danke. Aber noch mal: Du hättest mich nicht extra hier in Frankfurt abholen müssen, ich bin noch ganz gut zu Fuß«, sagt Mi-Ra.
»Ich musste hier Pflanzen besorgen. Andenpolster.« Er lächelt erwartungsvoll, als wäre die Pflanze wie ein bekanntes Lied, dessen Titel ausreicht, um gute Laune zu verbreiten.
Mi-Ra lächelt zurück. Sie kennt Andenpolster, muss ihm das aber nicht sagen. Sie braucht keine Extrapunkte. Bei niemandem. »Dann können wir jetzt los«, sagt sie stattdessen.
Sie steht auf, nimmt ihren Rucksack, der über dem Stuhl hängt. Dann fällt ihr etwas ein. Sie geht zu dem Mann mit der Umhängebrille.
»Das macht dann 18Euro 90«, sagt sie. Der Mann sieht noch nicht einmal richtig zu ihr auf, bevor er einen Zwanziger aus seinem Geldbeutel fingert. »Stimmt so«, sagt er.
»Danke und einen schönen Tag noch«, sagt Mi-Ra zu dem Mann und nickt Artur zu, der nicht versteht, was er da eben gesehen hat.
In Arturs rotem Scirocco riecht es nach Blumenerde und Hund. Sie bemerkt, wie er sie verstohlen ansieht, während er die Karl-Marx in Richtung Oderbrücke fährt.
»Du kannst mich ruhig fragen.«
»Was kann ich fragen?«
»Wo ich herkomme?«, sagt Mi-Ra.
»Das wollte ich nicht fragen«, sagt Artur und nimmt kurz sanft empört beide Hände vom Lenkrad, was ihr nicht gefällt. Sie fühlt sich nie sicher in Autos, egal wer sie fährt.
»Das glaube ich nicht. Deshalb sage ich es dir. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Geboren und aufgewachsen in Essen.«
»In Essen hatte ich mal einen Wettkampf.« Er legt die Hände oben auf dem Lenkrad ab.
»Was für einen Wettkampf?«, will sie wissen und lässt das Fenster mit dem kleinen Knopf in der Seitenleiste zur Hälfte herunter. In der Stadt riecht es nach Benzin und blühenden Bäumen. Sie hat in den letzten Tagen seltsamerweise immer häufiger das Bedürfnis nach Zigaretten, obwohl sie vor fünf Jahren aufgehört hat zu rauchen. Irgendwie erinnert sie der Geruch hier in der Stadt an eine Zeit, in der sie noch geraucht hat.
»Ich war Leistungsschwimmer«, sagt Artur.
»Gute Leistungen?«
»Gut genug für Olympische Spiele.«
»Klingt gut genug für mich. Welche Spiele?«
»Sydney 2000.«
»Was ist mit Disziplin, Platzierung, Zwischenzeiten? Bitte lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, Artur Arkadiusz.« Sie merkt, wie ihn ihre Direktheit verwirrt. Oder vielleicht ist es auch die Formulierung aus der Nase ziehen.
»1500Meter Freistil – ich bin Siebter geworden. Meine Zeit war 15:08Minuten.«
»In der Zeit schwimm ich das sogar«, sagt Mi-Ra und wartet ab, ob er ihre Ironie versteht. Er lächelt sanft und fährt weiter. Er kann ganz gut mit mir umgehen, denkt sie.
*
Artur hofft, dass sie nicht merkt, wie angestrengt er ist, als er nach der Stadtbrücke die 29 in Richtung Cybinka nimmt, die sie zum Friedhof bringt. Nach dem Blumenladen hat er sich unbedingt die Hände waschen wollen, ist in die kostenpflichtigen Toiletten des Oderturms gehetzt und deshalb zu spät gekommen. Ab da hat er sich in der Defensive gefühlt. Diese Mi-Ra mit Betonung auf der zweiten Silbe ist so sarkastisch und schnell, dass er sein Deutsch bis an die Belastungsgrenze treiben muss, um ihr folgen zu können. Seine Eltern haben ein paar Jahre drüben in Frankfurt gelebt, er war in einem deutschen Kindergarten und hat von da an auch Deutsch gesprochen. Aber er findet, es steht immer noch auf wackligen Beinen. Zumindest heute. Er fühlt, wie er schwitzt, aber hofft, dass sie es nicht bemerkt. Allerdings sagt man ihm nach, dass er aussieht, als könnte es ihn noch nicht mal aus der Ruhe bringen, wenn sich vor ihm die Erde auftut. Seine Frau hat das mal in einem Wutanfall Zen, bis man kotzt genannt. Und als Redewendung für ihn so beibehalten. Wenn er nicht emotional genug auf ihre Vorwürfe reagiert. Wenn er einfach nur aushält, dass sie wütend ist. Wenn er früher als sie begreift, dass ihre Wut eigentlich nicht ihm gilt.
Er ist ein bisschen eingeschüchtert von Mi-Ras Aussehen. Weil sie etwas ausstrahlt, das ihn in den Fahrersitz seines Sciroccos drückt: eine physische Stärke und doch etwas sehr Empfindsames. Sie hat die Oberarme und das Kreuz einer Leistungssportlerin und wirkt trotzdem zierlich. Und ihre Augen beobachten so scharf, dass man sich wie auf Video aufgezeichnet fühlt. Die meiste Zeit wirkt sie freundlich und neugierig, doch wie schnell ihr Gesicht versteinern kann, wenn sie sich unwohl fühlt oder über etwas Problematisches nachdenkt, ist ihm schon nach wenigen Minuten aufgefallen. Dann wirkt sie wie eine Schiedsrichterin, streng und undurchdringbar.
»Wir sind gleich da«, sagt er. »Da vorne ist es.«
»Was sind da rechts für Häuser?«, fragt sie.
»Nachtclubs«, sagt er.
»Nett«, sagt sie. »Dann wissen wir ja, was wir abends unternehmen.«
Er lacht, aber nicht besonders laut. Er findet es interessant, wie sie angezogen ist. Ein dunkelblaues ärmelloses Kleid – das konnte er im Oderturm sehen – und eine schwarze Strumpfhose, darüber eine Lederjacke. Weiß-grüne Turnschuhe. Eine schlichte Sonnenbrille. Sie wirkt nicht, als würde sie sich viel Gedanken um ihr Aussehen machen, gleichzeitig trägt sie das, was sie anhat, so souverän, dass sich alle anderen garantiert zu gut oder zu schlecht gekleidet fühlen.
»Da hinter dem Zaun geht er schon los.« Er zeigt mit dem Finger auf einen blau gestrichenen Eisenzaun mit Gitterstäben, die am oberen Ende wie mittelalterliche Pfeilspitzen wirken.
»Wie lange schon verheiratet?«, fragt sie.
Er braucht einen Moment, um den Themenwechsel zu verkraften.
»Ich tippe auf fünfundzwanzig Jahre. Erste und einzige Beziehung«, sagt Mi-Ra.
»Sechzehn Jahre«, sagt er. »Nicht die erste Beziehung.«
»Entschuldigung, das ist eine doofe Angewohnheit. Ich tu so, als wär ich Sherlock Holmes und könnte den Leuten am Staub ihrer Jacke die Biografie ablesen«, sagt Mi-Ra. »Dabei will ich nur ein bisschen Applaus dafür, dass ich gleich deinen Ehering bemerkt habe.«
Er lässt erneut kurz das Lenkrad los, klatscht leise Beifall und gibt sich Mühe, es nicht höhnisch wirken zu lassen, indem er dazu nickt. Dann nimmt er das Lenkrad wieder in beide Hände.
»Ich danke der Academy«, sagt Mi-Ra, und sein Kopf tut ein bisschen weh. Vielleicht ist sie ihm gerade zu viel. »Aber bitte lass die Hände doch am Lenkrad, ich bin eine nervöse Beifahrerin«, sagt sie dann auch noch.
Er fühlt sich ertappt und fährt langsamer. An einer Stelle hinter dem Zaun kann man drei große Steine erkennen.
»Das sind die Gedenksteine für Rabbiner Mendel, Rabbiner Theomim und Rabbiner Margolies. Sie wurden vor einiger Zeit neu aufgestellt«, erklärt er ihr.
»Das weiß ich. Aber wenn ich ehrlich bin: Mir sagt nur Theomim was. Der hat im 18.Jahrhundert über jüdische Essensregeln gebloggt, wenn man so will. Ein eher unbequemer Typ für die Berliner Rabbiner-Szene damals, wenn ich das richtig gelesen habe. Zu progressiv war er denen.«
Er kann auch nicht mehr zu Theomim sagen. Das mit den Essensregeln ist ihm neu. Sie wirkt dennoch gut unterhalten, sitzt kerzengerade in ihrem Sitz und sieht ihn fordernd an, so als müsste er ihre Aussage dringend bestätigen.
»Ich weiß nicht so viel über ihn«, sagt er leicht eingeschüchtert und beschleunigt wieder. Zu ihrer Rechten liegt das Einkaufszentrum, in dem er hin und wieder Whiskey und Reinigungsmittel holt. »Ich kehre jetzt gleich wieder um. Es ist nur, damit Sie ein Gefühl für die Länge bekommen.«
»Du«, sagt Mi-Ra.
»Wie bitte?«
»Wir duzen uns doch«, sagt Mi-Ra, und ihr Blick fällt auf das bunkerartige Cargo Hotel oben auf dem Hügel über dem Friedhof. Mit einer grotesk langen Funkantenne, die sich in den halb bewölkten Himmel bohrt. Fast möchte er sich für die Antenne entschuldigen.
»Entschuldigung«, sagt er und biegt in den Parkplatz der Wechselstube ein, wo er wendet und die 29 wieder zurück in Richtung Słubice nimmt. Gleich in der Nähe der drei Rabbiner-Steine ist eine mit Gras überwachsene Einfahrt, in der er den Scirocco parkt.
Sie steigen beide gleichzeitig aus, er holt einen Schlüsselbund aus der Innentasche seiner Jeansjacke und schließt auf, entfernt das Schloss und die Kette um den Zaun und öffnet das Tor. Sie stehen jetzt unmittelbar vor den Grabsteinen der Rabbiner.
»Folgen Sie mir«, sagt er.
»Folg du mir«, korrigiert sie.
*
Der vordere Teil des Friedhofs sieht aus wie ein Parkplatz. Dort, wo Artur ihnen aufgeschlossen hat, wächst kein Wald, der Untergrund ist Beton, aus dem vereinzelte Grashalme hervorbrechen. Sie läuft jetzt leicht erhöht, auf einer Art Plateau. Unter ihr ein Hohlraum. Womöglich steht sie auf dem Dach einer ehemaligen Tiefgarage.
Sie weiß nahezu alles über den Friedhof, vom ersten Beerdigungsabschnitt vor 1399 bis zum dritten bis 1945, doch worauf sie gerade steht, weiß sie nicht. Artur Arkadiusz antwortet ihr auf die nicht gestellte Frage.
»Der Friedhof ist nach dem Zweiten Weltkrieg völlig zugewachsen. Das hat schön ausgesehen auf den Bildern. Aber im Herbst 1975 hat man ihn dann abgerissen.«
»Abgerissen? Einen jüdischen Friedhof?« Sie kann sich zwar an das erinnern, was sie gelesen hat, aber sie will es aus seinem Mund hören. Auch weil sie seine freundlich monotone Stimme mag, die sogar eine archäologische Ungeheuerlichkeit wie diese erträglicher klingen lässt.
»Sozusagen über Nacht hat man die Mauer abgetragen und die Grabsteine mit Holzrollen weggefahren. Leider nicht alle. Die vom ältesten Abschnitt haben sie offenbar für wertlos gehalten und abgeschlagen und weggeworfen. Nur leider hat niemand mitgeschrieben, welche Grabsteine genau zerstört wurden. Niemand hat sich die Namen der Toten notiert.«
»Wow. Und dann?« Sie deutet vorwurfsvoll auf den Boden, auf die vermeintliche Tiefgarage unter sich. »Was soll das da?«
»Man hat ein Hotel mit Restaurant gebaut. Und einen Parkplatz. Du stehst auf dem Fundament vom Hotel.«
»Und niemand hat was dagegen gehabt?«
»Nein. Zumindest nicht hier in der Stadt. Der Friedhof war ja schon vorher vergessen. War ja ein deutscher Friedhof«, sagt Artur.
»Aber doch auch ein jüdischer. Gibt doch nicht gerade wenige Juden in Polen? Oder besser: gab.«
»Ich weiß auch nicht.« Er zuckt hilflos mit den Schultern. »Ich nehme an, die Leute, die sich um so etwas kümmern, sind eher in Krakau oder Warschau.«
»Hmmm«, macht sie, überlegt, ob das plausibel ist.
»Ende der Neunziger sind zwei bekannte Rabbiner aus Amerika gekommen und haben nach dem Grab von Theomim gesucht. Aber da war keins mehr. Daraufhin hat man zusammen mit der jüdischen Gemeinde von Brandenburg einen großen Gedenkstein für den gesamten Friedhof aufgestellt. Das ist der da drüben.« Er dreht sich um und zeigt hangaufwärts. Sie sieht keinen Gedenkstein, aber da stehen auch Bäume im Weg.
Auf der Wiese liegen umgefallene Grabsteine, auf denen es sich Moos bequem gemacht hat. Ein anderer Stein steht noch, ein zweiter lehnt sich altersschwach gegen ihn.
»Dann bitte ich mal um einen kurzen Rundgang«, sagt sie.
Er führt sie durch den Wald, zeigt ihr den ersten Beerdigungsabschnitt mit den Steinen, die man irgendwann wieder aufgerichtet hat. Die Mischung aus Moos und Verwitterung lässt manche gar nicht mehr wie Steine wirken, eher wie etwas Pflanzliches.
Er zeigt ihr Überreste der ehemaligen Friedhofsmauer. Besseres Geröll. Ansonsten überall tote Äste, dürre Bäume, trotz regenreicher letzter Wochen. Aus dem Friedhof ist ein Wald geworden, aber kein idyllischer. Die Natur hat sich hier nicht mit Gewalt etwas zurückgeholt, sondern sich eher lustlos breitgemacht. Als wäre sie lieber woanders gewachsen als auf Tausenden von Toten. Stellenweise findet sie Zigaretten und Kronkorken auf dem Boden. Schokoriegelpapier, eine leere Packung H-Milch, eine löchrige blaue Decke.
»Da hinten stand mal das Mausoleum. Ein wunderschönes Gebäude.« Artur schaut in die Bäume. Noch nicht mal ein Trampelpfad ist zu erkennen. Es geht jetzt ein unangenehmer Wind, der den Lärm der DK29 zu ihnen trägt.
»Ich hab ein Bild von der Ruine gesehen, wirklich schön«, sagt sie. »Wann hat eigentlich das letzte Mal hier jemand gegraben?«
»2004 war der Rabbiner aus Amerika erneut zu Besuch. Hat vom Bürgermeister verlangt, dass das Gelände in jüdischen Besitz übergeht. Aber der Bürgermeister hat einfach Nein gesagt. Immerhin durfte der Rabbiner einen Weg, Mauerreste und ein paar Gräber freilegen und schließlich auch die neuen Steine für Theomim und die anderen aufstellen. Eigentlich wollte man danach sogar das Mausoleum wieder aufbauen, aber das war der Gemeinde dann zu kostspielig. Man hat dann dafür das Gelände eingezäunt.«
»Und das sehr geschmackvoll«, sagt sie, aber er übergeht ihre Ironie.
»2008 wurde das Fundament der alten Friedhofsmauer freigelegt, aber wie du siehst, ist es schon wieder zugewachsen.«
»Was ist aus dem Hotel geworden?«
»Daraus wurde irgendwann nach der Wende ein Bordell.« Artur macht eine Pause, verschränkt umständlich die Finger. »Es hieß Eden.«
»Charming«, sagt Mi-Ra und holt ein Taschentuch aus der Jacke. Sie schnäuzt sich, gegen irgendetwas hier ist sie allergisch. »Und daran hat sich niemand gestört?«
»Erst als die Amerikaner sich bei unserem damaligen Ministerpräsidenten beschwert haben. Dann hat das Eden zugemacht, und der jüdische Landesverband hat das Grundstück als Entschädigung bekommen. Und die haben den Nachtclub abgerissen. Kann ich kurz eine Zigarette rauchen?«, fragt Artur. »Draußen?«
»Du kannst von mir aus auch hier eine rauchen.«
»Nein, das will ich nicht. Wir verhalten uns schon falsch genug. Wir müssten eigentlich eine Kippa tragen. Also ich muss eine tragen. Rauchst du auch?«
»Nein«, sagt sie ein bisschen zu entschlossen.