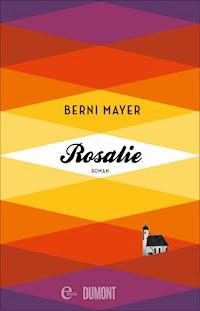9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Falling in Love, Coming of Rage Darauf hat Robert Bley eine Ewigkeit gewartet: Die Schule ist vorbei, endlich kann er weg von zu Hause, raus aus der Gärtnerei seines Vaters, und das tun, was er immer schon tun wollte. Nur, was war das noch mal? Auf jeden Fall eine eigene Wohnung finden, neue Freunde, eine neue Band – und vor allem: Mädchen aus der Stadt. Und die sind für Robert die reinste Naturgewalt, der er nicht immer standhalten kann. Mit Antonia Brandt erlebt Robert seine eigene sexuelle Revolution. Seine Band hat Erfolg, Robert wird gefragter Barkeeper, und das Studium ödet ihn zwar an, fällt ihm aber einigermaßen leicht. Besser kann es im Grunde nicht mehr werden. Dann aber beschließt das Leben kurzerhand und radikal, die Erfolgs- und Abenteuerkurve in die andere Richtung zu lenken ... Berni Mayer erzählt ebenso klug und präzise wie lakonisch von einer Mannwerdung zu einer Zeit, in der niemand mehr genau weiß, womit das Konzept Männlichkeit zu füllen wäre. Zugleich ist ›Ein gemachter Mann‹ ein feinsinniger Beziehungsroman, in dem jeder die Liebe sucht, aber erst mal einen Umweg gehen muss: über die unliebsame Konfrontation mit sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Darauf hat Robert Bley eine Ewigkeit gewartet: Die Schule ist vorbei, endlich kann er weg von zu Hause, raus aus der Gärtnerei seines Vaters, und das tun, was er schon immer tun wollte. Was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall in die Stadt ziehen und studieren, eine eigene Wohnung finden, neue Freunde, eine neue Band – und vor allem: die richtige Freundin, am besten eine Psychologin.
Dabei sind die Mädchen aus der Stadt für Robert die reinste Naturgewalt, der er nicht immer standhalten kann. Mit Antonia Brandt erlebt Robert seine eigene sexuelle Revo-lution. Seine Band Herman Lush hat tatsächlich Erfolg, Robert wird gefragter Barkeeper, und das Lehramtsstudium ödet ihn zwar an, fällt ihm aber einigermaßen leicht. Besser kann es im Grunde nicht mehr werden. Dann aber beschließt das Leben kurzerhand und radikal, die Erfolgs- und Abenteuerspur in die andere Richtung zu lenken …
Mit herausragendem Gespür für Zwischentöne fängt Berni Mayer ein Lebensgefühl ein, das gleichermaßen von Optimismus, Melancholie und Larmoyanz durchdrungen ist. Ein hochkomischer wie auch warmherziger Roman über das menschliche Miteinander und darüber, was passiert, wenn man im Grunde nur noch an einer Sache scheitern kann: den eigenen Erwartungen.
© Lena Fingerle
BERNI MAYER, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, hat Germanistik und Anglistik studiert, war Redaktionsleiter bei MTV und VIVA Online und hat für das Label Mute Records gearbeitet. Berni Mayer lebt in Berlin. Er ist Autor und Journalist und arbeitet für diverse Podcasts. Bei DuMont erschien 2016 sein Roman ›Rosalie‹.
BERNI MAYER
EIN GEMACHTER MANN
DIE LICHTSCHEUEN STUDIENJAHRE DES ROBERT BLEY
eBook 2019
© 2019 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
»Alle Männer sind ichbezogene Kinder.«
Christa Wolf, Kassandra
»Are you the little girl who’ll grow up to save the world or are you the little boy who carries on the evil men do?«
Frankie Stubbs/Leatherface, »
1
HAUNTING THE CHAPEL
Robert Bley hält seinen Zeigefinger ins Licht. Ein roter Tropfen perlt an ihm herunter, gefolgt von einem Blutfaden, überquert die Lebenslinie und fällt auf den karminroten Boden, wo er einen kleinen dunklen Fleck hinterlässt. Robert hat noch fünf Sekunden Zeit, bevor das Chaos ausbricht.
Es ist Feierabend in der Kapelle.
Links von ihm, unter der gusseisernen Wendeltreppe, die nach oben zum Ausgang und zur Toilette führt, sitzen die Punker in Unterhemden und Lederjacken und lachen ihn aus. Rechts davon auf der Bank mit den kleinen runden Tischen aus Metall, entlang der Wand mit dem gerahmten Filmplakat von Jesus Christ Superstar und einer Kopie von GnadenbildMariahilf von Cranach dem Älteren, sitzen die Stammgäste, die im Gegensatz zu den Punks noch bleiben dürfen. Thomas, der permanent schwitzende Türsteher, hat sie aus allen Winkeln der Kapelle zusammengetrieben und gegenüber der Theke auf der Bank aufgereiht. Sie beobachten stumm, wie Robert Bley seine blutende Hand ins matte Deckenlicht hält, nur einer ist aufgestanden, als wollte er etwas unternehmen, umklammert aber gleichzeitig sein Bierglas, als hätte er Angst, man könne es ihm wegnehmen.
Wer in der Kapelle arbeitet, nennt sie auch »Tropfsteinhöhle«, denn sie liegt unter dem Donauspiegel, und bei ernsthaftem Hochwasser wird sie mindestens bis auf Kniehöhe durchgespült. Beim letzten Jahrhundertregen stand das Wasser fast bis zum Tresen. Die Treppe von oben führte direkt ins Wasser, wie die Stufen ins Nichtschwimmerbecken drüben im Westbad.
Robert Bley hat jetzt noch drei Sekunden Zeit. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie sein Chef, der heute als zweiter Keeper eingesprungen ist, sein Geschirrtuch weglegt und mit finsterer Entschlossenheit zum Tresenausgang schreitet. Er kann beinahe sein tieffrequentes Schnaufen hören, obwohl im Hintergrund immer noch New Model Army läuft. Noch zwei Sekunden. Ein neuer Blutstropfen macht sich in Richtung Lebenslinie auf.
Gerade noch hat Robert im Nebenraum ein paar Tische abgeräumt, als der schwitzende Thomas ihn darauf ansprach, dass Mona Ärger mit einem Gast habe. Robert hat sich umgehend in den Hauptraum begeben, da stand dann dieser ausgezehrte Mann mit einem abgebrochenen Flaschenhals vor Mona und hat sie satt und selbstgefällig angegrinst, während sie ihn anschrie. Irgendwas von lebenslangem Hausverbot und kleinem Schwanz. Classic Mona. Robert hat sich dazugestellt und so was gesagt wie: »Meister, du legst jetzt sofort die Flasche weg, sonst rufen wir die Bullen«, worauf ihn Mona mit dem linken Arm auf Abstand gehalten hat, so als wollte sie nicht, dass er sich einmische oder ihre Autorität untergrabe.
Dann ist ihm aufgefallen, dass es sich bei der zerbrochenen Flasche um ein Budweiser handelte, und er hat nicht anders gekonnt als zu denken, dass ihm damit eine Pfandflasche für die Metro am Montag fehlen würde.
»Einen Scheißdreck mach ich«, hat der Gast gesagt, jetzt nur noch ihm zugewandt. »Ich bleib da und trink in aller Ruhe mein Bier aus. Dazu habe ich als Gast ein Recht«, hat er gesagt. Robert hat sich den Hinweis gespart, dass da überhaupt kein Bier mehr sei, das der Gast hätte austrinken können, und er wollte auch nicht jemandem zum hundertsten Mal erklären, dass das Hausrecht beim Gastwirt liegt und jemand, der nicht gehen will, Hausfriedensbruch begeht. Also hat er an Mona vorbei nach dem Handgelenk des ausgezehrten Gastes gegriffen, der hat es zurückgezogen und eine Zacke der abgebrochenen Flasche hat Roberts Finger aufgeschlitzt.
Daraufhin ist Robert zurück hinter den Tresen getreten, hat abwechselnd seinen blutenden Finger und den Gast angeschaut und gewusst, dass er sich eine Eskalation wünschte, aber nicht unbeträchtliche Angst davor verspürte. Der Gast hat ein Gesicht, als wäre er in der Jugend an Akne gestorben. Ein Gesicht zum Hineinschlagen, denkt Robert. Gelbliche Zähne, die das eklige Lächeln orchestrieren. Haare dunkelblond, kurz und doch fettig, hinten einen Tick zu lang. Eine bis ins Farblose ausgewaschene Jeans, ein brauner Wollpullover, ein schwarzer, offener Mantel darüber, an dem zwei Knöpfe fehlen.
Die fünf Sekunden sind vorbei, jetzt beginnt es.
Mona rennt nach hinten zur Stereoanlage, wo auch das Telefon steht, und ruft die Polizei. Sein stämmiger Chef kommt hinter dem halbmondförmigen Tresen hervorgerumpelt. Robert tritt einen Schritt zurück, damit der Chef sein Ziel nicht verfehlt. Der Chef heißt mit Spitznamen Turkey – lange muss man nicht nach dem Ursprung des Spitznamens suchen, er trinkt am liebsten Wild Turkey auf Eis.
Der Chef rammt den Gast mit der rechten Schulter gegen einen der Tische vor der Bank, auf der die Stammgäste aufgereiht sind. Robert schickt einen Fuß hinterher, während der Gast sich krümmt, und tritt ihm damit den abgebrochenen Flaschenhals aus der Hand. Er und Turkey sind wie ein Tag Team im Wrestling, das einen kombinierten Angriff einstudiert hat.
Erledigt ist die Sache damit aber noch nicht. Der Gast erhebt sich und springt den Chef an, klammert sich an seinen Hals. Turkey taumelt und kippt mitsamt Gast auf die untersten Stufen der Wendeltreppe. Als Robert den Gast von seinem Chef herunterziehen will, haut ihm jemand auf den Hinterkopf, und die Punker lachen. Ein anderer Gast, der schon lange kurz vorm Hausverbot steht, hat sich offenbar spontan solidarisch erklärt und schlägt mittlerweile von hinten mit der Faust auf Roberts Nacken ein, wenn auch nicht fest.
Wo bin ich denn hier?, denkt Robert, während die Schläge in seinen Nacken regnen. Als ob er alle Zeit der Welt hätte. In diesem mittelguten Leben bist du immer noch, antwortet er sich selbst in diesen verlangsamten Sekunden. In diesem mittelguten Leben, das einfach nicht aufhört, nur mittelgut zu sein. Immerhin passiert was, denkt er dann und ist vorerst beruhigt. Immerhin schlägt jemand von hinten auf mich ein, und aus meinem Finger fließt ein bisschen Blut. Immerhin passiert was. Jetzt hat er Lust, etwas zu unternehmen, rechnet aber noch kurz im Kopf zusammen, dass er zehn dieser kleinen Underberg-Fläschchen, drei Gimlets und zwei Bier getrunken hat und natürlich den Wild Turkey auf Eis zum Schichtende. Er dürfte eigentlich gar nicht mehr stehen können, und trotzdem ist er jetzt hellwach.
Er dreht sich um und packt den anderen aufsässigen Gast, der bis eben auf ihn eingetrommelt hat, bei den Schultern, dreht ihn um und nimmt ihn von hinten in den Schwitzkasten. Es ist ein junger, freundlich aussehender Jordanier namens Renan, der mit einem anderen Jordanier befreundet ist, der Hausverbot hat, nicht weil er Jordanier ist, sondern weil er der Vorgängerbedienung von Mona einmal während der Schicht ein Messer unter seinem Pullover gezeigt hat mit dem Hinweis, er lasse sich nicht einfach so von der Belegschaft um drei Uhr rausschmeißen. Womit er durchaus recht behalten hat, denn die Polizei hat das letztlich übernommen. Robert hat keine Ahnung, warum ausgerechnet der freundliche Renan dem Gelbzähnigen beispringt, vermutlich sind sie befreundet. Diese Art von Loyalität weiß Robert zu schätzen, aber jetzt muss er Renan in Schach halten, damit die Situation nicht noch weiter außer Kontrolle gerät und sich noch mehr Gäste einmischen.
Der Schwitzkasten um Renan geht so lange gut, bis der junge Jordanier seinen Hinterkopf gegen Roberts Kinn hämmert, sodass der nach hinten auf den gelbzähnigen Gast und seinen Chef fällt.
Jetzt wird es unübersichtlich.
Ein menschlicher Knoten aus vier Kombattanten müht sich die Treppe hinauf. Der Impuls nach oben kommt natürlich von Robert und Turkey, schließlich ist oben der Ausgang, die schwere Stahltür, durch die keiner kommt, außer der schwitzende Thomas öffnet sie nach einem Blick durch sein Guckloch. Thomas ist übrigens durchaus so gebaut, dass er eingreifen könnte, aber er saß schon mehrmals für kurze Zeit im Gefängnis; er hat von Turkey die Erlaubnis, sich nicht in eine Prügelei einmischen zu müssen, außer es geht um Leben und Tod. Auch deshalb wünscht Robert sich schon lange einen neuen Türsteher, doch der Chef hält zum schwitzenden Thomas, der gerade an einem Methadon-Programm teilnimmt.
Jetzt gerät Robert selbst in einen Aufgabegriff. Irgendein Unterarm würgt ihn von hinten, sodass er kurz in Panik verfällt. Doch dann sieht er den Ehering seines Chefs an der geballten Faust vor seinem Brustkorb. Er ist ganz leicht an dem roten Stein zu erkennen. Indianischer Ehering, hat ihm Turkey, der große Amerika-Fan, mal erklärt.
»Turkey, lass los, ich bin’s«, keucht Robert mit ersterbender Stimme.
Augenblicklich lässt der Druck nach, und Robert hört ein »Scheiße, sorry«, bevor er sich umdreht und sieht, wie Turkey sich stattdessen den freundlichen Jordanier packt und sich ihn über die Schulter hängt.
Jemand beißt Robert in den Arm. Es tut eigentlich nicht besonders weh, aber natürlich muss er sofort an AIDS denken. »Hast du den Arsch offen?«, stößt er aus und schlägt dem beißenden Gast mit der flachen Hand ins Gesicht, worauf der Gelbzähnige seinen Kiefer wieder entspannt. Er hat noch nie jemanden unmittelbar ins Gesicht geschlagen, seit er kein Kind mehr ist. Es fühlt sich verboten, doch nicht schlecht an. Robert rappelt sich auf und nimmt den Gast noch auf der Treppe in einen doppelten Nelson, den er sich beim Ringen abgeschaut hat. Schiebt ihn im Doppelnelson nach oben, wo schon der Chef mit Renan wartet. Endlich hastet auch der schwitzende Thomas hinterher und macht oben die schwere Eisentür auf.
Robert entlässt den Gast aus dem Doppelnelson und schubst ihn zur Tür hinaus. Hinter ihm kommt Turkey mit Renan über der Schulter angedampft, und um nicht im Weg zu stehen, tritt Robert ebenfalls nach draußen. Dann fällt die Tür hinter ihnen zu.
»Mach auf, Thomas!«, brüllt Robert, während der Gelbzähnige ihm mit größter Wut von hinten in die Kniekehle tritt. Im Umknicken reißt ihn Robert mit auf die steinernen Fliesen und rollt sich Richtung Jagdbedarf Müngerer ab, dem Geschäft gegenüber dem Eingang der Kapelle, durch dessen Fenster man auf Gewehre, schmale grüne Hüte, Bundeswehr-Rucksäcke und dunkelbraune Jacken blickt.
Thomas macht nicht auf, und Robert sitzt jetzt auf dem Gast mit den gelben Zähnen, bohrt ihm ein Knie in den Magen. Der Gast bekommt dafür Roberts Krawatte mit dem psychedelischen Muster zu fassen. Der einfache Windsor zieht sich zu, schneidet Robert in die Haut unter dem Adamsapfel. Kurz denkt Robert, dass es das jetzt gewesen ist, dass er jetzt erwürgt wird. Mitten im immer noch nur mittelguten Leben, so eine Scheiße.
»Ich lass nicht los, damit das klar ist«, presst der Gast raus. Während er das sagt, donnert Robert ihm das Knie in den Magen, dass man die Luft förmlich aus dem Gelbzähnigen entweichen hört. Er lässt entgegen aller Ankündigungen die Krawatte los.
»Du dummes Arschloch«, sagt Robert Bley, jetzt neben dem Gast kniend. Überall ist Blut, auf Roberts Hemd, im Gesicht des Gelbzähnigen, auf den Steinfliesen.
»Mist, wo ist meine Brille?« Über ihnen steht Turkey in seinen vollständig aufgerichteten 1,90, das Hemd aufgerissen, Blutflecken auf der rechten Seite. Der freundliche junge Jordanier ist verschwunden, nachdem Turkey ihm gedroht hat, ihn auf seiner Schulter höchstpersönlich bis zum Polizeipräsidium zu tragen.
Der gelbzähnige Gast hat seinen Widerstand aufgegeben, holt rasselnd Luft und richtet von unten das Wort an Turkey und Robert, der jetzt ebenfalls steht. Wütend sieht er immer noch aus, aber jetzt so wütend wie ein kleines Kind, das weiß, dass es sich nicht mehr gegenüber den Erwachsenen durchsetzen wird.
»Ihr braucht jetzt gar nicht so überheblich schauen. Zu zweit auf einen, das traut ihr euch. Ich geh da jetzt wieder runter und trinke mein Bier aus. Weil das mein gutes Recht ist. Als Gast.« Nur noch leicht beleidigt klingt er, als hätte er nicht gerade versucht, sie aufzuschlitzen, totzubeißen, zu erwürgen.
»Das glauben wir kaum«, sagt ein Polizist, der gerade die Passage betritt. Robert kann kein Blaulicht sehen, aber das Präsidium am Bismarckplatz ist auch nur ein paar enge mittelalterliche Gassen entfernt. Vermutlich sind die Bullen, die Mona gerufen hat, zu Fuß hier.
»Was haben wir denn heute für ein Problem, Herr Geyer?«, fragt der Polizist, dessen Kollege auch gerade angekommen ist. Er hat ein glatt rasiertes, faltiges Gesicht, dessen Ausdruck irgendwo zwischen weise und zutiefst erschöpft pendelt. Sein Kollege ist jünger, hat einen hauchdünn rasierten Bart um Kinn und Oberlippe, für den man sicher eine halbe Stunde am Tag braucht.
»Das Übliche. Der will nicht gehen«, sagt Turkey, der bürgerlich Stefan Geyer heißt, und blinzelt so hektisch, als könnte er nichts mehr sehen ohne Brille.
»Handgreiflich?«, fragt der tonangebende Polizist mit Blick auf die blutverschmierten Hemden der beiden Barkeeper.
»Gar nicht. Der Kollege hat sich nur an einem Glas geschnitten, das hat sich verteilt«, sagt Turkey, woraufhin Robert zustimmend nickt. Natürlich hat keiner von ihnen Lust, als Zeuge aufs Gericht in der Auguststraße zu gehen. Wegen so einem Blödsinn.
»Also keine Anzeige, Herr Geyer?«, hakt der weise Polizist nach. Das »Herr Geyer« zu betonen macht ihm sichtlich Spaß.
»Überhaupt gar keine Anzeige, Herr Wachtmeister«, sagt der Chef mit seinem leichten Lispeln und blinzelt immer noch wie wild.
»Dann kommen Sie jetzt einmal mit«, sagt der Polizist zum Gast mit den gelben Zähnen und den Aknenarben, der mittlerweile aufgestanden ist und interessiert zugehört hat, so als beträfe ihn das alles gar nicht.
»Es ist mein gutes Recht, mein Bier auszutrinken. Ich gehe nirgendwohin«, sagt er.
»Freilich«, sagt der Polizist und nimmt seinen rechten Arm, sein jüngerer Kollege den linken.
Sie führen ihn ab, er wehrt sich kein bisschen, so als wäre die Angelegenheit für ihn damit auch erledigt, als beruhigte ihn die Anwesenheit der Polizei. Er scheint zu wissen, dass die Schlacht verloren ist; der fliegt nicht das erste Mal aus einer Kneipe, denkt Robert. Kurz hält der eine Polizist mit dem erschöpften Gesicht noch mal inne, dreht sich um und sagt: »Ich hoffe, Sie haben da unten keinen Betrieb mehr um die Uhrzeit. Sonst muss ich Ihnen das Ordnungsamt vorbeischicken.« Er tippt sich an die Polizeimütze. »Nacht, Herr Geyer.«
»Nur noch Belegschaft«, sagt Turkey, und Robert zeigt den Polizisten den Mittelfinger, nachdem sie ums Eck gebogen sind.
»Jetzt haben wir uns aber echt einen Schnaps verdient«, sagt der Chef und legt eine Hand auf Roberts Schulter. Mit der anderen klingelt er. Der schwitzende Thomas öffnet.
»Wie geht’s deiner Hand?«, fragt Thomas mit seiner sanften Stimme.
»Blutet immer noch«, sagt Robert fast stolz und denkt daran, wie Kristin König morgen verständnislos den Kopf schütteln wird, wenn sie die Hand sieht. Wie sie überhaupt das meiste, was er zur Zeit so treibt, mit einem verständnislosen Kopfschütteln quittiert. Hauptsache, sie begreift, wie gefährlich er lebt.
»Raus jetzt. Und zwar alle«, schreit Mona unten die verbleibenden Gäste an. »Die Bullen sind draußen!« Natürlich lachen die Punker, aber sie spuren, denn zum einen respektieren sie Mona, zum anderen haben sie keine Lust auf die Polizei.
Während der Chef sich noch ein Bier zapft und drei Wild Turkeys einschenkt, klebt Mona drei Pflaster übereinander auf Roberts Zeigefinger.
»Das kriegst du nie wieder raus«, sagt sie und legt ihren Zeigefinger auf eine besonders rote Stelle an seinem Hemd. Dann betrachtet sie interessiert ihren eigenen Finger, ob das Blut abgefärbt hat.
»Ist das Trinkgeld okay?«, fragt Robert. Sein Blick gilt Monas ausgebeulter schwarzer Brieftasche, die sie hinten in der Jeans trägt. Einen besseren Hintern als ihren kann er sich gar nicht vorstellen. So kugelig und bestimmt. Dieser Hintern ist souverän, genau wie Monas Umgang mit den Gästen. Sie kann schmeichelnd und mädchenhaft sein, aber auch patzig und radikal, wenn sie zum Beispiel mit den betrunkenen Juristen spricht, die hin und wieder über die Bar herfallen und drohen, die ganze Kneipe zu kaufen, wenn etwas nicht nach ihrer Vorstellung läuft. Denen gibt sie nur für diesen Satz lebenslanges Hausverbot, das Turkey dann wieder aufheben muss, weil er es sich mit den Juristen nicht verscherzen will.
»Trinkgeld war gut. Das hauen wir beim Würstl-Toni auf den Kopf, oder?«, sagt sie und schüttelt ihre tomatenroten Haare, als müsste sie Staub loswerden.
»Ich komm nicht mehr mit«, sagt der Chef und hält ihnen zwei Tumbler mit Eis und Wild Turkey hin. »Ich muss morgen aufs Amt.«
»Was machst du auf dem Amt?«, fragt Robert.
»Ach, die Scheiße mit dem Mao.«
Der Mao ist ein Großgastronom, dem etliche Kneipen in der Stadt gehören, doch die meisten hat er verpachtet, so wie die Kapelle.
»Pfui Teufel«, sagt Mona und trinkt den Wild Turkey mit einem Schluck aus.
Bis der Würstl-Toni aufmacht, müssen sie noch eine halbe Stunde überbrücken. Mona nimmt zwei Budweiser mit, und Robert muss an das fehlende Leergut für die Metro am Montag denken, schließlich ist er der kommende Geschäftsführer der Kapelle.
Dann setzen sie sich gegenüber vom Eingang zur Kapellen-Passage an die Donau hinter das lang gezogene Haus an der Weinlände, das sie vor der Straße und den Blicken von früh aufstehenden Rentnern, Joggern und Straßenreinigern schützt. Es wird ein kühler Morgen werden, gegen Mitternacht hat es geregnet, die erste Junihitze ist vorbei.
Sie küssen sich aus reiner Gewohnheit, trinken ihr Bier aus und gehen schließlich zum Wurststand auf dem Parkplatz schräg gegenüber der Dombauhütte. Mona bestellt zwei Knackersemmeln mit süßem Senf und zwei Jägermeister. Danach ist Robert schlecht. Er begleitet Mona noch bis zur hinteren Hälfte der Oberen Bachgasse, sie knutschen noch mal, dann kehrt er in seine Wohnung im Gässchen ohne End zurück und legt sich in seinem kleinen Schlafzimmer auf die Matratze am Boden, neben der links und rechts Comics verstreut liegen. Das Bad, das er sich mal mit Rothkowski geteilt hat, besitzt immer noch keine Tür, deshalb duscht er auch nicht, obwohl er sich dreckig und blutverschmiert fühlt. Außerdem kann er so ein bisschen mehr Eindruck schinden, wenn sie ihn in ein paar Stunden sieht.
Es ist jetzt zwanzig vor sieben an einem Samstagmorgen, und Robert Bley kann nicht schlafen. Er steht noch mal auf, stellt sich ans Fenster hoch über dem Emmeramsplatz und blickt hinüber zum Schloss und zum Regierungsgebäude. Die Fahnen sind auf Halbmast wie nach dem Zugunglück vor ein paar Wochen. Er öffnet das Fenster und riecht an dem Samstagmorgen. Der duftet nach frisch gemähten Wiesen und Regen, nach Kamille und ein bisschen nach Benzin. Man kann jetzt nicht mehr abstreiten, dass Sommer ist. Nicht mehr abstreiten, dass jetzt dringend ein paar Dinge erledigt werden müssen, um dieses mittelgute Leben verdammt noch mal endlich hinter sich zu lassen.
Er denkt an sie, drüben in ihrem Zimmer, in dem sich bis vor ein paar Monaten noch die Whiskeyflaschen und Bücher von Rothkowski getürmt haben. Denkt an sie, wie sie vielleicht längst am Schreibtisch sitzt, an ihrer Diplomarbeit schreibt und vielleicht schon den Müll hinuntergebracht hat. Oder gar nicht mehr da ist. Sie ist ja selbst am Wochenende fürchterlich früh wach, während er es im Winter öfter geschafft hat, von Dunkelheit zu Dunkelheit zu schlafen.
Er fragt sich, wie lange er schon keinen Samstagvormittag erlebt hat. Kann Jahre her sein. Überhaupt sind die Vormittage ein rares Gut geworden. Vielleicht sogar die Tage.
2
DIE ANKUNFT DES REGENKÖNIGS
Am Vormittag von Allerheiligen 1994 fuhr Robert Bley in seinem bronzefarbenen Toyota Tercel Allrad auf der A3 die knapp fünfzig Kilometer von Ascha bis nach Regensburg und hängte spaßeshalber seine Mutter ab, die mit dem Gärtnerei-Bus verzweifelt versuchte, hinter ihm zu bleiben. Wenn er weit genug weg war, ließ er sich großzügig zurückfallen, nur um das Spiel zu wiederholen. Auf Höhe des Uniklinikums ließ er sie dann überholen, denn er hatte sich nicht gemerkt, wo die Wohnung war. Sein Orientierungssinn glich dem einer tauben Fledermaus.
Die Wohnung lag über dem Gasthaus Bürgerbräu Griesnagel und gegenüber vom Traditionsbäcker Salzmann, der mit den beiden schönen Töchtern, von denen eine aussah wie Julia Roberts, aber das sollte er erst später herausfinden. Eigentlich hatte seine Mutter vorgeschlagen, dass Robert in ein günstiges Studentenheim ziehen könnte. Auf gar keinen Fall würde er in ein Studentenwohnheim ziehen, hatte Robert protestiert. Nirgendwohin mit einem Gemeinschaftsabend und einer Gemeinschaftstoilette. Wie gehaltvoll konnte ein Morgen nach einem One-Night-Stand sein, wenn das Klo von irgendwelchen Wasserbüffeln aus Tirschenreuth besetzt war oder vollgeschissen? Das sagte er natürlich seiner Mutter nicht.
Aber da hättest du sofort Anschluss, argumentierte seine Mutter.
Ich brauche alles andere als Anschluss, ich will doch nicht vom einen betreuten Wohnen zum nächsten. Ich will endlich alleine sein.
Nichts gegen dich, hatte er hinzugefügt, als seine Mutter ihn entmutigt angeschaut hatte.
Also hatten sie seinen Vater gefragt, ob er etwas anderes als ein Studentenwohnheim finanzieren würde.
Mir ist das scheißegal, wo du wohnst und wie viel das kostet, hatte seine Antwort gelautet, Hauptsache, du beeilst dich mit deinem Studium, wenn du schon kein Gärtner sein willst.
Daraufhin war der Blick seiner Mutter glasig geworden, und sie hatte noch am selben Vormittag in der Zeitung eine Wohnung direkt beim Fernsehturm herausgesucht, in Universitätsnähe.
Da kannst du zu Fuß gehen. Altstadt ist zu teuer, und es gibt da keine Parkplätze, hatte sie gesagt.
Das hatte ihn überzeugt. Den Wagen unmittelbar vor der Haustür zu haben war schließlich auch eine Frage der persönlichen Freiheit, fand er. »Bleymobil« nannte er seinen Tercel Allrad zärtlich, und er konnte ewig den Gleichgewichts-Anzeigen in der Mitte des Armaturenbretts zuschauen, wie sie sanft im Rhythmus und Gefälle der Straße wogten. Er vermutete eine Art Wasserwaage dahinter, doch verstand er weder deren Sinn noch interessierten ihn die Details. Er wusste nur, dass die Reifen gleichmäßig auf der Straße liegen mussten, um in den Vierrad-Antrieb zu schalten, mit dem man besser über die Feldwege und Wiesen brennen konnte. Deshalb war der Tercel auch ein beliebtes Fahrzeug bei den Bauern in seiner Gegend.
Also hatte seine Mutter für ihn aus der Mittelbayerischen eine erschwingliche Vierzig-Quadratmeter-Wohnung auf dem Ziegetsberg herausgesucht, die er neulich vor dem Ausgehen mit Hamlet im Halblicht der Dämmerung besichtigt und für gut befunden hatte. Sie besaß ein eigenes Badezimmer und eine Küche, in die ein kleiner Tisch hineinpasste, an dem er rauchen konnte. Zudem hatte Hamlet ihm versprochen: Wer so nah am Fernsehturm wohnt, der empfängt garantiert mehr Fernsehprogramme als jeder andere Mensch und ganz sicher auch beide Musiksender. Dann kam noch dazu, dass gegenüber vom Gasthof Griesnagel das katholische Studentenwohnheim Erzbischof Buchberger stand, in dem überwiegend Mädchen wohnten.
*
In den beiden Autos war alles drin, was er für die neue Wohnung benötigte. Den Gärtnerei-Bus hatte sein Vater nur unter Protest und auf Druck seiner Mutter hin ausgeräumt und zur Verfügung gestellt. Aber so hatten sie Folgendes geladen:
1 Matratze
1Holzwürfel (H: 80cm) als Nachttisch
1 kleine weiße Wäschekommode mit vier Fächern
1 schwarzen 14-Zoll-Röhrenfernseher von Philips
1 schwarzes Bücherregal (H: 1,20m)
1 kleine Kompaktstereoanlage
3 Umzugskisten mit Kassetten, Büchern und CDs
1 weiß lackierter, quadratischer Holztisch für 2Personen
1 elektrische Schreibmaschine mit Display
2 blaue Müllsäcke mit Kleidung
2 schwarze Klappstühle
1 moderner Sessel mit hölzernen Armlehnen
1 Snare Drum
Robert hätte gern sein vollständiges Schlagzeug mitgenommen, doch das Argument seiner Mutter mit der Lärmbelästigung in einer Mietwohnung sah er ein. Einen Schreibtisch hatte er nicht dabei, denn man könne und sollte eh das meiste in der Universitätsbibliothek erledigen, hatte seine Mutter behauptet. Woher auch immer sie das wissen wollte, sie hatte ja nie studiert, war gleich nach der Berufsschule zur Gemeinde in Mitterfels gegangen.
Robert war im Grunde zufrieden mit der spärlichen Einrichtung. Redete sich ein, Ballast losgeworden zu sein; in Wahrheit hatte er eher Angst, sich einem unbekannten Ort zu versprechen, von dem er nicht wusste, wie lange er dort bleiben würde. Es reichte vorerst, wenn der Auszug von zu Hause nach außen hin wie eine Zäsur wirkte, es musste sich ja nicht gleich auch so anfühlen. Mindestens einen Tag in der Woche wollte er zumindest anfangs noch in der Gärtnerei und in seinem alten Zimmer verbringen. Deshalb war es dann auch erträglich, wenn sein altes, eigenhändig schwarz lackiertes Sonor-Schlagzeug zu Hause blieb, genau wie sein alter Kenwood-Receiver und seine in schwarzes Eichenholz eingefassten Siebzigerjahre-Lautsprecher, die ihm sein Onkel zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hatte. Ihr wärmend tiefer Klang war ihm wichtig, auch wenn er kein Hi-Fi-Spezialist war wie viele seiner ehemaligen Klassenkameraden, die in ihren Autos Stereoanlagen für tausend Mark spazierenfuhren.
*
In den Wochen vor dem Umzug hatte sich Robert wieder öfter mit seiner Ex-Freundin Nadja Fuchs getroffen. Zum Tennisspielen in der schlimmsten Augusthitze. Sie war erst sechzehn, spielte aber um Klassen besser als er, hatte schon einmal ein Jugendturnier gewonnen. Was sie ihm an Technik voraushatte, machte er an Laufleistung wett. Nach dem Spiel hatten sie wie schon öfter eine Bierdose angestochen und waren in einer Vernebelung aus Erschöpfung, Überhitzung und Löwenbräu auf ihrem Roller die paar Meter zu ihr nach Hause zum Sex gefahren. Während der Nachmittag draußen immer heißer wurde, lagen sie im Bett und taten die unerwartetsten Dinge, wenn man bedachte, dass Nadja Fuchs erst sechzehn und offiziell längst Schluss zwischen ihnen war.
Aus dir wird kein Tennisprofi, prophezeite sein Vater, der ihm als Kind das Tennisspielen beigebracht hatte. Dir fehlt die Geduld und du bist zu emotional.Dann noch lieber Gärtner.
Lächerlich. Als ob er je Gärtner hätte werden wollen. Dass er sich tausend Fakten über Pflanzen und Blumen merken konnte, war nur ein neurotischer Automatismus, weil er in einer Gärtnerei groß geworden war. Mit dem Umzug und dem Studium sollte dann auch endgültig Schluss sein mit den Spekulationen seines Vaters und seiner Verwandtschaft, ob er irgendwann die Gärtnerei übernehmen würde. Und Tennis wollte er auch nicht mehr spielen. Und sich auch nicht mehr mit jungen, Vereinssport-versessenen Mädchen wie Nadja Fuchs treffen. Viel lieber hätte er jemanden getroffen, der sich im selben Maße für Musik oder Filme interessierte oder vielleicht für Bücher. Eine Psychologiestudentin oder zumindest eine Germanistin. Und doch hätte er jetzt gerne Nadja Fuchs bei sich gehabt statt seiner Mutter. Sie hatte Kraft, sie hätte sicher ein paar Möbel getragen. Er hätte auch gerne mit ihr die erste Nacht in seiner neuen Wohnung verbracht, wenn er ehrlich war. Doch zum Glück hatte sich Hamlet angekündigt.
*
Hamlet war kein Mädchen, aber er war wichtig genug, um ihn aus der alten Zeitrechnung mit hinüber in die neue zu nehmen. Hamlet war der wichtigste Chronist seines Umbruchs. Die Ungeheuerlichkeiten, die sich schon bald in dieser Wohnung abspielen würden, brauchten einen verlässlichen Zeitzeugen, einen, mit dem er sich gleichzeitig darüber begeistern konnte, wie erwachsen und autark sie plötzlich waren. Hier oben auf dem Ziegetsberg, im langen Schatten des Fernsehturms, wollten sie zusammen die Stadt regieren, selbst wenn Hamlet sich gerade eine eigene Zivildienst-Wohnung ganz unten im Stadtteil Margaretenau nahe der Gleise gesucht hatte.
Hamlet hieß mit richtigem Namen Hartmut. Hartmut Lorenz. Und doch klang »Hartmut« falsch, viel zu faktisch, viel zu diesseitig. Der viel bessere Name Hamlet leitete sich so her: Im Leistungskurs Englisch hatte der Kursleiter Englbrecht-Happich, mit seinen langen Haaren und seiner monströsen Classic-Rock-Plattensammlung, gefragt, wem der Hamlet aus Shakespeares Drama in seiner verfahrenen Situation überhaupt noch vertrauen könne. Daraufhin hatte Hartmut die Stille, die entstanden war, weil niemand über die Winterferien den Hamlet gelesen hatte, durchbrochen und gesagt: Dem Kotelett.
Das hatte Robert nicht nur wegen der mutigen Plattheit des Witzes bemerkenswert gefunden, sondern weil Hamlet sonst nie etwas ungefragt sagte und sich überhaupt nie in den Vordergrund drängte. Wenn sich Robert recht erinnerte, hatte er bis zur zwölften Klasse noch nicht einmal Hamlets Namen gekannt. Erst nach der Kotelett-Pointe hatte er ihn sich genauer angeschaut: nicht zu bändigende, längere braune Locken, permanenter Dreitagebart (wie auch immer er das machte), langes weißes T-Shirt und eine schwarz-weiß karierte Fleecejacke. Dazu trug er einen obskuren Holzanhänger, der sich als längliches Gesicht mit offenem Mund entpuppte. Tikitiki-a-Taranga, der Maori-Gott der Briefträger, hatte Hamlet ihn am Ende der Stunde wissen lassen und ihn zu seinem Geburtstag eingeladen.
Eine Woche nach der Kotelett-Sache feierte Hamlet seinen achtzehnten Geburtstag im Partykeller seiner Eltern. Robert war gern hingegangen, aber nicht lange geblieben, da seine Fahrgemeinschaft früh nach Hause wollte, der Fahrer spielte am nächsten Tag Eishockey im Verein. Doch selbst in der kurzen Zeit waren ungeahnte Seiten an Hamlet zutage getreten. Wie er gesellig von Gast A zu Gast B gelaufen war, jedem seinen selbstgemixten Erdbeer-Daiquiri angeboten und für jeden ein paar Worte parat gehabt hatte. Wie er kommentarlos und bereits ziemlich früh am Abend mit Siglinde Weiß verschwunden war. So eine souveräne Gatsby-Art hatte Robert Hamlet nun gar nicht zugetraut, und auch nicht die erstklassigen Erdbeer-Daiquiris, für die Hamlet extra den Power-Mixer seiner Eltern nach unten geholt hatte, der cirka achtzehn Kilo wog. Nach der Party beschloss Robert, sich öfter mit Hamlet zu treffen.
Hamlet sprach meistens ziemlich leise und lachte häufig schon vor Satzende in sich hinein, was viele seiner gar nicht so schlechten Pointen erstickte und ihn schrullig wirken ließ. Nur wenn man genau zuhörte, verstand man, wie feinsinnig sein Humor war. Fast jeder seiner Sätze schien von der Prämisse auszugehen, dass alles im Leben schiefging. Er hatte diese Terry-Pratchett-Sicht der Dinge, für ihn war das normalste Leben hochkurios und mysteriös, doch er begegnete ihm neugierig und manchmal auch resigniert. Zum Beispiel behauptete er: Natürlich gibt’s einen Gott, aber der trinkt. Selbst tagsüber. Und weil er permanent verkatert ist, aber so viel zu tun hätte, dass er gar nicht erst mit der Arbeit anfängt, überlässt er alles seinem praktischen Zufallsgenerator.
Außerdem behauptete Hamlet, er sei überhaupt nicht das Kind einer Handarbeitslehrerin und eines Schlossers, sondern von Aliens ausgesetzt worden. Seine Eltern hätten ihn lediglich in einer Parkstettener Sandgrube gefunden und großgezogen.
Robert hatte etliche andere Schulfreunde, aber keinen hielt er für so einen Rohdiamanten. Die anderen waren einfach nur roh, saßen stundenlang Karten spielend im Gasthaus, statt sich in die Städte und Bars zu trauen. Nur Hamlet begleitete ihn, wollte auch raus aus den Dorfwirtshäusern und Jugenddiscos. Oder er passte sich einfach nur Roberts Explorationsdrang an. Außerdem glaubte Robert, dass nur Hamlet in ihm sah, was die anderen nicht erkannten. Einen Abenteurer, einen Eroberer des Unbekannten, einen Künstler und visionären Hedonisten. Einen, der das mittelgute Leben in der Provinz überwinden konnte und zu Höherem in der Stadt bestimmt war.
In Wahrheit fand Hamlet Robert anfangs hauptsächlich deshalb interessant, weil der so viele CDs besaß, die Hamlet sich gern überspielen wollte. Das wusste er schon früh, weil Robert oft mitten im Unterricht versuchte, sich mit dem LK-Leiter Englbrecht-Happich über Musik zu streiten. Manchmal stieg der darauf ein, doch oft ließ er Robert auch vor versammelter Klasse auflaufen, was Robert die Gelegenheit und das Publikum gab, seine Schlagfertigkeit unter Beweis zu stellen.
Die neue Deep Purple ist doch Schrott, Herr Englbrecht. So was hören doch nur Altrocker wie Sie.
Bert, du hast noch weniger Ahnung von Musik als von Shakespeare. Was eigentlich gar nicht sein kann.
Ich heiß nicht Bert.
Und ich heiß nicht Englbrecht, sondern Englbrecht-Happich.
Das ist mir zu lang.
Gut, dann machen wir’s kurz: mündliche Sechs wegen Störung des Unterrichts.
Alle lachten. Die Sechs wurde trotzdem eingetragen.
Ein paar Wochen nach der Geburtstagsparty hatte er Hamlet nach dem Leistungskurs gefragt, ob sie am Wochenende nicht zusammen in die Stadt fahren wollten. Robert schlug einen Irish Pub vor, weil auf Hamlets Party die Pogues gelaufen waren. Es war ihm selbst immer ein wenig unangenehm, dass er sich so für Irish Folk, für die Pogues, die Dubliners und die Chieftains begeisterte. Das gehe sicher bald wieder vorbei, hoffte er. Doch in der Zwischenzeit hatte er offenbar jemanden gefunden, mit dem er sein schlechtes musikalisches Gewissen teilen konnte. Bei einem Paddy waren sie schließlich auf Siglinde Weiß zu sprechen gekommen.
GV?, fragte Robert, und Hamlet nickte lächelnd in seinen Whiskey-Tumbler hinein. Robert konnte daraufhin seine Zigarette gar nicht anzünden vor lauter Neugier.
Dein erster?
Nein, nein.
Robert Bley war ein bisschen schwindlig vor Ehrfurcht und Neid.
Danach hatte er so schnell wie möglich jemanden finden müssen, um seine Unschuld zu verlieren, denn so wollte er nicht vor Hamlet dastehen. Beim Billardspielen hatte er vier Wochen später einer drei Jahre älteren amerikanischen Austauschstudentin aus Connecticut aus Versehen die schwarze Acht vor die Füße geschossen, sich bei ihr entschuldigt, nach der Telefonnummer gefragt und ein paar Tage später bei ihr im Studentenheim übernachtet. Es war vorbildlich gelaufen, sie hatte sogar Don Henleys »The End Of The Innocence« in den CD-Player gelegt, als er ihr seine Jungfräulichkeit gestanden hatte, doch den halben Morgen war das Bad von ihrer Mitbewohnerin besetzt gewesen. Ich hasse Wohnheime, hatte er gedacht.
*
Für heute Abend hatte sich Hamlet zum Antrittsbesuch in der neuen Wohnung angekündigt, aber noch war Roberts Mutter da.
»Du, Robo, wollen wir noch was essen, unten beim Griesnagel?«, fragte sie, nachdem sie gemeinsam den Röhrenfernseher auf die Kommode gehoben hatten. Jetzt war er eingerichtet.
Obwohl »Robo« schon immer sein Spitzname gewesen war, mochte er es nicht mehr, wenn sie ihn so nannte. Die Zeit für Spitznamen war vorbei.
»Nein, das ist mir ein bisschen zu teuer«, sagte er, was lachhaft war, denn er wusste, dass sie ihn einladen würde. Schließlich zahlte sie ja auch seine Miete und seine Kaution, da kam es ihr auf das Abendessen nicht an.
»Das spendier ich dir zum Einzug. Such dir aus, was du willst«, sagte sie für seinen Geschmack zu gönnerhaft.
»Du, Mama, ich bin schon ein bisschen müde. Ich werd das Bett beziehen«, sagte er, als wäre das schon eine Leistung und ein Beweis seiner Unabhängigkeit. »Dann steck ich den Fernseher ein und leg mich hin.« Er imitierte ein Gähnen.
»Du triffst dich doch noch mit dem Hartmut«, sagte sie und sah ihn jetzt unverwandt an. Dabei wischte sie mit der Handfläche über den Rand der Kommode und ließ sich dann fast trotzig in den Sessel fallen.
»Eben deswegen.« Er schaute aus dem Fenster, das zum katholischen Studentenheim hinausging. »Vorher wollte ich mich noch hinlegen.«
Sie glättete die Seiten ihrer dunkelbraun gefärbten Haare. Die Färbung erkannte er an dem leichten Rotstich. »Na gut, ich kann dich ja nicht zwingen. Wann kommst du das nächste Mal heim?«
»Ich komm gar nicht mehr heim«, sagte er.
»Was?«, sagte sie entsetzt.
»Nur ein Spaß. Am Donnerstag komm ich. Freitag ist frei.«
»Freitag ist frei?« Sie wirkte regelrecht erschrocken. Idiotisch. Warum hatte er das nur erwähnt?
»Nur diese Woche. Weil was ausfällt«, log Robert, der seinen Stundenplan extra so zusammengestellt hatte, dass der Freitag frei blieb, was ihm ja selbst impertinent vorkam.
»Irgendwie fällt mir das jetzt schon schwer«, sagte seine Mutter, die sich gerade wieder aus dem Sessel erhoben hatte. Ihre Augen glänzten, es war ihm unangenehm.
»Aber ich bin ja nicht weit weg«, sagte er widerwillig, weil es ihm nicht besonders cool vorkam, nur vierzig Autominuten von seinen Eltern weg zu wohnen. Nach einem harten Umbruch klang das nicht.
»Du bist immerhin das erste Kind, das ich ausziehen seh«, sagte sie.
»Ich bin ja auch das einzige«, sagte er, aber für Erheiterung sorgte das nicht.
Sie knöpfte sich die rote Strickjacke zu, setzte ihre kleine, eckige Brille auf, die sie auf den Fernseher gelegt hatte. Machte wieder ein freundlicheres Gesicht.
»Na dann, hab eine schöne Zeit in der Stadt.«
3
HALBGOTT IN CAMOUFLAGE
Wie eine Mischung aus Olympiadorf und Strafanstalt, dachte Robert, während sie warteten. Seit den späten 1960ern gab es den Campus, und deshalb vermengte er auch rücksichtslos die ästhetischen Strömungen dieser Zeit. Dem farblichen Ungeist der 68er trug er nicht nur durch orangene und mattgrüne Säulen Rechnung, sondern vor allem durch eine Handvoll abstrakter Skulpturen außerhalb der Fakultätsgebäude und merkwürdige Rohrkonstrukte im Inneren, so als wollte man an das Centre Pompidou erinnern, es aber gleich wieder zurücknehmen. Ansonsten gab es eine Menge Rohglas und gegossenes Aluminium zwischen Nachkriegspragmatik und Mies van der Rohe. Kubus und Rohr, dachte Robert. Überall Kubus und Rohr. Doch bevor man irgendetwas daran avantgardistisch oder originell finden konnte, setzte sich sofort der schimmelgraue Beamten-Brutalismus durch und verdarb einem im eh schon gräulichen Halbjahreswinter die Laune von Grund auf.
»Was für ein Scheißhaus, oder?«, sagte Hibiskus, als er Roberts Blick sah. »Und da sitzen wir jetzt die nächsten fünf Jahre fest. An der Uni Heidelberg sieht’s dagegen aus wie im Schloss Neuschwanstein.«
»Woher weißt du das?«, fragte Robert.
»Hab ich mir angeschaut. Wollt mich da einschreiben. War aber dann doch zu weit weg von daheim.«
Robert nickte und schaute auf die Schlange vor ihnen. Eine Stunde würde es schon noch dauern.
Hibiskus nannte die Uni »das Haus, das Verrückte macht«, wie in dem Asterix-Film. Hibiskus hieß eigentlich Johann Hibinger und kam aus der Steiermark. Robert fragte sich, ob Hibiskus wusste, dass Malvengewächse wie der Hibiskus an sonnenintensiven Plätzen eingegraben werden mussten, und ob er wusste, dass man im Frühjahr noch vor dem Neuaustrieb die abgeblühten Triebe des Vorjahres aus dem Strauch herauskürzte. Dazu fragte er sich, ob ihm seine Kindheit in einer Gärtnerei nicht vielleicht doch geistig geschadet hatte und wie viel Speicherplatz für wichtigere Informationen ihm das ganze botanische Wissen geraubt hatte. Und wer weiß, was für Sporen in der Gärtnerei den ganzen Tag durch die Luft geflogen waren und ihm eine normale Persönlichkeitsentwicklung unmöglich gemacht hatten.
Er stand mit Hibiskus in einer Schlange aus über hundert Studenten und wartete darauf, sich für einen der fünf Phonetik-Kurse einzuschreiben. Es gab nicht genug Platz für alle Erstsemester, daher der Andrang zwei Stunden vor der offiziellen Bürozeit.
Hibiskus war eine Mischung aus Heavy Metal und Gothic. Sosehr ihn der Metal mit Lederjacke, langen Haaren und einem Atrocity-T-Shirt äußerlich klassifizierte, so gothic war seine Lebenseinstellung. Hibiskus schaute ausschließlich Horrorfilme, las Lovecraft und Crowley und erzählte mit seinem resigniert meckernden Lachen gerne von aussichtslosen Dingen des Lebens.
Zum Beispiel: Das ganze System ist so arg verschult, dass du dich von Jahr zu Jahr weiter in die Unselbstständigkeit lernst. Oder: Bis du dich hier überall ang’meldet hast und die ganzen Scheine für die Zwischenprüfung beinander hast, hast du schon mehr Lebenszeit und Energie aufgebraucht, als du jemals haben könntest, um die ganzen Bücher von der Leseliste lesen zu können. Machen die Orschlöcher absichtlich, damit du dir gleich gar keine Illusionen machst von wegen geistige Elite. Das Studium prüft ausschließlich dein Reaktionsvermögen auf Regulierung, Norm und Struktur.
Robert wollte das gar nicht wissen. Wollte nichts von kommenden Komplikationen hören. Er wollte sich nicht die Vorstellung nehmen lassen, dass er das Studium auf seine Art hinbekommen würde. Die erprobte Art, mit der er die gesamte Oberstufe bestritten hatte: nur das Notwendigste lernen, keinen Gedanken an einen übergeordneten Sinn verschwenden und sich in organisatorischen Fragen an andere hängen.
An solche wie Hibiskus zum Beispiel, denn sosehr der auch das System anklagte, so früh war er zur Einschreibung gekommen, wo Robert ihm zum ersten Mal begegnete. Seit sechs Uhr, eine Stunde länger als Robert, wartete Hibiskus in dem zugigen kopfsteingepflasterten Säulengang, hatte aber mindestens fünfzehn Plätze dadurch eingebüßt, dass er sich zwei Bier mitgenommen hatte und zwischenzeitlich aufs Klo musste. Deshalb waren sie jetzt auch gleichauf. Robert hatte noch nie einen Menschen gesehen, der so viele Zigaretten innerhalb einer Stunde drehte und rauchte wie Hibiskus. Um sie herum hatte sich beim Warten schon eine Art Bannkreis aus Tabak gebildet.
»Magst du auch ein Seidl?«, fragte Hibiskus und hielt ihm eine Halbliterflasche Pils hin.
»Ist mir noch zu früh«, sagte Robert. »Bin außerdem mit dem Auto da.«
»Ich doch auch«, sagte Hibiskus.
»Vielleicht nehm ich doch eins.«
*
Eine Woche später, an seinem ersten offiziellen Tag als Student, traf Robert Hibiskus im General Language CourseII wieder, in den sie beide aufgrund des Einstufungstests versetzt worden waren. Ihr Englisch war offensichtlich so gut, dass sie sich den GLC I schenken konnten. Sie setzten sich nebeneinander.
»Was ist eigentlich dein zweites Fach?«, fragte Robert.
Hibiskus steckte sich sein Overkill-Shirt mit dem Totenkopf mit Fledermausflügeln in die Hose und schien zu überlegen.
»Erdkunde«, sagte er. »Also Geografie.«
»Auf Lehramt?«, fragte Robert. Hibiskus sah ihn verständnislos an. Warum sollte man sonst Geografie und Englisch kombinieren?, sollte der Blick wohl heißen.
»Ich hab noch Deutsch«, sagte Robert.
»Ich weiß«, sagte Hibiskus. »Warum eigentlich? Bist du ein literarischer Typ?«
»Nein, das würde ich nicht sagen. Ich hab mich halt leichtgetan in der Schule«, sagte Robert, und ihm fiel auf, dass er keinen Stift dabeihatte. Also auch nicht in der Wohnung, er hatte überhaupt keine.
»Ich hab mich in keinem Fach leichtgetan«, sagte Hibiskus. »Noch nicht einmal in Turnen. Schon gar nicht in Turnen.«
»Und willst du wirklich Lehrer werden?«
Hibiskus zog Rotz hoch. »Ach, wieso nicht? Hab ja auch sonst keine Vision. Und du?«
»Ob ich Lehrer werden will?«, fragte sich Robert eher selbst. »Ich glaub nicht. Mir hat jemand gesagt, dass das erste Staatsexamen so viel zählt wie ein Magister, aber dann hat man noch die Beamtenlaufbahn als Notnagel.«
»Notnagel, ha, na du denkst dir Spassetterl aus«, sagte Hibiskus. »Was willst du denn dann werden? Nein, lass mich raten … Journalist oder Bibliothekar. Oder Lektor? Oder Lebensberater.«
»Witzig«, sagte Robert. »Ich hatte an Redakteur gedacht. Es hängt doch alles an den Praktika, die man während des Studiums macht, oder? So kommt man rein.«
»Wenn du so reinkommst, ist es doch gut«, sagte Hibiskus und wischte sich über die Nase, bevor er wieder seinen Stift in die Hand nahm, an dem nur ein bisschen durchsichtiger Rotz klebte. Jetzt betrat die Dozentin den Raum 1.3.17, und die Gespräche verstummten, wenn auch nur ganz kurz.
Bisher hatte Robert gedacht, ein Studium bestünde hauptsächlich aus Vorlesungen, doch sein Stundenplan bestand ausschließlich aus Einführungskursen, die mit siebzehn Wochenstunden zu Buche schlugen und so gar nichts Honoriges hatten, wie er das von einer Universität erwartet hatte. Er hatte zudem herausgefunden, dass Vorlesungen in seinem Studiengang absolut freiwillig waren. Was ihn begeisterte. So wie ihn eine Freistunde in der Schule begeistert hatte. Es war wie ein Geschenk, etwas doch nicht tun zu müssen.
Ihre Kursleiterin im GLC II war eine junge, indisch aussehende Amerikanerin namens Alexa Kamish, die sehr freundlich zu allen war, aber keinerlei Autorität ausstrahlte, sodass der Lärmpegel von Anfang an dem in der Cafeteria glich. Nicht nur in diesem Punkt unterschied sich der Unterricht kaum vom Englischunterricht am Ludwigs-Gymnasium. Sie erledigten Übungen in einem Arbeitsheft, erörterten anhand von Tageslichtprojektor-Folien Grammatikfragen und mussten sich melden, wenn etwas gefragt wurde. Nur am Anfang der Doppelstunde hatte sich jeder kurz auf Englisch vorstellen dürfen.
»My name is Johann Hibinger but most people call me Hibiskus. I am a fan of Heavy Metal music«, machte es Hibiskus kurz und hatte die Lacher auf seiner Seite. Als Robert dran war, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, jeden im Kurs wissen zu lassen, dass er Schlagzeuger war.
»Oh, you have to do a drum solo for us one time. You know, like the guy from Mötley Crüe who spins around in a cage way up in the air«, schlug Miss Kamish vor, die sich offensichtlich mit Hard Rock auskannte. Sieben Achtel der Kursteilnehmer hatten garantiert noch nie von Mötley Crüe gehört, wenn er sich so umschaute. Überhaupt die Kommilitonen: Robert kam es vor, als wäre er einfach nur an ein neues Gymnasium versetzt worden. Nichts, aber auch gar nichts deutete darauf hin, dass bei den Leuten eine andere Lebensphase, geschweige denn Bildungsphase begonnen hatte. Er sah dieselben alles hinnehmenden Gesichtsausdrücke wie bei seinen Mitschülern all die Jahre lang. Die einzigen Ausnahmen bildeten Hibiskus, ein Typ mit einer Camouflage-Hose und ein Mädchen mit kurz rasierten Haaren. Er blickte an sich hinunter und musste zugeben, dass auch er nicht viel an sich geändert hatte: Jeans, schwarzes Hemd, gefütterte Wildlederjacke und seine grauen Converse mit dem gelben Stern. Nur die Haare trug er jetzt anders. Statt lang trug er jetzt einen Kurzhaarschnitt wie Bobby Briggs aus Twin Peaks. Und genau wie in der Schule sah er die meisten Leute auch gleich im nächsten Kurs wieder, selbst wenn das Fach ein anderes war. In Einführung in die Neuere Deutsche Literatur fanden sich etwa acht Leute aus dem GLC II wieder, seine allseits beliebte Fächerkombination machte es möglich. Nur Hibiskus war nicht dabei, der studierte ja Erdkunde.
*
Dieses verschulte Dasein störte Robert genau zwei Tage lang, dann akzeptierte er es als ein Positivum: die Sicherheit, sich nicht groß umstellen zu müssen, sondern sich auf das Wesentliche außerhalb des Stundenplans zu konzentrieren, zum Beispiel eine Erstsemesterparty der Psychologen am Donnerstagabend.
Robert beneidete die Psychologiestudenten. Insgeheim sah er eine erhabene Kaste in ihnen, auch wenn er sich öffentlich dem Vorurteil anschloss, dass sie sich alle nur selbst therapieren wollten. Denn während er mit seinen Fächern Englisch und Deutsch im Prinzip nur weiter zur Schule ging und Wissen vertiefte, über das er ohnehin bereits verfügte, stießen die Psychologen in eine gänzlich neue Wissenschaft vor, die so an keinem Gymnasium gelehrt wurde. Ein Psychologiestudent hatte dementsprechend viel mehr Daseinsberechtigung, und insgeheim glaubte er, dass er überhaupt einer der besten Psychologen der Welt hätte werden können.
Eine ehemalige Klassenkameradin von ihm, Uta Höfel, studierte Psychologie und hatte ihn zusammen mit ihren Kolleginnen in die Mensa mitgenommen. Während Robert ein unbekanntes Stück Fleisch mit brauner Soße und irgendetwas als Beilage wählte, was zwar wie Spätzle aussah, aber auf gar keinen Fall so schmeckte, aßen die Psychologinnen überwiegend Reis und Salat, nur die fast 1,90 große Uta hatte einen Teller Kaiserschmarrn vor sich stehen. Von den drei ihm bis dato unbekannten Psychologinnen beeindruckte ihn sofort ein Name: Kristin König. Ihr ganzes Wesen hatte etwas Alliteratives. Alle hörten ihr zu, wenn sie eine Anmerkung machte, selbst wenn sie nicht laut sprach. Und alles, was sie sagte, beinhaltete eine konkrete und nützliche Information, immer bedacht darauf, Lösungen anzubieten. Es ging um Stundenpläne, Dozenten, Arbeitsgruppen und Termine für den Psychologen-Stammtisch, doch sie redete nur, wenn sie etwas Substanzielles beizutragen wusste. Es schien ihr nie um ihren Redeanteil zu gehen, die meiste Zeit aß sie schweigend und konzentriert ihren Gemüsereis, als verlangte auch das ihre gesamte Aufmerksamkeit. Sie imponierte ihm, und sie gefiel ihm mit ihrem blonden Kurzhaarschnitt, ihrem langen Oberkörper, den leicht abstehenden Ohren und den viel zu großen, Letzteres noch betonenden Ohrringen. Und vor allem den Namen würde er so schnell nicht mehr vergessen.
»Gehst du auch auf eure Erstsemesterparty?«, versuchte Robert Kontakt mit ihr aufzunehmen.
Sie sah von ihrem Essen hoch. Strich sich die Haare hinter die Ohren, als müsste sie sich erst überlegen, wie sie ihm am besten antwortete.
»Ich kann nicht kommen. Ich muss meiner Mutter bei einem Elternabend helfen und hab auch kein Auto.«
»Wohnst du nicht in der Stadt?«, fragte Robert, der nicht glauben konnte, dass jemand hier studierte, aber nicht hier wohnte.
»Ich wohne nicht in der Stadt«, sagte Kristin König, und damit schien das Thema erledigt zu sein, denn sie widmete sich wieder ihrem Langkornreis mit gelbem Curry – oder was das obskure Zeug auf ihrem Teller auch immer darstellen sollte. Robert fiel auf, dass immer noch ein Klumpen Fleisch an seiner Gabel hing, die er in der rechten Hand hielt, eine Hand, deren Existenz er vergessen zu haben schien und die ihm nur einigermaßen bekannt vorkam, jetzt, wo er seinen Blick langsam von Kristin König abwandte und sich wieder mit seinem Essen zu beschäftigen begann.
*
Auf die Feier, die im Eingangsbereich der biologischen Fakultät stattfand, weil da mehr Platz war als bei den Psychologen, hatte er Hamlet mitgebracht und fühlte sich ein wenig wie dessen Mentor, schließlich ermöglichte er ihm seine erste Fachschaftsparty, obwohl er noch gar kein Student war. Und das gleich bei den Psychologen, was mysteriös und progressiv zugleich klang.
»Wie findest du deine erste Studentenfeier?«, fragte Robert gönnerhaft, während sie an einer Ziegelwand lehnten und auf eine Gruppe Studenten blickten, die Schlaghosen trugen und strähnige Haare wie der Sänger der Black Crowes.
»Es ist doch auch deine erste Feier«, sagte Hamlet, was Robert nur zu einem Schulterzucken veranlasste. »Sind das Psychologie-Studenten?« Hamlet deutete auf den Haufen Black-Crowes-Sänger.
Bevor Robert antworten konnte, sagte jemand: »Na, auch hier im Orkus der naturwissenschaftlichen Elite?«
Hibiskus trug eine schwarze Motorradlederjacke und ein schwarzes Bandana als Stirnband. Seine Schuhe waren weiße Adidas Trophy, von denen Robert gar nicht gewusst hatte, dass es die außerhalb der Museen noch gab.
»Orkus ist geil«, sagte Hamlet.
»Hamlet, das ist Hibiskus, Hibiskus, das ist Hamlet«, stellte Robert die beiden einander vor.
»Angenehm, Hibiskus«, sagte Hibiskus und hielt die Hand ausgestreckt, an der Tabakbrösel klebten.
»Hamlet«, sagte Hamlet.
»Lässiger Name«, sagte Hibiskus.
»Gleichfalls«, sagte Hamlet.
»Dann gehen wir uns jetzt einen gescheiten Dulliöh ansaufen«, sagte Hibiskus.
Das Bier wurde aus Fässern in große Plastikbecher hineingezapft, und der halbe Liter kostete 1,50 DM. Allerdings hatte das Bier zu wenig Kohlensäure.
Dafür war die Musik nicht schlecht. Keine Weather Girls, keine Gloria Gaynor, dafür Alice In Chains, Bad Religion und die Black Crowes. Hamlet war begeistert.
»Hätte ich gewusst, dass Studieren so gut ist, hätte ich nicht erst Zivildienst gemacht«, sagte er und zupfte an seinen Koteletten, bis er ein paar braune, sich kräuselnde Haare in der Hand hatte.
»Bist du deppert, das kann man sich doch nicht aussuchen in Deutschland, oder?«, fragte Hibiskus.
»Ich hätte mich sicherlich ausmustern lassen können wegen der Hirn-OP.«
»Eine Hirn-OP? Hatten wir vielleicht einen Tumor?«, fragte Hibiskus unaufgeregt nach.
»Nein, natürlich nicht«, schüttelte Hamlet kichernd den Kopf. »Mir wurde als Baby ein menschliches Gehirn eingesetzt, damit meine außerirdische Abstammung nicht auffliegt.« Hamlet wippte wie ein schlaftrunkener Tanzbär zur Musik.
»Okay«, sagte Hibiskus. »Aber hast du da Entwicklungsstörungen? Irgendwas, das eine Ausmusterung rechtfertigen täte?«
»Schau doch, wie ich tanze«, sagte Hamlet und begann zu tanzen. Hibiskus nickte einsichtig.
Da haben sich ja die zwei Richtigen gefunden, dachte Robert.
Bis auf die Begegnung zwischen Hamlet und Hibiskus passierte zunächst nichts Außergewöhnliches auf der Feier. Robert traf einige Kommilitonen wieder, die er in der letzten Woche kennengelernt hatte. Da war Christian, ein beinahe aufdringlich freundlicher, langhaariger Geograf und Anglist aus Kehlheim mit Fußprothese. Er war in Begleitung von Johanna, Bedienung aus Roberts altem Stamm-Café in Straubing, die ebenfalls Englisch studierte und die Robert vor zwei Jahren angehimmelt hatte, wenn sie ihm seinen Wodka Lemon mit extra Limette brachte. Dann war da noch Georg Ganserer, Theologe, Anglist und Keyboarder einer Blues-Brothers-Coverband. Er war mit David Deininger gekommen. Deininger war eine wuchtige Erscheinung mit fransigem Pony, Punkband-Shirt und Bundeswehrhosen. Er war ein Semester weiter als Robert, aber ebenfalls im GLC II und in Einführung in die anglistische Sprachwissenschaft. Doch Roberts erklärtes Ziel war natürlich, eine Psychologin kennenzulernen, deshalb ließ er Ganserer und Deininger nach einem kurzen Small Talk über Pulp Fiction und das letzte Pantera-Album wieder stehen.
Am Rande der Tanzfläche kam er mit einer der Psychologinnen aus der Mensa ins Gespräch, die nicht Kristin König war. Sie hatte ihn wiedererkannt und angesprochen, wollte ihn auf die Tanzfläche ziehen. Weil er noch zu nüchtern war, um zu tanzen, lud er sie reflexartig auf einen Tequila ein. Er konnte gar nicht sagen, ob er sie attraktiv fand, so begeistert war er davon, eine Psychologin näher kennenzulernen. Den Rest des Abends verbrachte er mit ihr und beobachtete immer wieder aus dem Augenwinkel, wie Hibiskus und Hamlet sich abgesondert von der Menge angeregt über etwas unterhielten und um die Wette rauchten. Irgendwann ging die Psychologin nach Hause und schrieb ihm ihre Nummer und ihren Namen auf, den er sich auch gar nicht gemerkt hatte.
Eine Woche später traf er sich auf einen Drink in der Altstadt mit ihr, und sie küssten sich zum Abschied. Am Samstag darauf besuchte er die Psychologin in ihrem Studentenappartement in Königswiesen, und sie schauten zusammen Wetten, dass …?. Dabei holte sie Robert einen runter und fragte ihn, ob sie so was wie ein Paar sein wollten. Er sagte Ja, doch ihre Gesichtszüge waren ihm mittlerweile viel zu hart, und ihr Akzent störte ihn. Sie kam aus Crailsheim und konnte den sogenannten Hohenloher Dialekt nachahmen. Es klinge, als hätte man einen Franken mit einem Gewehr in den Mund geschossen, scherzte sie selbst, was es nicht besser machte. Einen Tag später rief er sie an und sagte ihr, dass er sich das mit dem Paar-Sein anders überlegt habe.
*
Drei Wochen später hatte er sich auch ohne eine Psychologenfreundin gut in den universitären Alltag eingefügt. Er wusste langsam, wo die Kursräume waren, ohne sich jedes Mal vorher mit Hibiskus verabreden zu müssen, und hatte auch freundschaftliche Kontakte zu anderen Studenten geknüpft. Nur David Deininger mit seinen Camouflage-Hosen, mit dem er etliche Kurse in Englisch zusammen hatte, ging ihm auf den Zeiger.
Die Stühle im Raum 3.3.87 waren in Hufeisenform angeordnet, sodass Robert nur leicht nach links schielen musste, um zu sehen, was Deininger so trieb, und es beschäftigte ihn ungemein. Deininger war deutlich größer und um einiges breiter als er selbst, auf eine beneidenswert vitale Weise. Er hatte blonde Haare, die er vorne ein bisschen zu lang trug wie ein Waver, die ihm ständig und irrsinnig lässig ins Gesicht fielen. Außerdem fehlte ihm der Bartwuchs an den Backen, weshalb sein Bart aussah wie der von Ethan Hawke, ohne dass er ihn so penibel in Form rasieren musste wie Robert.
Bevor der Kurs begann und Professor Dr.Herman Lush mit seiner sterbenslangweiligen Lektion über die Unterschiede zwischen Morphologie und Syntax anfangen konnte, beobachtete Robert, wie Deininger mit seiner Sitznachbarin Sabine Zeitl herumschäkerte, als wäre nicht das Geringste dabei. Er flüsterte ihr etwas ins Ohr, lachte dann scheinbar ungehalten und boxte sie auf den Arm. Sie zeigte ihm dafür ganz konspirativ etwas in ihrem Buch und warf dabei fast ihre gesamte Dauerwelle über seine linke Schulter. Und immer wieder Gelächter.
Robert wunderte sich, wie sich so eine wie Sabine Zeitl für so einen wie Deininger begeistern konnte. Sie sah eher aus, als stünde sie auf surfende Sportlehrer, und Deininger war ein Punker. Vielleicht nicht im strengsten Sinn des Wortes, doch er trug diese Tarnhose und ein T-Shirt von einer Band, die Robert nicht kannte. Manches an ihm wirkte grobschlächtig, zum Beispiel nahm seine Nase viel zu viel Platz in seinem Gesicht ein, und auch seine Hände waren viel zu groß, doch wenn er dieses dröhnende Lachen hörte, wusste er, was ihn wirklich fuchsig an David Deininger machte: seine brachiale Unbeschwertheit, diese penetrante Fröhlichkeit. Die Selbstverständlichkeit, mit der er zerrissene Band-Shirts und löchrige Skater-Schuhe trug, sich die Haare wahrscheinlich selbst schnitt und scheinbar nichts darauf gab, was Frauen wie die Zeitl von ihm hielten. Und genau deshalb hielten sie auch so viel von ihm.
David Deininger bemerkte nicht, wie Robert ständig zu ihnen hinüberschaute. Sabine Zeitl schon. Sie zwinkerte Robert kurz zu, dann hing sie schon wieder an Deiningers Schulter.
Als Professor Lush den Raum betrat, merkte es zunächst keiner. Herman Lush war ein Gnom im Rollkragenpullover, vielleicht 1,60 groß, er trug ausschließlich die engsten und dunkelgrünsten Pullunder der Welt, mit enormen Schweißflecken unter den Achseln, hatte ein Gesicht wie Paul Kuhn und einen Bauch, als hätte er sich Kissen unter den Pullunder gesteckt. Wenn schon niemand sein Eintreten bemerkte, dann zumindest seinen Mischgeruch aus herbem Rasierwasser und süßlichem Schweiß, der sich eilig in dem engen Kursraum ausbreitete.
»Heute wir bearbeiten die Modalverben«, sagte Lush in seinem weichen Akzent.
Das schien Deiningers Stichwort zu sein, um Sabine Zeitl etwas ins Ohr zu sagen. Und er brachte sie schon wieder zum Lachen.
*
In der Cafeteria roch es nach Senf und nach Wiener Würstchen. Es war so laut, dass die Küchenfrau um ihr Leben brüllen musste, wenn sie »Schnitzelsemmel ist fertig!« in den Sitzbereich schrie. Gleichzeitig sprangen vier Leute auf, Enttäuschung war vorprogrammiert.
Nach dem Unterricht saß Robert mit zwei Musikern und einem Keyboarder an einem der kleinen runden Tische, die im Kopfsteinpflaster der PT-Cafeteria verschraubt waren. Das Kopfsteinpflaster vermittelte einem nie das Gefühl, dass man sich im Innern des Gebäudes befand. Irgendwie blieb man immer draußen.
»Im Roxy ist der Deini auf jeden Fall öfter, da hast du ihn garantiert schon mal gesehen«, sagte Georg Ganserer, Keyboarder der Blues-Brothers-Coverband. Robert hatte seine Band einmal auf dem Stadtfest in Straubing gesehen, es war das reinste Bauerntheater mit den Anzügen, den Hüten und den Sonnenbrillen, getoppt nur noch vom pseudoamerikanischen Akzent des Sängers, der seine Ansagen auf Englisch machte.
»Den hab ich noch nie im Roxy gesehen«, sagte Robert.
»Seltsam«, sagte der Ganserer. »Weil eigentlich arbeitet seine Freundin an der Theke.«
»Echt?«, sagte Robert. »Wie sieht die aus?«
»Die kennst du garantiert, die hat blonde, glatte Haare und lacht nie. Eine Zehn.«
»Eine Zehn? Weiß nicht, wen du meinst«, sagte Robert, aber befürchtete, ganz genau zu wissen, wer gemeint war. Es musste das Mädchen sein, das ungerührt vier Weißbier gleichzeitig ausschenken konnte und immer nur mit den älteren Langhaarigen redete, die meistens auch noch einen ausgewachsenen Ziegenbart hatten, für den Robert einfach keine Geduld aufbrachte. In der letzten Stunde vom Discobetrieb, wenn nicht mehr ganz so viele Leute Weißbier bestellten, ging sie meistens auf die Tanzfläche und tanzte zu irgendeinem Hippie-Mist wie Alex Oriental, und das wie in Trance. Oft stand er mit Hamlet am Rand und überlegte sich, wie man so eine auf sich aufmerksam machen könnte, auf seine gefütterte Wildlederjacke und seinen Bobby-Briggs-Schnitt.
»Lydi«, unterbrach der Keyboarder Roberts Gedankengänge.
»Lydi?«, wiederholte Robert träge, noch erschöpft von dem Gedanken an die ganzen ergebnislosen Nächte im Roxy.
»Ja, so heißt sie. Lydi von Lydia. Die sind schon lange zusammen. Obwohl er gut drei Jahre älter ist. Schau, da kommt er eh.«
Ganserer nickte in Richtung der Einbuchtung, in die die Ladentheke der Cafeteria eingelassen war. Sie war samt Miniküche in das Mauerwerk unter der Treppe zum ersten Stock hineingebaut worden, und wenn man bestellen wollte, musste man sich in eine Schlange stellen, die hinter der Cafeteria scheinbar ins Mauerwerk führte und auf der anderen Seite bei den kleinen runden Tischen wieder herauskam.
David Deininger, der eine Art orientalische Gebetskappe trug, und Sabine Zeitl grüßten und setzten sich an den Nebentisch.
»Der Herr Deininger, grüß Sie Gott«, sagte der Keyboarder Ganserer überschwänglich.
»Halloooo, liebe Freunde«, sagte David gestelzt, mit einer Stimme wie ein Zirkusdirektor oder als ob er im Kinderfernsehen aufträte.
»Du, der Kollege Bley hier«, sagte der Keyboarder und legte seine Hand auf Roberts Arm, »der kennt die Lydi auch. Aus dem Roxy.«
»Wer kennst sie nicht?«, sagte David in seiner Zirkusdirektor-Stimme und lachte guttural in Richtung Sabine Zeitl.
»Ich kenn sie gar nicht wirklich«, sagte Robert und versuchte desinteressiert zu klingen. »Wir sind nur drauf gekommen, weil sie hinter der Bar arbeitet.«
David Deininger schienen weder Roberts Interesse noch sein schlecht geschauspielertes Desinteresse an seiner Freundin argwöhnisch zu machen. Er sah Robert verständnisvoll an.
»Du, die Lydi arbeitet da ja auch ständig. Die kann man gar nicht übersehen. Beim nächsten Mal, wenn ich auch da bin, trinken wir einen Tequila miteinander. Aufs Haus selbstverständlich.«
Robert wurde widerwillig ein bisschen warm ums Herz. »Ja gern«, sagte er.
»Tequila? Bist du nicht mehr Straight Edge?«, fragte einer der Musiker an Roberts Tisch.
»Zurzeit eher Straight Flush«, schallte es aus David Deininger, dessen Witz direkt ins eigene Gelächter überging. Beide Tische lachten jetzt, obwohl Robert sich nicht sicher war, ob jeder die Poker-Referenz verstand. Als sich alle wieder beruhigt hatten, wandte sich Deininger explizit Robert zu. Sein massiver Körperbau warf einen regelrechten Schatten über ihn.