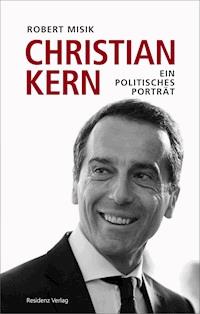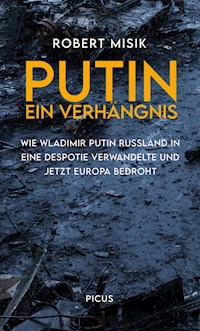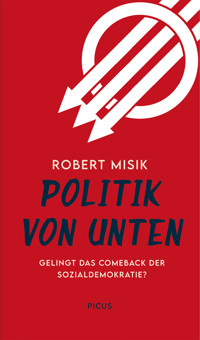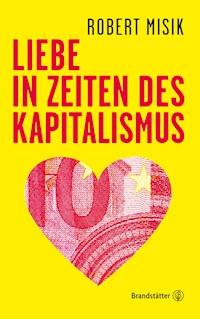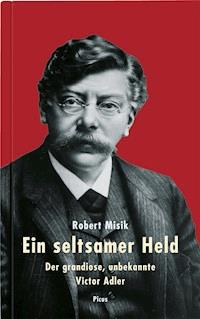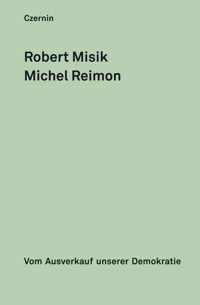15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Für eine moderne Linke Die Linke braucht neue Ideen, neuen Elan, eine neue Sprache. Robert Misik zeigt: das geht. Ein progressiver Wegweiser aus der Wirtschaftskrise. Deregulierung und freie Märkte führen zu Freiheit und Prosperität – so die Slogans der Marktideologie. Aber das ist falsch. Weder führen freie Märkte zu fairen Chancen für alle, noch können sie stabilen Fortschritt garantieren. Es kann nicht angehen, dass die Menschen der Wirtschaft dienen. Wir brauchen eine Wirtschaft, die den Menschen dient. Ein solches Wirtschaftssystem ist möglich, wenn neoliberale Parolen durch ökonomischen Sachverstand ersetzt werden. Und wir brauchen den Sozialstaat, der Chancen umverteilt und allen eine Möglichkeit gibt, aus ihrem Leben etwas zu machen. Robert Misik wagt nichts Geringeres als die Neuerfindung einer Linken, die sich dem 21. Jahrhundert stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Robert Misik
Anleitung zur Weltverbesserung
Das machen wir doch mit links
Impressum
ISBN 978-3-8412-0025-9
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, September 2010
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, hamburg
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Impressum
Inhaltsübersicht
Einleitung
Immer nur Dagegensein? Da bin ich gar nicht dafür!
1. Für einen »guten« Kapitalismus!
Eine Gesellschaft, die alle Bürger am Wohlstand beteiligt, ist auch wirtschaftlich funktionstüchtiger. Die Wirtschaftskompetenz der Progressiven besteht darin, dass sie das verstehen.
2. Gleichmacherei? Ja, bitte!
In Gesellschaften ohne krasse Ungleichheiten geht es allen besser – die Menschen sind glücklicher, sie leben länger und gesünder, und alle können aus ihrem Leben etwas machen.
3. Links sein heißt modern
Wie Sozialdemokraten und die anderen Parteien der demokratischen Linken wieder auf Erfolgskurs kommen können.
4. Mehr Demokratie in die Demokratie!
Wenn Bürger in Passivität verfallen, nützt das nur den gut organisierten Machteliten, die den Staat ausplündern. Deshalb müssen wir die Demokratie zur Mitmach-Demokratie umbauen.
5. Mehr Glück ins BIP!
Wir müssen die Wirtschaft wieder in Schwung bringen, den Klimawandel bekämpfen und die Unternehmen ökologisch umrüsten. Aber bei diesem »Green New Deal« dürfen wir uns nicht auf die Märkte verlassen. Dafür braucht es kluge staatliche Planung.
6. Eine neue Sprache
Progressive müssen lernen, über ihre Werte zu sprechen – ohne moralinsaure Predigten zu halten.
Schluss
Kooperation, Kreativität, Gleichheit – Schlüsselbegriffe für eine neue progressive Ära
Anmerkungen
Der Autor
EINLEITUNG
Immer nur Dagegensein? Da bin ich gar nicht dafür!
Wir Linken sind ja sehr gut im Dagegensein. Wir blicken uns um in der Welt, sehen beklagenswerte Missstände und himmelschreiende Ungerechtigkeiten und prangern sie an. Passiert etwas besonders Empörenswertes, organisieren wir eine Demonstration dagegen, und wenn ein menschenverachtendes Gesetz beschlossen werden soll, lancieren wir womöglich eine Unterschriftenliste, mit der wir unser Nichteinverstandensein dokumentieren. So ein bisschen von der Art: Die Bösen prägen die Welt. Und wir, die Guten, sagen, dass wir das aber sehr schlecht finden. Und manchmal müssen wir uns von unseren Zeitgenossen sagen lassen: »Ihr seid ja immer nur dagegen. Aber wofür ihr seid, das könnt ihr nicht so leicht sagen. Klar, ihr hättet gerne bessere Menschen und eine solidarischere Ökonomie – aber geht’s vielleicht ein bisschen konkreter? Eine Prise realistischer? Habt ihr vielleicht sogar einen Plan, wie wir dahin kommen könnten? Nein, habt ihr nicht. Ihr seid also weltfremde Weltverbesserer.«
Gesellschaftskritik ist uns ein hoher Wert. Wir kritisieren, was falsch läuft. Blättert man die Bücher von Karl Marx durch, dem revolutionären Denker der Linken des 19. Jahrhunderts, wird man feststellen: Viele seiner Schriften tragen das Wort »Kritik« schon im Titel. »Kritik des …« oder »Kritik der …« Klar, Marx war Philosoph, und in der Philosophie meint das Wort »Kritik« ein wenig etwas anderes als in unserer Umgangssprache – philosophische »Kritik« ist eine theoretische tiefgehende Auseinandersetzung mit »Kategoriensystemen«, sie klaubt die Dinge auseinander, daher muss die theoretische »Kritik« nicht unbedingt getragen sein von »Dagegen-« oder »Dafürsein«, sondern eher von analytischem Scharfsinn. Die Kategorie der »Kritik« ist in der Philosophie schließlich geprägt von Denkern wie Immanuel Kant, der jede seiner bahnbrechenden Arbeiten »Kritik« nannte: »Kritik der reinen Vernunft« etc.
Im 20. Jahrhundert wiederum entstand eine ganze Schule intellektueller Gesellschaftskritik, die diesen Impuls schon im Namen trug: die »Kritische Theorie«. In fast all diesen Fällen ist kritische Analyse von Kategoriensystemen freilich implizit, wenn nicht ohnehin explizit, auch Kritik von herrschenden, gegebenen Verhältnissen. Als Aufklärung will sie etwa den Schleier über vernebelten Verhältnissen wegreißen, beispielsweise über der »scheinhaften Freiheit der Wirtschaftssubjekte in der bürgerlichen Gesellschaft« (Max Horkheimer). Erkennen, Kritisieren und Verändern sind, so gesehen, Episoden eines Gesamtprozesses. Kritik deckt illegitime Privilegien, Macht, Herrschaft auf und ist, um Michel Foucault zu paraphrasieren, Voraussetzung für den rebellischen Impuls, »so nicht regiert werden zu wollen«.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Nichts ist schlecht daran. Ohnehin ist Kritik nie »nur Kritik«, »bloßer Negativismus«. Kritik an Zuständen skizziert immer auch – wie das Negativ einer Fotografie – das Bessere, das entstünde, wenn das Kritisierte verändert würde. Kritik ist, ganz klar, Vorbedingung der Verbesserung. Nicht zufällig haben »Krise« und »Kritik« einen gemeinsamen etymologischen Stamm und bezeichnen nicht bloß etwas, was »schlecht« ist, sondern etwas, was überholt ist, zum Sterben verurteilt. Kritisches Bewusstsein und Krisenbewusstsein sind keine depressiven Zustände, sondern getragen von der Überzeugung, das das »große Ganze« nicht mehr funktioniert und hoffentlich bald durch etwas Neues, Zeitgemäßes ersetzt wird.
Aber Kritik wird auch von einem anderen Boden aus geäußert, wenn die Vorstellung von einer besseren Welt nebulös wird, wenn sich die meisten Menschen eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, dass eine andere, eine gerechtere, eine fairere Welt möglich ist. Dann wird die Krise der Welt auch zur Krise der Kritik. Und seien wir doch ehrlich: Es gibt viel zu vieles in der Welt, bei dem einem gar nichts anderes übrig bleibt, als es zu kritisieren. Heutzutage gibt es eher zu wenig Kritik als zu viel von Dagegensein: viel zu oft sind die Menschen bereit, Dinge hinzunehmen, die man eigentlich nicht hinnehmen dürfte. Einfach, weil sie sich zu schwach fühlen, daran etwas zu ändern, oder auch, weil man sich an viele Dinge so gewöhnt hat, dass man gar nicht mehr richtig über sie nachdenkt. Man zuckt mit den Achseln und sagt sich: So ist das eben. Würde man sich über alles aufregen, worüber man sich aufregen müsste, man käme aus dem Aufregen gar nicht mehr heraus. Man würde nur mehr vor sich hin keppeln. Und dauerndes Keppeln ist uncool, zudem trübt es das Gemüt ein. Wer will schon als larmoyanter Kerl durch die Welt gehen, der dauernd mit Depri-Gesicht die Schlechtheit der Welt beklagt? Es macht die Luft auch nicht besser. Wenn man sich nicht vorsieht, wird einem die Übellaunigkeit zur zweiten Natur: Man sieht sich von Schlechtigkeit umstellt und geht ganz fix davon aus, dass ohnehin immer alles schlimmer wird. Das raubt einem alle Energie – auch die zum »Bessermachen«. Womöglich geht man seinen Zeitgenossen mit dem ewigen Negativismus auch noch auf die Nerven.
Vielleicht ist es da noch besser, sich nicht allzu viele Gedanken und stattdessen ein bisschen Party zu machen.
Was Sie hier in den Händen halten, ist ein Buch. Und mit Büchern – also mit geschriebenen Texten – ist das so eine Sache. Es gibt verschiedene Sorten von Sachbüchern: Biographien, historische Abhandlungen, gelehrige Fachbücher oder die Psychoratgeber mit dem Smiley auf dem Titelblatt (»Der schnelle Weg zu noch mehr Glück«). Politische Sachbücher sind in den meisten Fällen »kritische Bücher«. Sie prangern sehr oft irgendetwas an: Die negativen Folgen der Globalisierung. Den Konsumismus. Den Hunger in der Dritten Welt. Oder sie decken etwas auf: Wie gerissene Machtlobbys ein Land ausplündern. Auch ich habe eine Reihe kritischer Bücher geschrieben, etwa über das »Elend des Neoliberalismus« oder gegen die Neokonservativen. Eines meiner meistgelesenen Bücher heißt: »Genial dagegen. Kritisches Denken von Marx bis Michael Moore«. Natürlich war keines dieser Bücher »nur« kritisch. Im Allgemeinen kritisierte ich über zwei Drittel des Buches, und im letzten Drittel habe ich versucht darzulegen, wie es denn besser laufen könnte. Kritische Texte haben, sehen wir vom Inhalt einmal ab, auch einen schriftstellerischen Appeal: Sie lesen sich flotter. Es gibt – man könnte fast sagen: seit Jahrtausenden – eine spezifische Faszination kritischer Texte. Schon die alten Propheten in der Bibel klagten wortreich an, und wir sind heute noch fasziniert von ihrer Sprachgewalt. Einer dieser Propheten, Jeremias, gab einer ganzen Textgattung den Namen: Seinetwegen sprechen wir heute von einer »Jeremiade«, wenn jemand die Schlechtigkeit der Welt anprangert. Später entstand die Textgattung des Pamphlets, die Anklage des Kritikwürdigen in seiner modernen Form.
Aus der Sicht des Autors gesprochen, ist es viel einfacher, ein gutes Buch zu schreiben, das kritisch – also gegen etwas – ist, als eines, das für etwas ist. Wenn ich etwa gegen eine verdammenswerte politische oder ideologische Strömung anschreibe, kann ich die so richtig argumentativ auseinandernehmen, ich kann sie mit beißendem Spott überziehen und mit viel Ironie in den Boden schreiben, dass es eine Freude ist. Man kann dann auch die Herrschenden mit bösen Witzen überziehen – in Demokratien ist das sogar weitgehend gefahrlos. Als Leser hat man bei kritischen Büchern, mag der kritisierte Sachverhalt noch so deprimierend sein, gelegentlich auch etwas zum Lachen. Im Kontrast dazu bekommen Bücher, die für etwas sind, sehr schnell eine leicht betuliche Note. Sie sind voller Floskeln wie »man sollte« oder »man müsste«, strotzen von moralischen Aufforderungen und guten Ratschlägen und sind stilistisch meist dröge und darum sehr schwer zu ertragen. Selbst wenn es ihnen gelingt, den Leser oder die Leserin zu überzeugen, dann läuft es oft darauf hinaus, dass der Leser oder die Leserin nickt und nickt und nickt. Und am Ende ist er oder sie eingenickt. Dafürsein ist irgendwie langweilig. Dagegensein ist sexy.
Viele Menschen haben den Glauben daran verloren, dass man die Welt auf eine bessere Spur bringen kann. Seit der Aufklärung haben das immer wieder Menschen oder Gruppen von Menschen – Parteien, Revolutionäre, Umstürzler, Utopisten oder Reformer – versucht, aber oft ist nicht viel Gutes rausgekommen. Wir sind in dieser Hinsicht ein bisschen gebrannte Kinder. Wir wissen, wenn wir uns mit der Geschichte unserer Welt auseinandersetzen, dass Engagement sehr oft auch etwas Gutes bewirkt hat. Die Bürgerrechte der Schwarzen in den USA wären nicht durchgesetzt worden, falls sich nicht Menschen in einer Bürgerrechtsbewegung zusammengeschlossen hätten. In Österreich und Deutschland wurde das allgemeine, gleiche Wahlrecht von Arbeiterbewegungen durchgesetzt, die auch bessere Arbeitsrechte, den Achtstundentag, faire Löhne und eine ordentliche Sozialversicherung erkämpft haben. Das war nur möglich, weil sich einerseits viele Menschen zusammengetan und beispielsweise Parteien gegründet haben, die außerparlamentarisch Druck gemacht und in den Parlamenten Einfluss auf den politischen Prozess genommen haben. Und wir wissen leider ebenso, dass heute kaum mehr jemand etwas von diesen Parteien wissen mag – und die Anführer dieser Parteien wollen vor allem ihre Ruhe haben. Einerseits haben sie gerne Aktivisten, die ihnen etwa bei ihrer Wahlwerbung helfen, andererseits wollen sie nicht von irgendwelchen Weltverbesserern gestört werden bei der »professionellen« Politik.
Kurzum: Wir können uns im Grunde gar nicht vorstellen, wie das praktisch gehen sollte mit der Weltverbesserung. Selbst wenn wir eine ungefähre Idee davon haben, welche Reformen, Gesetze und Maßnahmen unsere Gesellschaften ein Stück weit besser, gerechter und funktionstüchtiger machen würden, scheint es uns ziemlich undenkbar, dass diese in absehbarer Zeit durchgesetzt werden können in einem politischen Betrieb, der von blutleeren Karrieristen oder altmodischen Apparatschiks geprägt und von mächtigen Lobbygruppen gekapert ist. Auch deshalb ist es einfach naheliegender, »dagegen« zu sein – gelegentlich auf sehr diffuse Weise »gegen das alles« – oder sich auf zynische Weise dem ganzen Spiel zu entziehen.
Ich gebe zu, auch mir fielen hundert Gründe ein, einzustimmen in ein großes Klagelied. Seit mehr als zwei Jahren ist die globale Ökonomie in der tiefsten Wirtschaftskrise seit achtzig Jahren, einer Wirtschaftskrise, die durch falsche Deregulierung im Finanzsektor provoziert wurde, und noch immer sind keine nennenswerten Regulierungsmaßnahmen eingeführt, die die Finanzbestie aushungern könnten. Unsere Volkswirtschaften sind so reich wie nie zuvor, aber junge Menschen können nicht einmal damit rechnen, sich einen ähnlichen Wohlstand zu erwirtschaften wie ihre Elterngeneration. Während sich die Reichtümer mehr und mehr konzentrieren, tun viele Firmen so, als könnten sie jungen Praktikanten nicht einmal ein minimales Einkommen garantieren. Für jeden Schwachsinn ist Geld da, aber wir leisten uns immer noch ein Bildungssystem, das mehr als acht Prozent unserer Kinder ohne Abschluss auf den Arbeitsmarkt spuckt. Die immer gleichen Propagandisten neoliberaler Weisheiten verkünden in den unzähligen Fernsehtalkshows, dass wir noch mehr Egoismus und »Selbstverantwortung« brauchen – außer bei den Bankern, die zahlen sich ihre Boni aus den staatlichen Rettungsgeldern. Gespart werden soll bei Hartz IV und bei den Sozialleistungen. Und die Banker zocken schon wieder – mit dem billigen Geld, das die Notenbanken in die Märkte pumpen, und mit den Rettungsmilliarden, die man ihnen mit unserem Steuergeld geschenkt hat. Es läuft weiter, weiter, weiter so.
Daran wird sich nichts ändern, wenn die Menschen zwar wissen, wogegen sie sind, aber man ihnen dass Gefühl vermittelt, dass es eigentlich ziemlich unmöglich ist, irgendetwas zu verbessern.
Im Folgenden will ich eine Lanze brechen für progressive Reformen in unserer Zeit. Zentral dafür sind Vorschläge für eine progressive Wirtschaftspolitik. Denn obwohl die Rezepte der Marktfundamentalisten den Kapitalismus praktisch an den Rand des Kollaps gebracht haben, hält sich absurderweise noch immer das hartnäckige Vorurteil, es wären die Wirtschaftsliberalen und Konservativen, die »etwas von der Wirtschaft verstehen«, während die Linken immer nur Schulden machen und das Wachstum abwürgen wollen. Ich werde zeigen, dass eine Wirtschaftspolitik, die eine gerechtere und fairere Gesellschaft im Auge hat, auch eine in ökonomischer Hinsicht bessere Wirtschaftspolitik ist – und dass die Wirtschaftsinkompetenz der Konservativen gerade darin besteht, dass sie dafür überhaupt kein Verständnis haben. Wahrscheinlich nicht einmal weil sie besonders dumm wären, eher trifft auf sie das Wort Upton Sinclairs zu, der einmal schrieb: »Es ist sehr schwer, einen Menschen dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht.« Aber ökonomische Fairness und eine einigermaßen gleiche Einkommensverteilung machen nicht nur die Wirtschaft stabiler, sie machen Gesellschaften als Ganzes lebenswerter. Der soziale Stress, der mit großen Reichtumsunterschieden einhergeht, macht unglücklich – und mehr Gleichheit macht die Menschen glücklicher. Progressive Reformen – das heißt aber auch, dass wir unseren Blick nach vorn richten müssen. Früher verstanden sich die Linken wie selbstverständlich als »Kräfte des Fortschritts«, und die Konservativen wurden als »rückwärtsgewandt« wahrgenommen. Aber diese Differenz ist schon lange nicht mehr trennscharf – ja, man kann sogar behaupten, der Fortschritt habe die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Konservativen und Neoliberalen für den Wirbelwind der Veränderung und plädieren für »Reformen« – für Maßnahmen, die jeweils das Leben der einfachen Leute erschweren –, sodass viele Linke eher auf die Defensive setzen, auf das Verteidigen sozialstaatlicher Standards gegen die stetigen Angriffe der Marktfundamentalisten. Während sich früher die Weltverbesserer mit dem Zeitgeist im Bunde wähnten und davon ausgingen, dass der gesellschaftliche Wandel zwar nicht automatisch und nicht in allen Details, aber doch im großen Ganzen in Richtung von mehr Gerechtigkeit und sozialem Fortschritt weisen würde, so ist diese Gewissheit gehörig ins Wanken geraten. »Fortschritt« wird heute oft einfach mit wirtschaftsfreundlicher Innovation gleichgesetzt, die den normalen Menschen mehr Stress bereitet und sie keineswegs glücklicher macht. Die Linke ging deshalb mental in Abwehrstellung.
Aber das ist eine Falle. Einerseits, weil ein vergangenes Arrangement nicht einfach wiederhergestellt werden kann – die Uhr kann nicht zurückgedreht werden. Andererseits, weil wir auf neue Herausforderungen neue Antworten brauchen – auf Probleme wie die ökologische Krise, den Klimawandel, die Endlichkeit fossiler Ressourcen. Dasselbe gilt für die innere Auszehrung der Demokratie, den Verdruss an Parteien, das Desinteresse an Politik. Dem ist nur mit mehr Demokratie in der Demokratie zu begegnen. All diese Dinge verlangen nicht Verteidigung, sondern Verbesserung. Aber vielen Linken ist nicht nur ihre Orientierung auf die Zukunft abhandengekommen, sondern mit dieser auch ihr Optimismus. Und das ist keine Kleinigkeit: Denn aus Optimismus resultiert Hoffnung und aus der Hoffnung die Entschiedenheit und Willenskraft, sich für etwas einzusetzen. Es waren immer die Optimisten, die die Welt verändert haben, niemals die Pessimisten, die von ihrer abgeklärten Gewissheit ausgegangenen sind, dass ohnehin immer alles schlechter wird – oder immer alles gleich schlecht bleibt. Kurzum: Die Linke muss den Fortschritt zurückerobern.
Und sie muss wissen, wofür sie steht: für faire Wohlfahrt für alle und gegen ungerechtfertigte Privilegien jener, die alle Chancen, die meisten Reichtümer, Macht und Einfluss monopolisieren, die wichtige Reformen blockieren und sich Politik und Medien kaufen, um ihre Vorteile zu verteidigen. Für eine Welt, in der die unterschiedlichsten Menschen ihre unterschiedlichen Talente entwickeln können, aber in der alle die gleichen Chancen und ein ausreichendes Maß an Sicherheit haben. Für eine Gesellschaft, in der es wieder gerecht zugeht. It’s that simple. Wenn das nicht die Begriffe sind, die den Menschen gewissermaßen automatisch in den Kopf kommen, wenn von linken oder sozialdemokratischen Parteien die Rede ist, dann haben diese Parteien verdammt viel falsch gemacht.
Wir können immer gut erklären, warum »die Linken« – das linksliberale Milieu, die progressiven Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die Parteien der demokratischen Linken – in dem Zustand sind, in dem sie sind. Es fehlt im Folgenden auch nicht an Erklärungen dafür. Aber, um Karl Marx zu paraphrasieren: Es reicht natürlich nicht aus, die politischen Kräfte der Linken zu interpretieren.
Es kommt darauf an, sie zu verändern.
1. FÜR EINEN »GUTEN« KAPITALISMUS!
Eine Gesellschaft, die alle Bürger am Wohlstand beteiligt, ist auch wirtschaftlich funktionstüchtiger.
Die Wirtschaftskompetenz der Progressiven besteht darin, dass sie das verstehen.
Anfang Februar 2010 gingen in Colorado Springs buchstäblich die Lichter aus. Die Stadtverwaltung hatte verfügt, dass mehr als ein Drittel aller Straßenlaternen für immer dunkel bleiben würden. In der zweitgrößten Stadt im US-Bundesstaat Colorado fuhren in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Wer sich in der Finsternis auf der Straße zu ängstigen begann, konnte auch nicht mehr darauf vertrauen, dass im Notfall die Polizei zur Stelle sein würde, denn die hatte so wie die Feuerwehr ihren Betrieb auf Sparflamme umgestellt. Die Polizeihelikopter wurden im Internet zum Verkauf angeboten. In den Parks hatten die zuständigen Behörden die Mülleimer abgeschraubt und durch Schilder ersetzt, auf denen die Bürger aufgefordert wurden, bitte ihren Unrat selbst aufzusammeln und mit nach Hause zu nehmen – die regelmäßige Entleerung durch die Müllabfuhr sei von der Stadt finanziell nicht mehr zu verkraften. Aber auch dieses Problem hat sich als nicht so drückend erwiesen, da die Parks bald nicht mehr sonderlich einladend ausgesehen haben. Das Budget für Blumen und Düngemittel wurde auf eine elegante Null heruntergeschraubt, und auch eine Bewässerung der Parks ist künftig nicht mehr vorgesehen: die Wasserrechnungen kann die Stadtverwaltung nicht mehr bezahlen. Die grünen Wiesen werden sich nach der ersten längeren Trockenperiode in braunes erdiges Ödland verwandeln. Gemeindezentren, Tagesstätten für die Alten, Kindergärten – alles wurde aus Kostengründen eingespart. Die städtischen Museen bekamen noch eine Gnadenfrist, in der sie sich um private Sponsoren umsehen konnten.
So sieht er im Endeffekt und im Extremfall aus, der »schlanke Staat«, der durch niedrige Steuersätze das Unternehmertum und die Eigenverantwortung der Individuen fördern will. In die Totalbredouille wurde die Stadt Colorado Springs gebracht, weil die Einnahmen aus Umsatzsteuern aufgrund der Wirtschaftskrise um 22 Millionen Dollar eingebrochen sind. Im Boom hatten die Bürger auf Pump eingekauft, und ein Teil des Geldes floss über Verbrauchersteuern in die kommunalen Kassen. Aber damit war nun Schluss: Konsumentenkredite gab es nicht mehr, viele Menschen waren arbeitslos geworden und hatten deshalb kein Geld mehr zum Ausgeben, andere wiederum hatten aufgrund der düsteren Wirtschaftsaussichten ihr Vertrauen verloren und begannen, zur Sicherheit ihr Geld zu horten, statt es als Käufer in den Wirtschaftskreislauf zu pumpen – was wiederum die Einkommen der Firmen schmälerte, sodass diese noch mehr Leute entlassen mussten und so weiter. Wenn eine solche Abwärtsspirale einmal in Gang gesetzt ist, dann schraubt sie sich weit nach unten.
Und keiner soll glauben, verwaiste Autobusstationen, eingemottete Polizeifahrzeuge, geschlossene Kindertagesstätten oder verödete Parks wären nur ein Phänomen amerikanischer Städte, weil dort der »Raubtierkapitalismus« eben besonders brutal sei. Im Sommer 2010 sorgte auch in Deutschland eine Studie für Aufsehen, die die Sparpläne deutscher Kommunen systematisiert hat. Das Ergebnis ist eindeutig: Die Kassen sind so klamm, dass Zustände wie in Colorado Springs auch zwischen Anklam und Zwickau bald die Regel sein könnten: 31 Prozent der Kommunen wollen bei der Straßenbeleuchtung Geld sparen, 29 Prozent bei der Jugend- und Seniorenbetreuung kürzen, 14 Prozent wollen Bäder schließen und 11 Prozent den Nahverkehr ausdünnen.1
Viele Möglichkeiten, zu Geld zu kommen, haben die Gemeinden nicht. Die Stadtverwaltung von Colorado Springs übrigens hatte, noch bevor die Lage gänzlich dramatisch wurde, in ihrer Verzweiflung noch versucht, die Einkommenssteuer zu erhöhen – was aber von den Bürgern in einer Volksabstimmung verworfen wurde. Schließlich hatte man ihnen ja seit Jahren eingetrichtert, dass höhere Steuersätze ein Übel seien und die Wirtschaft am Prosperieren hinderten.
Die Wirtschaft wird in der Wirtschaft gemacht, und der Staat soll sich so weit wie möglich raushalten, so lautete die Parole.
Erinnern wir uns noch einmal kurz an die Doktrin, die uns diese Malaise eingebrockt hat, zumal sie ja auch heute nicht gänzlich tot ist: Schließlich trommeln deren Anhänger immer noch, in Wirklichkeit hätten nicht die Märkte versagt, sondern die Staaten. So wird beispielsweise die Legende gestrickt, den Hauptanteil am Kollaps der globalen Finanzmärkte hätten die staatsnahen amerikanischen Hypothekenbanken Fannie Mae und Freddie Mac, weil diese auf Wunsch der Regierung Immobilienkredite an einkommensschwache und damit nicht kreditwürdige Kunden vergeben hätten. Daran ist richtig, dass die beiden Institute zeitweise verantwortungslos Kredite vergeben hatten. Aber sie haben im großen Geschäft mit Subprime-Krediten eine verschwindend geringe Rolle gespielt und sich schon im Jahr 2003, als die Immobilienblase so richtig anzuschwellen begann, aus dem Geschäft zurückgezogen. Die Hauptakteure im Business mit Hypothekarkrediten, die wenig zahlungskräftigen Kunden aufgeschwatzt und danach zerteilt, gebündelt und in sogenannte »strukturierte Produkte« verpackt und um die halbe Welt verkauft wurden, waren die privaten Finanzmarktakteure, Hypothekenvermittler und Investmentbanken.
Also Investoren auf den globalen Finanzmärkten, deren Agieren angeblich vor allem segensreiche Wirkungen habe: Weil Märkte, in die sich der Staat nicht einmischt, »effiziente Märkte« seien, würden auch die Finanzmärkte »effizient« funktionieren. Die Preise auf diesen Märkten seien »reale« Preise und böten damit korrekte »Informationen« über die zugrunde liegenden Werte. Auf globalen Investmentmärkten würde das Kapital daher in jene Firmen und Branchen fließen, in denen es bestmöglich eingesetzt wäre. Deshalb würden die Finanzmärkte auch zur »effizienten Allokation des Kapitals« führen, das Kapital somit dort zum Einsatz kommen, wo es am besten zur Wohlstandsmehrung beitragen kann. Auf diesen Finanzmärkten können gerissene Anleger sehr reich werden, was die Schere zwischen mehr und weniger Wohlhabenden aufgehen lässt, aber diese Ungleichheit müsse man in Kauf nehmen, wurde immer wieder gemahnt: denn letztendlich hätten alle etwas davon, wenn die Märkte »optimal« funktionierten, also wenn ihnen niemand, keine regulierenden Behörden, kein Staat, in die unsichtbare Hand fiele. So würden unsere Gesellschaften reicher und reicher, und von dem Reichtum würden dann auch die Ärmeren profitieren, weil der Wohlstand zu ihnen gewissermaßen »durchsickere« – im berühmten, legendären »Trickle-Down-Effekt«, der mit dem Ungeheuer von Loch Ness gemein hat, dass von ihm viel geraunt wurde, obwohl es noch nie jemand gesehen hat. Schließlich würden die Reichen sich große Häuser bauen oder shoppen gehen, und dadurch hätten Installateure und Maurer oder Verkäuferinnen ein Einkommen.
Wenn Regierungen aber versuchten, die Märkte zu zügeln, oder gar durch Sozialprogramme Umverteilungsmaßnahmen in Gang setzten, dann würde die Reichtumsproduktion als Ganze gehemmt. Dann wären die Gesellschaften möglicherweise relativ gleicher, aber insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Die Armen wären dann nicht reicher, sie wären höchstens relativ weniger arm im Verhältnis zu den Reichen. Aber von dieser relativen Gleichheit könnten sie sich nichts kaufen, also würde sie diese Gleichheit nicht glücklicher, sondern unglücklicher machen. Schlimmer noch: Sie würden sich womöglich nicht mehr so anstrengen, weil sie einerseits ein kommodes Auskommen durch den Staat hätten und andererseits das Vorbild der Reichen, Schönen und Erfolgreichen verlorenginge, das ja für die Armen ein Leistungsansporn sei; schließlich haben sie dank denen immer vor Augen, was man erreichen kann, wenn man sich nur anstrengt.
Dass Märkte, wenn man sie nur ungehindert tun lasse, zu »vollkommenen Märkten« werden, die aus sich heraus immer zu einem »Gleichgewicht« und zum »optimalen Output« tendieren, bewiesen die ökonomischen Fürsprecher dieser Doktrin mit einer Reihe elaborierter Ableitungen und betörender Modelle. Dabei wurde das Modell des perfekten Marktes gewissermaßen als Prämisse vorausgesetzt, aus der sich alle weiteren Ableitungen wie von selbst ergaben. Mit der ökonomischen Wirklichkeit und dem echten Leben mussten diese Modelle nicht unbedingt etwas zu tun haben, sie etablierten eher so etwas wie eine Phantasieökonomie. Lawrence Summers, der frühere US-Finanzminister und nunmehrige Wirtschaftsberater von Präsident Barack Obama, nannte diese Art von Wirtschaftswissenschaftlern deshalb einmal keck »Ketchup-Ökonomen«, und zwar aus folgendem Grund: »Aus der Entdeckung, dass zwei Ketchupflaschen exakt doppelt so viel kosten wie eine Ketchupflasche, ziehen sie den Schluss, dass der Ketchupmarkt ein perfekter, effizienter Markt ist.«
Diese Ökonomen entwickelten komplizierte mathematische Modelle und Formeln, die immer ergaben, dass Märkte effizient funktionieren. Nur leider gingen sie dabei, so der große britische Wirtschaftshistoriker Lord Robert Skidelsky, von Prämissen aus, »die jeder normale Mensch für absurd halten müsste«. Dazu zählten abstruse Vorannahmen wie die, dass auf den »perfekten Märkten« immerzu »symmetrische Information« aller gegeben sei, also jeder Marktteilnehmer stets alle wesentlichen Informationen über den Markt besitze. Eine andere solche Vorannahme war, dass Wirtschaftssubjekte – normale Leute würden sagen: Menschen – stets und primär danach trachten, ihren ökonomischen, materiellen Nutzen zu maximieren, und sich dabei auf schier übermenschliche Art und Weise vernünftig verhalten. Die Modelle setzten also voraus, dass alle Beteiligten immer alles wissen und sich dann diesem Wissen entsprechend stets rational verhalten.
Daran ersieht man schon, dass hinter dieser ökonomischen Doktrin mehr steckt als »bloß« eine wirtschaftstheoretische Lehre, sie gründet auf einem Welt- und Menschenbild. Diese Wirtschaftstheorie geht davon aus, dass Menschen funktionieren wie kühl kalkulierende, optimal programmierte Rechenmaschinen und dass nur vermittels der Preisbildung am Markt die Vielzahl an »Informationen«, die man für das Geschäftsleben braucht, verarbeitet werden kann – und dass der Markt tatsächlich diese Informationen effizient und fehlerfrei verarbeiten kann und alle Informationen transparent zur Verfügung stellt. Wobei »Information« in diesem Zusammenhang nicht nur das meint, was der Laie im Alltagsgespräch unter Information versteht – also Wissen oder Nachrichten, die man aus der Zeitung oder dem Fernsehen oder dem Warenkatalog erfährt oder im Gespräch mit dem Kumpel aufschnappt –, sondern mehr noch: eine unendliche Menge und Abfolge von Impulsen. Wenn ein Passant beim Geschäft X vor einem Schaufenster ein Paar Schuhe betrachtet, den Preis und auch die Fasson der Ware beurteilt, daraufhin aber in einen anderen Laden geht und ein anderes Paar kauft, ist das eine »Information« für das Geschäft X, auch wenn der Kunde mit niemandem in dem Laden gesprochen hat. Falls viele Kunden so agieren, weiß der Ladenbetreiber innerhalb weniger Wochen, dass er seine Schuhe entweder zu einem zu hohen Preis anbietet oder diese längst aus der Mode sind. In beiden Fällen wird er den Preis senken, damit er die Ware noch loskriegt. Und auch der Kunde hat eine Information erhalten: Er weiß jetzt, was Schuhe kosten. Er weiß, wo sie am teuersten beziehungsweise wo sie am billigsten sind. Sehr viel weiß er damit vielleicht nicht – aber möglicherweise genug für derart unkomplizierte Marktoperationen.
Nun mag das in einem solchen simplen Fall wie dem des Schuh-Marktes stimmen und zudem wohl die beste Form der Preisbildung sein, jedenfalls eine bessere als die meisten denkbaren Alternativen (etwa dass ein Beamter im Wirtschaftsministerium den Preis für Schuhe festlegt oder den Verkauf besonders hässlichen Tretwerks verbietet). Aber für kompliziertere Märkte trifft das nur bedingt zu, ja, selbst für Kleinstädte mit nur einem Schuhgeschäft, in denen von »symmetrischer Information« kaum die Rede sein kann, ist dieses Modell höchstens eine hübsche Illustration dafür, wie Märkte »theoretisch« funktionieren, wenn auch leider nicht in der Praxis vor Ort.
Die Modelle, mit denen Ökonomen das effiziente Funktionieren perfekter Märkte beschreiben, haben aber nicht nur ihrer scheinbaren Logik wegen sehr viele Anhänger und in Politik und Publizistik großen Einfluss gewonnen, sondern auch, weil sie so demokratisch anmuten. Die Idee der rational funktionierenden Märkte verwirft jede Möglichkeit des steuernden Eingreifens – etwa von Politikern – in die Wirtschaft und baut auf die »Weisheit der Vielen«. Die Gedankenreihe dahinter lautet in etwa folgendermaßen: Minister, die Regeln aufstellen, oder Gewerkschafter, die Mindestlöhne fordern, sollen ja nicht glauben, sie könnten den Märkten etwas vorschreiben. Die Märkte sind solchen Schreibtischhengsten immer überlegen. Der Minister kann zwei Universitätsstudien absolviert haben und auch sonst ein blitzgescheiter Kerl sein, dennoch kann er nie so viel »wissen«, wie die Märkte »wissen«, in die die Informationsimpulse, also Urteile und Aktivitäten von Tausenden und Abermillionen Marktteilnehmern, eingehen – die Impulse von einfachen Männern und Frauen, die morgens Brötchen und Milch kaufen, nachmittags ein Paar Schuhe und abends eine Versicherungspolice abschließen.
Die »Efficient Market Hypothesis« basiert also auf einem schier basisdemokratisch erscheinenden »Gesetz der großen Zahlen, dem zufolge die durchschnittliche Entscheidung mit umso höherer Wahrscheinlichkeit optimal ist, desto größer die Gruppe ist« (Skidelsky)2. Der Markt ist für diesen Typus von Ökonomen »wahrhaft ein Gotteswesen«, schreibt der amerikanische Ökonom John K. Galbraith sarkastisch, »›weiser und mächtiger als der größte Computer‹, wie sich Enthusiasten ausdrücken, der irgendwie die konfuse Masse von verschiedenen individuellen Präferenzen zur allgemeinen Zufriedenheit zu ordnen vermag«.3
Nun kann man gewiss einwenden, dass dies auch für Gütermärkte nur ein hübsches Modell ist, das in der Praxis nicht so funktioniert – sei es, weil die Menschen auch auf Gütermärkten nicht nur wie kühle Rechenmaschinen agieren, sondern sich von Moden und Massenpsychosen leiten lassen; weil auch auf Gütermärkten nur sehr selten eine symmetrische, perfekte Information aller Marktteilnehmer existiert; weil auch für Gütermärkte gilt, dass die schönsten Modelle nichts nützen, wenn die Menschen zu wenig Geld in der Tasche haben, um sich die Waren zu kaufen; weil auch auf Gütermärkten große Marktakteure eine überdimensionale Marktmacht anhäufen können. Ganz gewiss taugt die Hypothese der effizienten Märkte nichts, um das Geschehen auf mehreren entscheidenden Märkten einer kapitalistischen Ökonomie zu beschreiben: auf den Arbeitsmärkten, auf den Kapitalmärkten, aber auch – mit einigen Abstrichen –, wie wir gesehen haben, auf den Immobilienmärkten. Die beiden Letzteren sind eng miteinander verschränkt, und zwar einerseits, weil Menschen Immobilien als Wertanlagen kaufen, und andererseits, weil viele Menschen, die ein Haus oder eine Wohnung erwerben, dies über Kredite finanzieren.
Erinnern wir uns noch einmal an eines der Basispostulate der Effizienz-Markt-Theorie: Kapital wird dann optimal eingesetzt, wenn es sich auf möglichst freien Märkten seine Investitionsmöglichkeiten suchen, heute hierhin, morgen dahin fließen, einmal in Aktien, dann wieder in hochspekulativen strukturierten »Finanzprodukten« angelegt werden kann. Aber gerade die Kapitalmärkte sind höchst irrationale Märkte. Mal strömen Milliarden an Dollar oder Euro in bestimmte Anlageformen, seien es Unternehmensanteile in den gerade angesagten »Emerging Markets«, seien es Immobilienzertifikate, wenn der Häusermarkt boomt, seien es Staatsanleihen, seien es komplizierte spekulative Titel. Nur in seltenen Fällen wird man auf Basis realwirtschaftlicher Daten mit einer vernünftigen Begründung vorhersagen können, dass eine bestimmte Geldanlage stetigen Gewinn verspricht. Eine Geldanlage lohnt auch nur, wenn ihr »Wert« am Markt steigt. Der »Wert« am Markt steigt aber dann, wenn morgen genügend Leute bereit sind, das Wertpapier zu einem höheren Preis zu erstehen, als ich es heute erworben habe. Also: Wenn möglichst viele Leute glauben, dass es weiter an Wert gewinnen wird. Deshalb sind die Kapitalmärkte so empfänglich für Herdentrieb, überspannte Euphorien, aber auch für Hysterie und Panik. Wenn viele zur gleichen Zeit das Gleiche kaufen, steigt das, was sie kaufen, im Wert; wenn es dagegen im Wert sinkt und alle in Panik versuchen, ihr Wertpapier loszukriegen, fällt es ins Bodenlose. Auf den Kapitalmärkten herrschen die »Animal Spirits«4, die tierischen Instinkte, wie John Maynard Keynes, der größte Ökonom des 20. Jahrhunderts, pointiert formuliert hat. Von »sozialer Ansteckung« spricht Robert Shiller, ein renommierter Ökonom der Yale University, sie lasse sich am besten mit Begrifflichkeiten der Virologie beschreiben.
Deshalb trägt, so Keynes, die Entwicklung der »organisierten Investmentmärkte manchmal entscheidend zur Instabilität des Systems« bei.5 Keynes galt ja lange Jahre als toter Hund, seine Lehre von der systemischen Instabilität einer auf sich allein gestellten Marktwirtschaft und der Notwendigkeit, dass Regierungen dafür sorgen müssen, dass die Investitionen auf einem angemessenen Niveau bleiben und die Nachfrage nicht hinter dem volkswirtschaftlichen Output zurückbleibt, wurde als vorgestrige, gefährliche sozialistische Irrlehre abgetan. Aber seit dem Kollaps der Finanzmärkte ist Keynes wieder zurück. »Die Rückkehr des Meisters« jubelt sein Biograph, Lord Robert Skidelsky, in einem jüngst erschienenen Buch, und amerikanische Nachrichtenmagazine postulieren neuerdings wieder: »We are all Keynesians now!«