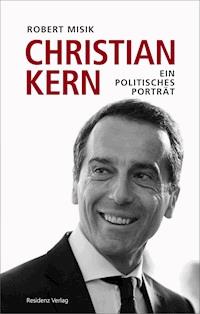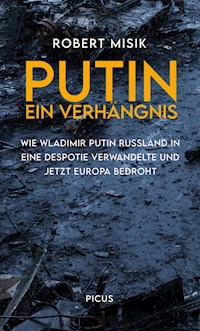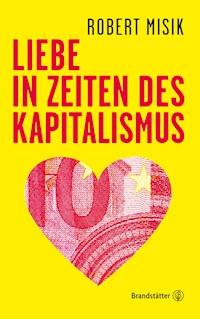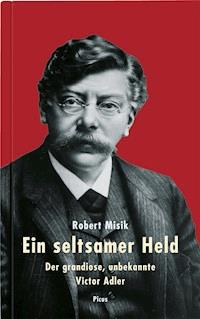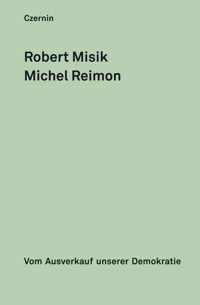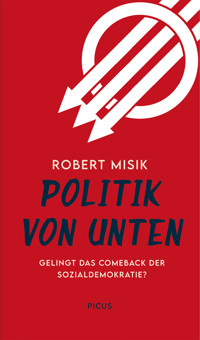
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Österreich steht vor der Gefahr einer endgültigen Orbanisierung, doch ausgerechnet in diesem Moment taumelt die Sozialdemokratie in eine schwere Krise. Nach der rumpelnden Lösung ihrer Führungsfrage wird die große, traditionelle demokratische und soziale Reformpartei SPÖ ihre Identität zu klären haben. Die Sozialdemokratie muss glaubwürdige Schutzmacht der Schwächsten sein und Anwältin der ganz einfachen, normalen Leute, die nicht mit goldenen Löffeln im Mund geboren wurden – aber auch Bollwerk von Demokratie, Liberalität und Modernisierung. Robert Misik, jahrzehntelanger Kenner der österreichischen und der europäischen Sozialdemokratie, beschreibt, wie es zur Sklerose der progressiven Parteien gekommen ist, wie sehr die Identitätskrise des »Dritten Weges« noch nachwirkt und wie in eine orientierungslose Apparatschikpartei wieder Leben hineinkommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Copyright © 2023 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
FINIDR, s.r.o., Český Těšín
ISBN 978-3-7117-2140-2
eISBN 978-3-7117-5498-1
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unterwww.picus.at
Robert Misik
Politik von unten
Gelingt Das Comeback Der Sozialdemokratie?
Picus Verlag Wien
Inhalt
1. Plötzlich Chef
Integer, glaubwürdig, volksnah – kann Andi Babler mit diesen Attributen punkten?
2. Die Verlassenen
Warum sich die arbeitenden Klassen der Sozialdemokratie entfremdet haben
3. Die Eigenen Wähler und Wählerinnen Verstehen
Die Sozialdemokratien haben schmerzhaft gelernt: Wer sein Profil verwässert, verliert
4. Am Ende Des Dritten Weges
Ein Jegliches hat seine Zeit: Eine kurze Aufarbeitung der Blair-&-Co-Ära
5. Sehnsucht Nach Hoffnung
Es steht viel auf dem Spiel
Verwendete Literatur
Der Autor
1Plötzlich Chef
Integer, glaubwürdig, volksnah – kann Andi Babler mit diesen Attributen punkten?
Es ist der 4. Juni 2023, knapp nach 15 Uhr, ein Sonntag, und nach wilden Wochen kommt »der Andi«, wie ihn das halbe Land längst nennt, langsam zur Ruhe. Er sitzt im Familienauto am Steuer und bringt die Schwiegereltern, die die letzten Tage auf die Tochter aufgepasst haben, zum Bahnhof. Denn schließlich findet ein großes Abenteuer jetzt sein vorläufiges Ende und der Traiskirchner Bürgermeister kann zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass sein Leben und das seiner Partnerin und Mitstreiterin, Karin Blum, wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser treibt. Es ist ziemlich genau vierundzwanzig Stunden nach Andreas Bablers größten Triumph– von dem in diesem Augenblick allerdings noch niemand etwas ahnt.
»Mich hat gestern niemand trösten müssen«, lacht er aufgeräumt, als ich ihn am Mobiltelefon erreiche. »Wir haben eine unglaubliche Kampagne zustande gebracht, wir haben in der Stichwahl so viele Delegierte auf unsere Seite gezogen, die Parteitagsrede hat gut funktioniert, mehr hätte man nicht drehen können«, sagt der Mann, der erst vor drei Monaten als Underdog-Kandidat und Frontfigur einer idealistischen Basisbewegung in den Wettbewerb um den SPÖ-Vorsitz eingestiegen war, mit seiner Grassroots-Kampagne für eine Eintrittswelle von Tausenden neuen Parteimitgliedern gesorgt und dann auf dem Parteitag nur haarscharf verloren hatte. Wir scherzen etwas herum, und irgendwann sage ich, »ein paar Stimmen mehr, und euer normales Leben als Familie wäre zu Ende gewesen.«
Vierundzwanzig Stunden später wird das bisherige Leben des Kleinstadtbürgermeisters tatsächlich zu Ende gehen.
Denn es ist etwas ganz Irres geschehen. In Wahrheit hatte Babler gewonnen, die Wahlkommission hatte sich nur verzählt. Eine falsch befüllte Excel-Vorlage hatte ein bizarres Additionsfiasko ausgelöst, sodass am Parteitag der falsche Sieger ausgerufen wurde. Am Montag wurde noch einmal nachgezählt und nach Fehlern gesucht, dabei fiel erst auf, dass eigentlich Babler gewonnen hatte.
Es war der skurrile Höhepunkt eines holprigen Führungswettbewerbs der SPÖ, bei dem die Emotionen hochgingen. Eine länger schon innerlich zerrissene, mit sich selbst hadernde Partei lieferte sich bissige Grabenkämpfe. Das Auszählfiasko verdeckte auch ein bisschen, was da eigentlich Unglaubliches geschehen war. Als sich ein Duell der bisherigen, oft recht glücklosen Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und ihres Dauerrivalen Hans Peter Doskozil abzeichnete, war nicht nur »bitte keiner von den beiden« eine recht weit verbreitete Stimmung in der Partei und der Sympathisantenschar. Eine Gruppe rebellischer, unorthodoxer Parteifunktionäre – nicht nur, aber überwiegend der jüngeren Generation – startete eine Basisbewegung. Nach einigem Hin und Her ging Andi Babler als Kandidat dieser Gruppen ins Rennen. Da die österreichische Sozialdemokratie, wie jede etablierte progressive Partei, auch eine behäbige Funktionärstruppe ist, erschienen die Chancen eines solchen antietablierten Underdog-Kandidaten nicht unbedingt extrem hoch. Gewiss, es war jedem klar, dass es diesmal ein Window of Opportunitygibt, also ein »Fenster des Möglichen«. Aber als Favorit hätte den Underdog wohl kaum jemand gesehen.
Wenige Wochen später war der Außenseiter tatsächlich Parteichef und Anführer der größten Oppositionspartei. Es ist ein veritables Politikmärchen geworden. Der Outsider, der den Apparat aufrollt, der David, der den Goliath bezwingt. Die linke Basiskandidatur, die so stark wird, dass am Ende auch wichtige Teile des führenden Parteiestablishments auf den Neuen einschwenken.
Betrachtet man die Sache aus einer größeren historischen und globalen Perspektive, dann ist dieses Geschehen zwar bemerkenswert, aber nicht völlig einzigartig. In den traditionellen progressiven Parteien gibt es viel Unzufriedenheit mit dem etablierten Führungskader, weil der oft nicht idealistisch genug ist, weil der die politischen Energien der Anhängerschaft frustriert, aber auch, weil er oft nicht auf der Höhe der Zeit ist, nicht modern genug, weil er das Strippenziehertum verteidigt, das seine Macht begründet. Das Lamento über das hergebrachte Politiksystem nährt sich auch durch die Tatsache, dass junge, eigensinnige Köpfe praktisch nie hochkommen. Teile der Wählerschaft würden sich leidenschaftlichere Weltverbesserungsparteien wünschen, bekommen aber nur langweilige, graugesichtige Anzugträger geboten, andere Teile der Wählerschaft würden sich volkstümlichere Politiker wünschen, von denen man spürt, dass sie das Herz am rechten Fleck haben. Oder einfach Leute, die begeistern können. Es ist ein ganzer Strauß an Gründen, nicht immer treffen alle gleichzeitig zu, die eine durchaus verbreitete Unzufriedenheit mit den linken Traditionsparteien begründen. Bei den US-Demokraten haben radikale Basiskandidat:innen wie Alexandria Ocasio-Cortez glänzende Erfolge gefeiert, der großväterliche, idealistische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders ist einer Nominierung als Spitzenkandidat überraschend nahe gekommen, die britische Labour Party wählte den eigensinnigen Hinterbänkler Jeremy Corbyn zum Parteichef, was zeitweise Begeisterung auslöste, am Ende aber nicht so viel brachte. Die italienischen Demokraten hievten 2023 eine Art links-progressive Quereinsteigerin, Elly Schlein, nach schmerzhaften Niederlagen auf die Spitzenposition, und bei der deutschen SPD gewann 2019 ein Links-Duo die Vorsitzwahl, das quer zum etablierten Apparat stand. Letztlich war sogar schon Barack Obama bei den US-Demokraten ein Produkt dieser Stimmungen: 2004 fiel der State-Senator des Staates Illinois erstmals einem größeren Publikum auf, schon vier Jahre später war er US-Präsident. Kurzum, die hergebrachten linken Parteien und politischen Kräfte der früheren Arbeiterbewegung haben ein großes Frustpotenzial in sich und auch genug an aufgestauter Identitätskrise, die in letzter Zeit immer wieder dazu führen, dass rebellische Außenseiter an die Parteispitze gespült werden. Und auch Spitzenpolitiker und -politikerinnen, die eher aus dem etablierten Funktionärskader kommen, versuchen ihre Politik zu adaptieren oder einen anderen Stil anzuwenden, vom charismatischen portugiesischen Premierminister Antonio Costa über Pedro Sanchez in Spanien bis hin zu Olaf Scholz, der sich nach seiner Niederlage im innerparteilichen Wettstreit neu positionierte, Kanzlerkandidat wurde und wider viele Prognosen die Bundestagswahlen gewonnen hat.
Andi Babler ist als Phänomen also eine Art Reaktion auf eine Unzufriedenheit, die es nicht nur in Österreich gibt. Als erst der linke Ökonom und widerborstige Bezirksfunktionär Niki Kowall und danach auch Babler die Kandidatur anmeldeten, geschah etwas völlig Unbekanntes: Es kam regelrechte Aufbruchstimmung auf. Praktisch über Nacht sind zehntausend neue Mitglieder der SPÖ beigetreten. Womöglich ist Babler auch deshalb eine so spannende Figur, weil er Charaktereigenschaften vereint, die heute relativ selten in einem Linkspolitiker kombiniert sind. Er ist links-progressiv, in der Gesellschaftspolitik liberal, hat keine Abgleitflächen in Richtung eines »Links-Nationalismus«, wie das etwa bei Sahra Wagenknecht der Fall ist, in ökonomischen und sozialpolitischen Fragen ist er links, und als Phänotyp ist er ein geerdeter, bodenständiger Bürgermeister einer Kleinstadt mit sehr viel Street Credibility auch im ländlichen Bereich. Er ist so eine Art Menschenfischer, von dem die Leute sagen, »das ist einer von uns«, der einfach von seiner Ausstrahlung wie selbstverständlich als ein warmherziger Fürsprecher der »ganz einfachen, normalen Leute« erscheint. Und dem man zudem anmerkt, dass er sich auf jedem Kirtag und Feuerwehrfest wohlfühlt.
Fünfzig Jahre war er gerade geworden, als er in den Führungswettkampf einstieg. Allgemein ist Babler da schon als »der gute Mensch von Traiskirchen« bekannt. Als linker Juso hat er gegen die konservative Kirche mobil gemacht und für einen Skandal gesorgt, weil er sarkastisch das Verbrennen von Kreuzen empfahl, aber mittlerweile ist es auch schon wieder einige Jahre her, und er wurde sogar vom Papst zu einer Privataudienz empfangen, der sich ausdrücklich bei ihm für die Hilfe bedankte, die er und seine Gemeinde hilfsbedürftigen Flüchtlingen zukommen lassen.
Babler hat den Zuspruch der Parteibasis, die sich nicht mehr gehört gefühlt hat, er ist ein Linker, der sich in Menschenrechtsfragen gegen den rechten Mainstream stellt, aber zugleich kultiviert der frühere Maschinenschlosser und Fabrikarbeiter seine Volksnähe. Darin ist er authentisch, dadurch wird er auch in weiten Teilen der arbeitenden Klassen als authentischer Vertreter wahrgenommen. Auf der Links-Rechts-Achse ist er links, auf der nicht minder wichtigen Oben-Unten-Achse verkörpert er das »Unten« gegen »das Establishment«. Vor sieben Jahren holte er in seiner Neunzehntausend-Seelen-Kommune sagenhafte dreiundsiebzig Prozent der Stimmen, vor zwei Jahren verlor er auch nur unwesentlich auf knapp zweiundsiebzig Prozent.
Die Befürworter Bablers sind kritische Parteimitglieder, die der Maxime folgen, »wir holen uns die Partei Victor Adlers zurück«, aber auch Aktivisten und Funktionäre, denen das Gegeneinander der vormaligen Top-Kandidaten einfach auf die Nerven geht.
Bald nach Bekanntgabe seiner Kandidatur war es eine veritable Woge, die ihn trug: Wo er hinkam, gab es volle Säle. Bei einer Veranstaltung in Wien musste Babler eine Rede sogar zweimal halten, einmal für die Teilnehmer im Versammlungssaal, ein zweites Mal für die Hunderten anderen auf der Straße, die in den Saal nicht hineingepasst haben. Wie ein Wirbelwind fegte er durch das Land, sprach in den meisten Landeshauptstädten, in kleinen Bezirken in der Provinz, in Gemeindebauhöfen in Erdberg, wo sich die Zuhörer drängten.
»Wir müssen Politik wieder von unten denken«, ist eine seiner häufig wiederholten Leitlinien. »Wir werden nicht gewählt, nur weil wir weniger schlimm als die anderen sind«, sagt Andi Babler, und: »Wir dürfen uns als Sozialdemokratie nicht unsere DNA nehmen lassen, wir sind immer auch Protestbewegung gewesen. Wir kommen aus einer Bewegung, die um Rechte gekämpft hat.« Bablers großes Ass ist, dass er als bodenständiger, hemdsärmeliger Typ, der in der Sprache der ganz normalen Leute spricht, glaubwürdig als die Stimme derer auftreten kann, die keine Stimme haben – und damit auch Nichtwähler:innen, und sogar Protestwähler:innen für sich wird gewinnen können. Hinzu kommt seine praktische, erfolgreiche Bilanz als Bürgermeister. Babler ist dauernd auf Achse, er ist ein freundlicher, stets zu Scherzen aufgelegter Kerl, der an den Wochenenden gern in Fußballstadien in der Fankurve sitzt und von dem die Leute sagen: »Der ist ein klasser Bursch.« Und wenn in der legendären Disco U4 mal wieder eine Falco-Nacht auf dem Programm steht, ist er bis zwei Uhr nachts dabei und singt mit, wenn es heißt: »Ganz Wien / Ist so herrlich hin, hin, hin.«
Babler ist in vielen Fragen explizit links, ein kämpferischer politischer Kopf, der nicht gleich seine Meinungen anpasst, aus Angst, diese könnten mit dem herrschenden Zeitgeist nicht kompatibel sein und für den engen Korridor der als »seriös« und »vernünftig« gebrandeten Haltungen als »zu radikal« erscheinen. Das macht ihn natürlich kantig und führt alleine schon dazu, dass über seine Haltungen diskutiert wird und damit die Sozialdemokratie einen Teil an Themenführerschaft übernimmt. Andererseits haben viele die Befürchtung, die Positionierungen Bablers wären »zu links«, um Mehrheiten gewinnen zu können. Er könnte »die Mitte« abschrecken, und als Humanist, der beim in Österreich notorisch dominanten »Ausländerthema« niemals chauvinistische Töne anschlagen wird, werde er auch den rechtsextremen Freiheitlichen keine Wähler abluchsen können, warnen seine Gegner.
Diese Gefahr ist durchaus vorhanden, seine Gegner schießen daher auch vom ersten Tag an aus vollen Rohren, doch es ist durchaus möglich, dass all das viel zu traditionell »superpolitisch« gedacht ist. Nach dem Motto: Manche Leute sind links, manche moderat, die dritten Mitte, dann kommen die Rechten und dann die Ultrarechten. Die Meinungen der Leute seien quasi fix, so diese Deutung, und entsprechend diesen Meinungen wählen sie dann. Ist jemand links, kann er niemanden gewinnen, der nicht links ist. Aber das ist viel zu eindimensional gedacht, wie sich schon sehr häufig in der Geschichte zeigte. So machte Richard Wirthlin, der Chefstratege des früheren Präsidenten Ronald Reagan, 1980 eine Entdeckung, die auf ganz entscheidende Weise die amerikanische Politik veränderte. Als Meinungsforscher hatte er gelernt, dass die Bürger:innen ihre Wahlentscheidung von den politischen Positionen des Kandidaten abhängig machen. Aber die Meinungsumfragen für Ronald Reagan hatten etwas ganz Faszinierendes ergeben: Wähler:innen, die mit Reagan überhaupt nicht politisch übereinstimmten, wollten dennoch für ihn stimmen. Verstört begann Wirthlin diesen überraschenden Fakt zu studieren. Reagan sprach über Werte und weniger über konkrete Sachfragen. Reagan gelang es, ein Band zu den Leuten zu weben. Er hat sie emotional angesprochen. Reagan wirkte auch authentisch – er glaubte ganz offensichtlich das, was er sagte. Und weil er eine Verbindung schuf, empfanden die Leute, dass sie ihm vertrauen konnten – teilweise unabhängig von seinen konkreten Positionen. Heute wird uns dieses Phänomen nicht mehr sonderlich überraschen, es ist schon sehr häufig zu beobachten gewesen. Es ist selten der lange Forderungskatalog, eine Art Einkaufszettel, der Menschen primär zur Wahl einer Partei motiviert.
Andi Babler steht für eine überzeugte, markante, auch idealistische sozialdemokratische Linie. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass gerade die Enttäuschten und Frustrierten genau auf so etwas gewartet haben. Und es geht ja nicht nur um große »Programmatiken«, sondern auch um persönliche Ausstrahlung. Dass jemand nah an den Leuten ist, dass man eine emotionale Verbindung spürt. »Ich bin jemand, der Menschen mag«, sagte er in der Woche seines Amtsantritts in einem TV-Interview. Das war ein kurzer Halbsatz fast am Ende eines langen Gesprächs, aber womöglich ist das ja eine nicht unwichtige Sache. Die ewig gleichen Kommentatoren grübeln darüber, ob irgendwer ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger »links« oder »rechts« sei, und sind blind dafür, dass das vielen Menschen relativ egal ist. Viel wichtiger ist, ob jemand »echt« und glaubwürdig ist als Fürsprecher derer, die sich nicht mehr wahrgenommen fühlen.
Gut möglich also, dass eine SPÖ mit Babler und seinem Kurs auch viele unzufriedene und frustrierte Wähler:innen gewinnen kann, die das Vertrauen in alle Parteien verloren haben, und auch Wählerinnen und Wähler aus den arbeitenden Klassen, die das Gefühl hatten, dass sich sowieso niemand für sie interessiert. Babler spricht von diesen Menschen gerne als »unsere Leute«, was vielleicht einen etwas paternalistischen Beiklang hat und ihm auch Kritik einbrachte, aber eine Verbindung herstellt. Babler ist so einer, von dem die Leute sagen, »das ist noch ein echter Sozi«, und damit ist ja im Allgemeinen nicht sofort eine präzise Programmatik gemeint, sondern eher so etwas wie ein Set an Charakterattributen wie: integer, authentisch, volksnah.
Wenn Babler davon spricht, dass man »Politik von unten« denken müsse, dann ist das zunächst einmal eine eher nebulöse Formel, aber dazu gehört: dass man die Lebenswelten und die Sorgen der ganz normalen Leute einfach einmal wahrnehmen und von diesen ausgehen muss. Dass Babler ein guter Rhetor und auch so etwas wie ein Geschichtenerzähler ist, hilft dabei gewiss. Wenn er über die Leben der Leute spricht, dann entstehen griffige Bilder und keine blutleeren Sätze wie bei so vielen Profipolitikern. Zum Sprachbild der »Politik von unten« zählt aber auch, dass man Parteibasis und Aktivisten mobilisieren, mit ihnen gemeinsam Politik machen muss.
Das Experiment Babler ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, von der man natürlich heute überhaupt nicht weiß, wie sie ausgeht.
Dass es in dem Moment, in dem die Führungskrise der SPÖ eskalierte, zu einer regelrechten Beitrittswelle kam, hat einen ebenso symptomatischen wie leicht erklärbaren Grund: Das Land ist in einer schweren politischen Krise und viele Menschen sind der Meinung, dass es eine funktionsfähige Sozialdemokratie braucht, da Österreich wie auf einer schiefen Ebene einen Überbietungswettbewerb der Rechtsparteien erlebt, bei dem es immer mehr in Richtung Orbanisierung geht. Die rechtsextreme FPÖ unter ihrem Frontmann Herbert Kickl liegt in Umfragen seit Monaten auf dem ersten Platz, ein Bundeskanzler mit autoritären Absichten, ultrareaktionärem Programm und faschistoider Rhetorik ist realistisch vorstellbar. Viele Menschen hatten einfach das Gefühl, dass sie jetzt selbst etwas tun müssten. Auch das war für viele ein Motiv, der SPÖ beizutreten, nicht nur die unorthodoxen Kandidaten.
Yascha Mounk, der polnisch-deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler, schrieb in seinem Buch »Der Zerfall der Demokratie« schon vor einigen Jahren: »Manchmal kriecht die Geschichte jahrzehntelang vor sich hin. Wahlen werden gewonnen und verloren, Gesetze verabschiedet