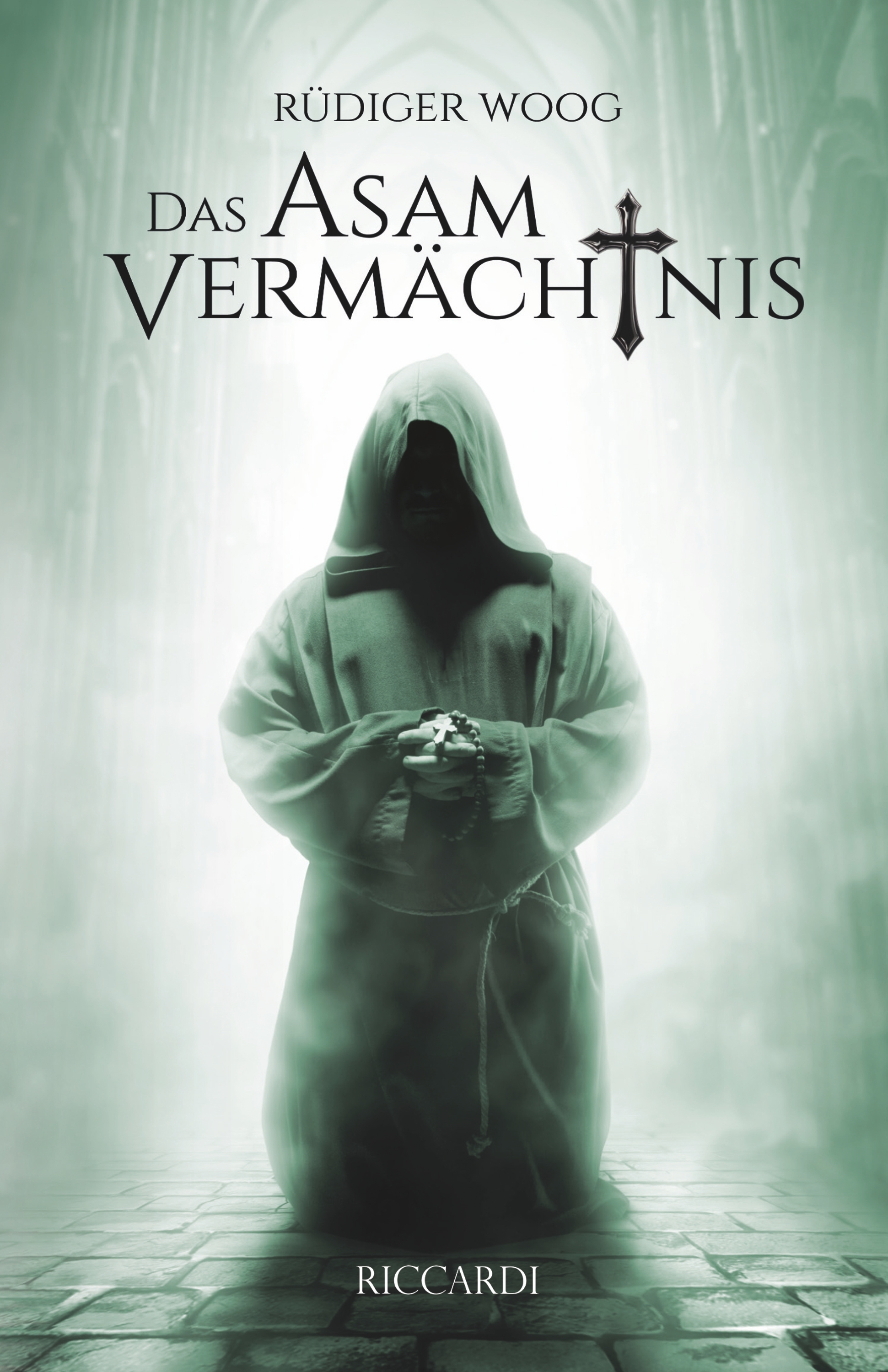Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Spielberg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niederbayern 1919. Miriam lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Dorf in der Hallertau. Am Tag ihrer Erstkommunion lernt sie Anna kennen. Miriam und Anna werden Freunde. Doch wer ist dieses geheimnisvolle Mädchen, das später im Volksmund auch „Schreiner Nanderl“ genannt wird und das von so seltsamen Dingen erzählt? Bevor Miriams Leben nach fast 90 Jahren zu Ende geht, hat sie noch einen letzten Wunsch. Ihre Enkelin Anna, die den gleichen Namen wie ihre Seelenfreundin trägt, soll die Lebensgeschichte ihrer Großmutter niederschreiben und erfährt dabei von dem langgehüteten und düsteren Geheimnis ihrer Familie. In „Anna und der Winter“ finden Mythos und historische Wahrheit zueinander.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
2. Auflage 2025
Originalausgabe: © 2015 »Anna und der Winter«
SPIELBERG VERLAG GmbH
Am Schlosserhügel 4a1, 92318 Neumarkt
Lektorat: Beate Brosig
Coverdesign: © Ria Raven www.riaraven.de
Bildmaterial: © shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
(eBook) ISBN: 978-3-95452-133-3
www.spielberg-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
-10-
Vorwort
-1-
Wenn der letzte Schnee oben am Steinbruchberg unter der kräftigen Märzsonne verdampft und die ersten Sprießlinge auf den noch harten Ackerschollen in derart lebendigem Grün schießen, dass man sie nach einem halben Jahr Kälte, Nässe und Dunkelheit für künstliche Requisiten halten möchte, wenn die von den Aussiedlerhöfen herabkommenden Spaziergänger Schal und Mütze zu Hause gelassen haben und sich das Abendlicht kaleidoskopisch über die leeren Hopfengärten, die roten Dächer der neuen Siedlung und den zerdrückten, ausgebleichten Rasen in meinem Garten legt, dann weiß ich, dass ich es wieder einmal überstanden habe.
Tatsächlich geht es mir wie vielen anderen Menschen in unseren trüben Breitengraden: Ich leide an Winterdepressionen, und jedes Jahr werden sie schwerer zu ertragen. Der schlimmste Monat ist für mich der Februar. Meine körperlichen und geistigen Akkus sind völlig leer, so leer, dass mir die Vorstellung von Frühling, Licht und Heiterkeit schon wie ein schönes Märchen erscheint, das man sich immer wieder erzählt, um sich davon abzulenken, dass die Welt für immer in Eis und Finsternis versunken ist. Und dann kommt sie doch wieder, diese unverhoffte Kraft, eine gewaltige Natursymphonie, deren Dirigent, eine große orange geschnäbelte Amsel, jedes Jahr auf der hohen Blautanne vor meinem Fenster sitzt und die Krokusse, die Schlüsselblumen, Forsythien und Palmkätzchen, die Hasen und Rehböcke und letztlich auch den blauen Himmel in einem brausenden Crescendo ihrer Todesstarre entreißt.
Im Französischen heißt Amsel merle. Ich weiß durchaus, dass die etymologische Verbindung zu Merlin nicht ganz sauber ist, aber mir hat immer die Geschichte des Zauberers gefallen, der durch seine Liebe zur Fee Viviane für alle Zeiten in einen Weißdornbusch verbannt wurde. Dass nun eben dieser kleine gefiederte Magier jedes Frühjahr in meinem Garten die Auferstehung der Natur zelebriert, halte ich für einen hübschen Gedanken, der nur mir alleine gehört.
Aber ich schweife ab. Die Herrlichkeit eines neuen Jahreszyklus mit allem, was er auch bringen mag, wird Miriam verwehrt bleiben. Die Spaziergänge drüben im Forst, das erste kalte Bad im Weiher, Erdbeerpflücken und Marmeladekochen im Juni, das verlängerte Wochenende am Gardasee oder in Salzburg, Ferien auf Rügen, Pilzesammeln, die Hopfenernte mit ihrem köstlichen Duft und der Mindelstettener Markt, Laternenumzüge, Plätzchenbacken und Christbaumstehlen – all dies und noch viele tausend andere gewohnte Dinge wird sie nicht mehr erleben. Die Ärzte geben ihr nur noch wenige Tage. Alles, was ich tun konnte, war, sie in ein Zimmer verlegen zu lassen, von wo aus sie über die Donauauen blicken und von Baum und Feld Abschied nehmen kann.
Miriam hat den ganzen Körper voll von Metastasen, sie ist der großartigste Mensch, den ich in meinen zweiundvierzig Lebensjahren kennen lernen durfte, sie ist achtundneunzig und sie ist meine Großmutter.
Jeder, der Miriam – sie wollte nie, dass ich sie Großmutter oder Omi nannte – zum ersten Mal sah, war sofort in ihren Bann geschlagen. Sie war zeitlebens eine atemberaubend schöne Frau. Die Spuren eines fast biblisch langen Lebens voller Arbeit und Fleiß waren natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ihrer Würde und Schönheit konnten sie aber keinen Abbruch tun. Ich denke, wenn sie Fotomodell geworden wäre, hätte sie in jedem Alter Erfolg gehabt und die Agenturen hätten sich um sie gerissen. Manchmal beobachte ich die Menschen um mich herum – meine Kollegen an der Uni, die Leute im Supermarkt, die Nachtfalter in den Studentenkneipen – und frage mich, wie sie wohl eines Tages aussehen werden, wenn Formlosigkeit und Schlaffheit ihre Körper regieren, die Ohren immer größer werden und ihre Haare nur noch an Stellen wachsen, wo keiner welche haben will. Dann verspüre ich meistens eine gewisse Schadenfreude, weil ich mir einrede, dass Miriams Gene auf mich übergegangen seien. Nun ja, ich bin sicherlich nicht unattraktiv; genau genommen bin ich eigentlich mit meiner äußeren Erscheinung sogar sehr zufrieden. Auch wenn man schon von Weitem sieht, dass mein blondes Haar aus der Tube kommt, ich schon lange keine T-Shirts mehr ohne BH trage und sich die Studenten im Grundstudium immer seltener nach mir umdrehen.
Aber ich spreche schon wieder nur von mir! Miriam färbte ihre Haare nie. Ich kenne sie nur mit langem, kräftigem, silbernem Haar, das sie, ganz im Gegensatz zu ihren Altersgenossinnen, meistens offen trug. Ihre Haut war das ganze Jahr über gebräunt und duftete nach einer Frische, die ich mit nichts vergleichen kann. Auffallend waren auch ihre langen Arme. Zuweilen sagte sie, sie sei in einem früheren Leben sicher ein Affe gewesen. Doch was niemand, den sie nur einmal kurz angesehen hatte, jemals wieder vergessen konnte, waren ihre klaren, cyanblauen Augen. Miriam hatte nie eine Brille getragen, und was das Verblüffende dabei ist, sie brauchte auch keine, nicht einmal mit achtundneunzig! Auf Zureden verschiedener Familienangehöriger und weil man das eben so macht, hatte sie durchaus immer wieder Optiker und Augenärzte aufgesucht, die sie alle gleichermaßen zum Frohlocken wie zum Verzweifeln brachte. Das Sehvermögen meiner Großmutter blieb ein Phänomen, das seinesgleichen suchte.
Mittlerweile hat es zu dämmern begonnen. Ich habe den ganzen Nachmittag an meinem Schreibtisch über Bergen von Briefen und Aufzeichnungen gesessen, ohne ein Wort zu Papier gebracht oder auch nur einen klaren Gedanken gefasst zu haben. Ich fühle mich ebenso konzeptlos und überfordert wie ein Erstsemestler bei seiner ersten wissenschaftlichen Arbeit. Die Bäume verstecken sich nun unter einer dünnen, dunklen Decke. Für heute haben sie genug ihrer eitlen Pracht gezeigt. Und doch kommt es mir so vor, als ob sich draußen, dort hinten, wo die große Blautanne steht, etwas bewegt, zu mir herein ins Büro sieht und auf schwarzen Schwingen würdevoll entschwebt – zumindest für heute.
• • •
Ich liebe die dreiviertelstündige Autofahrt zur Universität. Nein, ich bin keine passionierte Autofahrerin im technischen Sinne. Mein inzwischen fast lackloser Golf mit seinen zweihundertachtzigtausend Kilometern ist auch nicht gerade das, was autophile Herzen höher schlagen ließe. Es ist vielmehr die Zeit des Unterwegsseins, das Ausklinken aus der lokalen Verfügbarkeit mit all ihren Pflichten und die – wenn auch nur sehr theoretische – Möglichkeit, immer weiter zu fahren, vorbei an der Universität, vorbei an unserem Haus, weit weg von der Gewohnheit und allen Erinnerungen. Ich höre selbst gebrannte CDs und tauche mit meinem alten Auto wie in einem Unterseeboot durch die Landschaft.
Das Schönste an meinem Arbeitsplatz ist tatsächlich der Weg dorthin. Größtenteils schlängelt sich die Straße auf dem Rückgrat der Juraalb. Mal öffnet sich der Blick nach Süden, wo bei klarer Luft weit hinter der Hallertau die Zugspitze auszumachen ist, mal taucht man in die nördlichen Wälder ein, deren größte Kronen aus dreiarmigen, mich fortwinkenden Rotoren bestehen. Zuweilen fühle ich mich wie eine Figur auf einem Spielbrett, das eine weitläufige, vielfältige Landschaft vorstellt. Im Osten, am nördlichen Rand der Hallertau, liegt unser 350-Seelen-Dorf, im Westen, im barocken Eichstätt, ist die Uni, irgendwo im Norden, wo genau, weiß ich nicht und will es auch gar nicht wissen, lebt Hubert – ich habe gehört, er hat wieder jemanden gefunden – und im Süden, in Ingolstadt, befindet sich die Palliativstation des städtischen Klinikums mit der sterbenden Miriam.
Ich weiß nicht, wer über diesem Brettspiel sitzt und wie viele Punkte er dafür erhält, wenn ich abends um sieben noch einen Anruf vom Professor bekomme und mich nochmals – ohne über Los zu gehen und ohne zweitausend Euro zu bekommen – nach Eichstätt aufmachen muss. Aber ich weiß, dass jede Spielfigur über die Fähigkeit verfügt, sich während eines Zuges zu befreien und ihrem Spielführer aus der Hand zu rutschen. Ich schaue aus dem Dreck verspritzten Schiebedach, um mich zu vergewissern, dass keine gewaltigen Finger aus dem Nichts auf mein Auto heruntergreifen und es direkt in die Schlossallee setzen wollen, kichere hysterisch vor mich hin und drehe am Rad des CD-Wechslers.
Als ich am Abend im Klinikum ankomme, habe ich einen sonnigen und erfolgreichen Tag hinter mir. Und genau das ärgert mich. Natürlich rollt kein Stein vom anderen, wenn ein Menschenleben zu Ende geht. Aber muss denn dieser Abgang von Bilderbuchfrühlingstagen, an denen einem alles ohne jegliche Anstrengung in den Schoß fällt, verhöhnt werden?
Jeden Tag, wenn ich die Station betrete, versuche ich, in den Gesichtern der Stationsschwestern, die ich mittlerweile alle kenne, zu lesen, ob es so weit ist. Sie sind wie immer sehr geschäftig zugange und demonstrieren ihren Zeitmangel durch kurze, höfliche Blicke, die zu abgeschnitten wirken, als dass sie den Luxus wirklicher Anteilnahme bedeuten könnten.
Leise öffne ich die übergroße Tür. Es ist eigenartig, jedes Mal, wenn ich diese Tür öffne, hoffe ich, dass sie nicht quietscht oder knarrt, und ich mache mir jedes Mal wieder bewusst, dass die Patientenzimmertüren so hoch und breit gebaut sind, damit man ein Krankenbett mit diversen Apparaturen oder andere sperrige Gegenstände hindurch transportieren kann.
Nein, es ist noch nicht so weit. Miriam ist wach. Sie liegt auf der linken Seite und blickt zur Tür. Natürlich hat sie auf mich gewartet. Das tut sie jeden Tag. Auch wenn sie immer wieder betont, dass ich doch nicht täglich kommen müsse, da ich ja so viel Arbeit und so viel zu tun habe. Ich weiß, was sie mit zu tun meint.
»Anna, mein Kind«, sagt Miriam und streckt ihren langen Arm unter dem Laken hervor, die Hand wie ein kleines Papierboot zu einer länglichen Mulde geformt.
»Miriam«, erwidere ich, wobei ich ihre Hand fasse, meine Tasche mit den Tulpen auf den Boden gleiten lasse und mit dem Fuß einen Stuhl ans Bett heranziehe.
Das ist unser Ritual. Wir haben uns nie mit Hallo, grüß dich oder ähnlichem begrüßt. Sie sagt Anna und ich sage Miriam. Das war`s.
»Wie geht es dir heute?«, frage ich und will mir gleich für meine Dummheit auf die Zunge beißen.
Miriam lächelt milde. »Wunderbar, es könnte nicht besser sein.«
»Entschuldige, Miri, das war blöd von mir!«
Sie drückt meine Hand mit unerwarteter Kraft und sagt freudestrahlend
»Nein, wirklich: Es geht mir gut. Stell dir vor: Sie war wieder da. Endlich ist sie wieder da. Jetzt, wo es dem Ende zu geht, spricht sie wieder mit mir.«
Ich versuche, nicht die Augen zu verdrehen, und lasse ein halb geseufztes, halb gelangweiltes Mmh fallen. Miriam versteht sofort und drückt meine Finger noch fester.
»Nicht wahr, du hast es mir nie geglaubt, all die vielen Jahre hindurch hast du immer gemeint, ich spinne oder denke mir das alles nur aus.«
Ich halte ihrem Blick nicht stand.
»Nein, Miri, ich …«
Sie unterbricht mich.
»Ist schon gut, mein Schatz. Ich würde an deiner Stelle vermutlich genauso denken. Aber«,
ein fast kindlich anmutendes Strahlen streift über ihr schönes, altes Gesicht,
»sie war wieder da, heute Nacht, und hat zu mir gesprochen.«
Ich lasse mich darauf ein. »Was hat sie denn gesagt?«
»Sie hat gesagt, dass es nicht schlimm sein wird, dass ich keine Angst haben soll und es noch eine Weile dauern wird, ein gutes Stück länger, als die Ärzte erwarten, bis sie mich holen kann.«
Ich küsse sie auf die Stirn und sage
»Es wird bestimmt noch eine große Weile sein, denn so schnell werde ich dich nicht hergeben.«
Miriam dreht ihren Kopf zu dem Beistellcontainer hinüber, auf dem eine Karaffe mit Leitungswasser steht.
»Sei so lieb, Annaschatz, und gib mir etwas zu trinken. Die Folterknechte hier wollen mir immer nur ihren ekelhaften Kamillentee einflößen.«
Sie kann das Glas nicht mehr selbst halten, deshalb führe ich es an ihre Lippen und sie leert es in wenigen, gierigen Zügen. Dann lässt sie sich zurück ins Kissen fallen und lächelt mich verschwörerisch an.
»Hast du schon angefangen, mein Schatz?«
Ich verziehe den Mund, wie ein Kind, dem die nicht gemachte Hausaufgabe angemahnt wird.
»Ich hab`s versucht, ehrlich!«
»Du schaffst das schon, Anna. Wenn du das als Literaturdozentin nicht hinbekämst, wäre ja alles zu spät!«
»Ach Miriam«, jammere ich, »wenn ich Mediävistik und Sprachwissenschaft lehre, heißt das doch noch lange nicht, dass ich auch eine Biografie schreiben kann.«
Miriam winkt ab. »Papperlapapp! Natürlich kannst du das! Außerdem bist du die Einzige, außer meinem guten George, der ich alles anvertraut habe. Wenn du es nicht aufschreibst, werde ich alles mit ins Grab nehmen. Und da wird`s wohl keinen mehr interessieren!«
Mit einem Mal wird mir bewusst, dass ich das letzte verbleibende Bindeglied zwischen meiner Großmutter und ihrer Nachwelt sein werde. Was ich nicht niederschreiben werde, wird niemals irgendjemand erfahren. Ohne mich werden die Spuren ihres Lebens sich in Nichts auflösen, als hätte sie niemals existiert. Und noch mehr: Wenn ich dieses Buch nicht schreibe, werde ich eines Tages an meine Großmutter zurückdenken und selbst ich werde sie in meiner fragmentarischen Erinnerung all den Abermillionen anderen Verstorbenen gleichgemacht haben, die man nur deswegen positiv in Erinnerung hat, weil es sich so gehört und weil es schlichtweg in der menschlichen Natur liegt, Vergangenes zu glorifizieren.
Eine kleine Panikwelle schiebt sich durch meine Eingeweide, als ich an die vielen Briefe und Notizen auf meinem Schreibtisch denke, trotzdem bemühe ich mich, fest entschlossen zu klingen.
»Ich mache es, Miri, ich schreibe es für dich. Verlass dich drauf!«
• • •
Wer das Klischee über die Einsamkeit der Nacht aufgebracht hat, in der sich das dunkle Schlafzimmer immer enger zusammenzieht und einem die Stille das Trommelfell zu sprengen droht, mag vielleicht poetisch veranlagt gewesen sein, aber er – oder sie – hat mit Sicherheit noch nie wirkliche Einsamkeit empfunden. Die kommt nämlich immer erst mit dem Morgen. Man quält sich aus dem warm geträumten Bett, um einen weiteren Tag in der Welt der Anderen zu bestreiten. Diese Anderen treten stets in Paaren, Gruppen oder in der Menge auf. Wenn ich sie vor meinem geistigen Auge sehe, all die Studenten, Dozenten, Bäcker, Pendler, Schulkinder, Postboten, Tennisspieler, Jehova-Zeugen, Nachbarn und alten Klatschweiber, dann verschwimmen ihre Gesichter zu grauen Einheitslarven ohne Augen und Mund. Verzweifelt wage ich immer wieder, mich unter sie zu mischen, aber anstatt mit der Menge zu verschmelzen, gleichsam im menschlich-sozialen Nirwana aufzugehen, beginnen meine Wangen zu glühen und mit hochrotem Kopf suche ich bei der nächstbesten Gelegenheit das Weite.
Nein, die Nacht ist gnädig. Ich lasse alle Jalousien herunter, knipse verschwenderisch in fast allen Räumen das Licht an, wähle mir im Fernsehen oder im Internet die Menschen aus, mit denen ich gerade zu tun haben will, erledige den Großteil meiner Vorbereitungszeit für das Hauptseminar in Semiotik und die Einführung in die Mediävistik und verdränge für ein paar Stunden, dass sich morgen, übermorgen und überübermorgen die von seelenlosen Zombies bevölkerte Welt weiterdrehen wird, ohne sich einen Dreck um mich zu scheren.
Daher ein Hoch auf die Nacht und den Schlaf:
Süßer Schlaf! Du kommst wie ein reines Glück ungebeten, unerfleht am willigsten. Du lösest die Knoten der strengen Gedanken, vermischest alle Bilder der Freude und des Schmerzes; ungehindert fließt der Kreis innerer Harmonien, und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn versinken wir und hören auf zu sein.
-2-
Das Kleid war traumhaft schön. In ihrem ganzen Leben trug Miriam nie wieder etwas Vergleichbares. Die anderen Kommunionkinder sahen zweifellos auch adrett aus, doch das war eher dem Strahlen und der Freude in ihren braungebrannten Gesichtern als ihrer Aufmachung zuzuschreiben. Die Jungen waren in mehr oder weniger passende Anzüge meist älterer Familienangehöriger gesteckt worden. Bei einigen hingen die Jackettschultern bis auf die Oberarme herab, bei anderen aber waren sie so eng geschnitten, dass die Buben wie steifgefroren aussahen, ihr Hals sich wie eine Sprungfeder zusammengezogen hatte und man meinen mochte, sie suchten mit ihren hochgezogenen Schultern den ganzen Tag nach irgendeiner Erklärung für ihre absurde Erscheinung. Die Hosen hätten in Länge, Weite und Farbe nicht unterschiedlicher sein können. Immerhin trugen zwei Jungen, die Söhne des Bürgermeisters und des Herzogbauern, lange, rabenschwarze Strümpfe und auf Hochglanz gewichste Halbschuhe. Die Mädchen hingegen nahmen sich wie ein ganzer Lebensreigen aus. Da gab es das kleine Mädchen mit Zahnlücken, im kurzärmeligen Sommerkleidchen, die Braut mit langem, weißem Schleier und einem Kranz aus Schleierkraut auf dem kleinen Köpflein, die in kratzigem, beigem Leinenüberwurf schwitzende Bauerstochter und die von Kopf bis Fuß in Schwarz geschnürte Witwe.
Miriam hingegen war das einzige Mädchen mit einem gekauften Kommunionskleid. Es hatte einen Hauch von Flieder, lag eng am Oberkörper an und umspielte in der leichten Andeutung einer Glocke ihre schneeweiß bestrumpften Knie. Als Kopfbedeckung diente eine weiße, netzartige Haube. Die Mutter hatte Miriams fuchsfarbenes Haar zu einem kunstvollen Zopf zusammengebunden und eine weiße Flaumfeder hineingesteckt.
Miriams Herausstechen aus den dörflichen Kindern war ein Privileg, über das sie mit ihren neun Jahren noch nie nachgedacht hatte. Sie kannte das Leben eben nur als Tochter von Franz Raffalt, dem Amtsleiter der Bayerischen Staatsbahn in Ingolstadt.
Vor einem Jahr war die Bayerische Eisenbahngesellschaft in die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft eingegliedert worden, was dem Vater eine weitere von vielen Beförderungen eingebracht hatte. Die Gerüchte, dass Frankreich wegen ausstehender Reparationszahlungen das komplette deutsche Eisenbahnnetz beschlagnahmen wollte, hatten sich zum Glück nicht bewahrheitet.
Franz Raffalt war buchstäblich ein Sonntagskind. Wie Goethe, den er später sehr verehrte, kam er sonntagmittags beim ersten Glockenschlag zur Welt. Auch er war in ein wohlhabendes Elternhaus hineingeboren worden, durfte eine höhere Schule besuchen und schließlich in München studieren. Dort lernte er seine Dorothea, die er aber zeitlebens nur Thea nannte, kennen. Thea war eine begnadete Sängerin und wollte eigentlich, zum großen Entsetzen ihrer Eltern, die Schauspielschule besuchen. Doch bevor sie sich einschreiben konnte, war sie, just am Tag der angedachten Immatrikulation, dem hochgewachsenen Mann mit den kurzen, blonden, seitlich gescheitelten Haaren und dem dichten, wie zwei stachelige Fühler abstehenden Schnauzer über den Weg gelaufen und ihm sofort und gänzlich verfallen. Nur drei Monate nach dem ersten gemeinsamen Schwabinger Tanzabend läuteten schon die Hochzeitsglocken.
Als 1914 die erste große Nacht über dem Europa des zwanzigsten Jahrhunderts hereinbrach, saß der zweiundzwanzigjährige Franz noch mit von Tinte beklecksten Fingerkuppen im Examen und wurde vom Militär zurückgestellt. Schnell fand er eine Anstellung bei der Königlich Bayerischen Staatsbahn, wo er, nicht zuletzt durch den kriegsbedingten Mangel an Mitbewerbern – das war natürlich nicht sein Verschulden – schnell Karriere machte. Seit Oktober 1919 leitete er nun den Schienenverkehr im Herzen von Bayern, was er nicht oft genug betonen konnte. Franz Raffalt war eines von diesen Glückskindern, die auf ihren kurvenlosen Lebenswegen ohne Stolperfallen trotzdem nie verlernt haben, nach links und nach rechts zu sehen. Franz wusste, dass seine glänzende Karriere, die schicke Wohnung in der Münchener Straße und das stattliche Landhaus bei Mindelstetten in diesen bewegten Zeiten schneller dahinsein konnten, als man fähig war, einen Koffer zu packen. Daher war es seine ganz persönliche Art, sich bei der Welt für ein gutes Leben zu bedanken, indem er versuchte, seiner Umgebung unvoreingenommen, ohne Dünkel und immer mit großem Verständnis für alles und jeden zu begegnen.
Nur gestern Abend, ausgerechnet am Vorabend ihres großen Festes, hatte Miriam durch die Wand Gesprächsfetzen ihrer Eltern aufgefangen, in denen sich der Vater ungewohnt beunruhigt anhörte. Er sprach etwas von einem Zeppelin über dem transatlantischen Himmel, dem noch viele folgen und die eines Tages den weltweiten Schiffsverkehr und schon bald das gesamte europäische Eisenbahnnetz ersetzen würden. Aber noch mehr Sorgen machte er sich über diesen verrückten Österreicher, der imstande sei, die halbe Welt anzuzünden. Sogar die Mutter, die sonst immer beschwichtigend und aufmunternd sprach, schien diese Angst zu teilen.
»Den hätten sie für immer wegsperren sollen oder, noch besser, ihm irgendeine Stelle als Maler verschaffen, dann wäre er vielleicht nie in die Politik gegangen«, rief sie.
Miriam bekam große Angst und fragte sich, ob es sich bei dem verrückten Österreicher womöglich um einen mächtigen Zauberer handle. Schließlich saß die Mutter derzeit immer mit dem dicken, grauen Buch, auf dem in weißen, schwungvollen Lettern »Der Zauberberg« stand, im Garten und war stundenlang nicht ansprechbar. Bestimmt hatte sie von dem Magier gelesen, der die halbe Welt in Schutt und Asche legen konnte, und fürchtete sich nun vor ihm.
Dass der Vater im späteren Verlauf des Gesprächs noch sein Vorhaben preisgab, beim Münchner Ableger der Vox-Schallplatten- und Sprechmaschinen-AG ein Rundfunkempfangsgerät anzuschaffen, mit dem die ganze Familie die Funk-Welle Berlin verfolgen konnte, war einem schnellen Einschlafen auch nicht gerade zuträglich.
An diesem herrlichen Frühsommermorgen aber dachte niemand mehr an Zeppeline und Zauberer. Miriam war schon als Erste aufgestanden, hatte alleine das fliederfarbene Kleid angezogen und spielte im Garten mit Justus, ihrem Pudel, der in seinem scheckigen Fell so aussah, als hätte man ein Altmühltaler Lamm zu heiß gewaschen. Die weißen Schuhe mit den für ein zehnjähriges Mädchen auffallend hohen Absätzen und den glänzenden Verschlussriemen hatte sie im Haus gelassen, da das Gras noch nass vom Tau war. Als Zweite kam Miriams Mutter aus dem Haus. Sie hatte schon ihr violettes, sehr kurzes Kleid angezogen. Franz nannte es einen Unterrock, aber es war todschick und betonte Theas makellose Beine. Sie hatte ihre kurzen, schwarzen Haare noch nicht mit Pomade in die gewohnt burschikose Form gebracht, so dass sie sich wie der Struwwelpeter in Frauenkleidern vorkam. Thea war der Urtyp eines Morgenmuffels. Deswegen winkte sie Miriam nur mit einer Geste herein zum Frühstück.
Eine Stunde später machte sich die kleine Familie samt Pudel Justus in dem königsblauen Wanderer W6, den der Vater letztes Jahr auf der Automobilmesse in Berlin erstanden hatte, auf zur Kirche, vor der schon einige Familien mit ihren Kommunionkindern versammelt waren.
Die Kinder bestaunten Miriam und die Frauen bedachten Thea Raffalt mit missgünstigen Blicken, während ihre Männer versuchten, sich nicht dabei ertappen zu lassen, wie sie ihre Blicke zwischen dem blauen Automobil und den violett umhüllten Kurven im wahrsten Sinne des Wortes hin und her wandern ließen.
• • •
Es ist drei Uhr morgens und es geht einfach nicht, so sehr ich mich auch bemühe. Die Bilder verweigern sich, die Fragmente wollen sich nicht zusammenfügen lassen. Ich klappe genervt den Laptop zu und schleppe mich mit vor Müdigkeit brennenden Augen in die Küche, um mir eine Flasche Mineralwasser zu holen. Neben der Küchentür hängt das hölzerne Apothekerkästchen. Es glänzt verführerisch und will mir das hellblaue Päckchen mit den kleinen, elliptischen Tabletten feilbieten. Aber ich halte stand – nicht zuletzt aus der Befürchtung heraus, mein in fünf Stunden beginnendes Hauptseminar zu verschlafen. Die glatten, weißen Pillen versprechen fünf bis sechs Stunden tiefen Schlaf und manchmal werden es sogar mehr. Ich habe sie seit damals, als das mit Timmy passierte. Sie wirken immer, schalten den Geist einfach ab: Standby, stumpf, zuverlässig und anhaltend. Manchmal schenken sie mir sogar schöne Träume.
Ob Miriam wohl gerade schläft? Oder liegt sie wach und schaut auf denselben runden Schlafräuber am Himmel und fragt sich, wie oft er ihr noch ihre ersehnte Ruhe vorenthalten wird? Ich möchte sie sehen, jetzt gleich. Für einen oder zwei Momente bin ich drauf und dran, mich anzuziehen und zu ihr zu fahren, aber auch das geht nicht. Ich müsste mich durch die Notaufnahme in die Klinik schleichen und würde, wenn ich überhaupt so weit käme, von der Nachtschwester hochkant rausgeschmissen werden.
Mittlerweile ist es zwanzig vor vier. Jetzt bin ich bereit, alle Lichter im Haus zu löschen. Mit hinter dem Kopf verschränkten Armen liege ich auf der Bettdecke und durchforsche die schwarze Luft in meinem Schlafzimmer nach schon helleren Partikeln. Und da ist er wieder, mein kleiner, schwarzer Dirigent. Durch das gekippte Fenster schickt er mir als ersten Morgengruß Millionen helle, mit einem Stich ins Fliederfarbene durchsetzte Pixel, die sich zu einem zauberhaften, nach Maitau duftenden Kleid zusammensetzen, das sich über meine Augen legt und sie für knappe drei Stunden schließt.
• • •
Alle Kommunionkinder zogen sofort nach der Kirche ihre Schuhe aus. Auch Miriam warf ihre hinter den Fahrersitz des W6, um mit den anderen besser Räuber und Schandi oder anderes spielen zu können. Die Jungen hatten allesamt ihre schweren Festtagsjacken abgelegt und überließen sie ihren sorgsamen Müttern, die ausnahmsweise mit ihren Männern bei Kaffee, Dunkelbier und Kuchen im Hof des Wirts saßen. Nur die Mädchen behielten ihre Kränzlein aus Schleierkraut auf dem Kopf und tanzten barfuß über die Wiese hinter der Kirche wie Botticellis Chariten.
Es wurde Königsfrei gespielt und Miriam musste auszählen. Sie stand an der kühlen, kalkgetünchten Mauer der kleinen, seit zehn Jahren den Kriegsopfern gewidmeten Gnadenkapelle und hielt mit aufrichtiger Ernsthaftigkeit die Augen geschlossen. Von ihren Spielkameraden vernahm sie keinen Laut mehr, und doch spürte sie, dass sie jemand beobachtete. Miriam öffnete die Augen und drehte sich um.
Hinter ihr, nur durch die staubige Straße von ihr getrennt, stand eine von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete Frau. Ihre Haare wurden gänzlich von einem schwarzen Tuch verdeckt, so dass Miriam nicht erkennen konnte, ob sie schwarz, blond, rot oder grau sein mochten. Die wie gotische Spitzbogen hochgezogenen, dunklen Brauen mit den darunter liegenden, dunkelbraunen Augen verrieten einen wachen Verstand, die eingefallenen Wangen und die wegen der ausgefallenen Vorderzähne schlaffe, faltige Mundpartie ließen auf ein greises Alter schließen.
Durch das lange Zukneifen war Miriam ein wenig schummrig vor Augen – vielleicht war auch der Maihimmel von plötzlich heraufgezogenen Gewitterwolken verhangen. In jedem Fall glaubte sie zunächst, ihr Blick hätte sie getäuscht, denn ihr war ganz eindeutig so, als hätte die alte Frau sie zu sich herübergewinkt. Da, tatsächlich: Die schwarze Greisin stand vor dem Tor eines von der Straße etwas zurückgesetzten, unscheinbaren Hofs und ruderte mit ihren dünnen Armen in der Luft. Für einen Moment sah es so aus, als zöge sie damit den Wind und die pfenniggroßen Regentropfen herbei. Trotzdem ging Miriam ohne Furcht zu ihr hinüber, ihre Freunde auf der Wiese hinter sich vergaß sie, die Tropfen auf ihren nackten Füßen und vor sich den hoch spritzenden Dreck bemerkte sie nicht. Als sie bei der Alten, die sich mittlerweile unter das überhängende Schieferdach einer Scheune zurückgezogen hatte, ankam, brachen die Wolken mit Macht auseinander und ergossen sich über Hof, Straße, Kapelle, Wiese, über der Kirche und dem W6, über dem Wirtshaus und dem Wirtsgarten.
»Du bist die Miriam, nicht wahr?«, erkundigte sich die alte Frau, wobei dies mehr nach einer Feststellung denn nach einer Frage klang. Da Miriam nicht sofort antwortete, sprach die Frau weiter
»Du kannst mich Theres nennen, wenn du möchtest.«
Miriam nickte wortlos. Irgendwie machte ihr die Nase der Frau Angst. Sie stand trotz ihrer Kürze so absurd nach oben und war von so dünner Haut überzogen, dass sie Theres Gesicht den Anschein eines Totenschädels verlieh. Aber die Stimme der alten Frau klang trotz ihrer gebrechlichen Gestalt angenehm volltönend und irgendwie gütig.
»Komm«, sagte Theres, »sie wartet schon auf dich.«
»Auf mich?«, fragte Miriam verdutzt. »Wer soll auf mich warten?«
»Anna.«
Miriam kannte keine Anna – außer ihrer Münchner Großmutter, an die sie jedoch hier und jetzt, unter dem prasselnden Regen, neben dieser sonderbaren Gestalt nicht dachte.
»Weißt du, Miriam, du erinnerst mich sehr an sie, als sie in deinem Alter und noch wie … wie alle anderen Mädchen war.«