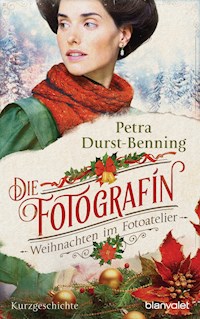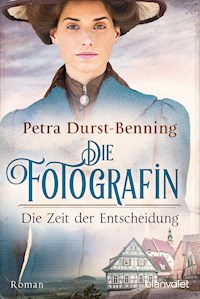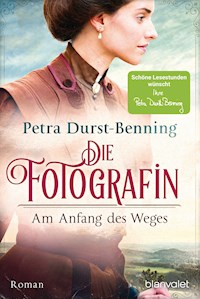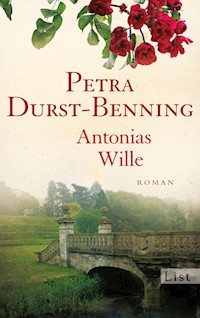
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
In der wildromantischen Landschaft des südlichen Schwarzwalds erfüllt sich auf dramatische Weise das Schicksal zweier ungewöhnlicher Frauen. Die junge Julie erhält von einer entfernten Verwandten einen wunderschönen alten Berghof geschenkt. Doch es gibt eine Bedingung: Julie soll herausfinden, warum das Haus - einstmals das einzige Hotel weit und breit - seinen Zauber verlor und in einen Dornröschenschlaf fiel. Julie, die sich auf den ersten Blick in den Berghof verliebt hat, beginnt in alten Tagebüchern zu stöbern und taucht ein in eine Welt aus Leidenschaft, Eifersucht und tödlicher Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Der Traum von der »reichen Erbtante aus Amerika« – für die junge Julie Rilling scheint er wahr zu werden. Antonia Fahrner, eine entfernte Verwandte, die viele Jahre in Japan verbracht hat, will ihr einen alten Berghof im südlichen Schwarzwald überschreiben. Seit mehr als einem Dreivierteljahrhundert liegt er nun einsam und verlassen da und war doch einst, im Jahr 1903, das erste Hotel weit und breit, eröffnet von einer außergewöhnlichen Frau namens Rosanna Moritz. Für Julie ist es Liebe auf den ersten Blick, sie träumt davon, das ehemalige »Hotel Kuckucksnest« als Kreativhotel zu neuem Leben zu erwecken. Doch Antonia knüpft an ihr Geschenk eine Bedingung: Julie soll anhand von Rosannas Tagebüchern herausfinden, was den einstigen Erfolg des Hauses ausgemacht hatte, worin seine magische Anziehungskraft bestand, die es auf die Gäste ausgeübt hatte. Was als Mittel zum Zweck beginnt, gewinnt mehr und mehr an Eigendynamik. Am Ende erfüllt sich das Schicksal der beiden ungewöhnlichen Frauen auf dramatische Weise …
Die Autorin
Petra Durst-Benning, 1965 in Baden-Württemberg geboren, ist Autorin, Übersetzerin und Dolmetscherin. Sie lebt südlich von Stuttgart auf dem Land. Die Gesamtauflage ihrer Bücher liegt inzwischen bei zwei Millionen. Mehr über Petra Durst-Benning und ihre Romane erfahren Sie unter www.durst-benning.de oder auf ihrem Fanforum unter www.durst-benning-fanforum.de
Von Petra Durst-Benning sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Glasbläserin
Die Amerikanerin
Das gläserne Paradies
Die Liebe des Kartographen
Die Salzbaronin
Die Samenhändlerin
Die Silberdistel
Die Zuckerbäckerin
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Ungekürzte Ausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage März 2005
6. Auflage 2008
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005
© 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München/Ullstein Verlag
Umschlaggestaltung: HildenDesign, München
(nach einer Vorlage von Hauptmann & Kompanie Werbeagentur,
München – Zürich, Doris Hünteler)
Titelabbildung: © International Center of Photography, David Seidner Archive
Satz: hanseatenSatz-bremen, Bremen
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
eBook ISBN 978-3-8437-0409-0
»Auch in Büchern lege ich Wert auf einen begrenzten Handlungsort. Nichts ist so ermüdend, als auf den Rädern eines Heldengespanns durch halb Europa gewirbelt zu werden, in Wien einzuschlafen, um dann in Madrid wieder aufzuwachen, so etwas macht den Geist wirklich matt und müde. Andererseits ist nichts so vergnüglich, als ein ländliches Dorf aufzusuchen und über die Zeit des Verweilens mit jedem Winkel darin, mit jeder Person, die dort lebt, vertraut zu werden …«
Mary Russell Mitford
In diesem Sinne wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Spaß in Rombach, dem kleinen Schwarzwalddorf, das überall dort liegen kann, wo Sie es sich wünschen …
Petra Durst-Benning, Sommer 2003
»Und du erbst das Grün
vergangner Gärten und das stille Blau
zerfallner Himmel.
Tau aus tausend Tagen,
die vielen Sommer, die die Sonnen sagen,
und lauter Frühlinge mit Glanz und Klagen
wie viele Briefe einer jungen Frau.
Du erbst die Herbste, die wie Prunkgewänder
in der Erinnerung von Dichtern liegen,
und alle Winter, wie verwaiste Länder,
scheinen sich leise an dich anzuschmiegen.«
Rainer Maria Rilke
Freiburg, im Herbst 2000
»Und Sie sind sicher, dass Ihnen unsere Verabredung wirklich gelegen kommt?« Yvonne Herrenberg, die Redakteurin der Frauenzeitschrift Unsere Welt, machte keine Anstalten mehr, ihre Verärgerung zu verbergen.
Julie lachte verkrampft. »Aber natürlich! Es ist nur … ausgerechnet heute scheint hier alles drunter und drüber zu gehen …« Hilflos zuckte sie mit den Schultern. Hätte sie der Frau sagen sollen, dass dies das alltägliche Chaos bei »Soul Fantasies« war?
Yvonne Herrenberg verzog ungnädig den Mund. »Vielleicht sollten wir trotzdem mit unserem Rundgang beginnen.« Ein strenger Blick auf ihre Designeruhr folgte.
Julie nickte heftig. »Kein Problem. Geben Sie mir noch einen Moment, dann bin ich bei Ihnen.« Ein Lächeln – und sie verschwand durch die Bürotür.
Konsterniert schaute die Redakteurin ihr nach. War das die typische Arroganz einer Frau, die glaubte, sich aufgrund ihrer Attraktivität alles erlauben zu können? Oder war Julie Rilling schlicht und einfach völlig unorganisiert?
Zwei Mal hatte Yvonne Herrenberg nun schon ihren Stift gezückt, um die Leiterin der progressivsten Kunstschule Süddeutschlands zu interviewen. Beide Male war sie mitten in ihrer ersten Frage unterbrochen worden: Zuerst war eine glatzköpfige junge Frau in den Raum gestürmt und hatte gerufen: »Räucherstäbchen! Wo sind meine Räucherstäbchen? Wie soll ich Siddharta ohne die entsprechende Atmosphäre rezitieren?« Julie Rilling hatte sämtliche Schubladen einer Kommode durchwühlt, bis sie schließlich in der letzten fündig geworden war. Die Glatzköpfige war gerade glückselig davongerauscht, als ein Jugendlicher mit grotesken Tätowierungen hereinpolterte und Julie am Arm aus dem Raum zerrte. »Spikey-Mike … er ist gestürzt!« – mehr hatte Yvonne nicht verstanden.
Sie seufzte. Was man nicht alles für seine Leser auf sich nahm!
»Verflixt noch mal, Theo, kannst du bitte dafür sorgen, dass ich in der nächsten Stunde meine Ruhe habe? Was soll denn die Zeitungstante für einen Eindruck von unserem Laden bekommen, wenn mir alle fünf Minuten ein anderes Baby heulend am Rockzipfel hängt!«, zischte Julie ihrer Geschäftspartnerin zu, die mit einer Zigarette in der einen und dem Telefonhörer in der anderen Hand am Schreibtisch saß.
»Da ist ein Privatdetektiv in der Leitung«, wisperte Theodora Herbst. Die Telefonschnur hatte sich in ihren langen roten Haaren verheddert. Während sie sprach, versuchte sie sie zu befreien. »Ein Herr Bogner. Er sagt, er hätte Anfang der Woche schon einmal angerufen.«
»Ein Detektiv?« Julie stutzte. »Ich habe jetzt keine Zeit. Er soll dir sagen, was er will.« Bevor Theo etwas erwidern konnte, war sie auch schon wieder draußen und lächelte die Redakteurin von Unsere Welt an. Mit einer Handbewegung wies sie den Gang hinunter. »Los geht’s!«
»Sind das alles Kunstwerke Ihrer Schüler?« Yvonne Herrenberg zeigte auf die lange Reihe von Bildern links und rechts von ihnen.
»Ja, wir nennen das hier unsere Galerie«, erwiderte Julie. »Wir haben versucht, das fehlende Tageslicht durch geschickte Beleuchtung wettzumachen, trotzdem bleibt es ein schlauchartiger Gang, mehr nicht. Doch so bekommen unsere Künstler immerhin schon ihre erste Ausstellungserfahrung.«
»Sehr gelungen!« Yvonne Herrenberg war vor einem Aquarell stehen geblieben, das einen Seerosenteich vor einer asiatisch anmutenden Gartenkulisse zeigte. »So etwas hätte ich hier gar nicht vermutet. Ich dachte, bei Ihnen gehen vor allem die Jungen Wilden in die Schule«, sagte sie mit einem leicht ironischen Unterton.
»Nein, hier arbeiten ganz verschiedene Künstlerinnen und Künstler, sowohl was das Alter und das Geschlecht als auch das Kunstverständnis angeht«, versetzte Julie lachend. »Und genau das haben wir uns von Anfang an vorgenommen: Jeder Art von Kunst einen Raum zu geben, wo sie blühen und sich entfalten kann. Hier ist zum Beispiel unsere Oase der Ruhe.«
Sie öffnete die Tür zu einem Raum, der in hellen Farben gestrichen war. Wedel von riesigen Farnen wiegten sich sanft vor halb geöffneten Fenstern, das Sonnenlicht wurde durch hauchdünne Organzavorhänge gefiltert, und aus einem CD-Player ertönte leises Vogelgezwitscher und das Plätschern eines Baches. Zarter Blütenduft lag in der Luft. Außer fünf Staffeleien, von denen im Augenblick drei besetzt waren, befand sich kein weiteres Möbelstück in dem Raum.
»Wir versuchen, alle Sinne unserer Schüler anzusprechen.«
Yvonne Herrenberg schien beeindruckt.
»Ich kann mir gut vorstellen, dass eine solche Atmosphäre inspirierend wirkt«, flüsterte sie fast ehrfurchtsvoll.
Julie lächelte. »Jeder Mensch findet seine Inspiration in anderen Dingen, wie Sie gleich sehen werden …« Sie ging ein Stück weiter und öffnete die nächste Tür. Laute Rockmusik scholl ihnen entgegen, und die Luft war grau von Zigarettenrauch.
»Punk and Power – hierher kommen vor allem die Kids«, schrie Julie gegen den Lärm an. Amüsiert nahm sie die Wirkung zur Kenntnis, die die Graffiti-besprühten Wände, der schwarze Boden und die Schar rumorender Jugendlicher auf die Redakteurin von Unsere Welt hatte: Schock und völliges Unverständnis darüber, dass ein Mensch in einer solchen Umgebung nach dem Pinsel greifen konnte, statt einfach nur die Flucht zu ergreifen, machten sich in ihrem Gesicht breit.
Über den Lärm hinweg winkte Julie dem Grafik-Designer zu, der den Kurs leitete.
»Nun ja, solange die Jugendlichen hier sind, hinterlassen sie wenigstens ihre Graffiti nicht auf Bürogebäuden.« Yvonne Herrenberg, die sich hektisch Notizen gemacht hatte, ließ Block und Stift abrupt sinken und fragte: »Angesichts Ihrer ungewöhnlichen und anscheinend auch sehr erfolgreichen Philosophie ist ein ausgefallener Name für Ihre Kunstschule sicher angebracht. Aber warum gerade ›Soul Fantasies‹? Ich meine, besteht da nicht die Gefahr, dass es in der Öffentlichkeit zu falschen … Assoziationen kommt?«
»Dass uns jemand für einen ganz besonderen Club hält, passiert hin und wieder mal, vor allem, wenn sich Theo mit ihrer rauchigen Stimme am Telefon meldet.« Julie verzog den Mund. »Aber als wir vor zwei Jahren nach einem Namen für unser Unternehmen suchten, wollten wir nichts Steriles wie zum Beispiel Freie Kunstschule Freiburg. Es sollte ein Name sein, der unser Kunstverständnis widerspiegelt. Einer, der nach Freiheit und Farben klingt, nach ›Alles ist erlaubt‹ und nach ›Öffnet eure Seelen und lasst die Sonne herein!‹.« Sie grinste. »›Soul Fantasies‹ eben.«
Danach schauten sie noch kurz in einen Raum, in dem gerade ein Hermann-Hesse-Workshop stattfand. Sofort legte sich ein schwerer Patschuli-Geruch wie eine dicke Wolldecke über sie. Während Yvonne Herrenberg eine ältere Dame befragte, die gerade mit einer Bleistiftzeichnung beschäftigt war, blieb Julie in der Tür stehen.
Hoffentlich zog sich das Interview nicht mehr allzu lange hin! Sie wollte heute unbedingt noch einmal den Besitzer der Schmiedewerkstatt aufsuchen, die direkt an ihre Kunstschule angrenzte, um noch einen letzten Versuch zu unternehmen. Ein bisschen mehr Platz – war das zu viel verlangt? Scheinbar ja, denn bisher weigerte sich der alte Mann standhaft, ihnen die alte Schmiede zu vermieten, obwohl er die Räumlichkeiten selbst kaum noch nutzte.
Julie musste sich ein Schmunzeln verkneifen, als sie sah, wie Yvonne Herrenberg sich gerade von Gerald, dem Dozenten des Kurses, die Hand führen ließ und weiche Linien auf einen Bogen Papier malte. Es schadete doch nie, wenn ein Dozent nicht nur gut war, sondern auch noch gut aussah!
Seltsam, wie sich die Medien plötzlich um sie rissen.
Angefangen hatte es vor zwei Monaten mit einem kleinen Bericht in der Kreiszeitung. Inzwischen hatten fünf verschiedene Zeitschriften Reportagen über sie gebracht, woraufhin sie von Interessenten fast überrannt worden waren. Und nun noch dieser Beitrag für Unsere Welt … Natürlich freuten sie sich über das Medieninteresse, wo doch bisher kaum ein Hahn nach ihnen gekräht hatte. »Wer weiß, wie lange das anhält«, hatte Theo noch am Morgen geunkt.
Mit der Skizze in der Hand kam Yvonne Herrenberg auf Julie zu. »Ich habe Talent, hat er gesagt!« Es klang verwundert.
Theo hatte Recht! Solange sie die Publicity bekamen, sollten sie das Beste daraus machen. Julie setzte ihr gewinnendstes Lächeln auf.
»Nachdem Sie nun unsere Räumlichkeiten gesehen haben – darf ich Sie zu einer Tasse Cappuccino in unsere Bar ›Fresco‹ einladen? Dort kann ich Ihnen in aller Ruhe weitere Fragen beantworten.« Den alten Griesgram von nebenan konnte sie auch noch morgen aufsuchen!
Der Nachmittag verlief genauso chaotisch, wie der Tag begonnen hatte: Der Kurs Aktzeichnen drohte auszufallen, weil das Modell nicht erschien, und Julie telefonierte eine halbe Stunde herum, um Ersatz aufzutreiben. Theo hatte einen Zahnarzttermin, sodass sich Julie außerdem noch um das Telefon kümmern musste. Anfragen aller Art, An- und Ummeldungen, Mütter, die wissen wollten, wann sie mit der Rückkehr ihrer Kids rechnen konnten – gegen Abend war Julies Mund vor lauter Reden dermaßen ausgetrocknet, dass ihre Zunge fast am Gaumen kleben blieb. Sie beschloss, bis zur Schließung der Schule um 21 Uhr den Anrufbeantworter einzuschalten, und wollte gerade in die Cafeteria gehen, um sich eine Diät-Cola zu holen, als sie im Türrahmen mit einem Mann zusammenprallte.
»Entschuldigen Sie«, sagten beide gleichzeitig und mussten lachen.
Was für ein gut aussehender Mann!, schoss es ihr durch den Kopf, während sie einen Schritt zurücktrat.
»Kann ich Ihnen weiterhelfen? In welchem Kurs sind Sie denn angemeldet?« Sie hatte ihn noch nie hier gesehen, was aber nichts bedeutete – sie kannte längst nicht mehr jeden Kursteilnehmer persönlich.
»In gar keinem. Ich möchte zu Ihnen. Mein Name ist Jan Bogner.«
Den Namen hatte Julie an diesem Tag schon einmal gehört, doch sie wusste nicht mehr, wann und in welchem Zusammenhang.
»Und wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich bin Privatdetektiv. Ich versuche schon seit letzter Woche, Sie telefonisch zu erreichen, was mir leider nicht gelungen ist. Wenn Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit für mich hätten …«
Während Julie an ihrer Cola nippte, klärte der Mann sie in kurzen Worten über den Grund seines Besuches auf: Er war von einer Anwaltskanzlei in Rombach, einem kleinen Ort im Schwarzwald, ungefähr fünfzig Kilometer südöstlich von Freiburg, engagiert worden, um Julie ausfindig zu machen. Dies geschah auf Wunsch einer Mandantin der Kanzlei, einer achtzigjährigen Dame namens Antonia Fahrner, die in einem Zeitungsbericht über Julie Rilling gelesen und in ihr eine Verwandte erkannt hatte.
»Frau Fahrner ist eine Kusine Ihres Vaters – ihr Vater war Helmut Fahrner, der neunzehn Jahre ältere Bruder Ihres Großvaters Gustav.«
Julie runzelte die Stirn. »Kann sein, dass mein Vater mal etwas von einem Onkel namens Helmut erzählt hat, aber ehrlich gesagt habe ich mich nie für die alten Geschichten interessiert. Und meinen Großvater habe ich nie kennen gelernt. Er starb schon Jahre vor meiner Geburt.«
Bogner nickte, als sage sie ihm damit nichts Neues. »Ihr Großvater hatte übrigens noch zwei weitere Geschwister: Martin und Roswitha. Beide wurden bald nach Helmut geboren, nur Gustav, Ihr Großvater, scheint ein Nachkömmling gewesen zu sein. Als er zur Welt kam, waren seine Geschwister schon aus dem Haus. Und als sein eigener Sohn – also Ihr Vater – geboren wurde, waren Helmut und die beiden anderen schon alte Leute. Von daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass Sie noch nie etwas von Antonia Fahrner gehört haben. Sie lebte zudem viele Jahrzehnte in Japan, wo sie als Lehrerin tätig war. Nach Auskunft des Anwalts, der mich beauftragt hat, ist sie erst vor zwei Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen. Noch ein Grund dafür, dass keine verwandtschaftlichen Kontakte existieren. Wie dem auch sei: Es ist Antonia Fahrners größter Wunsch, Sie kennen zu lernen!«, schloss der Detektiv seinen Bericht. »Aus diesem Grund bat sie die Anwaltskanzlei, den Kontakt mit Ihnen herzustellen. Was ich hiermit tue.« Er nestelte einen zusammengefalteten Zettel aus seiner Hemdentasche. »Antonia Fahrner lädt Sie herzlich nach Rombach ein. Hier ist ihre Adresse und Telefonnummer. Sie würde sich sehr freuen, wenn Sie sich so bald wie möglich melden würden, damit …«
»Mich kennen lernen? Aber warum?«, unterbrach Julie ihn. »Wenn diese Antonia die Kusine meines Vaters ist, warum will sie dann nicht ihn kennen lernen?« Sie spürte, wie sich in ihrem Kopf ein aufdringliches Summen bemerkbar machte – der Vorbote einer Migräneattacke. Bevor der Privatdetektiv antworten konnte, fuhr sie fort: »Und noch etwas: Woher kennt sie eigentlich meinen Mädchennamen? Ich kann mich nicht erinnern, dass in einem der Berichte über die Kunstschule der Name Fahrner gefallen ist.«
Julie hatte nach ihrer Scheidung vor einem Jahr zwar kurz mit dem Gedanken gespielt, ihren alten Namen wieder anzunehmen, war dann aber doch bei Rilling geblieben. Während sie jetzt in ihrer Handtasche nach einer Kopfschmerztablette kramte, fiel es ihr plötzlich ein. Der Reporter der Schwarzwälder Rundschau hatte sie gefragt, ob es in ihrer Familie noch weitere kreative Menschen gab, woraufhin sie ihm erzählt hatte, dass sie aus einer alten Furtwangener Uhrmacherfamilie stammte. Und dass ihr älterer Bruder heute die Fahrnersche Uhrmacherwerkstatt betrieb …
Tatsächlich war es dieser Zeitungsbericht gewesen, der Antonia Fahrners Interesse geweckt hatte, bestätigte Jan Bogner. Er zog ein Päckchen Zigaretten aus seiner Hemdentasche und fragte, ob er rauchen dürfe.
Julie nickte ungeduldig. Kopfweh hatte sie ohnehin schon – was machte da noch ein bisschen Zigarettenqualm aus?
Zwischen zwei Zigarettenzügen fuhr Bogner fort: »Dass sich unbekannte Verwandte oder als verschollen geltende Familienmitglieder eines Tages bei ihren Angehörigen melden, ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich selbst habe schon dutzende solcher Fälle bearbeitet. Oftmals sind es die so genannten ›schwarzen Schafe‹, die nach einem Bruch mit der Familie in die Welt gezogen sind und im Alter plötzlich entdecken, dass Blut doch dicker ist als Wasser. Hin und wieder ist es sogar der sprichwörtliche reiche Onkel in Amerika, der seinen deutschen Wurzeln nachspüren möchte – was für die betreffenden Personen durchaus angenehme Folgen haben kann«, fügte er grinsend hinzu.
»Blut ist dicker als Wasser – so ein Blödsinn! Wenn man die so genannten Verwandten noch nie im Leben gesehen hat …« Unwirsch strich Julie ihre dunkelbraunen Haare nach hinten.
Der Privatdetektiv musterte sie interessiert. »Ehrlich gesagt wundert mich Ihr Mangel an Neugier. Reizt es Sie denn gar nicht, mehr über Frau Fahrner und ihr Anliegen zu erfahren? Der Anwalt sagte, sie sei eine sehr liebenswerte und ungewöhnliche Dame. Mögen Sie denn gar keine Überraschungen?«
»Mein Bedarf an Überraschungen wird täglich aufs Neue gedeckt, glauben Sie mir! Sie sehen ja, was hier los ist …« Julie wies ringsum auf die Tische in der Cafeteria, die nun, nachdem die meisten Kurse geendet hatten, bis auf den letzten Platz besetzt waren.
»Unter der Woche bin ich von morgens neun bis abends zehn hier. Im Augenblick habe ich nicht mal Zeit, mir eine neue Herbstgarderobe zu kaufen oder zum Frisör zu gehen. Ich bin froh, wenn ich mal an einem Wochenende keinen Papierkram erledigen muss und mich ausruhen kann«, fügte sie hinzu und ärgerte sich im selben Moment. Warum hatte sie überhaupt das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen?
Um zu signalisieren, dass sie das Gespräch beenden wollte, schob sie ihr leeres Glas und die Colaflasche von sich. »Sie sehen also, selbst wenn Frau Fahrner der Liebreiz in Person ist, habe ich einfach keine Zeit für einen solchen Höflichkeitsbesuch. Und davon abgesehen … ich wüsste wirklich nicht, was wir uns zu sagen hätten.«
Es war ein sonniger Spätsommernachmittag. Die Nacht zuvor war ziemlich kühl gewesen. An vereinzelten Spinnweben, wo die Sonne nicht hinkam, hingen noch Tautropfen. »Feen-Häkelei«, so hatte Antonia die glitzernden Gebilde in ihrer Kindheit genannt. Am liebsten wäre sie hinaus in den Garten gegangen, um ihre Finger an den silbernen Fäden zu benetzen, aber das war wohl doch ein wenig kindisch.
Zum wiederholten Male rückte sie die zwei Kaffeetassen und Teller zurecht. Ihr Blick fiel auf die Thermoskanne. Vielleicht hätte sie den Kaffee doch frisch aufbrühen sollen? Zu spät. Antonia ging in die Küche, um ein Messer für den Marmorkuchen zu holen, den sie zur Feier des Tages gebacken hatte.
Es war halb zwei. Julie Rilling hatte sich für zwei Uhr angemeldet. Und um drei würde das Taxi kommen, das Antonia bestellt hatte. Die Sonne schien und es sah so aus, als ob sich das gute Wetter halten würde. Alles war demnach bestens vorbereitet.
Trotzdem wurde Antonia immer wieder von Zweifeln überfallen. Was wäre, wenn Julie sich verspätete und ihnen keine Zeit für ein erstes Kennenlernen blieb, bevor das Taxi kam? Was, wenn das Wetter doch nicht hielt und ihr geplanter Ausflug im Regen stattfinden musste? Und was, wenn Julie Rilling ihr am Ende gar nicht so sympathisch war, wie sie es sich nach dem Zeitungsartikel über sie und ihre verrückte Kunstschule erhoffte? Rannte sie einem Hirngespinst nach?
Mit aller Macht wischte Antonia jeden Zweifel weg. Sie hatte keine Zeit, sich Alternativen zu überlegen.
Zwölf Monate, hatte der Arzt im Kreiskrankenhaus gesagt. Wenn sie sich nicht doch noch für eine Operation entschied. Und selbst in diesem Fall stünden die Chancen nicht zum Besten …
Brustkrebs. Wie bei ihrer Mutter. Der Arzt hatte nicht gesagt, wie gut oder schlecht diese zwölf Monate verlaufen würden.
Ein Jahr also, in dem sie ihre Angelegenheiten regeln konnte. Vielleicht auch nur ein halbes Jahr, in dem sie zum Notar gehen und dafür sorgen konnte, dass die Verwandten im Dorf nach ihrem Tod das kleine Häuschen bekamen, das sie nach ihrer Rückkehr aus Japan gekauft hatte. Und in dem sie festlegen konnte, welche Institution ihre Ersparnisse erhalten sollte. Und dann war da noch ein anderes, ein viel größeres Anliegen …
Antonia schaute auf die Uhr. Viertel vor zwei. Es gab noch viel zu tun, bevor sie ans Sterben denken konnte.
Die Fahrt ging stockend voran. Sonntäglicher Verkehr füllte die steilen, in Serpentinen gewundenen Straßen des südlichen Schwarzwaldes in beide Richtungen: Ausflügler, die einen der letzten warmen Sonntage am Titisee verbringen wollten, Wanderer, deren Ziel der Belchen oder der Feldberg war, Radfahrer, die ihre Räder auf dem Dach eines PKWs spazieren fuhren. Überall an den Straßenrändern lockten handgeschriebene Schilder die vorbeifahrenden Gäste mit Wildgerichten und frischen Pfifferlingen und natürlich mit Schwarzwälder Kirschtorte und Kaffee.
Während Julie darauf wartete, dass es nach einer Haarnadelkurve weiterging, stellte sie mit der rechten Hand das Radio lauter und summte mit. Plötzlich war sie richtig in Urlaubsstimmung! Sosehr sie ihre Arbeit auch liebte, es tat gut, einmal für einen Tag rauszukommen. Sie war schon lange nicht mehr hier oben im Schwarzwald gewesen, und so kam es ihr vor, als sehe sie die bizarren, wilden Schluchten, die sich mit sonnigen Hochplateaus abwechselten, zum ersten Mal. Obwohl sie sich auf die enge Straße konzentrieren musste, nahm sie aus dem Augenwinkel heraus immer wieder faszinierende Anblicke wahr: einen Wasserfall, der steil an schiefergrauen Felswänden hinabstürzte, Fichtenwälder, in denen sich der Nebel trotz Sonne nicht gelichtet hatte. Zauberwälder! Schroffe Bergkanten, die sich wie die Umrisse eines Scherenschnitts vom Horizont abhoben.
Julie hatte zuerst nicht zu Antonia Fahrner fahren wollen. Doch nun war sie froh, dass sie sich von Theo und ihren Eltern dazu hatte überreden lassen.
Julie schmunzelte. Theo hatte richtig auf die Tränendrüse gedrückt! Ob Julie denn ruhig schlafen könne bei dem Gedanken, dass eine arme, einsame alte Frau sterben würde, ohne ihren Herzenswunsch erfüllt zu bekommen. Julie war versucht gewesen, mit einem kühlen Ja zu antworten, aber sie kannte Theos romantische Ader, und obwohl sie ihr manchmal auf die Nerven ging, liebte sie ihre Freundin dafür. Und eigentlich hatte Theo ja Recht: Es kostete Julie nur einen Sonntagnachmittag. Sie würde sich von der Kusine ihres Vaters ein paar Geschichtchen über Japan erzählen lassen, dann ein bisschen über die Kunstschule reden und Antonia schließlich die Telefonnummer ihrer Eltern in die Hand drücken.
Am liebsten wären sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter mitgefahren, um die unbekannte Kusine kennen zu lernen, doch Antonia hatte schließlich lediglich Julie eingeladen. Julie hatte ihren Eltern versprechen müssen, noch am selben Abend telefonisch Bericht von ihrem Ausflug zu erstatten.
Verdammt! Täuschte sie sich oder war sie gerade links an einem Schild mit der Aufschrift Rombach vorbeigefahren? Von der Entfernung her würde es passen … Das kam davon, wenn man sich seinen Tagträumen hingab! Julie beschloss, bei der nächsten Gelegenheit umzudrehen und sich die Abzweigung mit dem Schild genauer anzuschauen.
Das Kennenlernen lief unverkrampfter ab, als Julie angenommen hatte. Sie wurde nicht rührselig in den Arm genommen, hörte kein »Lass mich dich anschauen, Kind!« und auch nicht »Dass ich in meinem Alter das noch erleben darf …«. Antonia war um einiges kleiner als Julie und mochte wohl kaum mehr als fünfzig Kilo wiegen, doch ihr Händedruck war erstaunlich fest. Ihre Augen sahen ein bisschen müde aus, blickten aber freundlich und interessiert drein. Souverän, als hätte sie täglich Gäste, hängte Antonia Julies Blazer an die Garderobe, erkundigte sich nach ihrer Fahrt, lobte das sonnige Wetter und geleitete ihren Besuch dann ins Wohnzimmer, wo der Kaffeetisch gedeckt war.
Während sich Julie auf einen der Korbstühle setzte, registrierte sie mehrere Dinge gleichzeitig: Dem Haus fehlte der typische Alte-Leute-Geruch, stattdessen duftete es nach frisch gewaschenem Leinenzeug. Außerdem war die Einrichtung völlig anders, als sie es bei einer alten Dame erwartet hätte: keine Blümchentapeten, kein röhrender Hirsch, keine eingerahmten Familienfotos, keine Häkeldeckchen. Stattdessen stand in der Mitte des Raumes ein schlichtes, hellbeigefarbenes Sofa, gesäumt von zwei Stehlampen mit Schirmen aus Reispapier. In einer Ecke plätscherte ein Zimmerspringbrunnen. Trotz der spärlichen Möblierung wirkte das Haus weder kühl noch ungemütlich, sondern ausgesprochen harmonisch.
Antonia, die den Blicken ihrer Besucherin gefolgt war, sagte: »Ich habe das Haus nach den Prinzipien des Feng-Shui eingerichtet – oder es zumindest versucht!« Sie strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. »Meine Verwandtschaft hier im Dorf ist allerdings der Meinung, ich würde sie blamieren, weil ich nicht einmal Vorhänge an den Fenstern habe. Sei’s drum!« Sie schnitt zwei Stücke Marmorkuchen ab, wovon sie ein Stück auf Julies Teller hievte.
»Bei dieser Sicht würde ich auch keine Vorhänge haben wollen!« Julie zeigte auf den Obstgarten, in dem alte Bäume voller rotwangiger Äpfel hingen. »Man muss nur eine Hand ausstrecken, um sich einen Apfel zu pflücken! Und wenn ich mir den Duft im Frühjahr vorstelle, wenn die Bäume blühen!« Feng-Shui – wenn sie das ihren Eltern erzählte …
Noch während sie Kaffee einschenkte, erwähnte Antonia den Zeitungsartikel, durch den sie auf Julie aufmerksam geworden war.
»Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal gewusst, dass ich überhaupt noch Verwandte väterlicherseits habe! Und dann sogar eine erfolgreiche, schöne junge Frau wie Sie! Mein Vater … hat meine Mutter und mich verlassen, als ich noch ein kleines Kind war. Seitdem haben wir von den Fahrners nichts mehr gehört. Und auch davor gab es, glaube ich, keinen Kontakt zu Vaters Familie, obwohl ich das nicht beschwören möchte.«
»Aber mit Ihren Verwandten hier in Rombach sind Sie in Kontakt geblieben, oder?« Julie nahm einen Schluck Kaffee. Die alte Dame war wirklich völlig anders, als Julie sie sich vorgestellt hatte.
Antonia zögerte kurz. »Wenn ich ehrlich bin – nein. Als ich damals mit fünfundzwanzig Jahren nach Japan ging, prasselte so viel Neues auf mich ein, dass ich für Briefe in die Heimat kaum Zeit fand. Und nachdem meine Mutter gestorben war – wem hätte ich da noch schreiben sollen? Meine Mutter hatte keinen besonders guten Kontakt zu ihren Geschwistern, und das hat sich auf mich übertragen. Hin und wieder hat mir eine Kusine mal ein paar Zeilen geschrieben, mehr nicht. Nicht, dass ich deshalb böse gewesen wäre! Geburtstagsfeiern, Taufen, silberne Hochzeiten – diese ganzen Verpflichtungen sind Gott sei Dank an mir vorbeigegangen.« Antonia betrachtete eingehend ihre Kaffeetasse.
Und woher rührt dann der Schmerz in deiner Stimme?, fragte sich Julie insgeheim. Um die alte Dame aus ihren Gedanken zu reißen, richtete sie die Grüße ihrer Eltern aus sowie deren ausdrücklichen Wunsch, Antonia baldmöglichst persönlich kennen zu lernen.
Statt zu antworten schaute Antonia wie schon einige Male zuvor auf ihre Armbanduhr. Sie schien Mühe zu haben, die Position der filigranen Zeiger zwischen den Ziffern zu erkennen. Julie warf einen Blick auf ihre eigene Uhr. Es war kurz vor drei. Erwartete Antonia noch jemanden?
Die alte Dame räusperte sich. »Wenn Sie Lust haben, würde ich jetzt gern einen kleinen Ausflug mit Ihnen machen. Ich möchte Ihnen den Ort zeigen, wo ich geboren wurde.« Ihre Hände machten eine nervöse Bewegung.
»Warum nicht?« Julie zuckte mit den Schultern. »Bei dem schönen Wetter wäre es eine Schande, den ganzen Tag drinnen zu sitzen! Gehen wir zu Fuß oder sollen wir meinen Wagen nehmen?«
»Weder noch. Ich habe für drei Uhr ein Taxi bestellt«, erklärte Antonia. Im selben Moment läutete die Türglocke.
Julie hob irritiert eine Augenbraue.
Der Kies knirschte unter den Reifen des alten Daimlers. Hin und wieder spritzte Schotter in die Höhe und schlug gegen die Räder. Mit jeder engen Windung, die der unbefestigte Feldweg nahm, wurde die Miene des Taxifahrers noch missmutiger.
»Und Sie sind sicher, dass es da oben eine Wendemöglichkeit gibt?«
»Da oben könnte ein ganzer Lastzug wenden, also machen Sie sich keine Sorgen«, beruhigte Antonia ihn. Hinter fast unsichtbaren Elektrodrähten sprangen braune Kühe – je nach Gemüt – erschrocken zur Seite oder glotzten nur gelangweilt, als sie das Auto erspähten. Antonia hielt sich mit einer Hand am Haltegriff fest, rutschte auf dem abgewetzten Kunstleder nach vorn und schaute angestrengt aus dem Fenster. Wenige Minuten später stupste sie Julie leicht an.
»Gleich können Sie auf der linken Seite für einen kurzen Moment die Alpen sehen. Zumindest an einem so klaren Tag wie dem heutigen. Schauen Sie, da!«
Tatsächlich war im nächsten Augenblick in der Ferne die massive Felskette zu sehen. Julie, die bisher wortlos aus dem Fenster geschaut hatte, stieß einen leisen Begeisterungsschrei aus. Selbst der Taxifahrer warf einen Blick nach links und sah einen Moment lang weniger missmutig aus.
Die Kurven wurden immer steiler. Antonia fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die plötzlich trocken geworden waren.
Wenn sie sich recht erinnerte, musste nun gleich das Plateau mit den ehemaligen Tennisplätzen in Sicht kommen. Da! Da war es. Oder doch nicht? Zweifelnd schaute Antonia auf das mit Disteln überwucherte langgestreckte Feld, das sich zu ihrer Rechten erstreckte. Nein, das war der Übungsplatz für die Bogenschützen gewesen. Die Tennisplätze hatten hinter dem Haus gelegen, erinnerte sie sich. Ihr Blick fiel auf eine Aussichtsbank abseits des Weges, von der lediglich noch ein Brett der Sitzfläche sowie eins von der Rückenlehne übrig geblieben waren. An schönen Tagen wie diesem hatte man den Eindruck gehabt, sich nur ein wenig strecken zu müssen, um von hier aus einen Zipfel des blau gewaschenen Himmels zu erhaschen.
Antonias Brust wurde auf einmal eng. Nur noch ein paar Kurven trennten sie von dem hoch gelegenen Plateau, wo keine Berge, keine Felsvorsprünge mehr das Auge ablenkten. Gleich. Gleich würde es so weit sein. So viele Jahre war es her … Fast schüchtern schaute sie zu Julie hinüber. Die beiden Frauen lächelten sich an.
Dann huschte der letzte Fels an Antonias Fenster vorbei, und der Daimler fuhr plötzlich wieder waagerecht. Die Steigung war bewältigt.
Der Taxifahrer stieß einen Pfiff aus. Er hielt an und schaute sich ungläubig um. »Wer hätte das gedacht! Das ist ja wie … eine Welt für sich!«
»Ich glaub es nicht!« Wie in Trance stieg Julie aus. Sie machte ein paar Schritte nach vorn und blinzelte, als wolle sie sich versichern, dass sie nicht einer optischen Täuschung unterlag.
Vor ihnen breitete sich eine riesige Hochebene aus, samtig überzogen von dicken Teppichen aus Heidekraut. Doch nicht deren mattes Lila fing das Auge des Betrachters ein und auch nicht die plustrigen Wolken, die scheinbar zum Greifen nahe über ihre Köpfe hinweghuschten. Es war ein riesiges Haus, genauer gesagt ein Berghof, der die Blicke auf sich zog. Majestätisch erhob sich der Hof wie aus dem Nichts, reckte sich dem Himmel entgegen, in goldenes Sonnenlicht getaucht, als hätte ein Bühnenbildner die Beleuchtung für diesen Moment geplant. Die Symmetrie des Fachwerks – dunkles Holz und gekalkte Wände – war eindrucksvoll, obwohl die Wände vom Alter grau und fleckig waren. Man brauchte nicht viel Vorstellungsvermögen, um sich auszumalen, welche Wirkung allein ein simpler Anstrich mit weißer Farbe erzielen würde. Die Sonne spiegelte sich gleißend in den Dutzenden von Fenstern, von denen ein Großteil noch intakt war. Keine toten Augen wie sonst in verlassenen Häusern blickten ihnen entgegen, sondern es war eher ein verführerisches Zuzwinkern.
Weder der Taxifahrer noch Julie dachten daran, Antonia aus dem Wagen zu helfen. Beide schienen sie vergessen zu haben. Der Taxifahrer hatte sich eine Zigarette angezündet, und Julie war in die Hocke gegangen und strich mit ihrer Hand über die lilafarbenen Blüten des Heidekrauts.
Antonia, die sie vom Auto aus beobachtete, lächelte. Von jeher hatte dieser Flecken Erde, auf dem das »Kuckucksnest« stand, auf jeden, der zum ersten Mal hierher kam, eine solche Wirkung gehabt. Manche Dinge änderten sich zum Glück nie.
Statt auszusteigen, blieb Antonia noch für einen Moment im Wagen sitzen und starrte gedankenverloren in Richtung des dichten Nadelwaldes, der hinter dem Hof begann. Ein unerwartet heftiges Glücksgefühl, gepaart mit einem nicht zu stillenden Schmerz, regte sich in ihrer Brust.
Der alte Hof strahlte noch immer so viel Wärme, Charme und majestätische Zeitlosigkeit aus, dass die grandiose Landschaft daneben Gefahr lief, zur Kulisse zu werden. Die Häuser von Rombach, tief unten im Tal gelegen, wirkten wie Modelle auf einer Modelleisenbahnanlage – winzig, verspielt, fast ein wenig unwirklich.
Als Antonia endlich ausstieg, zitterten ihre Knie ein wenig. Sie bat den Taxifahrer, am Auto auf sie zu warten, dann atmete sie tief durch. Es war an der Zeit, Julie das »Kuckucksnest« zu zeigen.
»Hier oben sind Sie geboren? In diesem riesigen Haus?«, fragte Julie, während sie langsam auf den Berghof zugingen.
Dankbar stützte sich Antonia auf Julies Arm. Ihr war auf einmal ein wenig schwindlig.
»Ja, hier bin ich geboren, aber … Haus würde ich das ›Kuckucksnest‹ eigentlich nicht nennen. Hier oben wurde nämlich im Jahr 1903 das erste Hotel der ganzen Gegend eröffnet. Und zwar von der besten Freundin meiner Mutter, von Rosanna Moritz! Für die Gäste war es wie der Himmel auf Erden. Hier konnten sie sich nicht nur von der schlechten Stadtluft erholen, sondern Tennis spielen, ein Sonnenbad nehmen, mit dem Förster auf die Jagd gehen, im Winter Ski fahren …«
»Ski fahren – vor hundert Jahren?« Julie lachte ungläubig.
»Ja, stellen Sie sich vor, der erste Skilift der Welt wurde im Schwarzwald eröffnet! Der Strom dafür kam von einer Wassermühle. Schwarzwälder Erfinderreichtum, kann man da nur sagen.« Antonia lächelte. »Und kurze Zeit später wurde hier auch solch ein Ding aufgebaut. Wenn der Wind das Holz nicht weggeweht hat, müssten ein paar Überreste des Gestänges noch zu sehen sein. Hinter dem Gebäude.« Sie machte eine unbestimmte Handbewegung. Ihr war nicht entgangen, dass Julie den Blick während ihrer Ausführungen keinen Moment vom »Kuckucksnest« abgewandt hatte.
»Rosanna Moritz war ihrer Zeit immer ein bisschen voraus. Sie wusste, wie man den Menschen eine schöne Zeit bereitet. Meine Mutter war übrigens von Anfang an Teilhaberin. Die ersten Jahre haben die beiden Frauen das Hotel gemeinsam geführt. Nachdem Rosanna dann … nachdem sie gestorben war, ging es ganz in den Besitz meiner Mutter über.«
Inzwischen waren sie am Eingang des Hofes angelangt. Antonia holte einen Schlüssel aus ihrer Tasche. Leise quietschend bewegte er sich im Schloss der massiven Holztür.
Antonia zögerte einen Moment lang, dann drehte sie sich zu Julie um. »Ich habe Rosanna allerdings nie kennen lernen dürfen. Sie ist früh gestorben, schon vor meiner Geburt. Und nachdem meine Eltern das Hotel übernommen hatten, war alles … nicht mehr so wie früher. Zumindest haben das die Leute erzählt.«
Während Julie versuchte, durch eins der zahlreichen Fenster einen Blick ins Innere des Hauses zu erhaschen, öffnete Antonia im Windfang auch die zweite Tür. Mit einer einladenden Handbewegung bat sie Julie ins Haus.
»Das hier war die Eingangshalle.« Sie zeigte auf einen großen, reich mit Schnitzereien verzierten Tresen. »Hier wurde jeder Gast persönlich begrüßt.«
Mit leisen Schritten, fast ehrfürchtig, betrat Julie den sonnendurchfluteten Raum.
»Das glaub ich sofort – dass sich die Gäste hier willkommen fühlten!« Sie wies mit dem Kopf auf eine Gruppe von Polstersesseln. Sie waren mit weißen Tüchern abgedeckt, auf denen das hereinfallende Sonnenlicht gelbe Streifen hinterließ. Auf einem Tischchen stand eine Vase mit einem verstaubten Strohblumenstrauß. Daneben lag ein Stapel Bücher, der aussah, als hätte ihn erst unlängst jemand in der Hand gehabt – wäre da nicht die dicke Staubschicht gewesen. An der Wand hinter der Sitzgruppe hing – aufgereiht wie auf einer Perlenschnur – eine ganze Sammlung Schwarzwalduhren. Darunter stapelten sich aufgerollte Teppiche oder Decken, was es genau war, konnte man auf den ersten Blick nicht erkennen.
Antonia war plötzlich so seltsam zumute, dass sie sich mit einer Hand an dem Tresen festhalten musste. Es dauerte einen Moment, bis sie darauf kam, was dieses Gefühl ausgelöst hatte. Es war nicht die Tatsache, dass sie dieses Haus nach so langer Zeit wieder betreten hatte. Es war auch nicht die Aufregung, weil dieser Tag so immens wichtig für sie war. Es lag an der Luft, an dem eigenen Geruch des »Kuckucksnests«, der sie völlig aus dem Gleichgewicht brachte. Er rief so viele Erinnerungen in ihr wach … Dieser eigentümliche Duft nach Bienenwachs, mit dem die hölzernen Stiegen, die zu den Gästezimmern führten, poliert worden waren. Dazu ein Hauch von Weihrauch. Außerdem glaubte Antonia geradezu, die Backwaren zu riechen, die damals hinten im Backhaus täglich frisch hergestellt wurden. Wie konnte ein Haus nur so lange seinen ureigenen Duft konservieren?
Julie war in der Zwischenzeit zu der Treppe gegangen, die in den ersten Stock führte. Rechts davon stand – ebenfalls mit weißen Laken abgedeckt – ein Flügel. Sie hob das Laken ein wenig an. Schwarzes, auf Hochglanz poliertes Ebenholz kam zum Vorschein.
»Was für ein edles Stück!« Andächtig strich sie mit der Hand darüber.
Es passte zu der jungen Frau, dass sie nicht nur sehen, sondern auch fühlen wollte, freute sich Antonia im Stillen. Fühlen, hören, schmecken, die Welt mit allen Sinnen erfassen – was für eine Gottesgabe!
Sorgfältig zog Julie das Laken wieder glatt. »Wie um alles in der Welt ist der Flügel hier hochgekommen? Das muss doch unglaublich mühsam gewesen sein! Die armen Pferde – oder gab es da schon Autos?«
Antonia zuckte nur mit den Schultern. Wie das riesige Musikinstrument je auf den Berg gekommen war, hatte sie sich als Kind nie gefragt. Der Flügel war einfach schon immer da gewesen.
»Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, oder?«, antwortete sie. »Ich glaube, Rosanna war eine Frau, die ein Nein so schnell nicht gelten ließ.«
Der Schwindel hatte inzwischen wieder nachgelassen, und Antonia wollte Julie jetzt den Rest des Hotels zeigen.
»Was möchten Sie zuerst sehen? Die Gästezimmer oder die anderen Räume? Also den Speisesaal, die Bibliothek, den …«
Sie war schon halb die Treppe hinaufgestiegen, als sie merkte, dass Julie noch immer wie angewurzelt neben dem Flügel stand.
»Julie? Ist Ihnen nicht gut?« Fühlte sich Julie womöglich nicht wohl hier?
Julie schüttelte fast unmerklich den Kopf. Als sie zu Antonia aufblickte, kniff sie die Augen zusammen. »Es heißt doch, dass Häuser, in denen kein Mensch mehr wohnt, sterben. Dass sie zerfallen, innerlich und äußerlich. Hier jedoch ist alles noch so … intakt!« Sie nickte nach oben in Richtung der Fachwerkbalken. »Kein Holzwurm, keine Fäulnis. Nicht einmal Mäuseköttel liegen herum!« Ihr Lachen klang verwundert. »Man hat das Gefühl, als wären die Gäste nur für einen kurzen Ausflug in den herbstlichen Wald verschwunden. Wie lange, sagten Sie, liegt das Haus schon im Dornröschenschlaf?«
»Zu lange«, antwortete Antonia – und kam sich dabei vor wie eine böse Hexe, die es verwunschen hatte.
Nachdem sie wieder in Antonias Haus zurückgekehrt waren, bestand jene darauf, dass Julie es sich im Wohnzimmer bequem machte, während sie selbst in der Küche Teewasser aufsetzte.
Julie wählte einen Sessel am Fenster und schloss einen Moment lang die Augen. Sie fühlte sich wie betrunken. Es war, als hätte sie von allem zu viel genossen: von der guten Luft, von den kräftigen Farben, von der Noblesse des alten, riesigen Fachwerkbaus, von …
Als sie Schritte hörte, öffnete sie die Augen. Sie lächelte Antonia an, die mit einem Tablett hereinkam, auf dem eine Kanne Tee und zwei zarte Tassen standen.
»Wenn ich eine künstlerische Ader hätte, würde ich jetzt schon dasitzen und eine Skizze für ein Bild vom ›Kuckucksnest‹ entwerfen. Oder ein Lied komponieren«, sagte Julie, während sie Antonia das Tablett abnahm und die Sachen auf dem kleinen Tisch vor dem Fenster abstellte. »Aber ich verwalte ja nur die Kreativität anderer!«
»Auf Ihre Art sind Sie doch auch eine Künstlerin«, entgegnete Antonia und ließ sich im Sessel gegenüber nieder. »Wer die Gabe hat, so viele Menschen kreativ arbeiten zu lassen, wie Sie es in Ihrer Kunstschule tun, ist für mich ein wahrer Künstler!«
»Na ja, ich würde sagen, das hat eher etwas mit Organisationstalent zu tun«, wehrte Julie ab. »Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in früheren Zeiten viele Künstler ins ›Kuckucksnest‹ gezogen hat. Dieses Licht! Und dann die Ruhe …« Wenn sie nur ein bisschen davon mit in die Stadt nehmen könnte!
»Maler, Dichter, sogar Bildhauer sind als Gäste auf den Berg gekommen. Und Schauspieler von allen großen Häusern! Aber vor allem die Maler wurden tatsächlich fast magisch angezogen. Wegen des Lichts, wie Sie richtig erkannt haben.« Antonia lächelte. »So haben sich ja meine Eltern damals auch kennen gelernt. Mein Vater kam als Gast ins Hotel …«
Julie nippte an ihrem Tee. »Ich dachte, Ihr Vater wäre Uhrmacher gewesen, wie seine Brüder.« Stimmte die ganze Verwandtschaftsgeschichte womöglich gar nicht?
»Nein, er war Schildermaler! Es musste doch schließlich auch jemand die Schilder und Zifferblätter der Uhren bemalen, nicht wahr? Vater hat dafür nicht nur die klassische Apfelrose gewählt, sondern alle möglichen Motive. Einige der Uhren an der Wand in der Eingangshalle hat er bemalt. Manchmal sind Leute extra mit ihren Uhren angereist, um sich von ihm ein ganz besonderes Motiv malen zu lassen. Ich kann mich an einen Mann erinnern, der wollte sogar seine zwei Jagdhunde auf dem Zifferblatt seiner Standuhr verewigt haben! Ach, ich hab meinem Vater so gern zugeguckt, wenn er mit Pinsel und Palette hantierte. Für mich – ich war ja damals noch ein kleines Kind – war das wie Zauberei, wenn so nach und nach zwischen den langweiligen Ziffern auf einem Uhrblatt eine ganze Landschaft entstand. Schildermaler – das ist heutzutage leider ein ausgestorbener Beruf. Für Vater war das sein Leben, alles andere war nicht so wichtig …« Auf einmal schien Antonia weit weg zu sein.
Unter niedergeschlagenen Lidern beobachtete Julie die alte Dame. Gerade noch forsch und fröhlich, wirkte Antonia nun, als sei sie von einer tiefen Traurigkeit befallen. Eine seltsame Frau! Julie hätte sie gern gefragt, warum sie ein Leben in der Ferne vorgezogen hatte, statt sich dort oben auf dem Berg mit Mann und Kindern niederzulassen. Gleichzeitig spürte sie jedoch, dass Antonia eine so intime Frage nicht schätzen würde. Sie schenkte Tee nach, obwohl beide Tassen noch halb voll waren.
»Das ›Kuckucksnest‹ …« Julie ließ das Wort auf ihrer Zunge zergehen. »Heißt es nicht, der Kuckuck legt seine Eier in fremde Nester? Ich meine, das ist doch ein sehr … ungewöhnlicher Name für ein Hotel, oder? Wie kam es dazu?«
Eigentlich gefiel ihr der Name sehr gut, er passte zu dem ungewöhnlichen Gebäude. Und zur Landschaft. Vielleicht gab es in den umliegenden Wäldern ja besonders viele Kuckucke?
»Ursprünglich wurde das Anwesen Moritzhof genannt. Wie es später zu seinem anderen Namen kam, weiß ich eigentlich auch nicht so genau.« Geistesabwesend zupfte Antonia an den Fransen der Tischdecke.
Julie winkte ab. »Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich den Ausflug sehr genossen! Sie müssen da oben eine wunderbare Kindheit verbracht haben.«
Antonia schaute auf. »Wie man’s nimmt … Nun, schlecht ging es mir nicht. Es war ja immer jemand da. Sieglinde, die Hauswirtschafterin, die Zimmermädchen und der Kellner haben mir öfter mal eine Karamelle zugesteckt oder ein Butterbrot. Manchmal, wenn wenig Gäste da waren, hat sich Luis, der Page, sogar dazu erweichen lassen, mit mir Verstecken zu spielen! Und die alte Martha in der Wäschekammer hat mir geholfen, aus der Schmutzwäsche eine Höhle zu bauen, darin hab ich dann selig geschlafen wie ein Lämmchen. Ja, es gab wirklich schöne Momente …«
Einen Augenblick lang schwiegen beide. Dann räusperte sich Antonia.
»Wissen Sie, was ich nie verstanden habe? Zu Rosannas Zeiten war das ›Kuckucksnest‹ ein Ort, an dem sich Menschen besonders wohl fühlten und wohin sie immer wieder zurückkehren wollten. Noch heute habe ich die Geschichten im Ohr, die die Leute im Dorf mir erzählt haben, als ich noch ein Kind war: von den rauschenden Festen oben im Berghof, von den berühmten Gästen, die so verrückte Sachen unternahmen wie eine nächtliche Schlittenfahrt bei Fackelschein. Und nur ein paar Jahre später war es damit aus und vorbei! Die Gäste wurden immer weniger, und irgendwann blieben sie dann ganz weg. Es war, als ob nach Rosannas Tod auch das Glück und die Fröhlichkeit abgereist wären … Und keiner hat sie zurückholen können. Dabei hat sich meine Mutter bemüht, davon bin ich überzeugt! Nun ja, viel Hilfe hatte sie wohl in Vater nicht – er hat sich jeden Tag stundenlang in seinem Zimmer verschanzt, um zu malen. Er war ein Künstler, und ein Hotelwirt war er gewiss nicht … Ich glaube, er hat dieses Leben gehasst.« Antonia starrte vor sich hin. »Vielleicht hat er auch uns gehasst. Er ist gegangen, als ich gerade einmal fünf Jahre alt war. Ist eines Tages runter vom Berg und nicht wiedergekommen. Einfach so! Ich habe meinen Vater nie wiedergesehen.«
»Das tut mir Leid«, sagte Julie leise.
»Jedenfalls … im ›Kuckucksnest‹ war der Zauber verloren gegangen.« In einer resignierenden Geste warf Antonia beide Hände in die Höhe. »Eine so schöne Frau wie Rosanna, bei allen beliebt – und dann stirbt sie so jung! Das ist wirklich ein Drama, oder?«
Julie rutschte auf ihrem Sessel herum. Das Gespräch berührte sie auf unangenehme Weise. Da sie nicht wusste, was sie antworten sollte, nahm sie einen Schluck Tee.
»Das muss für Ihre Mutter sehr schwer gewesen sein – ihre beste Freundin zu verlieren.« Und dann auch noch vom eigenen Mann verlassen zu werden, fügte Julie in Gedanken hinzu.
Antonia nickte vage. »Ich glaube, sie ist nie darüber hinweggekommen. Sie war … sehr unnahbar, hat keinen an sich herangelassen. Vielleicht vor lauter Angst, noch einmal solches Leid ertragen zu müssen. Wissen Sie, es ist eigentlich seltsam, aber meine Mutter tat so, als hätte es Rosanna nie gegeben. Jedenfalls hat sie nie über sie gesprochen. Nun, mit dem lieben Gott vielleicht. Mit dem hat sie ja dauernd geredet, ansonsten war sie sehr verschlossen.«
Antonia blinzelte, als wolle sie damit den harten Ton mildern, der plötzlich in ihrer Stimme aufgetaucht war.
»Was ich über meine Mutter und Rosanna weiß, das haben mir die Leute im Dorf erzählt. Gemeinsam durch dick und dünn, als seien sie Schwestern gewesen, so hieß es immer.« Sie lächelte versonnen.
»Diese Rosanna muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein«, sagte Julie. »Zu jener Zeit ein Hotel zu eröffnen! Überhaupt auf die Idee zu kommen!«
Antonia nickte. »Das war sie bestimmt. Und einfach haben es ihr die Leute im Dorf nicht gemacht, so viel ist gewiss! Nichts gegen die Rombacher, aber Sie wissen ja, wie das in kleinen Dörfern ist: Da wird alles Neue erst einmal argwöhnisch betrachtet. Und wenn es dann noch von einer Frau kommt …«
Julie wollte gerade davon erzählen, welche Unkenrufe sie und Theo sich hatten anhören müssen, als sie ihre Kunstschule eröffnet hatten, doch da sprach Antonia schon weiter.
»Irgendwann – wir wohnten schon im Dorf unten, ich muss ungefähr acht Jahre alt gewesen sein – hab ich Mutter gefragt, warum wir ihre beste Freundin eigentlich nie auf dem Friedhof besuchen. Eine Antwort habe ich nicht bekommen. Mutter hat mich nur in ihrer besonderen Art angeschaut, und ich wusste, dass ich wieder einmal ein böses Mädchen war. Und dann hat sie mich in die Kirche geschleift, am helllichten Nachmittag, und wir haben zusammen Rosenkränze gebetet. Ich hab schnell gelernt, dass es besser ist, gewisse Dinge nicht anzusprechen. Das Thema Rosanna gehörte dazu.«
Antonia seufzte laut auf. »Du meine Güte, Sie müssen mich für ein altes Waschweib halten! Kaum fange ich an zu erzählen, finde ich kein Ende mehr.«
Sie drehte wieder ihr Handgelenk hin und her, um die Zeit auf dem winzigen Zifferblatt ihrer Uhr ablesen zu können. »Schon sechs Uhr, oje! Sie wollen doch sicher nicht allzu spät losfahren, bei dem weiten Heimweg!« Antonia räusperte sich und strich sich fahrig durchs Haar. »Julie, ich glaube, es ist Zeit, dass wir jetzt das Wesentliche besprechen …«
Julie runzelte die Stirn. Das Wesentliche?
»Wahrscheinlich wird das, was ich Ihnen jetzt sage, ein bisschen plötzlich für Sie kommen, aber ich bin eine alte Frau und krank obendrein. Ich habe also nicht mehr viel Zeit. Kurz gesagt: Ich möchte Ihnen das ›Kuckucksnest‹ überschreiben. Viel zu lange habe ich mich nicht um den Hof gekümmert. Ach, was heißt hier viel zu lang? Mein Leben lang habe ich mich nicht darum gekümmert! Mir war es egal, was dort oben auf dem Berg passierte. Fragen Sie mich nicht, warum … Vielleicht war ich einfach nur dumm und egoistisch. Doch das Gebäude hat sich dafür erstaunlich gut gehalten, finden Sie nicht? Ich habe letzte Woche einen Gutachter hingeschickt. Gestern ist sein Bericht gekommen. Die Bausubstanz sei absolut in Ordnung, schreibt er. Und er –«
»Entschuldigen Sie, aber … was haben Sie am Anfang gesagt?«, unterbrach Julie Antonias Redefluss. Was sollte das alles? Erlaubte sich die alte Dame einen Scherz mit ihr?
»Ich möchte, dass Sie das ›Kuckucksnest‹ bekommen«, antwortete Antonia schlicht.
Julie war sprachlos.
»Ich habe niemand anderen, dem ich den Hof vererben könnte. Meine Verwandten hier im Dorf – ihnen gehört der Gasthof ›Fuchsen‹, vielleicht haben Sie ihn auf der Fahrt hierher gesehen – werden das Häuschen erben. Und denen würde ich den Berghof eh nicht geben. Und sonst gibt es niemanden«, betonte Antonia noch einmal, als würde das alles erklären. »Als ich den Artikel über Sie gelesen habe, wusste ich, dass Sie ein Mensch sind, der die Kraft und die Gabe hat, das Glück ins ›Kuckucksnest‹ zurückzubringen.«
Wovon redete Antonia Fahrner da? Julie umklammerte ihre Teetasse so fest, dass sie für einen Moment befürchtete, sie würde zerspringen. Abrupt stellte sie die Tasse ab.
»Aber Sie kennen mich doch gar nicht! Und die Tatsache, dass wir über ein paar Ecken miteinander verwandt sind … was heißt das schon? Ich … ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!« Julie machte eine hilflose Handbewegung. Ich träume!, schoss es ihr durch den Kopf. »Warum verkaufen Sie den Hof nicht einfach? Solch eine Immobilie mit so viel Land ringsum … das muss doch ein Vermögen wert sein! Sie könnten eine Weltreise machen. Oder das Geld für einen guten Zweck spenden …«
Julie hob die Hände, als wollte sie sagen: Alles ist möglich. Tausend Gedanken flogen wie aufgeschreckte Vögel durch ihren Kopf. Sie hatte Mühe, sich auf den am nächsten liegenden zu konzentrieren.
»Ich will aber nicht einfach verkaufen! Das hätte ich schon vor Jahren tun können. Alle paar Jahre sind mir entsprechende Anfragen nach Japan geschickt worden. Nein, das will ich nicht!« Eine kleine, steile Falte hatte sich zwischen Antonias Augen gebildet.
»Aber warum wollen Sie das ›Kuckucksnest‹ gerade mir vererben?« Julie spürte ein nervöses Zucken im Mundwinkel. Ungebetene, verführerische Visionen tauchten vor ihrem inneren Auge auf. Dieser Berghof ihr Eigentum? Wie oft hatten Theo und sie schon nächtens zusammengesessen und darüber fantasiert, wie es wohl wäre, die Kunstschule in größeren Räumen unterzubringen. Raus aus der Hektik der Innenstadt, an einen Ort, der den Menschen Ruhe und Kraft gibt. An ein Objekt wie das »Kuckucksnest« hatten sie jedoch in ihren kühnsten Träumen nicht gedacht.
Auf Antonias Gesicht machte sich ein Lächeln breit, das eher einer Grimasse glich.
»Sie haben nicht richtig zugehört, meine Liebe. Sie sollen den Hof nicht erst nach meinem Tod bekommen, sondern schon bald. Aber um ein Geschenk im üblichen Sinne handelt es sich auch nicht. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Und was ich von Ihnen verlange, ist nicht wenig …«
Antonia erklärte Julie ihre Idee.
Julie hörte schweigend zu. Doch die ganze Zeit über kitzelte ein nervöses Kichern ihre Kehle. Der Nachmittag hatte einen unwirklichen Verlauf genommen, es war ein verrückter Traum, über den man am nächsten Morgen verwundert nachdenken konnte.
Als Antonia schließlich fertig war, beugte sich Julie nach vorn. »Habe ich das richtig verstanden? Sie wollen mir den Hof überschreiben, wenn es mir gelingt, anhand von Rosannas Tagebüchern, die sie anscheinend lange Zeit geführt hat, herauszufinden, was den einstigen Zauber des ›Kuckucksnests‹ ausgemacht hat?« Julie schaute Antonia herausfordernd an. »Entschuldigen Sie, wenn ich so direkt frage: Warum haben Sie in diese Tagebücher nicht längst schon selbst einmal einen Blick geworfen? Vor allem, wenn Sie der Meinung sind, dass darin das Geheimnis des ehemaligen Erfolgs vom ›Kuckucksnest‹ zu finden ist? Das wäre das Erste, was ich an Ihrer Stelle getan hätte! Dazu brauchen Sie mich doch gar nicht!« Sie wies auf einen Stapel ledergebundener Bücher, die Antonia aus einer Schublade unter dem Tisch hervorgekramt hatte. In einer separaten Kiste lagen außerdem noch Haufen uralter Zeitungen, dicke Mappen, die wie Fotoalben aussahen, und allerlei anderer Kram. Dafür, dass sich Antonia ein Leben lang nicht um den Hof gekümmert hatte, besaß sie eine Menge Dokumente …
»Das sind viele Fragen auf einmal«, antwortete Antonia ausweichend. Sie strich eine unsichtbare Falte aus dem Tischtuch. »Wahrscheinlich halten Sie mich für ein verrücktes altes Huhn. Exzentrisch nennt man solch ein Verhalten bestenfalls, oder?«
Julie winkte ab. »Darum geht es doch gar nicht. Ich will einfach nur verstehen, was das alles zu bedeuten hat.«
Sie hatte noch nie etwas geschenkt bekommen. Gut, als ihr Vater vor ein paar Jahren Michael die Werkstatt überschrieb, hatte er auch ihr einen nicht unerheblichen Betrag ausgezahlt. Ihr Anteil am Erbe sozusagen – der Grundstein für »Soul Fantasies«. Aber das hier war etwas anderes.
»Wollen Sie es nicht wenigstens versuchen?«, fragte Antonia leise.
Julie lachte auf. Erwartete Antonia allen Ernstes, dass sie einfach Ja sagte?
»Woher wollen Sie wissen, dass ich das überhaupt kann? Dass ausgerechnet ich anhand von Rosannas Tagebuchaufzeichnungen und einem Blick auf ein paar vergilbte Fotografien die alten Zeiten rekonstruieren kann? Entschuldigen Sie, Frau Fahrner, aber was Sie da vorhaben … ist das nicht eine sehr seltsame Art von Vergangenheitsbewältigung?«
Sie unterhielten sich noch eine Weile. Antonia beantwortete Julies Fragen – die ihr aus welchem Grund auch immer nicht genehm waren – auf ihre Art und Weise, nämlich sehr ausweichend oder gar nicht. Irgendwann hatte Julie das Gefühl, dass sie sich nur noch im Kreis drehten. Gegen acht Uhr verabschiedete sie sich schließlich. Sie müsse über Antonias Vorschlag nachdenken und bitte sich dafür eine Woche Bedenkzeit aus, sagte sie an der Tür. Antonia stimmte dem zu. So wurde verabredet, dass Julie am nächsten Sonntag um dieselbe Zeit abermals nach Rombach kommen sollte.
Statt das Teegeschirr in die Küche zu tragen, setzte sich Antonia wieder an den Tisch. Im Schein der Reispapierlampen wirbelten kleine Staubwolken über den Boden, die sie bei ihrem morgendlichen feuchten Wischen übersehen haben musste. Blindes altes Weib!
Antonia fuhr sich mit der Zunge über ihre trockenen Lippen. Der Verlauf des Gesprächs hatte einen faden Nachgeschmack in ihrem Mund hinterlassen. Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich mehr Begeisterung von Julie erwartet. Gab sie sich womöglich einer Illusion hin, wenn sie sich einbildete, die schöne junge Frau könnte für sie das erledigen, was sie ein Leben lang nicht zu tun gewagt hatte?
Einmal, da war sie nahe dran gewesen, Rosannas Aufzeichnungen zu lesen. Sie konnte sich noch gut erinnern, es war kurz nach dem Tod ihrer Mutter. Nachdem der Krebs sie zerfressen hatte.
Ihre Tante Katharina, die sich um die Beerdigung und die Haushaltsauflösung gekümmert hatte, packte damals auch eine Kiste mit Simones persönlichen Unterlagen und schickte sie an deren Tochter nach Kyoto: Simones Kennkarte, das Familienbuch, ein paar Fotoalben mit alten Schwarz-Weiß-Fotografien, das Gästebuch des Hotels, Zeitungen von damals mit Berichten über das Hotel und eben auch Rosannas Tagebücher. Wahrscheinlich hatte Tante Katharina geglaubt, es handele sich dabei um Simones persönliche Aufzeichnungen. Ihr, Antonia, war es anfangs ja nicht anders ergangen.
Zuvor war sie tagelang um die Kiste, randvoll mit der Vergangenheit, herumgeschlichen. Hatte hundert Ausreden gefunden, um die modrig riechenden Unterlagen nicht in die Hand nehmen zu müssen. Allein beim Gedanken an ihre Mutter in den schwarzen Gewändern und mit der stets düsteren Duldermiene sträubte sich alles in ihr. Mutter hat mich nicht lieb, sie mag mich nicht einmal – dieses Wissen hatte Antonia ein Kinderleben lang wie einen zu schweren Mantel mit sich herumgeschleppt. Allein beim Anblick der Kiste fühlte sie dessen Gewicht erneut auf ihre Schultern sinken. Hatte sie sich dafür auf den weiten Weg in die Ferne gemacht? Und dennoch: Eines Tages – an einem japanischen Feiertag, die Schule war geschlossen gewesen – hatte sich Antonia dem Unvermeidlichen gestellt.
Zuerst betrachtete sie die Fotografien. Auf fast allen war dasselbe Motiv zu sehen: zwei junge Frauen, eine schöne und eine hässliche, lachend, Arm in Arm vor dem »Kuckucksnest«, in einer Gruppe anderer Menschen, wahrscheinlich bekannte Persönlichkeiten, die als Gäste im Hotel abgestiegen waren. Bei der Einweihung des Tennisplatzes – die schöne Frau strahlend mit einem Tennisschläger, die hässliche abseits mit Bällen in den Händen, mit einem Blick voller Liebe. So fremd.
Rosanna und Simone.
Durch dick und dünn. Wie Schwestern.
Dann hatte Antonia eins der Tagebücher in die Hand genommen. Hatte angefangen zu lesen und schon nach wenigen Minuten erkannt, dass es sich nicht um die Lebensaufzeichnungen ihrer Mutter handelte, sondern um Rosannas. Sie hatte nicht gewusst, ob sie erleichtert oder enttäuscht sein sollte.
Plötzlich war es wieder da, das kleine Mädchen von damals, das verbotene Fragen stellte, Simones Blick im Rücken. Die Luft schwanger mit ihren stummen, bitteren Vorwürfen. Welches Recht hatte sie, Antonia, auf Rosannas persönlichste Gedanken?
Es war nicht der Nachlass ihrer Mutter, also weg mit dem alten Zeug! Der schwere Mantel der Vergangenheit verschwand in der Mottenkiste. Und mit ihm die Tagebücher und alles andere. Antonia versteckte die Kiste im letzten Winkel ihrer kleinen Wohnung. Sie wollte die Antworten auf die einstigen Fragen nicht mehr hören. Das kleine Mädchen von früher gab es nicht mehr.
Schon bald war alles wieder weit weg gewesen, so leicht, so unwesentlich. Zum Glück.
Antonias Blick hatte sich in die Rückenlehne des Sofas gebohrt. Die Augen schmerzten vor Trockenheit.
Es waren nicht Skrupel gewesen, die sie davon abhielten, fremde Tagebücher zu lesen. Es hätte einfach zu wehgetan, sich mit der Frau auseinander zu setzen, die der Liebe ihrer Mutter würdig gewesen war. Die von Simone geliebt wurde. Im Gegensatz zu ihr.
Ihr Leben lang hatte sich Antonia eingeredet, dass sie sich von der Einsamkeit ihrer Kindheit frei gemacht hatte. Ihre Entscheidung, Rombach zu verlassen und im fernen Japan ihrer Arbeit nachzugehen, war dafür doch der beste Beweis, oder nicht?
Glücklich und zufrieden und frei, ein Leben lang. Antonia lachte bitter auf.
Und nun sollte Julie, eine Fremde, ihr helfen, den Schmerz der frühen Jahre, der noch immer an ihr nagte, zu besiegen?
Es gab Momente, in denen selbst Antonias Wille nicht stark genug war. In denen sie sich einfach nur für verrückt erklärte. Andererseits: Was hatte sie zu verlieren?
Und was hatte sie zu gewinnen?
Das Gefühl, nicht mit einer unbewältigten Vergangenheit ins Grab zu gehen – das hatte sie zu gewinnen! Aber sollte sie das Jahr, das ihr laut den Ärzten noch blieb, wirklich damit verbringen, ihre komplizierte Vergangenheit aufzudecken? Und womöglich belastende Dinge ans Licht zu befördern, die ihr wehtun, die sie traurig machen würden? Sollte sie die Zeit, die ihr blieb, damit vertun, in dunklen Ecken zu kramen, das Unterste nach oben zu befördern? Nein, diese Kraft brachte sie nicht auf.
Antonia wandte den Blick durch das Fenster nach draußen. Er verlor sich zwischen den rotwangigen Äpfeln und dem müde gewordenen Laub.
Julie würde das Richtige tun – daran musste sie einfach glauben!
Das Erste, was Julie tat, als sie im Auto saß, war, die Freisprechanlage ihres Mobiltelefons zu aktivieren. So gut wie kein Empfang – na toll! Sie tippte auf eine gespeicherte Nummer und wartete auf eine Verbindung. Hoffentlich ist sie ausnahmsweise einmal zu Hause und hoffentlich kann ich sie verstehen, betete Julie, als sie endlich das Freizeichen im Ohr hatte.
»Herbst.«
»Hi, Theo, ich bin’s. Ich bin gerade auf dem Weg von Rombach nach Freiburg.«
»Ach ja, dein Besuch bei der Omi. Wie war’s denn?«
»Sag mir erst mal, wie viel Zeit du hast«, antwortete Julie trocken. Während sie versuchte, sich auf die engen Kurven zu konzentrieren, schilderte sie Antonia Fahrners Ansinnen, Julie solle das vorhandene Material über das »Kuckucksnest« durchsehen, Rosannas Tagebücher lesen und danach ihre Erkenntnisse in einer Art »Bericht« niederschreiben.
»Ich und schreiben – die ich den letzten Aufsatz in der dreizehnten Klasse geschrieben habe!« Sie kicherte nervös. »Ach Theo, irgendwie kommt es mir vor, als ob das alles ein Traum ist, aus dem ich gleich erwachen werde. Wenn du den Berghof gesehen hättest! So etwas gibt’s nur einmal. Unzählige Räume, und alle so hell! Ich hab noch nie in einem Fachwerkhaus so viele Fenster gesehen. Dort oben unsere Kunstschule … Im Geist habe ich schon die Zimmer eingerichtet!« Sie seufzte tief. »Und dann sagt sie, ich würde das alles geschenkt bekommen, wenn ich …« Plötzlich lief Julie eine Gänsehaut über den Rücken. »Es ist, als hätte Antonia meinen geheimsten Wunsch erahnt.«
Am anderen Ende der Leitung war es still. Erst nach einer Weile sagte Theo: »Das hört sich ziemlich verrückt an. Sie will dir tatsächlich für ein bisschen Recherche und Schreiberei dieses alte Hotel schenken? Einfach so? Ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dann wäre das ja ein Superdeal!«
»Aber ich glaube einfach nicht dran, verstehst du? Ich frage mich die ganze Zeit, wo verdammt noch mal der Haken an der Sache ist!« Julie schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad.
Einen Moment lang war nur Rauschen in der Leitung zu hören. Julie glaubte schon, die Verbindung sei unterbrochen, doch dann hörte sie Theo sagen: »Warum muss es denn einen Haken geben? Manchmal werden Träume einfach wahr. Vielleicht ist Antonia Fahrner deine beziehungsweise unsere gute Fee! Stell dir mal vor, wir hätten endlich ausreichend Platz! Und müssten nicht jeden Tag so viel Zeit mit der Parkplatzsuche verplempern. Schon allein das wäre ein Traum!« Theo stöhnte. »Und man kann sogar die Alpen sehen? Wann, sagtest du, ziehen wir um?« Sie lachte.
»Du und deine gute Fee!«, spottete Julie. Das war wieder einmal typisch für Theodora. Im Grunde ihres Herzens war sie eine hoffnungslose Romantikerin. Gleichzeitig machte Julies Herz einen kleinen Freudensprung. Theo war wirklich für jede Verrücktheit zu haben!
»Du hast doch hoffentlich zugesagt!«, ertönte Theos Stimme wieder, und der drohende Unterton war selbst durch den Autolautsprecher nicht zu überhören.