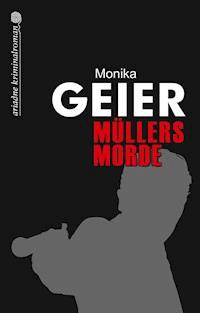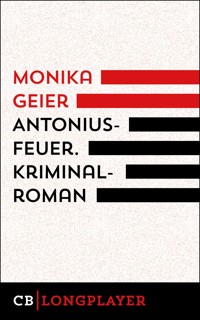
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriminalkommissarin Bettina Boll ist Ärgernisse gewöhnt, doch der jüngste Streich ihrer Dienststelle schmeckt bitter. Ein Tod im Jugendknast muss untersucht werden, die Behörden fürchten einen Skandal, und nun soll Bettina für ihren neuen Chef die Kohlen aus dem Feuer holen und einem Kollegen dazwischenfunken. Überdies erweist sich der Fall als ausnehmend verschroben. Gibt es wirklich katholische Dorf-Aktivisten, die Dämonen austreiben? Und was hat das berühmte Isenheimer Altarbild voller bunter Bestien damit zu tun? Zu Recht gilt Monika Geier als eine der besten deutschen Krimiautorinnen und Meisterin im Jonglieren mit den schrägen Aspekten der Wirklichkeit. Antoniusfeuer ist ein betörender neuer Bettina-Boll-Krimi: lebensprall und farbenfroh mit starkem Plot, umwerfenden Charakteren und feinen Überraschungen. »Was wie Intuition scheint, ist Ergebnis blitzschneller Kombination von Gesehenem und Gehörtem, unkonventionellem Denken und analytischem Rückgriff. Darin – nur darin – ähnelt Monika Geier ihrem Vorbild Agatha Christie. In allen anderen Punkten hat sie die Britin längst meilenweit überflügelt.« Jury Deutscher Krimipreis
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 561
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Kriminalkommissarin Bettina Boll ist Ärgernisse gewöhnt, doch der jüngste Streich ihrer Dienststelle schmeckt bitter. Ein Tod im Jugendknast muss untersucht werden, die Behörden fürchten einen Skandal, und nun soll Bettina für ihren neuen Chef die Kohlen aus dem Feuer holen und einem Kollegen dazwischenfunken. Überdies erweist sich der Fall als ausnehmend verschroben. Gibt es wirklich katholische Dorf-Aktivisten, die Dämonen austreiben? Und was hat das berühmte Isenheimer Altarbild voller bunter Bestien damit zu tun?
Zu Recht gilt Monika Geier als eine der besten deutschen Krimiautorinnen und Meisterin im Jonglieren mit den schrägen Aspekten der Wirklichkeit. Antoniusfeuer ist ein betörender neuer Bettina-Boll-Krimi: lebensprall und farbenfroh mit starkem Plot, umwerfenden Charakteren und feinen Überraschungen.
»Was wie Intuition scheint, ist Ergebnis blitzschneller Kombination von Gesehenem und Gehörtem, unkonventionellem Denken und analytischem Rückgriff. Darin – nur darin – ähnelt Monika Geier ihrem Vorbild Agatha Christie. In allen anderen Punkten hat sie die Britin längst meilenweit überflügelt.« Jury Deutscher Krimipreis
Über die Autorin
Monika Geier, gebürtige Pfälzerin, studierte Bauzeichnen und Architektur. Schon für den ersten Bettina-Boll-Krimi Wie könnt ihr schlafen erhielt sie den Marlowe, den Krimipreis der Raymond-Chandler-Gesellschaft. Vielen gilt sie als eine der besten deutschsprachigen Genre-Autorinnen überhaupt. Für den siebten Bettina-Boll-Krimi Alles so hell da vorn
Monika Geier
Antoniusfeuer
Kriminalroman
the cake is a lie!the cake is a lie!the cake is a lie!the cake is a lie … Graffiti in Portal
Vorbemerkung von Else Laudan
Kommissarin Bettina Boll vom Ludwigshafener K11 ist seit langem daran gewöhnt, sich quer zur Konvention durchzuwurschteln: als Mordermittlerin, als Halbtagskollegin, als Teenagermutter – und neuerdings auch als Bewohnerin eines uralten Hauses, das sie abwechselnd mit seinem Charme einlullt und mit dunklen Schatten aus der Vergangenheit bedroht. Ihr Bauchgefühl sagt, Aufräumen hilft auch gegen Gespenster, und Spirituelles ist eh nicht so Bettinas Ding. Aber ausgerechnet darum geht es bei dem seltsamen Fall, den ihr Willenbacher als neuer Dienststellenleiter jetzt ans Bein bindet: um Glauben.
Ein Totenzettel mit dem Isenheimer Altarbild voller Dämonen. Ein zutiefst frustrierter Kollege, zurückgepfiffen, weil er nicht christlich genug ist. Ein tätowierter Sozialarbeiter mit undurchsichtiger Vorgeschichte, der nicht weiter befragt werden kann. Und schließlich ein seltsam verändertes Marienbild in der sehr alten Kirche des Vorzeigedörfchens Frohnwiller. Licht und Schatten in der Pfalz mit ihren ordentlichen Straßen und wuchernden Wäldern.
Bettina Boll, ganz gegenwärtig, forscht nach konkreten Interessen und Motiven, sucht den unsichtbaren Linien auf die Spur zu kommen, die Fehltritte in der äußeren Welt mit den inneren Dämonen der Beteiligten verbinden. Denn sie weiß, dass kaum jemand nichts zu verbergen hat. Und angesichts der heraufbeschworenen Monster fragt sie: Was wird anders, wenn man dem Schrecken Namen gibt?
In der momentanen Jetztzeit voll verdrängter Erkenntnisse, Inbrunst und Vertrauensschwund bei gleichzeitigem Informationsoverkill gelingt Monika Geier ein fein ziselierter, stimmungsvoll bildhafter und höllisch gewiefter Kriminalroman über Glaube und Bedeutung. Sie gewährt Einblick in die Abgründe ewiger Ansprüche, tiefer Konflikte und ganz normalen Irrsinns, und wie immer sind ihre Charaktere von furioser Präsenz – mit oder ohne Dämonen. In diesem Buch steckt unsere ganze Kultur drin, unsere ganze Ära samt Herkunft, Verknöcherungen und Verbiegungen. Und mein Lichtblick im Labyrinth trägt einen orangen Gartenpulli.
1
Es regnete, aber nicht hier, sondern woanders, nicht weit weg. Das spürte sie am Wind. Freitagnachmittag, die Luft war warm und feucht, die Schatten schwach, die Bereitschaft vorbei. Feierabend. Wochenende. Bettina blickte hoch in das satte Laub der Baumkronen. Sie verbrachte zu viel Zeit im Garten. Daran durfte sie sich nicht gewöhnen. Denn sie würde diese alten Gehölze mitsamt dem Haus verkaufen müssen, und dann würde jeder Baum, in den sie sich jetzt verliebte, gerodet werden. Es war dumm, ihr Herz daran zu hängen. Sich von dem Haus zu trennen würde ihr leichter fallen, zumindest hoffte sie das. Und womit sie gar keine Probleme hatte, waren die vielen Altlasten, die das Grundstück zumüllten. Malerischer alter Schrott, rostige Gartengeräte, windschiefe Mäuerchen und Zäune, all das riss Bettina ein, sammelte es auf, packte es weg, fuhr es zum Wertstoffhof. Von morgens bis abends, in jeder freien Minute. Seit sie hier eingezogen waren.
Du räumst auf, sagte ihre innere Stimme ihr manchmal, wenn sie am Ende des Tages allzu zufrieden und müde im Sessel einnickte. Du richtest dich ein.
Ich bring nur den Müll weg, sagte Bettina sich dann. Aber das war gelogen.
Doch, echt, ich mach nur klar Schiff, damit das Grundstück schön aussieht und endlich einen Käufer findet.
Gelogen.
Andererseits ging es nicht, dass sie hier wohnten, wenn auch nur vorübergehend, und alles weiter vermodern ließen, also richtete sie das Anwesen her, was im Moment bedeutete, dass sie mit Gartenschere und Zimmermannshammer an der mutmaßlichen hinteren Grundstücksgrenze auf einem Stückchen Wiese stand und versuchte, in eine Rosenhecke einzudringen. Sie wusste, dass sich dort drin ein morscher Zaun befand, der vermutlich ihr Land zu einem anderen, an dieser Stelle ebenso verwachsenen begrenzte. Den Zaun hatte sie verfolgt und eingerissen bis zu dieser dichten Hecke. An dem Ende, in das der Zaun hineinführte, würde sich vielleicht ein Zugang finden. Bettina schnitt ein paar Ranken ab, hieb einen morschen Holzpfosten um, entfernte rostzerfressene Nägel, da klingelte ihr Handy.
Willenbacher. Sie erkannte ihn am Klingelton. New Kid in Town. Kleiner Scherz, musste sie unbedingt ändern, aber Willenbacher war noch nicht lange zurück, er war noch nicht lange Chef, und er nervte jetzt schon. Klar, die Abteilung hatte eine katastrophale Zeit hinter sich und wurde erst mal grundsaniert. Sie war Willenbachers einzige Vertraute und musste da einfach mithelfen, auch aus eigenem Interesse. Jetzt wurden Weichen gestellt. Andererseits war sie aber Halbtagskraft. Sie konnte nicht wie der neue Chef Tag und Nacht präsent sein, auch wenn das vielleicht nötig wäre. Beziehungsweise andersrum, es wäre nötig, dass Willenbacher mal Pause machte und jemand anderem die Verantwortung überließ. Konnte er nicht. Das Handy hörte auf zu klingeln und begann kurz darauf erneut.
Bettina ließ die Gartenschere ins Moos fallen. Am Morgen war ein neuer Fall reingekommen, da waren manchmal Rückfragen im Team nötig. Ein brisanter neuer Fall sogar. Politisch, wenn auch nur ein Selbstmord in der JVA Schifferstadt. Ich geh aber trotzdem nicht ran, Will.
Es klingelte weiter.
Das Brisante war nicht das tragische Geschehen selbst, sondern die Identität des Toten: Er war der Mörder der jungen Sophie, ein afghanischer Flüchtling, der mit seiner Eifersuchtstat das ganze Land in Aufruhr versetzt hatte. Gut möglich, dass dort in Schifferstadt jetzt spontane Kundgebungen abgehalten wurden und größere polizeiliche Präsenz nötig war. Doch dafür waren die Kollegen von der Bereitschaft zuständig. Und nach allem, was Bettina so den Tag über gehört hatte, hatte der Selbstmord bislang erstaunlich wenig mediale Hysterie erzeugt.
Es hörte auf.
Bettina zog ihre Gartenhandschuhe aus, warf sie zu der Schere ins Moos und holte das Handy aus der Hosentasche. Es blieb stumm.
Sie legte es vorsichtig auf einen Stein in der Nähe.
Nix.
Sie drehte sich um und ging langsam Richtung Handschuhe.
Schweigen.
Sie zog die Handschuhe an.
Pling. Eine Whatsapp. Das Display leuchtete auf, sie sah Willenbachers kleines Profilbild, einen roten Punkt, dann gleich noch mal und noch mal. Dann schwieg das Handy wieder.
Oh, verdammt. Bettina pfefferte die Handschuhe fort. Okay, erst mal war da ein Bild, Tatortfoto konnte es kaum sein, das verschickten sie nicht über freie Nachrichtendienste und nur übers Diensthandy. Also was Privates. Sie klickte auf Runterladen und las die Textnachrichten: Sagt dir das was?, lautete die eine und die andere: Ruf mich an!
Morgen vielleicht, dachte Bettina, und dann poppte das Bild auf. Sie sah nicht viel. Ein paar Fratzen. Es war das Foto eines alten Gemäldes, das ihr irgendwie bekannt vorkam, bunte Farben, eine Ruine, ein Gebirge, davor seltsame Schreckenswesen aller Art, ein Vogelkopf, mehrere Drachen, ein leidender Mensch in der Ecke, und über allem schwebte weit oben in einer fernen Sonne ein kaum erkennbarer Gott.
Sagte ihr das was?
Nein.
Nein, tippte sie ein.
Dann fluchte sie und rief Willenbacher an.
»Endlich«, sagte der zur Begrüßung. Er hörte sich müde an, im Hintergrund redeten mehrere Personen.
»Was ist das für ein komisches Bild?«, fragte Bettina.
»Das war im Koran des Toten. Wusste ich doch, dass ich dich damit kriege«, sagte Willenbacher.
»Wie bitte? – Du hast das Foto eines Asservats über Whatsapp –«
»Natürlich nicht«, unterbrach Willenbacher gereizt. »Das ist ein Teil vom Isenheimer Altar. Was ich dir geschickt habe, ist ganz normal von Wikipedia, es geht nur ums Prinzip, der Tote hatte ein Andachtsbild mit genau diesem Ausschnitt drauf in dem einzigen Buch, das er laut Aufsehern und Mithäftlingen jemals angerührt hat.« Der Lärm im Hintergrund wurde lauter und verklang dann, offenbar hatte Willenbacher sich zum Telefonieren an einen stilleren Ort begeben. Dafür hallte seine Stimme jetzt. »Bolle«, sagte er.
Auch so ein Ding. Eigentlich redete er sie offiziell mit Tina an, aber wenn es ernst wurde, fiel Willenbacher in alte Gewohnheiten zurück.
»Komm hierher, einfach nur als Verstärkung. Das ist eine ganz blöde Sache.«
»Was ist denn los?«, fragte Bettina.
»Verdammter Mist«, fluchte Willenbacher plötzlich los, vermutlich nicht zu ihr, aber Bettina bekam trotzdem einen Schreck.
»Was sagt Tavanaianfar?«, fragte sie so nüchtern wie möglich. Tava war heute Morgen offiziell von Willenbacher mit der Ermittlung betraut worden.
»Nein«, sagte Willenbacher. »Ja, ganz recht, der Kollege wird das regeln. Einen Moment bitte, ich hab hier ein wichtiges Gespräch.«
Im Hintergrund grummelte etwas. Willenbacher seufzte tief.
»Will«, sagte Bettina. »Was sagt –«
»Er ist kein Christ«, sagte Willenbacher dumpf.
»Wie meinen?«
»Tavanaianfar ist kein Christ.«
»Hast du eine Macke?«, entfuhr es Bettina.
»Nicht in diesem Ton, Frau Boll«, schnappte Willenbacher sofort.
»Ich bin auch keine Christin.«
Willenbacher ließ sich nicht beirren. »Du bist anders keine Christin, als Tavanaianfar kein Christ ist.«
»Ich lege jetzt auf«, sagte Bettina. »Ich hab zu tun.«
»Bolle«, sagte Willenbacher da leise, und es klang echt verzweifelt, »das LKA ist hier. Das BKA interessiert sich. Der Fall ist total sonnenklar, der Junge hat sich erhängt, aber sein Anwalt stellt jetzt schon alles infrage und gibt lange Interviews. Das wird ein Spießrutenlauf. Und Tavanaianfar ist nun mal –«
»Polizist?«
»Afghanischer Abstammung.«
»Und?«
Willenbacher senkte die Stimme noch weiter. »Bolle. Die kommen damit nicht klar.«
»Weil er kein Christ ist oder was?«
»So ungefähr.«
»Wenn das ein Witz ist, dann finde ich ihn ganz schlecht.«
»Bolle«, sagte Willenbacher. »Komm.«
Dann war die Verbindung unterbrochen.
Über der Gretchenfrage hatte sie das Bild mit den seltsamen Tierwesen ganz vergessen, die fielen Bettina erst wieder ein, als sie auf den Parkplatz der JVA einbog. Es war der Zaun, der sie daran erinnerte, die Mauer und die Tatsache, dass es ein Jugendgefängnis war. Wenn es irgendwo einen Ort gab, an dem Monster aller Art zusammenkamen und schnell noch grellere zeugten, dann hinter diesem Zaun. Davor stand jetzt neben den Einsatzfahrzeugen der Kollegen ein einsamer Ü-Wagen des SWR, leer, Leute von der Presse waren nicht zu sehen. Besorgte Bürger auch nicht. Die Luft war diesig, der Himmel hing tief. Hierher kamen sie nicht, die Aufgeregten. Hier spürte man, wer die wahren Bedürftigen waren. Bettina parkte ihr Auto, stieg aus und klingelte am ersten Tor.
»Ah, Tina, heute mal in Farbe«, sagte Willenbacher zur Begrüßung und blickte stirnrunzelnd an ihrem orangen Gartenpulli hinab. Bettina dachte, dass sie Willenbacher inzwischen fast genauso gern hatte wie seinerzeit Härting, auch der hatte ausgiebig und unverschämt ihr Äußeres kommentiert. Wenn auch in der Sie-Form. Hatte was. Sollte sie bei Willenbacher vielleicht anregen.
»Ich war im Garten«, sagte sie kühl. »Du hast mich herbestellt. Dringend. Außerhalb der Bereitschaft. Ich bin gekommen. Was gibt’s?«
Die Ansprache brachte Willenbacher in Verlegenheit. Zu viele Zuhörer, wie es schien. Sie standen im breiten Flur vor der Zelle des Verstorbenen, um sie herum werkelten mindestens zehn Kollegen, beschäftigt, aber auch nicht taub, und das hier war nicht mal der Tatort selbst. Der befand sich in der Zelle. Darin war der junge Mann abends um 20 Uhr eingeschlossen worden, und niemand hatte etwas Auffälliges bemerkt, bis er am Morgen um 6:34 Uhr beim Öffnen gefunden worden war. Er hatte sich mit einem verknoteten Hemd an einem Pfosten seines Stockbettes erhängt. Bettina wollte ihn nicht sehen, sie fand Selbstmörder gruselig. Bewusst blickte sie an der offenen Zellentür vorbei, vermutlich grundlos, sicher war die Leiche schon abtransportiert. Viel Zeit blieb ihr sowieso nicht, sich umzusehen, denn Willenbacher packte sie am Arm und zog sie fort.
»Ich erkläre es dir später genau«, wisperte er, als sie außer Hörweite der anderen Beamten ganz am Ende des Ganges an einer Gittertür standen. Diese versperrte ein Treppenhaus, doch die Luftbewegung konnte sie nicht verhindern, es herrschte leichter Zug, der davon kündete, dass rundherum noch viele andere unerreichbare Räume lagen, in denen Menschen eingeschlossen waren, die sie vielleicht nicht sehen, aber möglicherweise hören oder ihre Anwesenheit sonst wie spüren konnten.
»Nein, jetzt«, sagte Bettina. Sie wusste, dass ihr Ton ihn aufregte. Willenbacher war immer sehr statusbewusst gewesen, es musste ihn irritieren, dass sie mit ihm redete wie früher, als sie die Vorgesetzte gewesen war. Und sie sah an seiner Haltung, seinen Augen, den zusammengekniffenen Brauen, dass er das nicht ewig durchgehen lassen würde. Nur, im Moment brauchte er sie.
»Ganz kurz«, knirschte er. Dann tönte aus dem Treppenhaus ein gedämpfter Schrei, fröhlich, ein normales Geräusch in einem Haus, in dem Jugendliche lebten. Willenbacher griff sich an den Kopf und knetete seine Stirn. »Das hier ist ätzend«, sagte er dumpf.
Bettina wartete.
»Ich hab die Lage falsch eingeschätzt«, gestand er dann leise. »Ich dachte, offensichtlicher Selbstmord, politisch brisant, da schicken wir so viele Leute, wie wir können, und arbeiten haargenau nach Vorschrift. Viel passieren kann nicht, weil der Fall im Prinzip klar ist, wir dürfen nur keine unüberlegten Statements abgeben und die Routine nicht verändern.« Er seufzte.
Bettina bekam Mitleid. Gegen ihren Willen. »Und routinemäßig war Tava heute Morgen dran«, sagte sie.
Willenbacher sah auf. »Du warst dabei. Du hast es gehört. Hab ich ihn auch nur im Geringsten gemobbt? – Nein! Seine Herkunft ist mir scheißegal! Da hab ich nicht eine Sekunde dran gedacht! Dass er Afghane ist wie unser Toter, das haben die vom LKA mir gesagt.«
»Wir haben ihn eingestellt«, sagte Bettina. »Er ist Polizist.«
»Mit doppelter Staatsbürgerschaft.«
»Aber was wollen die denn jetzt überhaupt? Das LKA?«
»Die wollen gar nix. Die haben nur routinemäßig Migranten im Blick. Die Staatsanwaltschaft will. Und zwar auch die Routine einhalten, total genau sogar, aber mit einem gemischten Team auf unserer Seite. Wir sollen ganz ohne Änderungen am normalen Prozedere den Tatort aufnehmen, die Obduktion überwachen und dann einen Bericht schreiben, auf dem unten mindestens ein deutscher Name steht.«
»Dann unterschreib doch du.«
»Das ist nicht das normale Prozedere. Ich kann da morgen nicht mit zur Obduktion. Bolle, da soll, und das ist vielleicht sogar richtig, eine öffentliche Diskussion vermieden werden. Und vor allem diese irrsinnigen Verschwörungstheorien, die es zwangsläufig geben wird, wenn der leitende Ermittler einen ähnlichen Migrationshintergrund hat wie das Opfer. Im Normalfall ist das egal, aber hier …«
Bettina seufzte.
Willenbacher wurde lauter. »Du weißt, dass seit dem Mord an Sophie dort in Dings jedes Wochenende die Reichsflagge gehisst wird. Die Leute da sind durch. Die wollen kein Parteitagsgelände mehr sein. Wir wollen das auch nicht. Du willst das nicht, Bolle. Und jetzt stell dir mal vor, wir finden doch noch einen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Dann ist aber Polen offen. Dann werden die einen sagen, dass Ausländer und Muslime in unseren Gefängnissen nicht sicher sind, und die anderen, dass der Kollege Tavanaianfar in der idealen Position war, die Beweise zu fälschen. Und dieser Anwalt von dem Jungen, der würde zur Not beides sagen. Vermutlich hat er das schon.«
Bettina sah ihn schief an. »Wenn du mich fragst, entsteht gerade hier die Verschwörungstheorie.«
Willenbacher blickte nach vorn zu den Kollegen, senkte die Stimme wieder, jetzt flüsterte er nur noch. »Tina, ich hab diesen identitären Schwachsinn nicht erfunden, aber ich will keinen Ärger deswegen. Das wäre nämlich echt viel Ärger. Außerdem ist da noch was. Thema Fremdeinwirkung. Warum wir eine Christin brauchen. Dieses Bild.«
»Ich bin keine Christin.«
»Pst!«, machte Willenbacher und sah sich nervös um.
Die Sache wurde immer schräger. »Will«, sagte Bettina laut.
Worauf Willenbacher sie am Arm packte und noch tiefer in die Ecke zog. »Da ist eine Sache, die weiß Al-Afghanis Anwalt noch nicht«, wisperte er, »und wir müssen es ihm nicht sagen, jedenfalls nicht sofort, denn wir ermitteln ja nicht gegen ihn, aber er wird es rauskriegen. Und dann müssen wir es geklärt haben. Das muss so schnell wie möglich passieren.«
»Was?«
»Pass auf, irgendwer hier muss dem Jungen einen Gesprächspartner vermittelt haben. Selbsthilfegruppe ›Die Wüste‹. Gekommen ist ein katholischer Sozialarbeiter aus irgend so ’ner kleinen Gemeinde in der Nähe. Die machen das aus persönlichem Engagement. Gefängnisbesuche.«
»Das ist doch schön.«
»Na ja. Diese Gruppe agiert bundesweit. Die sind nicht klein, und die sind auch nicht öffentlichkeitsscheu.«
»Und?«
»Und dieser Sozialarbeiter soll an Al-Afghani einen Exorzismus vollzogen haben. Oder sogar mehrere.«
»Was?«
»Teufelsaustreibung. Dämonen hatte der Junge vermutlich genug.«
Plötzlich war Bettinas Zorn verschwunden. Sie blickte auf den so ungewöhnlich belebten Gefängnisflur. »Und heute Nacht sind die Geister wiedergekommen und haben ihn mitgenommen.«
»Gefährlicher Hokuspokus. Das ist der Punkt, Bolle. Erstens, stell dir die Schlagzeilen vor, zweitens, da kann der Anwalt von dem Jungen alles reinlegen bis zum Mordversuch! Und dann ist es auch noch die falsche Religion.«
»Wieso falsch? War Al-Afghani überhaupt Moslem?«
Willenbacher schaute sie grimmig an. »Natürlich.«
»Woher weißt du das? Steht das irgendwo?«
»Gefängnisakte. Bolle, wir wollen nur wissen, was überhaupt passiert ist.« Er rieb sich die Stirn und sah einen Moment ungeheuer gestresst aus. »Die Gefängnisleitung ist zu der Ansicht gekommen, dass dieser Typ von der ›Wüste‹ sich von Al-Afghanis … Popularität angezogen gefühlt hat und dass das ein Grund für sein Interesse an dem Jungen war. Da war dann die Religion egal.«
»Und was soll ich jetzt machen?«
»Treib diesen mutmaßlichen Geisterjäger auf, die Personalien sind hier in der JVA archiviert. Besuch ihn, heute Abend noch, wenn’s geht, frag ihn, was er genau gemacht hat, wie es dazu kam, wie Al-Afghani drauf war. Erklär ihm, dass er sich selbst und allen einen großen Gefallen tut, wenn er erst mal nur mit uns redet.«
»Was ist mit diesem Isenheimer Bild?«
»So sind wir drauf gekommen, das muss er Al-Afghani gegeben haben. Einer von den Vollzugsbeamten hat es erkannt. Die haben die Besuche auf der Überwachung beobachtet. Der Junge hat plötzlich angefangen zu stöhnen und zu brüllen. Das haben die dann unterbunden.«
»Hm.«
Willenbacher seufzte und sah sie eindringlich an. »Und. Der Kollege Tavanaianfar ist nicht der Erste, der vom Ergebnis deiner – äh – Befragung erfahren muss. Damit kommst du zu mir. In die Akte setzen wir es gemeinsam. Nach Absprache mit dem Staatsanwalt und dem LKA.«
»Moment mal –«
Willenbacher sah sie an, halb genervt, halb Hundeblick. Er war dicker geworden, fand Bettina. Und hatte Haare verloren. Seine Augen waren auch ein bisschen starrer als früher. »Und morgen, Bolle, wirst du bitte die Obduktion begleiten. Mit einem Random-Kollegen aus ’m großen Zimmer.« Im großen Zimmer waren die unteren Ränge zusammengefasst.
»Oh nein.«
»Du weißt genau, die Obduktion ist beim Suizid das Wichtigste. Und ich sag Tavanaianfar, dass du ihm damit assistierst.«
»Ich ihm?« Tava war keine dreißig und erst seit Willenbachers Ankunft in der Abteilung. Er war weniger als großes Zimmer. Er war Flur.
»Hör mal, Bolle, du wirst den Suizid feststellen und gut. Dann sind wir sowieso aus dem Fall raus. Den Kollegen erklär ich, dass es besser für Tavanaianfar ist, wenn er ein bisschen aus der Schusslinie kommt, und dass wir dich pro forma wegen deines Dienstalters und Rangs einsetzen und im Zweifelsfall der Öffentlichkeit präsentieren. Dass du aber außer der obligatorischen Obduktion nichts tust. Weil du eh Halbtagskraft bist und darum gar nicht in der Lage, eine Ermittlung zu leiten. Du bist keine Gefahr. Das werden alle akzeptieren.«
Gar nicht in der Lage. Keine Gefahr.
»Von mir aus nimm Müller mit«, ergänzte Willenbacher. »Den magst du doch.«
Bettina blickte kurz an ihrem orangen Pulli hinab. Ein Stängel mit vertrocknetem Rosenlaub haftete noch daran. »Apropos Rang«, sagte sie und pflückte den Stängel ab.
»Ich weiß, Härting hat deine Beförderungen verschleppt«, sagte Willenbacher mit nervösem Blick auf die Leute vorn im Gang, die Gedanken sichtlich woanders.
Bettina starrte ihn an.
»Das werden wir selbstverständlich korrigieren«, setzte er hinzu und fixierte sie ungeduldig. »Was …?«
»Nix«, sagte Bettina. Dieses überfällige Gespräch schob sie schon länger vor sich her. Und sie hatte es sich anders vorgestellt. Chefzimmer mit vielen schnörkeligen Wortgefechten. Emotional. Schrecklich. Und jetzt waren sie sich einfach einig?
»Ich hab mit der Gleichstellungsbeauftragten gesprochen«, holte sie ihr Hauptargument sinnloserweise doch noch hervor, nur, weil dieser Sieg ihr zu leicht vorkam. Tatsächlich hatte umgekehrt die Gleichstellungsbeauftragte mit ihr gesprochen. Und geschimpft. Fällige Beförderungen nicht einzufordern, das schadete allen Frauen, das senkte die Moral der Schwesternschaft.
»Ich auch«, sagte Willenbacher. »Aber dieser Stau betrifft nicht nur dich. Das hat Härting bei allen rausgeschoben. Im Grunde kriminell. Da kommt auch noch was auf uns zu. Also in der nächsten Runde Oberkommissarin, und dann vielleicht vorgezogen beim nächsten Mal gleich Hauptkommissarin, das werden wir sehen.«
»Also schön.« Sie kam sich überrumpelt und bestochen vor.
»Mit Tavanaianfar redest du am besten gar nicht, das mache alles ich. Wenn, dann soll er auf dich zugehen. Hat er aber vielleicht gar keine Lust zu.«
Das konnte Bettina sich auch nicht vorstellen. »Wo ist dieses Bild?«, fragte sie.
»Da vorne asserviert.«
»Kann ich es mitnehmen?«
»Aber unauffällig.« Willenbacher sah schon wieder so gestresst aus. »Und bitte krieg raus, wie sehr – ob dieser Typ überhaupt befugt war, so was durchzuziehen. Mit dem Segen der Kirche. Denn wenn dieser Möchtegernseelsorger das nur so inoffiziell als Hobby betrieben hat, was ich ja glaube, dann wird es für uns viel weniger kompliziert.«
»Ist es denn wichtig, ob es erlaubt war?«
»Natürlich! Und du weißt, wen man das fragen muss!«
»Den Papst?«
»Hör mal, Bolle, nimm das ernst. Es ist ernst. Du warst in einem katholischen Internat, das weiß ich. Also praktisch im Kloster.«
Weil ihre Eltern gestorben waren. Das war die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen. Das wusste Willenbacher.
Hör auf, dachte sie.
»Und du hast es überlebt«, sagte Willenbacher hart. »Muhammad nicht. Und wenn ich so drüber nachdenke, würde ich wirklich gerne wissen, warum.«
Sie sah sich das Bild an. Zwischendurch musste sie zwei, drei Hände schütteln, Staatsanwalt Flohr beäugte missfällig ihren Pullover und sagte: »Ah. Boll. Richtig, über Sie haben wir gesprochen.«
Und jetzt fragst du dich, ob Tava nicht am Ende doch der Bessere ist, dachte sie und schenkte ihm einen extrafesten Händedruck. Zwei Damen vom LKA nickten ihr nur zu, Dr. Lee lächelte kurz und geheimnisvoll in ihre Richtung und verschwand wieder in der Zelle. Dann entstand etwas Unruhe, als der Zinksarg angeliefert wurde, die Leiche war also doch noch nicht weg. Bettina rettete sich vor ihrem Anblick weiter raus auf den Flur, die beiden Plastiktüten mit dem Koran und dem Andachtsbild in der Hand. Der Koran war eine Billigausgabe in schwarzem Kunstleder mit Deutschübersetzung, er sah völlig ungelesen aus. Die Seiten hingen zusammen wie ein einziger Block, kaum vorstellbar, dass da mal was dazwischen gesteckt haben sollte. Und das Bildchen selbst war kaum handtellergroß, mit den Versuchungen des heiligen Antonius. Stand unten drauf. Aberwitzige Monster in einer wüsten, doch völlig überfüllten Landschaft … Gott saß mitten in der Sonne und schaute träge aus seiner Höhe in noch weitere Ferne …
Zu welchem Anlass verteilte man so ein Bild?
Bettina drehte es um. Auf der Rückseite stand groß und vorwurfsvoll: »Wo warst du, guter Jesus, wo warst du? Warum bist du nicht dagewesen, um meine Wunden zu heilen?« Darunter, in kleinerer Schrift: Hochwürden Sebastian Amorth, 1930–1968, Waldstätten. Und ganz klein darunter: Waldstätten, den 30.4.1968, Friedhof zu St. Anton im Tale.
Ein Totenzettel, dachte Bettina. Das Datum bezog sich vermutlich auf eine Beerdigung. Mit Beerdigungen kannte sie sich aus, im K11 kam man da nicht drum herum. Bettina schüttelte die Plastiktüte in der Luft. Sie war viel zu groß für das kleine Bild. Es verrutschte. Was war das Besondere daran?
Sie gesellte sich wieder zur Gruppe und schnappte sich den erstbesten Kollegen – den großen Mang von der Spusi –, um sich zu erkundigen, wer das Bild gefunden hatte.
»Ich glaub, das war der Otto«, sagte Mang abweisend, die Augen auf ein Klemmbrett mit einer Liste geheftet, die er durchging. Otto kniete daneben und sortierte Asservate.
»Otto«, sagte Bettina.
Er sah nicht auf. »Tina. Du auch hier?« Es klang wie ein Vorwurf, der wie keiner klingen sollte.
»Ja«, sagte Bettina.
»Weiß Tava, dass du hier bist?«, fragte Otto sotto voce. Die Augen ringsherum blieben gesenkt.
»Ich denke schon«, sagte Bettina.
Er richtete sich auf. »Orange steht dir gut.« Der Satz triefte. Vor undeutlicher, lauernder Bosheit.
»Danke, du, hör mal –«
»Und du bist jetzt extra aus ’m Garten hierhergekommen, Tina, um zu helfen?«
»Herbestellt worden«, sagte sie. Sagte der Pullover. Hoffentlich. Sie sah Otto an, er sah sie an. Immerhin. »Hast du dieses Bild in diesem Buch gefunden?«, lenkte sie ab.
»Jawollja.«
»An einer bestimmten Stelle?«
Otto kniff die Brauen zusammen. »Zwischen Deckel und Papier«, sagte er in unverändertem Ton.
Bettina reichte ihm die Tüte mit dem Koran, weil sie selbst keine Handschuhe trug. »Bitte zeig mir wo.«
Otto holte das Buch aus der Tüte, schlug den Deckel auf und hielt ihr das Ganze vor die Nase.
»Erste Seite oder letzte Seite?«
»Erste«, sagte er ohne Zögern.
»Gibt es ein Foto davon?«
»Das müssen wir auswerten.«
Also nein. »Danke«, sagte sie.
Otto ließ den Koran in die Tüte zurückfallen. »Brauchst du den noch?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Und das Bild?«
Sie zögerte.
»Das Bildchen ist dokumentiert«, sagte Otto hellseherisch. »Keine Angst. Du kannst spätestens in einer Stunde alles in der Akte aufrufen und kontrollieren.«
Jetzt reichte es. »Wieso redest du so? Was glaubst du, was ich hier tue?«
Die Augen rundherum blickten bei diesem Ausbruch kurz und anklagend auf – hallo? Staatsanwaltschaft! LKA!
»Ich glaube, dass du hier nur deine Arbeit tust, Tina«, sagte Otto unfreundlich.
»So ist es!«
Er senkte die Stimme. »Tava ist ein Topkollege.«
»Ich weiß.«
»Der kann das allein.«
Die Ohren ringsherum waren gespitzt, die Stimmung gespannt, welche Art Statement die Kollegen bevorzugen würden, nicht ganz klar. Dass sie eins wollten, das schrien ihr die gesenkten Köpfe entgegen. Aber so einfach war das nicht. Sie konnte im Gartenpulli mit Laub im Haar erscheinen und Willenbacher in einer stillen Ecke persönlich beschimpfen, aber ihm in den Rücken fallen, das ging nicht.
»Ich bin schon fast wieder weg«, sagte sie nur.
»Und was ist mit Tava?«, fragte Otto.
»Nichts. Also, nichts, was sich geändert hätte.«
»Wieso ist das eigentlich so wichtig«, mischte Mang sich jetzt ein, »auf welcher Seite vom Koran dieses Bild war? Bearbeiten wir das hier als Tötungsdelikt?«
»Wir bearbeiten es genau«, sagte Bettina mit Seitenblick auf den Staatsanwalt. Man sah nur seinen Rücken. Er redete.
»Und jetzt mal ohne Scheiß, Tina, wenn da so ’ne Koranfrage ist, wieso wird dann nicht Tava gefragt, ist der Moslem oder nicht?«
»Weiß ich nicht«, sagte Bettina und spähte nach einem Fluchtweg.
Mang senkte sein Klemmbrett. »Also weißt du, ich bin echt kein Freund von diesen scheiß Ka–« Er verschluckte den Rest und setzte neu an. »Ich bin ja jetzt nun wirklich nicht, äh –«
Pause. Plötzlich waren alle da, die Köpfe erhoben, die Blicke offen und frei, sie sahen sich an. Niemand sagte was.
Mang holte Luft und kriegte die Kurve. »Aber das hier, Tina, das könnt ihr mit Tava nicht machen.«
Hach Mang, dachte sie. »Ich muss jetzt gehen«, sagte sie, fast bedauernd. Sie schob das Bild in ihren Ärmel, drückte sich an Mang vorbei, blendete die Kollegen aus, so gut es ging, und versuchte, trotz ihres orangefarbenen Pullovers unsichtbar zu werden und so schnell wie möglich zu verschwinden.
Als sie dann mit dem Betreuer redete, um sich die Personalien des Exorzisten raussuchen zu lassen, krachte ein ungeheurer Donner vom Himmel, so laut, dass sie die Schallwellen erst im Magen und dann in den Ohren spürte. Darauf setzte Hagel ein, der mächtig gegen das Dach und vor allem irgendein metallenes Bauteil hämmerte. »Mist, ein paar von den Jungs sind noch draußen«, sagte der Betreuer, kritzelte eilig einen Zettel voll, drückte ihn ihr in die Hand und verließ den Raum. Da erst dachte sie an Unwetter und Regen und den Garten. Doch sowie sie im Ausgangsbereich wieder natürliches Licht sah und schließlich draußen vor der JVA im Freien stand, war der Spuk vorbei. Von den Dachrinnen tropfte es, im Gully rauschte Wasser, doch über allem erschien jetzt groß und glänzend eine heiße Sonne, die zarte Nebelschwaden aus der Straße zog und das bisschen Hagelweiß in den Ecken zusammenschmolz.
Bettina schaute auf ihren Zettel. »Moritz Johann Hansen«, stand da sehr undeutlich, und eine Adresse in einem Ort namens Frohnwiller. Und hinter der Telefonnummer eine Abkürzung, die sie als JUZ entzifferte.
Was hatte sie sich vorgestellt? Einen von oben bis unten tätowierten, aus der Lederkluft nach Rauch stinkenden, silberbehängten Satanisten mit Lidstrich und langem Zopf? Wohl kaum. Wie sah ein katholischer Exorzist aus? Blass und streng und konservativ? Tatsächlich war Moritz Johann Hansen drahtig und sehr tätowiert. Indigofarbene Ranken und Buchstaben bedeckten seine Arme, außerdem trug er eine Madonna auf dem rechten Bizeps. Dazu kurzes Haar und Ohrringe in beiden Ohren. Er stand an der Tür zu einem malerisch zugewachsenen Flachdachbau, dort verabschiedete er drei Jugendliche mit Gitarrenkästen, und er war es wirklich. »Moritz Johann Hansen?«, fragte Bettina, die Jugendlichen schauten belustigt, flachsten Unverständliches unter Erwachsenenradar, und Hansen grinste und nickte.
»Mojo«, dröhnte er in tiefstem Bass, ergriff ihre Hand, nach Rauch roch er auch. Sein Blick wanderte schnell, er besaß die nervöse Unschärfe der Musiker. »Herein«, sagte er und führte sie in einen Raum, der ganz mit alten Teppichen ausgehängt war. »Akustik«, kommentierte er mit Blick auf die Wände, das war wohl der Proberaum des hiesigen Jugendzentrums, es standen auch allerhand Mikrofone und Verstärker herum. Er wies auf eine sehr durchgesessene Couch im 80er-Volleiche-Stil und setzte sich in den zugehörigen Sessel. »Du bist Silas’ Mutter?«, fragte er. »Wie schön, dass –«
Bettina schüttelte den Kopf. »Kriminalpolizei.«
»Aha.« Mojo Hansens Haltung änderte sich kaum, seine Augen wurden kurz schmal, dann legte er den Kopf etwas schräg. Um das linke Auge prangte ein veritables Veilchen. »Bist du jetzt echt noch mal wegen diesem Brief gekommen?«, blieb er beim Du. »So einen haben wir nie wieder gekriegt. Wir haben da auch dran gearbeitet, Seminar und alles. Ich würde für die Kiddies die Hände ins Feuer legen.«
Bettina lächelte. Das war eine der verrückten Seiten ihres Berufs: Sie bekam alles erzählt. Es rutschte den Leuten einfach heraus. »Was für ein Brief?«, fragte sie sanft.
»Drogen …?«
So. Bettina zögerte kurz. Du oder Sie? Autorität zeigen (was sie sollte) oder vielleicht noch mehr erzählt kriegen (was sie interessierte)? »Was genau meinst du?«
Er sah sie an und sein schwebender Blick wurde plötzlich klar. »Nicht so wichtig.« Sein Gesicht war hager, als hätte er schlagartig sehr viel abgenommen, aber schon vor längerer Zeit. Braune Augen, ein entschlossener Mund. Ein schönes, ernstes Gesicht. Mit einem Veilchen.
»Was war hier mit Drogen?«
»Jemand hat sich ein Päckchen irgendwas an die Adresse von der Pfarrei schicken lassen.« Hansen verschränkte die Arme. »Aber wir haben das besprochen.«
»Wer hat sich ›irgendwas‹ schicken lassen?«
»Wissen wir nicht und ist auch schon ewig her.« Jetzt sah er ein bisschen spöttisch aus.
Okay. »Tatsächlich bin ich wegen was anderem da. Ich hab Fragen zu Muhammad Al-Afghani.«
»Muhammad.« Hansen fuhr sich mit dem marienbewehrten Arm vom Nacken aus über den Kopf. »Zu dem hab ich leider keinen Kontakt mehr.«
»Er ist heute Nacht verstorben.«
»Was?«
Die Meldung war online, aber noch nicht lang. »Tut mir leid.«
Hansen sprang auf. »Was ist passiert?«
Bettina seufzte und sah ihn nur an.
Die Ranken auf Hansens Armen waren plötzlich fast schwarz, sein Gesicht grau. »Fuck. Oh Mann.« Er blickte auf. »Wieso – nichts gegen dich, aber wieso krieg ich die Nachricht persönlich überbracht?«
»Wir müssen möglichst schnell Diskretion anmahnen«, sagte Bettina. »Es ist momentan von allgemeinem Interesse, die Berichterstattung um Al-Afghani nicht unkontrolliert hochkochen zu lassen.«
Er starrte sie an. »Diskretion? Wieso? – Was ist passiert?«
»Das wird noch untersucht, aber wir gehen von Suizid aus.«
»Oh nein.« Hansen fiel in den Sessel, in dem es ihn gerade eben nicht mehr gehalten hatte.
Bettina beugte sich vor. »Und du hast bis vor einem halben Jahr Teufelsaustreibungen an ihm vorgenommen. Das wird viele Journalisten interessieren.«
Hansen sah auf, Augen schmal und düster, Fäuste geballt. »Diese Idioten. Diese bescheuerten, bornierten Idioten«, grollte er mit tiefer Stimme.
»Die tun auch nur ihre Arbeit.«
»JVA. Ich hatte Kontakt zu Muhammad. Wir hatten unsere Abmachungen, unsere –«
»Exorzismen?«
Er schüttelte den Kopf, als wollte er das Wort loswerden. »Was ist so schlimm daran? Wen soll das jucken?«
»Du hast gefährliche Psychosachen gemacht. Mit einem labilen Inhaftierten, den das ganze Land kennt. Wir können nicht vorhersehen, was so eine Info vielleicht auslöst.«
»Ich habe Muhammad geholfen. Mehr nicht.«
»Wir müssen verstehen, was da überhaupt passiert ist.«
»Muhammad ist tot!«
»Weil …?«
»Der Junge hatte Dämonen.«
Davon war Bettina überzeugt. »Aber waren die von ihm zu trennen?«
Hansen schnaubte nur.
»Der Betreuer in der JVA sagte, dieses – was auch immer ihr gemacht habt, hätte ihn belastet.«
»Das ist ein Arsch.«
»Machst du das öfter?«
»Was?«
»Dämonen austreiben.«
Er fuhr sich wieder über den kurzgeschorenen Schädel. »Wie hat er es getan?«
Bettina schüttelte den Kopf und hob die Hände.
»Oh fuck.« Hansen stand wieder auf, begann unruhig im Raum herumzutigern. »Niemand ist an Muhammad rangekommen. Nicht mal er selbst. Er hat nicht gewusst, wer er war, oder er hat so lange so getan, als ob er es nicht wüsste, dass er den Überblick verloren hat. Die Gutachter haben sogar seine Sprache analysiert, um rauszukriegen, wo er ursprünglich herkam und wie alt er war. Er war älter, als er behauptet hat. Das war mir klar. Er war aber auch fürchterlich getrieben.«
»Er war ein Mörder.«
»Ja.«
»Wie hast du ihn kennengelernt?«
»Die Wüste, eine Selbsthilfegruppe.«
»Für …?«
»Hauptsächlich gegen Suizidgedanken«, sagte Hansen flach. Er holte Luft. »Allerdings versuchen wir, das Wort und dieses ganze – Mindset nicht zu verwenden. Es triggert.«
»Es ist eine größere Gruppe?«
»Es gibt eine Dachorganisation und einzelne Zellen. Wir arbeiten mit Patenschaften. Manche Zellen bieten anonyme Treffen an.«
»Du bist da Aktivist?«
»Ich bin – war Muhammads Pate.«
»Ist das bei euch üblich, dass ihr Dämonen austreibt?«
Hansen blieb stehen. »In der akuten Phase ist erlaubt, was hilft.«
»Wieso hast du ausgerechnet mit ihm gearbeitet?«
»Es war bei mir in der Nähe und zeitlich machbar.«
»Es hatte nichts mit seiner Bekanntheit zu tun?«
»Was?«
»Der Betreuer hat gesagt –«
»Du meinst, wir hätten Muhammad ausgesucht, weil er in der Zeitung war?«
In der Zeitung war untertrieben. Al-Afghani war überall gewesen. Er war in den Köpfen der Menschen. »War es so?«
»Nein!«
»Okay, und wie oft hast du ihn besucht?«
»Dienstags nachmittags. Etwa ein Jahr lang.«
Bettina holte die Plastiktüte mit dem Totenzettel aus ihrer Tasche und hielt sie hoch, das kleine Bildchen hing in der Luft zwischen ihnen, die Seite mit den Dämonen auf Hansen gerichtet. Er zuckte zurück.
»Hast du Muhammad diese Viecher gegeben?«, fragte Bettina.
»Das war sein Notfalltool«, sagte Hansen leise, der Bass war fast ausgeschaltet, ein reines Flüstern.
»Wo warst du, guter Jesus, wo warst du, um meine Wunden zu heilen?«, las Bettina von der Rückseite vor. »Ist das die richtige Botschaft für einen Selbstmordgefährdeten?«
Er schnaubte. »Was glaubst du denn, wie man das Grauen loswird? Sagst dir: Gibt es nicht?«
»Sport«, sagte Bettina und hielt das Bild weiter hoch. »Arbeit. Sich suhlen hilft nicht. Meine Meinung.«
»Visualisieren ist manchmal die Rettung«, widersprach Hansen, den Blick starr auf die Dämonen gerichtet.
»Heißt es nicht: Du sollst dir kein Bild machen?«, fragte Bettina und dachte gleich darauf, dass das nicht wahr sein konnte, dass sie jetzt tatsächlich in Bibelzitaten sprach, ganz so, wie Willenbacher es wünschte. »Und ist das Bilderverbot im Islam nicht noch viel strenger? War Muhammad nicht Moslem?«
»Er war ein Mensch.«
»Okay«, sagte Bettina, »du arbeitest für die katholische Kirche, oder?«
»Ich bin hier Sozialarbeiter.«
»Und du bist ein, hilf mir, ausgewiesener, offiziell kirchlicher Exorzist?«
Hansen starrte sie an.
»Also quasi im Namen des Herrn unterwegs?«
»Ich habe mit Muhammad gebetet. Sonst nichts.«
»Bist du dafür ausgebildet? Weiß deine Kirche überhaupt davon?«
Er hob die Hand an den Nacken und ließ sie da, jetzt linste die Maria seltsam von seinem Bizeps herunter.
»Was ist, ja oder nein?«
»Niemand ist dafür ausgebildet!«
Sie legte den Kopf schräg.
»Jedenfalls nicht hier in Deutschland.« Er ließ die Arme sinken.
»Dann erklär mir doch bitte mal, was du da überhaupt gemacht hast.«
»Es ist ein spiritueller Kampf. Jemand hat etwas in sich, was er nicht behalten will, und das versucht ihr beide mit vereinter Kraft aus ihm rauszustoßen.« Jetzt sah er sie mit dunklem Blick an: Glaub es oder nicht. »Dazu brauchst du keine besondere Konfession oder Religion, das ist einfach nur Überlebenshilfe.«
»Wie geht das, etwas aus jemandem rausstoßen?«
»Beten.«
»Was beten?«
»Du sprichst das Böse an und vertreibst es.«
»Also betest du zum Teufel?«
»Natürlich nicht«, sagte Hansen unwirsch. »Du schickst ihn weg. Das machst du so lange, bis er verschwindet.«
Muss ich mal probieren, dachte Bettina. So auf der Arbeit. »Dann hast du das getan, was ein echter Exorzist tun würde, nur, dass du dazu nicht befugt bist.«
»Ein befugtes Befreiungsgebet kriegst du in Deutschland sowieso nicht!«
»Warum nicht?«
»Weil es hier keine Dämonen gibt.«
Sie musterte ihn mit erhobenen Brauen.
»In Italien«, blaffte er, »wenn du Glück hast, macht das dein Gemeindepfarrer. Polen genauso. Geh nach Tschenstochau, da ist es kein Problem. USA, die schicken Priester nach Rom auf Lehrgänge. Nur hier in Mitteleuropa wird es nicht gemacht. Da musst du erst zum Psychiater. Und weiter kommst du nicht.« Er ließ sich neben ihr auf die Couch fallen und sah sie aus nächster Nähe direkt an. Braune Augen, ein bisschen starr, mit ein paar roten Äderchen drin. Bartstoppeln auf den Falten. Ziemlich dunkle Haut, deren Grundton gut mit dem Indigo von den Tattoos harmonierte. Und auch mit dem Veilchen.
»Hast du das mal versucht?«, fragte sie ihn.
»Was?«
»Psychologisch statt spirituell zu helfen?«
Hansen seufzte. Es klang fast amüsiert. Wo er so neben ihr saß und nach Rauch roch, bekam Bettina Lust auf eine Zigarette. Hatte sie schon ewig nicht mehr gehabt, aber Hansen, an dem roch es irgendwie gut. Jetzt beugte er sich vor, stützte die Ellenbogen auf die Knie und schaute in den Raum hinein. »Ich hab mal versucht, eine Gutachterin davon zu überzeugen, dass ich selbst besessen bin. Hat aber nicht geklappt.«
»Wie, da werden Gutachten gemacht? Über Besessenheit?«
»Ja«, sagte Hansen, sah sie plötzlich von der Seite an und grinste.
Sie reagierte mit einem Lächeln. »Schräg.«
»Wieso?« Sofort zog er die Brauen zusammen: Du respektierst meinen Glauben nicht.
»Immerhin weißt du jetzt, dass du clean bist. Von Teufeln. Sogar mit Nachweis.«
»Ganz so clean war ich nicht. – Das Gutachten konnte nicht fertiggestellt werden. Ich hab den Drogentest nicht bestanden.« Er sprang wieder auf, zu nervös, um lange zu sitzen. »Ich hatte nichts genommen. Ich hab noch nie LSD genommen. Aber der Test war positiv.«
»Hm«, machte Bettina.
»Wahrscheinlich die Jugendlichen«, sagte er widerstrebend.
»Die haben dir was in die Limo getan?«
»Das wollte ich nie wirklich glauben. Ich vertrau denen. Und es war direkt nach unserem Seminar. Da waren die eigentlich alle eingenordet.«
»Vielleicht war der Test fehlerhaft? Hast du ihn wiederholt?«
»Nein.« Er starrte sie einen Moment lang an, als sei ihm die Idee nie gekommen. Dann zuckte er die Achseln. »Wie auch immer, ich hab mit den Kids geredet. Wir haben es jetzt im Griff.«
»Okay«, sagte sie und stand auf. »Also. Meine Vorgesetzten werden sich höchstwahrscheinlich mit den Verantwortlichen aus der Diözese über deine Beziehung zu Al-Afghani austauschen. Katholischer Exorzismus an einem so kontroversen Straftäter, das hat leider Potenzial für einen großen Aufreger, das können die nicht unvorbereitet auf sich zukommen lassen. Die werden miteinander reden.«
Hansen nickte und sah plötzlich müde und alt aus. Das Veilchen leuchtete sehr violett.
»Kann sein, dass ich wiederkomme, wenn wir noch Fragen haben. Rede am besten sonst nicht darüber. Nicht mit Fremden.«
»Hatte ich nicht vor.«
Irgendwie hatte sie das Gefühl, das Gespräch sei noch nicht vorbei. »War das ein Dämon?«
Er blickte verständnislos.
Bettina deutete auf sein linkes Auge.
Er betastete die Stelle, furchte die Stirn und sah sie ernst an. »Würdest du mir eh nicht glauben«, sagte er.
Als sie heimkam, war es Abend, und die Abende in dem alten Haus in Grünstadt waren lang. Nachtessen, einen Freitagabendfilm für die Kinder finden, Bügelwäsche ignorieren. Dann saß sie irgendwann auf dem Balkon – auf dem ganz kleinen westlichen, der sich vor ihrem Schlafzimmer befand – und blickte hinaus in den dunkel werdenden Garten. Die Luft, die von dort aufstieg, war immer noch warm, darüber ein jetzt aufgeklarter Himmel mit blitzenden Diamantsternen. Noch mächtiger allerdings waren das Moos, die Feuchte und die alten Bäume. Bettina legte die nackten Füße auf das rostige Balkongeländer, schloss die Augen und versuchte, den Garten zu spüren. Was sagte ihre nackte Haut? Hieß es nicht, dass dort an den Fußsohlen alle Nerven zusammenkamen? Dass man da die Verbindung spüren konnte, zur Erde, zum Universum, zu den Wurzeln? Bettina fühlte nur ein schwaches Lüftchen und das raue, farbblättrige Geländer. Trotzdem schön. Sie öffnete die Augen, blinzelte in die Nacht – und sah ein Licht. Dort vorn, in den Baumkronen. Ein goldenes Viereck mit einer menschlichen Silhouette darin.
Sie blinzelte wieder, setzte sich auf und schaute genauer hin. Ein Fenster in den Baumkronen? Unmöglich. Schlief sie? Nein. Die Silhouette bewegte sich. Ein Mann. Er stapelte etwas.
Bettina erhob sich und beugte sich übers niedrige Geländer, um besser zu sehen. Wer war das? Wo war es? Von hier aus konnte man doch nur ins Laub sehen. Rechts und links von ihrem Grundstück, ja, da grenzten die Handtuchgärtchen der neuen Reihenhäuser an, aber geradeaus, da war nichts.
Außer diesem leuchtenden Viereck.
Der stapelnde Mann legte irgendwas Kistenähnliches in Augenhöhe ab, dann hielt er inne, hob den Kopf, schaute sich um. Bettina trat einen Schritt zurück, als sei sie beim Spionieren erwischt worden. Sie fragte sich, ob sie sichtbar war wie er. Licht hatte sie keins an, aber die Hauswand hinter ihr war hell.
Der Mann trat vor, er befand sich, wie Bettina jetzt erkannte, ebenfalls im Freien, vielleicht auf einem Balkon wie sie, er trat an eine Brüstung, halb aus dem leuchtenden Viereck, das wohl eine Türleibung war, nach vorn. Und blickte in den Garten. Zumindest vermutete Bettina das, sein Gesicht lag im Dunkeln, und die Gestalt war zu klein, um Details wie die Blickrichtung zu erkennen. Trotzdem sah sie an seiner Haltung, dass er suchte. Mich, dachte Bettina. Die Beobachterin, die er spürt. Sie trat noch einen Schritt zurück, während er sich gleichzeitig vorwärts über die Brüstung beugte. Tango, dachte sie. Du kannst mich nicht sehen, aber wir tanzen. Eine Weile standen sie so, und vielleicht trafen sich ihre Blicke irgendwo im schwer belaubten Geäst. Dann wandte der Mann sich ab, ging durch seine eckige Balkontür in den goldenen Schein zurück und das Licht erlosch.
Bettina sank auf ihren Stuhl zurück und dachte vage an eine Zigarette. Dann dachte sie, dass es wieder mal typisch für sie war zu glauben, dass die Welt an der Gartenhecke endete. Natürlich war hinter diesem Wald, diesen Dornen, diesem undurchdringlichen Gebüsch wieder Zivilisation. Ein Haus. Menschen. Goldener Schein.
In der Nacht träumte sie von einem gelborangen Leuchten, das magisch strahlte, aber trotzdem zu weit entfernt war, um einem in der Finsternis umherirrenden jungen Mann die Richtung zu weisen. Sie war der junge Mann, und sie starb. Da öffnete sich in der dunkelsten Tiefe eine eckige Luke mit einem warmen Licht und lockte sie, doch sie wollte nicht durchgehen. Wo warst du, dachte sie, als er gestorben ist. Als er seine Freundin umbrachte. Vergiss es. Ich komm nicht in dieses billige Glück. Ich bleibe hier bei ihm. Da schien das Schwarz zu ächzen und das Licht sich zu verflüssigen und sie erwachte. Frierend, obwohl die Nacht warm war und die Luft sich anfühlte, als sei sie aus dem goldenen Zimmer mit herübergeflossen.
Bettina erhob sich, suchte ihre runtergefallene Decke vom Boden, wickelte sich ein, entspannte kurz, konnte aber nicht mehr schlafen. Schließlich holte sie fluchend ihr Handy vom Nachttisch und googelte die Versuchungen des heiligen Antonius. Wann, wenn nicht in dieser Zwischenstunde kurz vorm eigentlichen Erwachen, konnte sie hoffen, den Isenheimer Altar zu verstehen? Also betrachtete sie die Vogel- und Echsenmonster, die prügelnden Teufel, den schrecklich kranken Mann mit dem aufgetriebenen Bauch in der Ecke. Er hat Entenfüße, stellte sie befremdet fest.
Ich bin nicht die Zielgruppe, dachte sie dann. Ich fürchte mich nicht. Am unheimlichsten noch fand sie den Heiligen selbst, der steif zwischen all den Monstern lag. Seltsam, wie lange sie gebraucht hatte, um ihn überhaupt zu sehen. Dabei war er doch der Gute.
Aber war er das wirklich?
Offenbar focht er in diesem starren Zustand einen Kampf aus, rang mit Dämonen um die schiere Frage, ob es sie gab oder nicht. Ja, sagte das Bild, schau sie an, sie sind doch da! Jeder hat ein Gesicht! Und: Nein, sagte das Bild, siehst du nicht, dass sie zu schrill sind? Das müssen Einbildungen sein! Das ist nur ein Teil von dir!
Und vielleicht war das der eigentliche Grusel: eingeschlossen zu sein innerhalb der Grenzen der eigenen Vorstellungskraft, zu wissen, dass es so war – und ihr trotzdem ausgeliefert zu sein. Das waren die Dämonen, die einen am Ende kriegten, ob sie echt waren oder nicht.
Sie schaltete das Handy aus und schaute aus dem Fenster. Draußen im Gewirr der Baumkronen ging die Sonne auf. Der Himmel darüber glühte gelborange. Gott, wenn es ihn gibt, will mich foppen, dachte sie. Sie stand auf, ging raus auf den Balkon und versuchte, zwischen den alten Bäumen hindurch das Fenster zu erkennen, das sie gestern Abend so deutlich hatte sehen können. Es musste zu einem Haus gehören, dem Haus auf der anderen Seite. Doch die aufgehende Sonne blendete zu sehr.
Foppen.
2
Lavendelwasser, so warm, dass es dampfte. Ein sauberer Mopp, doppelt ausgespült, Besen und Kehrblech. Der Schlüssel zur Kirche. Drei Schlösser aufsperren, das gewöhnliche Türschloss ganz oben, das zweihundert Jahre alte Kastenschloss in der Mitte, das Sicherheitsschloss darunter. Dann die schwere Tür aufziehen, kühle Luft von innen abfließen lassen. Brille absetzen, Augen umgewöhnen ans Dunkel. Eintreten. Putzen. Ja, putzen. Es ging Elle nicht darum, gefällig zu sein, Gutes zu tun, obwohl sie tatsächlich viel zu schlecht bezahlt wurde. Sie war nur einfach gern an diesem aufgeladenen Ort. Meistens schloss sie wieder hinter sich zu, weil es so schön war, allein zu sein in dieser Welt aus all den alten Sünden, die sich hier überall in die Ritzen gesogen hatten. Einfach arbeiten, ganz gewöhnlich schrubben neben dem Tabernakel mit den Goldkelchen, ums ewige Licht, in den Beichtstühlen. Wachs abkratzen unter dem großen Kerzenständer des Marienaltars. Nirgendwo sonst war die Zeit so zu spüren. Die frühgotische Unsere Liebe Frau war älter als jedes andere Haus im Ort, älter als jeder Weinstock in den Wingerten ringsum, ja sogar älter als jeder einzelne Baum im Pfälzerwald. Als diese Kirche gebaut wurde, gab es gerade mal dieselben Berge, Wege und Feiertage wie heute. Sie war eine Verbindung in jene fremde Welt, aus der die Gegenwart entstanden war, darum gehörte sie allen. Auch Elle. Obwohl Elle nie Katholikin gewesen war und es nie sein würde. Es war einfach ihr Recht als Mensch, in diese gewachsene Spiritualität einzutauchen, auch ohne knien und beten, befolgen und glauben. Also schloss Elle jeden Samstag- und Montagmorgen die Tür zu Unsere Liebe Frau auf und atmete tief den Geruch des alten Holzes ein, das jahrhundertelang mit Weihrauch und Kerzenruß und immer neuer Andacht imprägniert worden war.
Heute war aber etwas anders.
Es roch. Chemisch. Nach Renovieren. Hatte vielleicht endlich jemand die Holzvertäfelung der Sakristei gestrichen? Nötig wäre es ja.
Nein. Ein kurzer Blick in den vollgestopften Raum zeigte ihr: alles wie immer. Hier war der seltsame Geruch sowieso kaum noch wahrnehmbar. Vermutlich von außen mit hereingeweht. Elle vergaß ihn und legte los, wie immer zuerst in den Ecken um den Hochaltar herum, an den Stühlen für die Messdiener vorbei, dann bei dem Tisch für Wein und Wasser, dem Altar, den Stufen mit den Kniepolstern und der Glocke. Sie endete an der Osterkerze und der großen Vase. Dann hatte sie die Apsis durch und schleppte den Eimer ins südliche Seitenschiff vor den Marienaltar.
Da war dieses chemische Aroma wieder, diesmal stärker.
Ganz frische Farbe, irgendeine Art von Lack, beißend. Sie hob die Nase und schnupperte. Schaute auf das lebensgroße Marienbild, das überm Altar hing.
Nichts.
Merkwürdig, hier nahm die Intensität zu. Elle griff nach dem Schaber, der brav an seinem Platz neben der gusseisernen Spendenkasse lag, und inspizierte den Kerzenständer. Hundert Lichter passten drauf, drei brannten. War aber auch Samstagmorgen, und freitags wurde nicht viel gebetet. Keine Wachsreste auf dem Boden. Sie sammelte die paar leeren Teelichthalter ein und sah sich noch mal um. Der Geruch ging nicht weg. Also gut: Der Kerzenständer war definitiv nicht frisch gestrichen. Was war mit dem Marienaltar? Darauf lag eine weiß gestickte Decke und da stand die blaue Porzellanvase, heute mit Margeriten. Alles wie am Montag. Oder? Nein, gewöhnlich befanden sich die Blumen weiter rechts. Damit sie ganz genau unter der Stelle des großen Marienbildes standen, wo das Jesuskind zu sehen war.
Aber es war weg.
Bild noch da, Kind weg.
Das Schrägste an der Sache war: Es dauerte eine ganze weitere Minute, bis Elle erkannte und verstand, dass dieser Jesus nicht einfach aus dem Bild spaziert und verschwunden war. Jemand hatte ihn schwarz übermalt. Daher der Geruch. Aber die Farbe war so deckend, so exakt auf das Kind aufgetragen und so matt, dass sie das Gemälde nicht verschandelte. Es war keine hilflose Schmiererei. Es war ein Statement. Irgendwer hatte in Unsere Liebe Frau in Frohnwiller in der Nacht der Sonnenwende den Jesus am Marienaltar geschwärzt.
Elle machte ein Foto. Die Maria dort oben lächelte ihr freundlich und eine Spur komplizinnenhaft zu, ein schwarzes Bündel im Arm, sich keines Verlustes bewusst.
Da erst erschrak Elle wirklich.
Denn im Grunde war die Sache sehr einfach. Es gab zwei Schlüsselsätze für die Kirche. Seit dem Unfall des Pfarrers verwahrte einen davon die Gemeindereferentin Ina, den anderen der Sozialarbeiter Mojo. Ina war fast eine Freundin, eine oft hadernde, wunderbar unkonventionell denkende Katholikin, die irgendwie in dieses Leben geboren war. Sie sah entwaffnend spießig aus und funktionierte immer tadellos. Mojo wirkte dagegen ziemlich verrückt, zuweilen sogar pubertär und obercool. Er hatte ein bewegtes Leben hinter sich, über das keiner das Geringste wusste. Und seine erste Amtshandlung hier war vor sechs Jahren (oder sieben?) ein Graffitiworkshop mit der Jugend gewesen. Wenn es also um illegales Malen ging, wer würde da wohl in Verdacht geraten?
Elle mochte Ina (die es echt nicht gewesen sein konnte), war aber grundsätzlich auf der Seite des Protests (wenn er nicht total destruktiv war), und sie wollte nicht, dass Mojo Ärger kriegte. Er war ein Mensch. Selbst wenn er beschloss, einen Jesus zu schwärzen (was ihr nicht ganz unmöglich vorkam), würde er dafür einen Grund haben. Keinen vernünftigen, klar, aber einen Grund. Sie blickte ihr Handy an: Hatte sie Mojo als Kontakt eingespeichert? Nein, aber das Jugendzentrum. Sie drückte auf »Verbinden« und wartete. Die Maria schickte ihr weiter dieses heitere, unbehelligte Lächeln herunter. Mir geht’s gut, sagte es. Besser als je. Kinder können auch eine Last sein.
Verrückt ist es trotzdem, antwortete Elle, Schwester zu Schwester. Warum den Jesus schwarz anmalen?
»Jugendzentrum Unsere Liebe Frau!«, meldete sich Mojo etwas atemlos, sein Bass dröhnte durchs Telefon.
Er ist da, dachte Elle sofort erleichtert. »Hallo, Mojo, Elle Kling hier, ich bin in der Kirche, kannst du grade mal rüberkommen? Hier ist was passiert.«
»Leider bin ich nicht hier, bitte hinterlasse deine Nachricht nach dem Ton.«
Witzbold.
Eine halbe Stunde später waren dann zumindest ein paar wichtige Leute da: Ina, die Bullen und drei Damen vom Rosenkranz, die zufällig vorbeigekommen waren.
»Also dann erklären Sie mal von Anfang an«, sagte ein Polizeioberkommissar Barolo. Der andere, der mehr nach Praktikant aussah, schrieb mit.
Elle erklärte. Die anderen Anwesenden betrachteten etwas ratlos das Bild. Am wenigsten erschüttert wirkte Ina. Sie hatte beim Anblick der Maria nur kurz die Brauen gehoben und schien jetzt mit den Gedanken schon wieder woanders. Vielleicht bei ihrem anstrengenden Familienleben. Sie hatte eine schwierige Tochter, die in Berlin herumgammelte, eine ebenso ferne und sehr kleine Enkelin und zu Hause einen erwachsenen Sohn, der ständiger Pflege bedurfte. Sie sah oft müde aus. Manchmal sogar böse, streng und übernächtigt, so wie jetzt.
»Wer hatte denn den Schlüssel?«, fragte eine der Rosenkranzdamen scharfsinnig.
»Da müssen wir Mojo fragen, der hat auch einen Satz«, sagte Ina eine Spur abweisend. Und zu den Polizisten: »Mojo Hansen, unser Sozialarbeiter hier. – Also unseren hatten wir die ganze Nacht im Pfarrhaus am Schlüsselbrett. Wie immer.« Sie seufzte und sah plötzlich erschöpft aus.
»Sie hatten die Schlüssel die ganze Zeit?«, fragte Barolo. Das Gesicht dieses Bullen kam Elle zunehmend bekannt vor. Vermutlich hatte sie mit dem schon zu tun gehabt.
»Gut, vorhin hab ich den Bund an Frau Kling hier gegeben, die zum Putzen gekommen ist.«
»Sonst war niemand da? Die ganze Nacht nicht? Niemand kann den Schlüssel genommen haben?«
»Nein, aber, wie gesagt, Mojo Hansen besitzt auch einen Satz«, sagte Ina, jetzt fester, sodass der Gedanke im Raum verharrte und einen Verdacht gebar. Kaum aber war diese Niederkunft abgeschlossen, formierten sich die Rosenkranzdamen zu einem Chor, der energisch Mojos Vertrauenswürdigkeit bekräftigte. Sie kannten ihn, er war zuverlässig, und dass er nicht ans Telefon ging, war ein klarer Pluspunkt, zeigte es doch, dass er seine Arbeit ernst nahm und nicht ununterbrochen am Handy hing wie andere Leute. Vermutlich rettete er irgendwo ein Leben und hatte auf jeden Fall Besseres zu tun.
Elle amüsierte es, dass Mojo mehr Rückhalt im konservativen Teil der Gemeinde hatte als vermutet. Als Barolo nachfragte, ob der Herr Hansen nicht schon Jugendcamps mit Graffitikursen veranstaltet hätte, entstand ein richtig peinlicher Moment. Denn die Graffiti konnte keine bestreiten, und außerdem wusste jede hier: Falls der Kirchenschlüssel wirklich verlegt, heimlich verliehen oder benutzt worden war, um nachts einzubrechen, konnte eigentlich nur Mojo verantwortlich sein. Wie aber das ansprechen, ohne es zu sagen? Schließlich fand eine der Rosenkranzdamen einen Ausweg: Der Täter hatte sich wahrscheinlich einschließen lassen. Denn die Kirche stand tagsüber allen Gläubigen offen. Da konnte jemand hereingekommen sein und sich versteckt haben. Gelegenheit dazu gab es ganz sicher, denn schon morgens nach dem Putzen ließ Elle die Tür unverschlossen, und erst abends nach Andacht, Rosenkranz, Gottesdienst oder Anbruch der Dunkelheit wurde wieder verriegelt. Von Ina, meistens, die wohnte ja direkt nebenan. So auch gestern, nicht wahr?
»Ja«, sagte Ina. Eine steile Falte auf ihrer Stirn wurde tiefer. »Aber eins stimmt, Mojo war gestern Abend ziemlich komisch«, sagte sie zögernd. »Ganz ehrlich, ich hab mich über ihn geärgert, denn er weiß genau, dass ich dieses Wochenende nicht kann und dass aber einer von uns beiden den Sonntagsservice machen muss. Das war seit Ewigkeiten geplant! Dann sagt er irgendwas von diesem Mörder von Sophie, ihr wisst schon, der jetzt plötzlich bedauert werden muss, weil er ein Selbstmordopfer sein soll, und ist ab. Ganz kurz vorm Wochenende.« Sie schüttelte den Kopf und warf einen genervten Blick auf die bemalte Maria. »Also ehrlich, ich weiß langsam nicht mehr, was ich denken soll.«
»Das war er nicht«, sagte eine sehr kleine alte Frau mit Silberlöckchen kategorisch. Sie schien kurz nachzudenken. Dann wandte sie sich an Elle und musterte sie von oben bis unten. »Frau, äh, Kling, seit wann heute Morgen sind Sie eigentlich hier?«
Augen richteten sich auf sie. Die Bullen schauten auch plötzlich so aufmerksam. Die waren ja lustig.
»Sie kriegen den Schlüssel, wann immer Sie ihn wollen, oder?«, fuhr Silberlocke fort. »Und manchmal auch bei Mojo?«
Elle holte Luft, doch bevor sie dieser kleinen Alten Bescheid stoßen konnte, griff Ina ihr an die Schulter.
»Bitte, Frau Grimm. Unsere Frau Kling kann es nicht gewesen sein, die hat den Schlüssel kaum eine Stunde, und hier ist geputzt, das wäre allein von der Zeit gar nicht gegangen.«
»Danke«, sagte Elle.
Ina sah sie nicht an.
»Dann hat sich vielleicht wirklich einer einschließen lassen«, sagte Barolo unschlüssig.
»Genau«, knurrte Ina.
»Den sollte die Frau Kling aber doch heute Morgen bemerkt haben, als er rauslief?« Grimm ließ nicht locker und fixierte Elle mit hochgezogenen Brauen. »Haben Sie?«
Elle schüttelte den Kopf.
»Du hast die Kirche nicht verlassen?«, sagte Ina in Elles Richtung. »Du hast sofort die Polizei gerufen, mit dem Handy, genau wie mich?«
»Ja.«
»Dann müsste derjenige ja noch hier drin sein, denn in der Zwischenzeit konnte er kaum ungesehen wieder rauskommen.«
Sie schauten sich um.
Eine Sekunde der Stille.
Niemand stürmte plötzlich aus dem Beichtstuhl.
»Lass uns nachgucken«, sagte Barolo zu seinem Kollegen.
Sie begannen die Kirche abzusuchen. Elle wäre sehr gern dabeigeblieben, doch sie musste fort, einen Kurs geben. Genau genommen musste sie ihn in fünf Minuten schon geben, und, Mist, nicht jede zahlte zwanzig Euro die Stunde für Anders atmen im Wingert, diese Schüler*innen durfte sie nicht verlieren. Sie stürzte also los. Draußen merkte sie, dass sie in all der Aufregung tatsächlich die Kirchenschlüssel noch einstecken hatte. Sie holte den Bund aus der Handtasche, warf einen kurzen Blick drauf, erstarrte: Auf dem Bart des langen Schlüssels fürs Kastenschloss befand sich ein schwarzer Punkt. Ein kleiner Tropfen matte Farbe saß rund und frisch auf dem rostigen Eisen. Sie berührte das Pünktchen. Es hatte locker gesessen und fiel ab. Elle starrte die Stelle an und fühlte einen kurzen und sehr beunruhigenden Schwindel. Schwarze Farbe?
Auf diesem Schlüssel …?
Ich mag Elle, das weißt du. Ich beneide sie sogar. Ihr hat nie einer zu erklären versucht, warum das Weib in der Kirche schweigen soll: wie übertragen das alles gemeint ist, wie differenziert man das sehen muss, welche Vorteile das für eine Frau hat. All den Mist hat Elle nie gehört. Die kann dich anschauen wie eine Schwester. Und wenn es sie interessiert, dann kann sie auch mal eben dein Kind wegschwärzen und gucken, was passiert. Einfach so.
Eine Frechheit.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Maria. Es ist eine Zumutung. So unnötiger Stress. Typisch Elle. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat, wie das irgendwer hat machen können, im Grunde muss es gestern Nacht passiert sein und nicht heute Morgen, als Elle den Schlüssel hatte. Mojo hätte es machen können, Drama würde zu ihm passen, aber der war es nicht, kann nicht sein, der hat sich noch nie für Frauen interessiert … Na ja, Elle ist künstlerisch begabt, die gibt Farbseminare! Die hat das vielleicht in Minuten hingekriegt … Ich werde mit ihr reden. Ich klär das, aber nicht vor der Polizei, und nicht jetzt. Jetzt kümmer ich mich erst mal um meine Kinder und meine Enkelin. Tut mir leid, Maria, aber die Lebenden gehen vor. Und Elle wird sich zu dieser Verrücktheit bekennen. Falls sie es war.
* * *