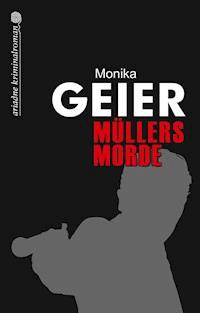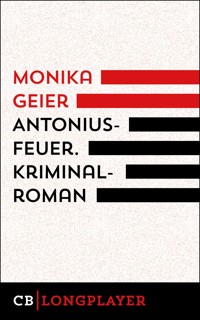7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Aufruhr an der Architekturfakultät: In der Werkstatt für Kunstkurse mitten im Aktzeichenkurs, ja sogar während Kriminalkommissarin Bettina Boll dort gerade mutmaßliche Diebstahlszeugen befragt, geschieht ein Mord! Das Opfer ist das Aktmodell, eine ambitionierte junge Frau aus Estland: Sie wird erstochen, während sie vor aller Augen auf einem Podest liegend posiert. Mit Verve verhört Bettina Boll geltungssüchtige Akademiker und preziöse Künstler, stellt preisgekrönten Architekten nach und trifft in diesem illustren Milieu ausgerechnet auf Max Marquardt, den charmanten Gutsherrn aus ihrem ersten Fall. »Monika Geier verfügt über die Bösartigkeit aller guten Krimiautorinnen, über Witz und die Raffinesse für wirklich subtile Plots.« Tobias Gohlis, DIE ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Wie ein dunkler Schwamm hängt der November über der Pfalz, tränkt Land und Seelen mit endlosem Regen. Kriminalkommissarin Bettina Boll, gebeutelt vom Alltag mit zwei kleinen Kindern, missgünstigen Vorgesetzten und einer fiesen Tagesmutter, soll die Provinzvariante eines Kunstraubs aufklären – doch der Tod ist schon unterwegs ...
»Monika Geiers Erzählhaltung ist maliziös, aber nicht zynisch, spöttisch, aber nicht speichelnd, scharfsinnig, aber nicht naseweis und insofern sehr klug und weise. Rundum erfreulich.« Thomas Wörtche
»In der wunderbar leichten, nur scheinbar in der hinteren Pfalz, eigentlich mitten in der besten Unterhaltungsliteratur angesiedelten Geschichte ermittelt Kommissarin Boll.« Buchjournal
»Bettina Boll, die Gehetzte, die Kluge, die sich nie hinters Licht führen lässt, hat wieder alle Fäden in die Hand genommen. Geiers Morde sind allerfiligranstes Kunst-Handwerk, gemacht aus Augenzwinkern und Hellsicht.« Tobias Gohlis, Die Zeit
Über die Autorin
Monika Geier
Stein sei ewig
Bettina Bolls dritter Fall
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2017
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Printausgabe: © Argument Verlag 2008
Lektorat: Ulrike Wand
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: April.2017
ISBN 9783959880688
Das Problem, das er mit dem Tal hatte, war: der Mönch glaubte im Augenblick, dass das Tal und alles in dem Tal und um es herum, den Mönch und das Pferd des Mönchs eingeschlossen, einheitlich blassrosa sei. Das erklärte eine gewisse Schwierigkeit, jedes Ding von einem anderen Ding zu unterscheiden.
Douglas Adams
-1-
Oben am Himmel, rechts neben dem Fußballstadion, hing, mehr hell als rot, der Mars. Er stand, wie Ella aus der Bildzeitung wusste, gerade auf dem erdnächsten Punkt seiner Bahn, was ihn besonders hell scheinen ließ. In der Bild war das dann fast ein Kollisionskurs: Roter Planet dicht wie nie. Außerdem warnte eine schlichte Schlagzeile: Aufgepasst, Männer: Mars-Strahlen lassen Sex-Hormone schäumen. Oder so ähnlich. Ella hatte die Zeitung nur morgens beim Bäcker auf der Theke liegen sehen. Sie blickte auf die leere Straße vor sich, eine riesige, gelb erleuchtete Kreuzung mit zig Spuren, völlig ausgestorben, für sie war Rot. (Marsstrahlen, wahrscheinlich.) Kurz blinzelte Ella durch ihre Brillengläser – die spielten ihr manchmal Streiche – und zog ihr Fahrrad trotz des Haltesignals nach links, rüber auf die kreuzende Straße, schrammte knapp am Bordstein vorbei – Gott, sie brauchte so dringend neue Gläser für die Brille! – und trat ein paarmal kräftig in die Pedale. Damit hatte sie dann genug Schwung, um sich elegant am Messeplatz vorbeirollen zu lassen.
Das war so ein Phänomen in der Baubranche: die Bild. Jeder wusste, was drinstand. Viele sträubten sich irgendwann dagegen, das jedoch waren, wie Ella mit ihren inzwischen elf Semestern Architektur und diversen Baupraktika wusste, nur vorübergehende Phasen, die höchstens in geschützten Innenarchitekten-Zirkeln länger durchgehalten werden konnten. Wer raus auf die Baustelle und zugeben musste, dass er Ingenieur werden wollte, tat gut daran, Bodenhaftung zu beweisen. Das klappte am besten, indem man seinen Dialekt pflegte, nie etwas fragte und dem Polier regelmäßig die Bildzeitung klaute. Nur nicht, bevor der sie durchhatte, versteht sich.
Die Ampel an der nächsten Kreuzung war grün und dann plötzlich aus, zwei Uhr nachts also, da wurden die Verkehrsanlagen ausgeschaltet. So spät schon. Ella fühlte sich überhaupt nicht müde, im Gegenteil, die frische Temperatur und die Bewegung hatten sie aufgemuntert, die Luft in den einsamen Straßen war wunderbar, kalt und leicht. Über ihr ein klarer Himmel, Sterne, der Mars jetzt rechts zwischen den Dächern. Ella zwang sich, auf die Straße zu schauen. Es roch kräftig nach Herbst und Holz und Erde, der Geruch lag um die Jahreszeit über der ganzen Stadt, Lautringen war von Wäldern umgeben.
Ella fuhr raus zum Friedhof. Zur Baustelle. Sie wusste auch nicht, was sie immer dorthin zog, aber sie war unruhig, konnte nicht schlafen, seit dem Sommer ging das so. Es war fast wie ein Zwang, sie wollte, musste täglich diese große Baustelle sehen, den kahlen, immer noch ungewohnt weiten Platz, an dem das Unglück geschehen war. Aus vielerlei Gründen, die sie gar nicht alle nennen konnte, fand sie diesen Ort, zumal wenn er verlassen lag, faszinierend. Einer davon war sicherlich dieser leichte Grusel, der so eine Absturzstelle umgab, das Wissen, dass die alte Herkules mit dem übermüdeten Reservisten drin auch noch einen Kilometer weiter hätte kommen können, bis zur Uni vielleicht, oder bis zu Ellas Haus. Und was dann passiert wäre.
Noch eine Kreuzung, und da war der Friedhof auch schon, die Straßenseite hell erleuchtet, ein großes Schild, ein Zaun, dahinter viel langer Rohbau mit zwei Kränen, dann ein gestreckter Hügel mit undeutlich schwarzen Bäumen, unter denen, wie Ella wusste, noch unversehrte Gräber lagen, der Friedhof war groß und das Militärflugzeug hatte hauptsächlich den vorderen Teil zerstört, die alte Aussegnungshalle, die historischen Gräber, die angrenzende Gärtnerei und auch ein Stück des dahinter liegenden Altenheims, das jetzt mitsaniert wurde. Ella hielt kurz unter der gemeinsamen Werbetafel der ausführenden Firmen und atmete durch, die Luft hier war weicher und feuchter und roch nach Sand und Zement, diesen Geruch mochte sie. Stehen bleiben wollte sie allerdings nicht. Das war ihr allein doch zu unheimlich, und so stieg sie erst gar nicht ab, sondern radelte nur gemütlich den Parkplatz hoch, durch den etwas schmierigen, breit ausgefahrenen Sand und Dreck, immer schön am Bauzaun entlang. Ihre Hände waren kalt, sie steckte sie zum Aufwärmen in die Taschen, saß hübsch gerade auf dem Rad, gut ausbalanciert, versuchte absichtlich langsam zu fahren, kam ins Schwanken, fing sich wieder. Ein paar inzwischen verregnete Transparente »Amis raus!« und »Stoppt den Flughafenausbau!« hingen hier oben etwas schief am Zaun. Seit der Sommer um war, hatten die Demonstranten ihre immerwährende Mahnwache aufgegeben; sie schliefen jetzt zu Hause in ihren Betten. Bis der Winter um war. Oder der Ausbau des Flughafens in Rahmstein gestoppt, woran aber niemand ernsthaft glaubte, nicht einmal mehr der neue grüne Lautringer OB.
In Höhe der Gärtnerei stand dann eine weitere Tafel, eine kleinere, mit einer Zeichnung der geplanten neuen Aussegnungshalle und dem Namen des Architekten: Thomas Kußler. Ella musste wieder nach dem Lenker greifen, da kam ein Bordstein, nun spürte sie die Kälte. Sie zog ihre Strickmütze tiefer, das Rad machte einen kleinen Hüpfer, plötzlich dachte sie an einen Platz am Kamin. In einem Wohnzimmer. Bei einem Mann, einem – Gespräch. Wein trinken. Vielleicht mit einer Katze auf dem Schoß. Einen Freund, etwas Warmes haben; wenn sie anhielt, war ihr immer so kalt, auch zu Hause in der WG.
Sie kannte Thomas Kußler, vom Sehen. Er sah gut aus. Er war nett. Er war Assistent gewesen, bei ihnen oben an der Uni, bevor er im Sommer den Wettbewerb um den Wiederaufbau des Friedhofs gewonnen hatte. Er war immer in ziemlich ausgefransten Pullovern herumgelaufen, irgendwann hatte es geheißen, seine Frau habe ihn verlassen, was Ella kaum glauben konnte. Aber gut. Nun war sein Gesicht in ganz Deutschland bekannt, er hatte ein Büro mit vier Angestellten, Hemden mit Schlips, und er war immer noch Assistent an der Uni. Für Grünordnungsplanung. Das war Bodenhaftung. Der Mann brauchte keinem Polier die Bildzeitung zu klauen. Und morgen – jetzt fror Ella richtig – würde sie ihn sogar sehen, mit ihm reden, doch darauf freute sie sich kein bisschen, sie mochte kaum daran denken, denn sie würde ihm eine Arbeit vorstellen müssen. Und das war für sie schon ohne Kußler ein Horror. Es würden zwar noch ein paar andere Lehrbeauftragte da sein, vielleicht, dachte sie, fast hoffte sie es, schaffte er es ja gar nicht zu kommen, sicher hatte er viel zu viel zu tun. Vielleicht regnete es auch, dann musste die Veranstaltung ausfallen, denn sie würde im Freien stattfinden, es ging um Skulpturen in einem Waldstück. Tatsächlich war Regen gemeldet. Ella blickte nach oben zum Himmel, er trotzte der Vorhersage klar und wunderschön, mit prächtigen Sternen, der Mars blinkte jetzt halb versteckt hinter einer entfernten Baumgruppe. Ella drehte ein paar Kreise mit dem Rad, weiter ging es nur noch zur Autobahn, hier musste sie umkehren. Sie sah die Kräne hoch, roch den scharfen Geruch des frischen Betons, stellte sich vor, sie hätte hier Arbeit, bei Thomas Kußler. Arbeit. Geld für eine neue Brille. Und dachte daran, wie es wäre, wenn sie auch tagsüber herkommen könnte, ganz normal als Hiwi aus Kußlers Büro, wenn sie Pläne kutschieren und vielleicht mal ein Aufmaß machen würde oder dabei wäre, wenn er mit den Leuten hier sprach. Sie musste sich einfach wieder bewerben, vielleicht klappte es ja irgendwann.
Nun befand sie sich ganz oben am immer noch evakuierten Altenheim, am höchsten Punkt der Anlage, blickte runter auf die Stadt. Wechselte die Straßenseite. Fand den Mars zwischen seinen Bäumen, ließ die Bremse kommen, schoss die breite, einsame Straße hinab, die Brille rutschte, sie sah wenig, das kümmerte sie nicht. Der Mars, dachte sie undeutlich in den frostigen Wind hinein, war das nicht ein Gott des Kriegs? Wenn von dem Planeten wirklich etwas ausging, wäre das dann tatsächlich die von der erhitzten Bild beschworene »Versexung«? Oder nicht eher doch schlicht und einfach – Blutvergießen?
* * *
»Und hier«, sagte der Profiler aus München, während er ein weiteres grausiges Dia in den Projektor schob, »ist er etwas anders vorgegangen.« In seiner trockenen Stimme war ein verhaltenes Beben. Jagdfieber, und das am Morgen, dachte Bettina Boll, die einzige Kommissarin in der Runde. Der Profiler hieß Silberstein und sah aus wie der Gute aus einem Heimatfilm: braun gebrannt, hochgewachsen, ordentlicher Haarschnitt. Er sprach Hochdeutsch, aber mit unverkennbar bayerischem Zungenschlag. »In diesem Fall schimmert die Persönlichkeit, die Leidenschaft ein wenig durch.«
Auf dem Dia war ein von wilden Stichen regelrecht zerfetzter Junge, der auf armseligen blutigen Laken lag. Ornamente zierten seinen Körper, ungeschlachte Zeichnungen aus Blut unter den Achselhöhlen und an den Innenseiten der Oberschenkel, doch diese waren auf dem Foto nicht zu sehen. Nichts war auf dem Foto zu sehen außer entsetzlicher Verachtung. Bettina kamen immer noch die Tränen, wenn sie so etwas sah, heimliche Tränen, mehr ein Kloß im Hals. Nichts, was die Kollegen merkten, und auch nichts, was sie von sachlicher Arbeit abhalten würde, aber etwas, das sich an der Erregung des Profilers stieß.
»Dieses Opfer wurde dreiundzwanzigmal in die Augen gestochen, wobei der Schädelknochen an mehreren Stellen absplitterte«, fuhr der Kollege aus München fort. »Durch die Wucht der Einstiche.« Er illustrierte es mit einem neuen Dia. Bettina sah weg. Seit sie die Verantwortung für zwei Kleinkinder hatte, war sie empfindlicher geworden. Ihre Welt war zu schlecht. Enno und Sammy verdienten keine Ersatzmama, die sich mit scheußlichen Bildern quälte.
»Dreiundzwanzig Stiche in die Augen«, wiederholte Silberstein. »Das ist auffällig. Bei den anderen Fällen, das wissen Sie, gab es nur die Stiche in der Herzgegend, dann die Verletzungen der Hände und Füße, was wir eventuell mit einem Fetisch-Komplex erklären können, außerdem –«
Nun begann er wieder, sich an den einzelnen Verletzungen aufzugeilen. Diese lustvollen Fachausdrücke. Die ständige Wiederholung. Die Zahlen. Bettina betrachtete den Profiler, wie er dastand, breitbeinig, wachsam, vom Licht aus dem Projektor spärlich beleuchtet. Wenn sie ihm aus dem Dunkeln plötzlich einen Ball zuwürfe, würde er ihn noch aus dem Satz heraus abschmettern und weitersprechen. Er befand sich in Deckung, auf sehr aufmerksame Art. Was wohl aus ihm geworden wäre, wenn er sich nicht legal mit all den Gräueltaten befassen dürfte? Ob es weniger Serientäter gäbe, wenn das Wissen um sie in der Öffentlichkeit geringer wäre? Bettina rieb sich die Stirn. Sie war ungerecht. Silbersteins persönliche Motive gingen sie auch nichts an, ja der ganze Gedanke, konsequent weitergedacht, führte nur dazu, dass sie ihre eigene Existenz anzweifeln musste. Im Prinzip tat sie genau das Gleiche wie der Mann vorne am Diaprojektor.
»... wir schließen daraus, dass unser Täter dieses Opfer persönlich gekannt hat, und das, verehrte Kollegen«, Silberstein knipste plötzlich das Licht des Projektors aus, »ist der konkreteste Hinweis, den wir bislang haben. Hier müssen wir ansetzen. Das ist unsere Chance.«
In dem dunklen Raum entstand Unruhe. Hauptkommissar Härting erhob sich und schaltete die Deckenbeleuchtung an; andere sprangen auf, um die Jalousien hochzuziehen. Doch das Licht von draußen war fahl und schwach. Der Winter würde bald da sein.
Bettinas Kollege Ackermann begann das Umfeld des eben gezeigten Opfers zu beschreiben. Ein junger Mann, fast noch ein Kind, der eine in so ziemlich jeder Hinsicht beschränkte Jugend gehabt hatte. Er war früh von zu Hause ausgezogen, hatte ziellos Verschiedenes, aber nicht allzu Unterschiedliches ausprobiert und war nun ermordet worden, bevor er sich einigermaßen hatte fassen können. Bettina kannte die Geschichte schon; sie bearbeiteten den Fall seit fast einem Monat, und seit vierzehn Tagen in der Sonderkommission »Künstler« unter Härtings Leitung. »Künstler« nannten sie den Mörder wegen der schauerlichen Ornamente, mit denen er seine Opfer schmückte. Und für ihn hatten sie das ganze Programm aufgefahren, alle möglichen länderübergreifenden Einsätze. Trotzdem waren sie nicht viel weiter gekommen, der Täter mordete, wie es schien, wahllos jeden jungen Mann, dessen er habhaft werden konnte. Der Junge mit den dreiundzwanzig Stichen in den Augen war das zweite Opfer gewesen. Insgesamt gab es vier, im Großraum Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Und womöglich noch weitere – ohne Ornamente – in Hessen.
Bettina hatte mit der Mutter des Jungen mit den Augenverletzungen gesprochen; sie war von erschütternder Gefasstheit gewesen. So als wäre die Frau durch die schlimme Nachricht überhaupt erst wieder an die Existenz ihres Sohnes erinnert worden. Eins der anderen Opfer war sogar minderjährig. Bettina knetete ihre Nasenwurzel, jetzt hatte sie es wieder geschafft. Wenn sie an den Kleinen dachte, bekam sie jedes Mal Kopfschmerzen. Sie war bei seiner Obduktion dabei gewesen.
Vorne am quer stehenden Tisch erhoben sich die Polizisten und räumten ihre Sachen zusammen. Die Morgenkonferenz war beendet. Bettina war verwirrt. »Haben wir die Einsätze für heute schon besprochen?«, flüsterte sie ihrem Kollegen zur Rechten zu, dem kleinen Willenbacher, so genannt, weil er tatsächlich kein Riese war. Er spielte leicht nervös mit seinem Kugelschreiber herum.
»Die der anderen schon«, antwortete er.
»Und wir?«
Als Antwort wies Willenbacher auf ihren Chef, Härting, der in der Tür stand und sie abwartend anblickte. »Wir kriegen die Extrawurst.«
In Härtings Zimmer roch es auf die bestimmte Härting’sche Art muffig, und das, obwohl gerade frisch renoviert worden war. Bettina nahm den Stuhl unter dem Hibiskus. Harte, grün glänzende Blätter streiften ihren Ärmel. Härting hockte auf seinem Sessel und musterte sie ungeduldig. Bettina lächelte ein wenig aufsässig. Privataudienzen beim Chef hatten für sie noch nie Gutes bedeutet.
»Ja, Frau Boll. Willenbacher. Schließen Sie doch die Tür.«
Willenbacher tat, wie ihm befohlen ward. Er sah blass aus, trotz seines lila gemusterten Hemdes.
»So. Na, dann wollen wir mal Ihre neue Aufgabe besprechen.«
Neue Aufgabe? Bettina linste zu Willenbacher hinüber. Wusste der etwa mehr? Nein, der jüngere Kollege sah genauso gespannt und misstrauisch aus, wie Bettina sich fühlte.
»Herr Willenbacher, ich höre, Sie engagieren sich bei Polart.«
Polart war ein Kunstverein, dem hauptsächlich Kollegen aus dem Fälschungsdezernat angehörten. Auch Willenbacher war in Gnaden aufgenommen worden und seither mit Leib und Seele dabei.
»Jawohl.«
»Sie sind sogar Schriftführer.«
»Ja.« Willenbacher nahm eine aufrechtere Haltung ein.
»Sie haben also ein sicheres Urteil, was Kunstfragen betrifft?«
Der Obermeister versuchte, bescheiden abzuwinken, was gründlich misslang. »Na, ich kann schon ein Arkanthusblatt von einer Volute unterscheiden«, sagte er eifrig. »Aber sonst bin ich halt auch nur ein Polizist.«
Härting runzelte die Stirn, Bettina verkniff sich ein Grinsen. Wahrscheinlich hatte der Hauptkommissar von keinem der beiden je gehört. Nicht dass es ihr da anders ging, aber sie war halt auch nur eine Polizistin.
»Hm. Ja. Und Sie kennen auch – äh – Kollegen aus der Region? Künstler, die nicht bei der Polizei arbeiten, ich meine, echte, also –« Härting sah inzwischen etwas genervt aus.
»Na klar«, sagte Willenbacher. »Ich korrespondiere ja mit den anderen Vereinen.«
»Schön, Willenbacher, da sind Sie also für diese kleine Aufgabe hier wie geschaffen. Und Sie, Bö–«, Härting warf einen Blick auf Bettinas Gesicht, »Frau Boll, sind mit der leichten Muse sowieso vertrauter als wir Herren der Schöpfung.«
»Leichte Muse?«, gab Bettina misstrauisch zurück. »Davon verstehe ich gar nichts.«
»Nun, ich habe jedenfalls eine sehr schöne Aufgabe für Sie beide.«
Die Ornamente, dachte Bettina. Wir sollen die Ornamente untersuchen, die den ermordeten Jungen auf Arme und Beine gemalt worden sind. Mit ihrem eigenen Blut.
»... Sie werden in Lautringen gebraucht. Vielleicht haben Sie es schon in der Zeitung gelesen: Dort hat ein spektakulärer Kunstraub stattgefunden.«
»Was?!«
»Nein.«
Ihr Chef warf eine ziemlich zerfledderte Ausgabe der Rheinpfalz über den Tisch. »Überregionales, vorletzte Seite«, sagte er. »Ah, und irgendwo habe ich noch die Lautringer Ausgabe.« Er suchte in einem seiner übermäßig zahlreichen Ablagekörbe. »Da ist sogar ein Foto dabei.«
Willenbacher hatte die Zeitung zu sich gezogen und aufgeschlagen. Bettina schaute mit ihm auf die angegebene Seite. »Ich sehe nichts«, sagte der Obermeister.
»Da rechts in der Spalte mit den Kurznachrichten«, war die Antwort. Und tatsächlich war da eine winzige Meldung:
Kunstprojekt erfolgreicher als gewünscht
In der vergangenen Nacht wurden in Lautringen mehrere Plakatvitrinen aufgebrochen, die Kunstwerke von verschiedenen Mitgliedern einer örtlichen Künstlergemeinschaft enthielten. Insgesamt zwölf Werke wurden gestohlen. Die Künstlergemeinschaft stellt mit der Aktion »Kunst im Vorübergehen« einhundert verschiedene Plakate in Vitrinen der Fa. Stadtmöbel GmbH im gesamten Lautringer Stadtgebiet aus. Diese Aktion dauert noch bis Ende November. Von den Dieben, die mit Spezialwerkzeug vorgingen, fehlt bislang jede Spur. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.
Willenbacher ließ die Zeitung sinken. Er war erschüttert.
»So, und hier ist die andere.«
Den Lautringern war das Ereignis wenigstens den Titel der Lokalseite wert gewesen. Rätselhafte Kunstdiebe!, behauptete er. Auf dem zugehörigen Foto war ein älterer Herr abgebildet, der mit erhobenen Händen neben einer leeren Plakatvitrine stand und strahlte. Einer der Diebe wahrscheinlich. Der Artikel darunter war launig abgefasst. Künstler, denen gleich mehrere Arbeiten gestohlen worden waren, kamen zu Wort und feierten sich stolz. Fast, zu diesem boshaften Schluss kam jedenfalls der Autor der Zeilen, könnte man glauben, bei der ganzen Angelegenheit handele es sich um eine heimliche Fortsetzung der Aktion, eine Art Event, das nachträglich die einfachen Dimensionen der Plakatvitrinen sprengte. Oder um einen klugen Marketinggag.
»Aber das ist doch ein Fall für die örtlichen Dienststellen«, sagte Bettina ärgerlicher, als wahrscheinlich gut für sie war. »Was sollen wir vom K 11 dort? Etwa mit der Spurensicherung antanzen und zwölf Plakatvitrinen einstäuben lassen?«
»Das halte ich für übertrieben«, erwiderte Härting trocken.
Bettina atmete durch. Dieses Gespräch konnte nur ein Missverständnis sein. »Wir sollen also offiziell als K 11-er nach Lautringen fahren, um dort den Diebstahl von zwölf Plakaten zu untersuchen? Als Kapitalverbrechen? Ist das angemessen?«
»Es handelt sich hierbei um ein Politikum.« Härtings schmaler Mund hob sich zu einem winzigen Lächeln.
Das »Politikum« schien zumindest Willenbacher wieder etwas aufzurichten. Was so ein bisschen Latein doch ausmacht, dachte Bettina.
»Die Frage nach der Angemessenheit ist im Übrigen nicht Ihre Sache, Frau Boll. Und wo wir gerade dabei sind: Sie haben im vergangenen Monat mehrere Einsätze vorzeitig abgebrochen, um pünktlich Feierabend zu machen, obwohl wir hier, wie Sie ganz richtig sagten, Kapitalverbrechen bearbeiten.« Härting blinzelte unfreundlich. »Wollen Sie das auch tun, wenn Sie dem Täter Auge in Auge gegenüberstehen?«
Bettina regte sich richtig auf. »Ich bin nie ohne Ihre Erlaubnis gegangen. Ich muss nun mal die Kinder von der Tagesmutter abholen. Das war so ausgemacht, oder nicht?! – Und ich habe Ihnen versichert, dass ich nie einen wichtigen Einsatz abbrechen würde.«
»Schön«, sagte Härting kühl, »das trifft sich wirklich gut, denn das hier ist ein wichtiger Einsatz. Sie beide werden Ihre Aufgaben in der Soko ›Künstler‹ bis auf weiteres niederlegen. Bis morgen Nachmittag erwarte ich Ihre überfälligen Berichte. Morgen Abend«, er blickte Bettina an, »haben Sie dann einen Termin mit den Geschädigten. Mit dieser Künstlergemeinschaft. In deren Vereinslokal.« Er reichte ihr drei zusammengeheftete Blätter. Die Anzeige, eine schlechte Kopie des Lautringer Stadtplans mit zwölf roten Punkten darauf und ein Zettel mit einer handschriftlichen Terminabmachung. »Seien Sie nett, Böllchen, und tun Sie so, als würden Sie die Leute ernst nehmen. Denken Sie immer dran, Sie sind vom K 11. Die Lautringer Kollegen wissen Bescheid.« Er grinste schmal. »Na ja, am besten, Sie lösen den Fall. Das wäre vielleicht am elegantesten. Auch den Lautringer Kollegen gegenüber, die sollen schließlich nicht ihren Glauben verlieren.«
»Aber die Soko braucht jeden Mann«, meldete sich Willenbacher flehentlich zu Wort. »Wir sind doch noch –«
»Herr Willenbacher«, unterbrach Härting, »Sie sind nun mal künstlerisch interessiert. Sie können mit diesen Leuten reden. Sie kennen die sogar! Wir brauchen Sie genau an dieser Stelle! Wer außer Ihnen weiß hier schließlich, was der Unterschied zwischen einer Volute und einem – hm«, an dieser Stelle lief der Hauptkommissar leicht rosa an, »einem – Dingsbumsblatt ist ...« Er räusperte sich. »Und davon abgesehen verstehen Sie sich mit Frau Boll.«
Oh, dachte Bettina, das spricht natürlich gegen ihn.
»Und Frau Boll ist in dieser Phase der Ermittlungen für die Soko einfach – entschuldigen Sie das Wort, Frau Kollegin – zu belastend. Ich kann mir nicht jeden Abend überlegen, ob Frau Bolls Einsatz wichtig ist oder nicht. Wir brauchen Leute, die im Notfall auch mal selbst entscheiden können. Immerhin sind wir im gehobenen Dienst.«
Jetzt reichte es. Bettina sprang auf. Der zudringliche Hibiskus streifte sie. Erbittert schlug sie ihn zur Seite. Erst war sie nicht lenkbar genug und dann zu unselbständig, und das innerhalb von nicht mal zehn Minuten. »Was ist mit den Familienvätern?«, rief sie. »Die gehen auch mal früher, um ihre Kinder abzuholen! Wir haben über zehn Väter in der Abteilung – Sie inbegriffen, Herr Hauptkommissar, und keiner von Ihnen macht deswegen seine Arbeit schlechter.«
Eine schwere, blutrot gefüllte Hibiskusblüte schwankte noch, fiel dann zu Boden und lag nun neben einer Auswahl von Flaschen mit verschiedenen Giften. Gegen jeden Schädling ein eigenes. Härting sah die Blüte stirnrunzelnd an. »Das ist etwas ganz anderes, Böllchen: Wir haben Familien. Sie aber sind allein erziehend, noch dazu mit zwei Kleinkindern. Ich habe nichts gegen arbeitende Frauen –«, hier blickte Härting drohend auf, »aber etwas gegen Kollegen, die in meiner Abteilung versuchen, gleich zwei Vollzeitberufen nachzugehen. Das genau tun Sie nämlich, Frau Boll. Und ich kann in einer Sonderkommission keine übermüdete Beamtin gebrauchen, die zwischendurch einkaufen geht und die Minuten bis zum Feierabend zählt. Sie sind ein Risiko, für Ihre Kinder und auch für die Kollegen. Denken Sie mal genau nach: Auch Sie würden keinen Lahmen, dem Sie den Krückstock hinterhertragen müssen, mit zu Außeneinsätzen nehmen, wo Gott weiß was passieren kann. Oder?«
»Ich bin nicht behindert«, sagte Bettina, weiß vor Zorn.
»Das habe ich auch nicht gesagt.« Härtings Gesicht sah nun sehr streng aus. »Seien Sie froh, dass Sie nach Lautringen dürfen. Lassen Sie sich Zeit dort und überlegen Sie, was gut für Sie ist.« Er sah an Bettina vorbei, nickte Willenbacher zu und griff sich ein Foto von einem toten Jungen, das auf seinem Schreibtisch lag. »Viel Erfolg. – Alles andere besprechen wir, wenn Sie zurück sind.«
Draußen vor Härtings Tür blieb Bettina im finsteren, nur vom trüben Novemberlicht erhellten Gang stehen. Am liebsten hätte sie jetzt was kaputtgehauen. Irgendwas. Eine Plakatvitrine. Einen Hibiskus. Da hatte sie dieser unfähige Hund von Chef tatsächlich vor der alten Klatschtante Willenbacher quasi aufgefordert zu kündigen – das war doch eine Unverschämtheit. Wahrscheinlich sogar illegal, aber das scherte Härting nicht, und mit ihr konnte er es ja machen. Willenbacher stand neben ihr und sah benommen aus.
»So eine Scheiße«, sagte Bettina. »Das ist ja wohl –«
»Du schuldest mir noch zweitausend Euro«, sagte Willenbacher giftig und rauschte davon.
So viel also zu ihrem Rückhalt bei den Kollegen. Bettina fluchte unfein vor sich hin. Und auch noch ein Abendtermin mit diesen Scheißkünstlern. Die Tagesmutter würde sie umbringen. Schließlich war sie eine Tagesmutter, wie sie immer betonte, wie Tag, am Abend arbeitete sie nicht mehr ...
* * *
Ella war spät aufgestanden. Eigentlich hatte sie morgens in die Denkmalschutz-Vorlesung gehen wollen, das hatte sie sich für dieses Semester fest vorgenommen, doch die Veranstaltung begann um acht, und das hatte sie nicht geschafft. Jetzt war es elf, und nun hatte sie nichts zu tun, außer auf die verhasste Vorstellung heute Nachmittag zu warten, je näher die rückte, desto kribbeliger wurde sie. Ella wünschte, sie wäre verhindert. Sie saß wieder auf ihrem Rad, fuhr rasch, ohne den Verkehr richtig wahrzunehmen, kreuz und quer durch die Stadt. Morgens hatte der Himmel einen grauen Schleier übergeworfen, und nun sahen die Straßen kalt und schmutzig aus und der herbstliche Waldgeruch wurde von dem Diesel des klapprigen weißen VW-Bus vor ihr verdrängt.
Ihr Projekt war nicht auffällig, ein paar Himbeersträucher hatte sie gepflanzt, im Karree, auf eine kleine, versteckte Wiese auf dem Gelände, als lebende Kunst, Land Art, darum ging es bei der Aufgabe, doch im Moment kam ihr das einfach idiotisch vor. Was hatte sie sich dabei gedacht?
Nun fuhr die Autoschlage an der Ampel vor ihr an und sie musste sich konzentrieren, links abbiegen, immer in Bewegung bleiben. Heute war ein Tag zum Linksabbiegen. Sie wechselte die Spur, zog an einem protzigen schwarzen Mercedes-Cabrio mit einer Blondine drin vorbei, die ihr die Faust hinterherschüttelte, aus irgendeinem Grund hob das Ellas Laune. Sie schlängelte sich durch den Gegenverkehr, erreichte eine ruhige, dafür umso steilere Straße, nahm den Berg kraftvoll und souverän, wenn nur alles so einfach wäre. Oben dann rollte sie lässig an einer Bushaltestelle vorbei, die zugehörige Plakatvitrine war leer, das sah ganz merkwürdig aus, als wäre die Haltestelle tot, als würde sie nicht mehr angefahren, als wären auch die umliegenden Häuser höchstens provisorisch bewohnt. Sollte da nicht sogar momentan Kunst drinhängen?
Oder war sie das etwa?
Zur Vorstellung der Skulpturen regnete es dann wirklich, wie angekündigt. Sie fand trotzdem statt. Es waren zu viele Fachgebiete beteiligt, Grünordnungsplanung, Werken, Raumgestaltung, mit zu wichtigen Menschen, die in diesem Leben nie wieder einen gemeinsamen Termin finden würden. Außerdem war es ein Renommierprojekt, die Arbeiten sollten dauerhaft das Waldstück um den frisch renovierten Winterturm zieren; eine Lautringer Familie wollte einen Preis stiften, und sogar eine Dame von der Rheinpfalz hatte bereits vorbeigeschaut. Keine Chance, die Veranstaltung zu vertagen oder abzukürzen. Außer man war Studentin und verzichtete aufs Vorstellen.
Die schwarzfeuchten Bäume um sie her tropften, Ella fror. Außerdem stand knapp vor ihr der Architekt und Grünordnungsplaner Thomas Kußler. In persona. Das machte sie nervös. Dabei war er eigentlich ein Lichtblick. Denn obwohl Kußler von allen Korrekteuren derjenige sein musste, der zur Zeit am meisten zu tun hatte, wirkte er am entspanntesten, ruhig und freundlich. Und sah gut aus, ganz wie Ella ihn in Erinnerung hatte, vielleicht ein bisschen dünner als letztes Semester. Sie reckte den Kopf, um bessere Sicht auf sein Profil zu bekommen – das war natürlich überspannt von ihr, andererseits war es einfach nett, ihn anzusehen. Ihm standen die knappen Koteletten, die in zu vielen bemüht charaktervollen Architektengesichtern störten. Und Thomas’ dunkle Haare waren zurückgekämmt und so messerscharf geschnitten, wie Ella es sonst nur von Szenenfotos aus alten Gangsterschinken kannte. Sie trat noch ein bisschen näher heran, wenn jetzt jemand käme und sie schubste, würde sie gänzlich unabsichtlich auf den Herrn Architekten Kußler drauffallen ...
Hinter Ella, in der Reihe ihrer Kommilitonen, entstand Bewegung. Sie blickte zurück und wurde tatsächlich geschubst, kräftig und gezielt, allerdings in die andere Richtung, von Thomas fort.
»Oh, Pardon«, sagte eine helle Stimme befriedigt. Die dazugehörige naturblonde Studentin trug einen echten Pelzkragen und roch blumig nach Geld. Eine Frau mit Doppelnamen, wusste Ella. Ann-Kathrin? Jedenfalls aus ihrem Semester. Rasch hieb ihr die mutmaßliche Ann-Kathrin noch den Ellenbogen in die Seite, bevor sie sich mit ihrem Haifischlächeln an Thomas ranmachte: »Hallo, Herr Kußler.«
»Anna?«
»Frau Dettenhorst. – Mal eine Frage, finden Sie es nicht ineffektiv, mal hier, mal da zu korrigieren? Also«, sie sah feierlich auf eine elegante silberne Uhr, die wahrscheinlich zu den unveräußerlichen Gütern ihrer Familie zählte, »es ist schon drei vorbei, und wenn wir so weitermachen, stehen wir heute Abend noch hier.«
Ann-Kathrins Projekt befand sich überraschenderweise ganz in der Nähe, und sie kam, weil es sich anbot, als Nächste dran. Selbstsicher pflanzte sie sich vor einem Steinkreis aus Rheinkieseln auf, die bei der Nässe und Dunkelheit kaum zu erkennen waren, musterte ihre frierenden Zuhörer drohend und hob an zu sprechen: »Wir sind hier auf einem Gelände, das mal ein Garten war. Umfriedeter Garten heißt auf Altpersisch pairie-daeza, woher unser Wort Paradies stammt. Das Paradies ist heute aber nicht nur der Garten, sondern eben auch alles Wunderbare, was wir damit verbinden.« Nun lächelte sie einnehmend in die Runde. »Und dazu habe ich mir Gedanken gemacht.«
Das mit den Gedanken bezweifelte Ella stark. Sie glaubte nicht, dass Ann-Kathrin überhaupt ein Gehirn besaß, höchstens eine leichte Verdickung der Nervenstränge irgendwo im Lendenwirbelbereich. Der direkte Angriff der Kommilitonin hatte sie in der Gruppe weiter zurückfallen lassen. Zwischen ihr und Thomas Kußler befanden sich nun ein verwilderter Rhododendron und mindestens drei Reihen Studenten. Was schade war, aber den Vorteil hatte, dass sie sich hier auf einem Stück geteerten Weges befand und außerdem Ann-Kathrin nicht sehen, sondern nur hören musste. Aber selbst das war noch schlimm genug.
Ellas Kommilitonin machte eine längere Pause und hielt dann ein Buch über ihren Kopf, dessen Titel im düsteren Licht nicht zu erkennen war. »Dies ist mein Lieblingsbuch«, bekannte sie. »Von Janosch.« Sie blätterte. »Der kleine Bär und der kleine Tiger langweilen sich zu Hause. Sie gehen fort in die Welt, bekommen aber Sehnsucht und kehren zurück. Dort stellen sie fest, dass es zu Hause doch am schönsten ist. Das Paradies eben.« Ann-Kathrin klappte mit einem begeisterten Knall das Buch zu und verstummte, wahrscheinlich aus Ehrfurcht vor seiner physischen Präsenz, der Gewalt seiner unleugbaren Existenz.
»Der Steinkreis«, erinnerte Dr. Martens, die Professorin für Raumgestaltung, nach einer Weile, »aus Rheinkieseln.«
»Ja. – Die Steine bilden einerseits eine Grenze, die ein Stück Garten einschließt, also ein Paradies im altpersischen Sinne. Außerdem ist der Kreis ein Symbol der Wiederkehr ganz im Geist dieser schönen Geschichte von Janosch; wenn wir ihn abgehen, erleben wir viele verschiedene Eindrücke, von hier aus kann man zum Beispiel den Winterturm sehen, von dort vorne die Straße und den Sportplatz und so fort. Aber am Ende kommen wir immer wieder zum Ausgangspunkt zurück.«
Das Schweigen aus der vordersten Reihe dehnte sich. »Wir können den Kreis gern mal abgehen«, bot Ann-Kathrin an.
Ihre eigens mitgebrachten Claqueure, die schon vorwurfsvoll blickten, bereit, im Notfall eine spontan protestierende Entwurfsklasse zu imitieren, setzten sich eifrig in Bewegung. Ella zündete sich die erste Zigarette des Tages an. Wenn das so weiterging, würde sie wieder richtig anfangen zu rauchen.
»Beruhigen Sie sich«, rief Dr. Martens. Die Professorin war eine kompakte, nur äußerlich mütterlich wirkende Frau, die hinter ihrem Rücken berechtigterweise Doc Martens genannt wurde. »Wir wollen vorerst davon ausgehen, Frau Dettenhorst, dass Ihre Theorie, der zufolge ein Kreis in sich unbegrenzt ist, zutrifft.«
Dank der Bewegung, die durch die Gruppe gegangen war, stand Ella jetzt wieder näher am Zentrum des Geschehens.
»Aber Sie haben Recht, Frau Dettenhorst, wir sollten diesen Steinkreis abgehen.«
Abermals Aufbruchstimmung bei den Kommilitonen vorne, gemischt mit leichten Unmutsäußerungen und auffälligen Blicken auf die Uhren.
»Und das werden wir vielleicht auch tun, wenn Sie zunächst die relevanten Punkte ansprechen.«
»Aber das habe ich.« Was wollt ihr denn jetzt noch, sagte Ann-Kathrins Tonfall. Wozu habt ihr eigentlich studiert, wenn ihr nicht mal meine Gedanken lesen könnt? »Ich sagte doch schon: das altpersische pairie-daeza –«
»Also wissen Sie was«, meldete sich eine schlanke, dunkelhaarige Frau etwas aufgeregt zu Wort, »ich kenne diese Geschichte von dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger, und mir gefällt sie auch sehr gut.« Schweigen trat ein, Ella betrachtete die Dame vage interessiert. Das war die Abordnung der Sponsorenfamilie, eine gewisse Raisch, frische Gattin eines alteingesessenen Lautringer Zahnarztes und Kunstmäzens. Sie war noch so jung, dass sie ohne weiteres als Studentin durchgegangen wäre. Allerdings hätte sie dazu Architektenschwarz statt dieses leuchtend hellorangefarbenen Kostüms tragen müssen. Es sah reizend aus, fand Ella, aber völlig fehl am Platz, obwohl die Dame die Einzige war, die vernünftigerweise einen Schirm benutzte, einen passend blassgelben, versteht sich. Sie leuchtete wie ein Frühlingstag. Und sie hatte einen Auftrag: die Förderung der Kunst in Stadt und Landkreis in Vertretung des unpässlichen Gatten zum höheren Ruhme ihres neu erworbenen Namens. »Vor allem die Art und Weise, wie er die Sachen darstellt, Janosch, meine ich, das Gras zum Beispiel.«
»So grün«, ergänzte Susanna von Stauff, Doc Martens’ Assistentin. Wieder trat eine kleine Pause ein.
»Frau Dettenhorst, wir wollen wissen, warum Sie ausgerechnet einen Steinkreis gemacht haben, um Ihre wirklich schöne Idee umzusetzen«, ließ sich Doc Martens dann mit sanfter Stimme vernehmen.
»Warum diese Steine?«, ergänzte Klaus Hartmann, der Assi aus dem Fachgebiet Werken. »Warum diese Größe, warum dieser Platz hier? Warum nicht drei Meter weiter?«
»Warum nicht, zum Beispiel, um einen Baum herum?«, sprang Thomas Kußler bei. »Hab ich schon gesehen. Steinkreise um Pflanzen, die Kraft brauchen. Wenn man dran glaubt, funktioniert es wahrscheinlich.«
»Und wenn nicht, sieht’s wenigstens gut aus.« Hartmann grinste und bückte sich über die Steine: Da würde sich doch mit Sicherheit irgendwo ein mickriges Pflänzchen finden lassen. Doch Ann-Kathrin wollte die Brücke, die ihr Raisch zuliebe gebaut worden war, nicht betreten. Für mickrige Pflänzchen interessierte sie sich nicht, die ließ sie allerhöchstens daheim auf dem Anwesen der Familie vom Gärtner ausreißen.
»Aber es geht hier um Land Art«, sagte sie hochnäsig. »Um Architektur. Um Kunst. Das ist schließlich kein esoterischer Gartenbauwettbewerb.«
»Da hat sie wirklich Recht«, sprach Frau Raisch unter ihrem frühlingsgelben Schirm hervor in das abermals entstandene Schweigen hinein. »Steinkreise um Pflanzen, das ist doch albern. Unsere Nachbarin macht das auch, nicht dass es mich etwas anginge –« Sie verstummte.
»Also, Frau Dettenhorst, Sie haben diesen Platz hier willkürlich gewählt«, sagte die inzwischen etwas ungeduldige Doc Martens.
Natürlich hatte sie das nicht. Das wies Ann-Kathrin energisch von sich, es gab schon Gründe, diese Mulde da zum Beispiel ...
Ella wusste, dass Ann-Kathrin den Platz gewählt hatte, weil es der begehrteste gewesen war: sonnig und leicht zu erreichen. Außerdem hatte Ann-Kathrins Freundin den gleich nebendran ergattert. Nun erzählte sie etwas von Geländekanten. Ellas linker Fuß war mittlerweile komplett durchnässt, denn in der spröden Sohle ihres Schuhs befand sich ein Riss. Missmutig bewegte sie ihre klammen Zehen, zündete sich noch eine Zigarette an und verfolgte mehr interessiert als verärgert, wie von Stauff sich zur Retterin des Entwurfs aufschwang, wahrscheinlich inspiriert von der trotzig blickenden Meute dunkler Typen in feinem Tuch um sie herum. Die Runde um den Steinkreis wurde doch gedreht; mindestens die Hälfte der Anwesenden, allen voran die junge Frau Raisch mit ihrem gelben Schirm, stolperte durchs dämmrige, nasse Unterholz. Und erlebte viele verschiedene Eindrücke, konnte den Winterturm sehen, außerdem die Straße, den Sportplatz und so fort ...
Eine Drei, schätzte Ella. Wenn nicht gar eine Zwei. Sie würden es morgen erfahren. Wenn die Noten offiziell ausgehängt wurden. Bis dahin musste selbst eine Ann-Kathrin Dettenhorst sich gedulden. Nun war die Gruppe am Ende doch wieder am Ausgangspunkt angekommen, nur Heimatgefühle stellten sich trotz geballten guten Willens nicht ein.
* * *
Die »überfälligen« Berichte waren längst geschrieben. Bettina hockte in ihrem einsamen Büro (der Kollege Bauer, der sonst hier mit ihr saß, war für die Soko unterwegs im riskanten Außendienst) und zerlegte systematisch das Sandwich, das zum Mittagessen bestimmt gewesen war. Gurke auf den Notizblock, Paprika auf die alte Telefonliste, Käse auf das Einwickelpapier, Salatblatt auf die leere Kaffeetasse, Brötchen auf die Fensterbank. Dann entschied sie, dass die Gurke auf dem Notizpapier nichts zu suchen hatte, und arrangierte alles um. Es war so absurd: Hier saß sie und hatte nichts zu tun, während die Sonderkommission unterbesetzt war. Alle beteiligten Kollegen mussten regelmäßig Überstunden machen. Ackermann, der so etwas wie die inoffizielle Leitung erhalten hatte, arbeitete seither über achtzig Stunden die Woche. Zwei Vollzeitjobs. Ohne wegen Überarbeitung zur allgemeinen Gefahr erklärt zu werden. Wenn Ackermann am Ende des Tages vor Müdigkeit rote Augen bekam und nicht mehr richtig sehen konnte (und das auch ganz offen vor allen Kollegen zugab!), sprach keiner von Lahmen und Krüppeln, selbst wenn Ackermann seine Brille vergaß. Wenn Ackermann »aus Zeitmangel« das allgemeine Auffrischungs-Schießtraining schwänzte, wurde seine Ernsthaftigkeit gelobt, und ein guter Schütze war er sowieso. Wenn Ackermann vor lauter Arbeit nicht mehr wusste, wo hinten und vorn war, dann war das bei ihm ein Beförderungsgrund. Ackermann war im selben Dienstalter wie Bettina und hatte ein leibliches Kind. Er war älter als sie, hatte länger für die Schule gebraucht und schlechter abgeschnitten. Bettina biss sich auf die Lippen. Sie mochte Ackermann, eigentlich, und das war das Schlimmste. Sie konnte ihm seine Bevorzugung nicht mal richtig missgönnen.
Unglücklich sah sie auf die Uhr. Kurz vor vier. Um sechs erst musste sie die Kinder abholen. Auch das war absurd: Nun saß sie hier und wartete auf den Feierabend, statt Enno und Sammy einfach früher zu holen und sich ein bisschen länger mit ihnen zu beschäftigen. Die Tagesmutter bestand auf regelmäßigen Zeiten. Bettina packte ihr Sandwich wieder zusammen. Die Tagesmutter war schon genervt genug wegen der vielen Überstunden. Und sie verstand sowieso nicht, dass Bettina noch arbeiten ging, statt sich mit Kindergeld und Sozialhilfe einen schönen Lenz zu machen. »Wenn Sie dann noch ein, zwei Pflegekinder aufnehmen«, hatte die Frau – fast vorwurfsvoll – vorgerechnet, »dann leben Sie besser als vorher, und noch dazu mit viel weniger Stress.«
In einem plötzlichen Entschluss stand Bettina auf und warf das Brötchen in den Papierkorb. Sie packte Zigaretten und Schlüssel in die Jacke und verließ das winzige Büro. Scheiß auf die regelmäßigen Zeiten. Jetzt würde sie die Tagesmutter mal überraschen und früher kommen.
Draußen auf dem Gang brannten grelle Leuchtstoffröhren gegen das neblige Grau von draußen an. Weiter vorne wurde eine Tür aufgerissen. »Herbert!«, schrie eine heisere Stimme. »Hopp, ich brauch dich mal kurz –«
Kollege Donauer streckte seinen Kopf auf den Gang hinaus, sah Bettina statt Herbert, runzelte die Stirn und knallte die Tür wieder zu.
Nur raus hier, dachte Bettina. Doch so einfach war das nicht. Jemand klopfte ihr von hinten auf die Schulter.
»Dr. Leonhardt«, sagte Bettina mit einiger Überraschung. »Was kann ich für Sie tun?«
Dr. Leonhardt war Kriminalrat, einer der höchsten Beamten der Abteilung, der allerdings mit den täglichen Ermittlungsgeschäften wenig zu tun hatte. Er koordinierte die Zusammenarbeit der Behörde mit anderen Institutionen, der Bundeswehr zum Beispiel, der Zollbehörde oder ausländischer Polizei. Man sah ihn selten, und wenn, dann führte er meist einen wichtigen Gast herum.
»Ja.« Dr. Leonhardt lächelte Bettina leicht zweifelnd an. Er hatte sie zuvor wahrscheinlich noch nie bewusst zur Kenntnis genommen und fragte sich jetzt, ob sie für seine wie auch immer gearteten Zwecke wirklich geeignet war. »Sie sind Frau Boll, richtig? Sie müssen Frau Boll sein. Sie haben rote Haare.«
»Kastanienbraun«, sagte Bettina automatisch und runzelte die Stirn. Absurd. Dieser ganze Tag war absurd. Nun stand sie hier mit Härtings Chef, der mit ihr über ihre Haarfarbe plauderte.
»Verzeihen Sie.« Dr. Leonhardt lächelte, doch seine Augen lächelten nicht mit.
Er beobachtet mich, dachte Bettina. Er hat eine Aufgabe für mich, aber er weiß jetzt schon nicht mehr, ob er sie mir zutraut. Er findet mich zu jung.
»Sie sind jung«, sagte Dr. Leonhardt prompt.
Bettina fand, ganz plötzlich, dass es nun genug war. Rauswurf aus der Soko. Gespräche über ihre Haarfarbe. Noch fünf Jahre, dann war sie nicht mehr jung. Dann würde es heißen: zu wenig Erfahrung. Wollte nie draußen mitarbeiten. Hat ständig und ungefragt auf ihre körperlichen Vorzüge hingewiesen. Versuchte, sich den Chefs an den Hals zu schmeißen, nicht dass wir es nicht bemerkt hätten. »Was soll ich tun?«, fragte sie erneut, knapper im Ton.
Dr. Leonhardt zögerte.
»Ich kann alles.« Bettina musste selber lächeln. Irgendwie hörte sich das kindisch an. Aber gut. Vielleicht sollte sie öfter so reden.
Der Kriminalrat zuckte ein wenig zurück. »Alles.«
»Ja.« Gelassen blickte Bettina Dr. Leonhardt in die Augen. Sie waren grau und dunkel wie der November draußen, der Mann selbst nicht mehr jung, aber schlank und mit absolut gerader Haltung wie ein Mauerpfeiler.
»Dann hab ich ja die Richtige angefordert«, sagte Dr. Leonhardt.
Angefordert. Bettina folgte Dr. Leonhardt zu seinem Büro, das sie sich größer vorgestellt hatte. Das eigentlich Große war das Vorzimmer. Da gab es zwei abstrakte Ölgemälde, mehrere kastige Sessel und dunkle Einbaumöbel aus dünnem Furnierholz. Außerdem den unbesetzten, aber unmissverständlich eigenen Schreibtisch der Sekretärin. Frau Frei, wusste Bettina. Deren schwertartige Klivien gediehen in fast anstößiger Üppigkeit, ein einzelnes Häkeldeckchen schützte die Tastatur ihres hochmodernen Computers auf dem sonst leeren Tisch. Und ein leichter Geruch von medizinischem Alkohol lag unbestimmt über dem Raum. Kölnisch Wasser. Franzbranntwein. Etwas in der Art. Dr. Leonhardt durchquerte das Zimmer rasch und hielt Bettina höflich die Tür zu seinem kleineren, dunklen Allerheiligsten auf, obwohl die zuvor schon halb offen gestanden hatte.
Ein Rauswurf würde das nicht werden.
»Hauptkommissar Härting hat mit Ihnen schon über Ihre neue Aufgabe gesprochen«, begann der Kriminalrat, nachdem Bettina sich bei sanftem Licht in dem niedrigen Klubsessel einigermaßen eingerichtet hatte. Vermutlich bedeutete der zwanglose Rahmen und mithin der Platz auf dem Sessel ein Privileg, doch Bettinas Beine waren für solchermaßen informelle Sitzmöbel zu lang. Der Doktor saß in gleicher Augenhöhe, aber wesentlich entspannter auf der Couch gegenüber. »Der Kunstraub in Lautringen.«
»Ja.«
»Das ist selbstredend ein Bagatellfall. Diese Plakatvitrinen stehen im öffentlichen Raum. An Bushaltestellen. Normalerweise ist Werbung drin. Sie sind nicht groß geschützt und werden natürlich ab und zu beschädigt, wenn meinetwegen Werbung für Unterwäsche drinhängt. Aber deswegen komplizieren diese Vitrinenbetreiber nicht ihr System. Die Dinger werden jede Woche frisch bestückt, das muss ruckzuck gehen. Man öffnet sie mit einem Sechskant, klemmt die neuen Plakate rein und fertig. Den Sechskant kriegen Sie für ein paar Cent in jedem Baumarkt.« Dr. Leonhardt erhob sich wieder. »Möchten Sie was trinken?«
Bettina dachte, inspiriert von Einrichtung und Tageszeit, spontan an einen Martini und lehnte ab. Doch natürlich hatte der Doktor nichts Alkoholisches gemeint, er öffnete einen versteckten Kühlschrank und nahm zwei kleine Flaschen Wasser heraus. »Nun hing halt Kunst drin.« Er stellte die Getränke auf den niedrigen Tisch vor ihnen und zauberte auch noch Gläser herbei. »Ich tippe auf Jugendliche. Eine Art Streich.«
»Und wir behandeln es als Kapitalverbrechen«, sagte Bettina ruhig.
Etwas wie Interesse blitzte in Leonhardts Augen auf. Er setzte sich wieder, schob Bettina ein Glas hin und öffnete eine Wasserflasche. »Bei Kunst ist das immer eine Ermessensfrage.«
»Was waren die Sachen wert?«, fragte sie. »Mehrere hundert Euro?«
»Das ist schwer zu sagen. Vielleicht hätten sie Käufer für die Sachen gefunden. Vielleicht aber auch nicht.«
»Was war drauf auf den Plakaten?«
Dr. Leonhardt zuckte die Achseln. »Grafiken. Fotografien. Gemälde.« Er schien auf etwas zu warten. War das ein Test?
Bettina beugte sich vor. »Wieso ist dieser Kunstraub ein Kapitalverbrechen?«
»Oh, das ist er nicht.« Leonhardt runzelte die Stirn und blickte an Bettina vorbei in die Ferne. »Aber einer der Bestohlenen ist der Neffe unseres ehemaligen Polizeipräsidenten. Und er hat um diese bevorzugte Behandlung gebeten.«
»Der Neffe welches Polizeipräsidenten?«, fragte Bettina ahnungsvoll. Etwa von dem, dachte sie, der von einer Kollegin wegen Belästigung angezeigt worden war und dann freigesprochen wurde, weil er zu der betreffenden Zeit betrunken gewesen war? Die Polizistin musste nun auch noch die Kosten des Verfahrens tragen, das sie angestrengt hatte, dem Typen hingegen war nichts geschehen. Man hatte ihn bei vollem Gehaltsausgleich versetzt. Männer, besauft euch, in der Pfalz urteilen die Gerichte nach Gutsherrenart.
»Ja, Ihr Verdacht ist richtig.« Der Doktor lächelte Bettina rätselhaft zu. Und schwieg.
War der Test nun bestanden? Hätte sie verständnisvoller sein sollen? Ärgerlicher? Wo war die Moral von der Geschicht?
»Wissen Sie, unser Expräsident und dieser Neffe, ein gewisser Tim Henning, haben uns unabsichtlich einen großen Gefallen getan.« Dr. Leonhardts Augen glitzerten. »Die haben uns eine Tür aufgestoßen.« Er beugte sich vor. »Wir müssen an einen dieser Künstler herankommen, aber ganz unauffällig, verstehen Sie, Frau Boll? Vielmehr, Sie müssen an ihn herankommen.« Er musterte die abgeschabten Knie ihrer Jeans. »Thomas Kußler heißt er. Aber im Grunde«, ein scharfer Blick traf Bettinas Gesicht, »geht es um seine Frau.«
Darauf schien der Kriminalrat eine Antwort zu erwarten. Oder war dieser fragende Tonfall nur eine Angewohnheit? Bettina goss sich doch etwas Wasser ein. »Wer ist sie?«
»Hier.« Dr. Leonhardt griff nach einem weißen DIN-A4-Karton, der – längst vorbereitet – auf dem niedrigen Tisch gelegen hatte, und drehte ihn um. Auf die andere Seite war sorgfältig eine Fotografie geklebt. Ein Porträt, ziemlich bieder, aus einem altmodischen Fotostudio. Braun gebrannte Frau um die vierzig in weichem Licht vor blau gesprenkeltem Hintergrund. Sie hatte dunkle, lockige, kurz geschnittene Haare, die im wirklichen Leben wahrscheinlich wunderbar aussahen. Für den Fotografen jedoch waren sie so streng gescheitelt worden, dass man ihnen nur noch den vergeblichen Versuch, Ordnung hineinzubringen, ansah. Die Frau hatte ein kantiges Gesicht, vorstehende Wangenknochen und ziemlich hochmütige dunkle Augen. Bettina hatte sie noch nie gesehen, obwohl Dr. Leonhardt das spürbar von ihr erwartete. Nach einer gewissen Pause, in der Bettina schwieg, lehnte sich der Doktor zurück. »Sagt Ihnen der Name Ötting etwas?«
»Nein«, gab Bettina zu.
»Valerie Ötting.«
»Hm«, machte Bettina und versuchte sich an einer passenden Miene. Interessiert? Wissend? Betroffen?
»Brauchen Sie vielleicht ein Aspirin?«, fragte Dr. Leonhardt. »Sie sehen aus, als hätten Sie Kopfschmerzen.«
»Nein, danke. – Es tut mir leid, aber ich kenne diese Frau nicht.«
Wieder ein Punkt abgezogen. Dr. Leonhardt hob ganz leicht die Brauen, dann begann er sacht seine Schläfe zu massieren. Es sah aus, als hätte er sich dieses Gespräch anders vorgestellt. »Wissen Sie was«, sagte er endlich, »da gab es doch neulich diesen Indizienprozess in Niedersachsen. Haben Sie das verfolgt? Ging durch zwei Instanzen. Der Ehemann, der als Mörder verurteilt wurde, obwohl die Leiche bis heute nicht gefunden werden konnte. Das müssen Sie mitbekommen haben.«
Hatte Bettina. Sie nickte.
»Nun«, sagte Dr. Leonhardt, »von Valerie Ötting gibt es seit anderthalb Jahren keine glaubwürdigen Lebenszeichen mehr. Frau Ötting war – nein, ich muss ja sagen: ist mit Thomas Kußler verheiratet.«
Bettina nahm den Karton zur Hand und sah das Bild genauer an. Die Frau strahlte eine gewisse Stärke aus. »Sie sieht gar nicht aus wie die typische unterdrückte und irgendwann totgeprügelte Ehefrau.«
»Nein«, sagte Dr. Leonhardt. »In der Tat nicht.« Er machte keine Anstalten weiterzusprechen.
»Was, glauben Sie, ist geschehen?«, fragte Bettina.
»Sie kommt aus einer bekannten, sehr vermögenden Familie, Ötting – ihr Großvater ist mit Kugellagern reich geworden.« Ein fragender Blick; wieder musste Bettina bedauernd den Kopf schütteln.
»Nun, das Geschäft haben Onkel oder Cousins von ihr übernommen, inzwischen ist es auch verkauft, aber Valerie Ötting war trotzdem versorgt und erbte außerdem noch ein in den entsprechenden Kreisen sehr berühmtes Haus. Es ist eine Villa außerhalb von Lautringen, ein Denkmal im Stil der klassischen Moderne.« Der graue Blick des Kriminalrats streifte erneut ihre Knie. »Egal. Ein schönes und wertvolles Haus, jedenfalls. Der Traum eines jeden historisch einigermaßen interessierten Architekten.«
»Und Thomas Kußler ist so ein Architekt.«
Dr. Leonhardt verschränkte die Arme und lehnte sich zurück. »Wissen Sie, Valerie Ötting ist eine bekannte Autorin. Sie schreibt Reiseberichte.« Sein eben noch scharfer Blick schweifte wieder in die Ferne. »Und ihr Mann ist Architekt, in der Tat.«
* * *
Eine kleine, sehr zarte Studentin stand nun vorne, neben ihr eine mannshohe, rostige Stahlplatte, die in Augenhöhe ein rechteckiges Loch hatte. Die Studentin, die Ella nur vom Sehen kannte, zitterte. Es konnte Aufregung sein oder einfach Kälte. Das Licht einer Laterne der angrenzenden Straße beleuchtete die junge Frau; auf der anderen Seite des Fahrwegs begann der Forst. Kilometerweit Wald, bis zur nächsten Ortschaft, zur nächsten Stadt, ja wahrscheinlich Wald bis zur französischen Grenze und darüber hinaus. Nasser Dunst hing tief über dem aufgeweichten Boden, fing die Helligkeit aus der Laterne und löste die Konturen auf; das neblige Grau fraß Gesichter und Farben und Zweige und die düstere Weite des Waldes, die dennoch überdeutlich zu spüren war. Nur Frau Raisch mit ihrem hellen Schirm trotzte orangegelb der Gleichmacherei. Zuvor hatte ihr Outfit schrill gewirkt; nun schien sie die Normalste, die Sicherste zu sein.
»Diese Stele heißt ›Edward Hopper findet die Blaue Blume‹«, sagte die kleine Studentin. Ihre Stimme war ganz heiser vor Erkältung. »Man kann es trotz des Nebels erkennen, Gott sei Dank.« Sie kicherte nervös, was zu einem Hustenanfall führte. »Sehen Sie, ich fand den Blick an dieser Stelle des Grundstücks bemerkenswert. Wenn man in die eine Richtung blickt –«, sie stellte sich vor den rostigen Stahl und wies durch das ausgeschnittene Fenster, »dann sieht man unsere Art-déco-Bushaltestelle von hinten.« Sie flüsterte mit einem großen jungen Mann, der neben ihr stand und sich jetzt in Bewegung setzte. »Bushaltestellen«, fuhr sie fort, »erinnern mich immer an Bilder von Hopper.«
»Oh! Das ist wahr!«, stimmte Frau Raisch zu, es folgte eine der üblichen Pausen. Ella fiel ein bisschen zurück, sie überlegte heimzugehen.
»Menschen an Bushaltestellen sehen haargenau so aus wie die Menschen auf seinen Gemälden«, fuhr die Studentin mit einem Blick auf den jungen Mann, der nun an der Haltestelle stand, fort, »genauso selbstverloren und einsam –«
»Na, endlich hat dieses Ding seinen Rahmen gekriegt«, sagte eine Stimme direkt neben Ella. Zuerst glaubte sie gar nicht, dass sie angesprochen war, dann erschrak sie und sah nochmals hin: Thomas Kußler! Er lächelte sie an, seine dunklen Haare hingen ihm eine Spur lässiger als zuvor in die Stirn, sein sommersprossiges Gesicht sah vom Regen entzückend feucht aus. »Unsere bunte Bushaltestelle, meine ich. Jetzt ist sie Art déco, Hopper, und keiner kann sich mehr aufregen.«
Das fragliche Bauwerk bestand aus geschwungenem Plastik in Bonbonfarben und war ohne Billigung der wichtigsten Dozenten der Architekturfakultät »in einer Nacht-und-Nebelaktion«, sprich in den Semesterferien, aufgestellt worden und in den einschlägigen Kreisen arg umstritten (Kitsch!).
»Also ich«, hörte Ella sich von ferne sagen, »fand die schon immer ziemlich witzig.« Oh Scheiße, dachte sie dann sofort, jetzt hast du dich selber rausgekickt, dein Geschmack ist einfach –
»Ich auch«, sagte Thomas Kußler lächelnd. »Und die Stele ist interessant, ich hab sie betreut, von der anderen Seite sieht man den Winterturm, ganz wildromantisch. Caspar David Friedrich, Novalis und so weiter. Aber überleg mal, das muss eine Tonne Stahl sein. Das soll sie uns jetzt gleich mal erzählen: wie sie die in den Wald gekriegt hat.«
»Mit dem Tieflader?« Ella lächelte vorsichtig. Thomas duzte sie! Sprach so ein Dozent mit einer zufällig neben ihm stehenden Studentin? Die er gleich auch noch zu bewerten hatte? Ja, entschied Ella bedauernd, doch. Trotzdem müsste sie diese Chance nun wirklich nutzen: Sieh mich an, bitte, ich bin eine gute Architektin, eine talentierte Entwerferin, ach was, eine gefügige Praktikantin! Ich koste wenig und steige in Gullischächte, wenn du willst! Ich möchte den Wiederaufbau des Friedhofs mitmachen! Ja, ich hab mich schon mal bei dir beworben, und ja, wurde abgewiesen, aber das war, bevor wir uns persönlich kannten ...
»Jedenfalls hat es drei Mark fuffzig gekostet«, sagte Thomas, mit den Augen wieder bei der Gruppe. »Auf deine Arbeit bin ich auch gespannt. Wer hat dich korrigiert?«
»Keiner«, gab sie zu.
Er lächelte wieder. »Du bist Ella, oder?«
Sie nickte schwach. Los! Sag’s! Stell mich ein! Ich will Arbeit! Ich bin gut ...
Thomas ging weiter. Du liebe Zeit, dachte Ella jetzt beunruhigt, wenn der die blöden Himbeersträucher sieht, stellt er mich nie ein. Nie.
* * *
»Thomas Kußler«, sagte Dr. Leonhardt, »hat seine Frau Valerie Ötting vor dreieinhalb Jahren gemeinsam mit einem Freund nach Frankfurt zum Flughafen gefahren. Sie wollte nach Indien, nach Rajasthan, genauer gesagt, um dort die Rabari aufzuspüren, das ist ein kastenloses Nomadenvolk. Insgesamt sollte es ein Jahr dauern.«
»Sie ist also 2000 aufgebrochen?«
»Genau. Im Mai. In Indien war sie, dafür gibt es Zeugen. Zurückgekommen ist sie jedoch offiziell nie. Sie wurde nicht gleich vermisst.«
»Da müsste man doch eher in Indien suchen«, gab Bettina zu bedenken. »Wenn sie so ein abenteuerliches Leben geführt hat, dann könnte ihr auch leicht unterwegs etwas passiert sein.«
Dr. Leonhardt nahm eine dünne Aktenmappe vom Tisch. »Indien ist keine solche Wildnis, wie Sie vielleicht meinen.« Er blätterte. »Im Gegenteil, in vielen Bereichen ist es ein hochmodernes Land. Wenn Valerie Ötting da einen Unfall gehabt hätte, wäre das bekannt. Sie war eine erfahrene Reisende. – Übrigens laufen dort Nachforschungen. Es wurden mehrere Zeugen gefunden, unter anderem der Mann, der Valerie zu den Nomaden brachte, für sie knapp zwei Jahre als Begleiter und Dolmetscher arbeitete und sie anschließend in dem Glauben verließ, sie führe nun wieder nach Hause. – Es ist natürlich alles sehr vage.«
»Aber verdächtig.« Valerie, dachte Bettina. Nur der Vorname?
»Ja. Wissen Sie, von hier aus ist es einfach zu behaupten, eine Frau wie Valerie Ötting sei in Indien verschollen. Bei dem Beruf.«
»Aber wie kommen Sie dazu, nach ihr zu suchen? Ihr Mann wird sich ja kaum an die Polizei gewandt haben, wenn er sie wirklich ermordet hat.«
»Nein. Ihre Tante hat das getan. Zu dieser Tante, Ada Ötting, hielt Valerie ziemlich regelmäßigen Kontakt. Frau Ötting erwartete ihre Nichte schon vor anderthalb Jahren zurück.« Dr. Leonhardt schloss die Akte und reichte sie Bettina. »Viel haben wir nicht. Nur die Behauptung der Tante, dass sie tatsächlich vor anderthalb Jahren einen Anruf ihrer Nichte erhalten hat. Aus Deutschland, glaubt sie.«
»Sie glaubt?«
Dr. Leonhardt zuckte die Achseln und nickte. »Valerie Ötting sprach davon, dass sie die Rabari nun verlassen habe und sich bald melden würde. Ada Ötting erwartete dann mehr Kontakt, Anrufe, Briefe, einen Besuch. So wie immer, wenn ihre Nichte in Deutschland war. Doch es tat sich nichts. Darauf wandte sie sich, nach einem halben Jahr etwa, an Mona Beyer, eine Staatsanwältin und alte Freundin Valeries. Das war letztes Jahr um die Zeit.« Er breitete die Arme aus. »Und Frau Beyer fand dann etwas wirklich Verdächtiges heraus. Sie fuhr beim Haus von Ötting und Kußler vorbei, als alte Freundin, spontan auf Besuch – und sah, dass gerade das Dach der Villa saniert wurde.«
»Was ist daran verdächtig?«
Dr. Leonhardt warf ihr einen Blick zu. »Die Kosten. So etwas ist nicht billig. Ötting konnte es nicht angeordnet haben, die war ja nicht da. Aber das Geld musste von ihr stammen. Kußler besaß zu der Zeit gar nichts, jetzt ist er zwar gut im Geschäft, aber damals war er wissenschaftlicher Mitarbeiter mit einer halben Stelle an der Uni, das hat ihn gerade so ernährt. Eigenes Vermögen hat er nicht, bei seiner Hochzeit mit Ötting besaß er grade mal das Hemd, das er auf dem Leib trug. – Und Frau Beyer wusste, dass ihre Freundin Valerie sich immer dagegen ausgesprochen hatte, Geld ins Haus zu stecken. Das sagte auch die Tante. Ötting wusste genau, dass so ein Denkmal ein Fass ohne Boden ist. – Nein, sie hatte eine klare Linie: Das Geld ist für die Reisen. Außerdem reagierte Kußler auf Beyers Besuch ziemlich kühl. Er fertigte die alte Freundin seiner Frau schnell ab. Beyer stellte darauf ein paar kleinere Nachforschungen an und fand heraus, dass Kußler tatsächlich sukzessive angefangen hatte, das Geld seiner Frau auszugeben.« Er blickte ernst. »Und zwar seit dem Zeitpunkt, da Ada Ötting das letzte Mal mit ihrer Nichte gesprochen hatte.«
»Hm«, machte Bettina.
Dr. Leonhardt hob die Hände. »Frau Beyer sprach mit der Tante, und die wandte sich an mich. So kamen wir zu dem Fall. Natürlich können wir nur verdeckt ermitteln.« Er sah Bettina jetzt sehr genau ins Gesicht. »Es läuft ein bisschen unter der Hand, Sie wissen ja, dass es im normalen Dienstbetrieb für solche Fälle kein Budget gibt. Es könnte wohl um Mord gehen, aber wir werden nur aktiv, wenn sich eine günstige Gelegenheit zum Handeln ergibt. Die haben wir jetzt, Frau Boll. Dass wir so leicht an den Kußler rankommen, müssen wir ausnutzen. – Die genaue Aussage der Tante können Sie in der Akte nachlesen. Sie lebt auf Sylt. Wir haben sie dreimal befragt.« Ein winziges Lächeln stahl sich auf Dr. Leonhardts Lippen. »Sie noch einmal zu besuchen, wird, fürchte ich, nicht nötig sein.«
»Schade.«
Sofort war das Lächeln verschwunden. »Wie beurteilen Sie das Problem bisher?«
Bettina sah auf Valerie Öttings Bild. Die dunkel gelockte Frau blickte kühl zurück. Ob der Fotograf versucht hatte, sie zum Lächeln zu bringen? Einer, der so einen altmodischen Hintergrund gewählt hatte, bestimmt. Und Ötting hatte wohl umso hochnäsiger dreingeschaut. Bettina meinte fast, durch all den Weichzeichner hindurch ihre Augen blitzen zu sehen. »Ich denke«, sagte sie, »die Sache mit dem Geld wirft ein schlechtes Licht auf Herrn Kußler. Und die Aussage ihres indischen Begleiters und die der Tante sind auch beunruhigend, falls sonst tatsächlich niemand mehr von ihr gehört hat.«
Dr. Leonhardt nickte, da hatten sie endlich eine gemeinsame Basis. Zwei Polizisten, ein Verdacht. »Leider nein. Wir haben fast die ganze Familie befragt, vielmehr, die Staatsanwältin und die Tante haben diese Nachforschungen betrieben. Als besorgte Freundin und Verwandte. Kußler behauptet übrigens, Kontakt zu seiner Frau zu haben. Telefonanrufe.«
»Ist sie vermisst gemeldet?«
»Nein.« Der Doktor beugte sich vor. »Die beiden Frauen sind dagegen, weil sie fürchten, dass Kußler dann überhaupt nicht mehr mit ihnen reden wird. Jetzt ist er wenigstens noch einigermaßen höflich. Im Grunde haben sie Recht, diese Verbindung könnte ganz wertvoll sein, während eine Vermisstmeldung wahrscheinlich nicht viel bringt. Leider hatten wir nur die ganze Zeit niemanden vor Ort. – Das ist jetzt unsere Chance, Frau Boll. Wir müssen das Grab finden, dann haben wir ihn sicher.«
»Das Grab.«
»Ja, irgendwo muss er sie gelassen haben. Es kann ja nicht immer ohne Leiche abgehen, nicht wahr? – Und hier kommen Sie ins Spiel, Frau Kollegin. Natürlich müssen Sie sehr vorsichtig vorgehen.«
Bettina schluckte. Sollte sie sich wirklich als Polizistin, mit nur den Plakaten als dürftigem Vorwand, bei einem Mörder einschleichen? Der würde sie ohne Zweifel mit offenen Armen empfangen und ihr auch gleich die geheimen Ecken im Keller zeigen.
»Wie haben Sie sich das vorgestellt?«
»Es ist nicht ganz einfach«, gab Dr. Leonhardt zu. »Lassen Sie es mich so sagen, Sie haben meine volle Unterstützung. Sie können im Notfall auf alle Ressourcen unseres Kommissariats zurückgreifen. Wie Sie es aber genau machen – da muss ich Sie bitten, selbständig zu arbeiten.« Einen Moment lang ruhte Dr. Leonhardts Blick auf Bettinas roten Haaren, dann sah er zur Seite. »Möglicherweise wird es leichter für Sie, als Sie glauben, eventuell haben Sie ja einen Draht zu dem Mann.«
Und wenn nicht?
»Was ist«, Bettina wählte sorgsam ihre Worte, »Herr Kußler denn für ein Mensch? Wie ist Frau Ötting überhaupt an ihn geraten?«
Dr. Leonhardt erhob sich, für einen Moment wirkte er alt, so alt wahrscheinlich, wie er war. Seine Stirn war hoch und vornehm, seine Haare kurz geschnitten, aber eben doch schon dünn, ja sie sahen fast weich aus, die Züge um seinen Mund dagegen waren scharf. Etwas schwerfällig setzte er sich dann auf die Kante seines ordentlichen und leeren Schreibtischs, blickte auf seine Hände und verschränkte die Arme. »Ötting und Kußler sind seit gut sechs Jahren verheiratet. Er war damals achtundzwanzig, sie siebenunddreißig. Es ist wahrscheinlich für beide eine Zweckehe gewesen. Valerie hatte dieses Haus. Kußler war ein junger Architekt. Aus nicht gerade geordneten Verhältnissen, er ist ein uneheliches Kind und bei Verwandten groß geworden.«
Ja dann, dachte Bettina.
»– Irgendwie ist er an sie rangekommen. Und für die Villa hat er gern in Kauf genommen, dass seine Ehefrau fast zehn Jahre älter als er selbst und so gut wie nie zu Hause war.«
»Und Frau Ötting«, Bettina konnte nicht anders als den Nachnamen zu benutzen, »was hatte die von der Zweckehe?«
Dr. Leonhardt sah seine verschränkten Arme und öffnete sie, Bettina hatte den Eindruck, dass er es bewusst tat, um entspannter zu wirken. Stattdessen runzelte er nun die Stirn. Ja, Körpersprache war eine verzwickte Sache.
»Kußler sieht ganz gut aus«, antwortete er. »Und es ist wahrscheinlich nett, nach so langen Reisen vom Flughafen abgeholt zu werden.«
»Und er hat sie umgebracht? Wegen des Hauses?«
Der Kriminalrat hob die Achseln. »Immerhin hat er sie wahrscheinlich deswegen geheiratet. – Schauen Sie sich die Akte an. Das Problem ist, wir können offiziell keine Vermögensverhältnisse prüfen. Wir wissen nur, dass Valerie Ötting wahrscheinlich ihr Kapital angreifen musste, um ihre Reisen zu finanzieren. So etwas ist teuer. Mit den Tantiemen aus Büchern kann man diese Spesen nicht wieder reinholen. Und möglicherweise war das Geld nun aufgebraucht, will sagen, eben gerade noch genug da, um das Dach zu sanieren, aber nicht mehr so viel, dass Valerie Ötting ihren Lebensstandard hätte halten können. Die Tante vermutet, dass Valerie deshalb vorhatte, bei ihrer Rückkunft ihr Anwesen zu verkaufen, um für die nächsten paar Jahre wieder flüssig zu sein. Mit dem Plan wird sie sich bei ihrem Ehemann aber nicht beliebt gemacht haben.«