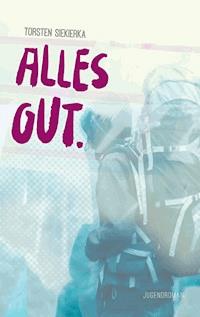Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Apfelkuchen mit Chili" - Ein Buch über die erste Liebe, das Erwachsenwerden und darüber, warum es so unfassbar schwer ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor:
Torsten Siekierka erblickte im Jahr 1984 in Potsdam das Licht der Welt. Viel sah er von dieser noch nicht, kam er bisher lediglich bis zum Nachbardorf Berlin, wo er heute mit Frau und Kindern lebt.
Siekierka begann Bücher zu schreiben, weil er die Hoffnung hatte, mit diesen die Welt zu verändern. Klappte (noch) nicht, aber sie wurde schöner, weil abwechslungsreicher. Und das ist doch auch schon was.
Folgen Sie ihm auf Facebook und / oder Instagram. Dort wird er Sie regelmäßig mit neuen Informationen zu Büchern, Lesungen usw. versorgen. Wenn Ihnen das folgende Buch gefällt, freut sich der Autor natürlich über eine Rezension auf den bekannten Portalen. Danke!
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
01. Kapitel
Es krachte. Mein Oberkörper schnellte nach oben.
Was war das?
Nur langsam gewöhnten sich meine Augen an die Morgensonne, die sich genauso erbarmungslos zeigte, wie die Gestalt, die die Tür gegen die Wand meines Jugendzimmers krachen ließ.
»Aufstehen!« Es war mein Stiefvater. Herr Andreas Schuhmacher. Schnauzbartträger und, seit ich fünf Jahre alt war, der Freund meiner Mutter. Und seit ich fünf Jahre alt war, hoffte ich, dass er wieder das Weite suchte.
Es war also alles wie vor den Sommerferien. Als wären wir nie in dieses schreckliche Haus gezogen. Und je länger ich an die Zeit vor den Ferien dachte, desto größer wurde dieses mulmige Gefühl, dass mich spüren ließ, dass hier natürlich nichts wie vor den großen Ferien war. Es war ein Gefühl, als wenn ich beim Handball mit einer Augenbinde im Tor gestanden hätte. Ich wusste nur, dass auf jeden Fall was passieren wird, irgendwann wird ein Ball auf mein Tor geworfen. Nur wann und wie und wer der Werfer war, das wusste ich nicht. Vor den Sommerferien wohnten wir noch in der Stadt Norden in Ostfriesland und ich besuchte gerne die Schule. Von Ausnahmen abgesehen. Jetzt wohnten wir in Berlin und ich hatte so gar keine Ahnung, was mich erwartete. Ich saß auf der Bettkante und starrte auf meine Knie. Dann schaute ich mich um, erkannte weiße Tapete, die mich an Krankenhäuser erinnerte, und Möbel, die älter aussahen, als ich war. Immerhin hatte ich, seit dem Umzug nach Berlin, ein doppelt so großes Zimmer, als noch in Ostfriesland. Aber was nutzte das, wenn niemand da war, der mich besuchte? In Ostfriesland hatte ich auch nur ein paar Freunde, woraufhin meine Mutter einmal meinte, dass es wichtiger wäre, richtige Freunde zu haben, statt viele.
Nachdem es mir gelang, mich zu erheben, wuchs in mir der Wunsch, mich wieder unter meiner Bettdecke zu verstecken. Aber unter der Decke hätte ich ihn auch noch gehört. Einen der Gründe für unseren Umzug nach Berlin. Richtigerweise müsste es Gründin heißen, denn die Nervensäge hörte auf den Namen Annabell. Und Annabell war seit acht Monaten meine Halbschwester. Blind zog ich die erstbesten Klamotten aus dem Kleiderschrank und flüchtete ins Bad. Ruhe hatte ich dort auch nicht, aber die Dusche und meine Zahnbürste sorgten immerhin für etwas Lebendigkeit.
02. Kapitel
Eine halbe Stunde später stand ich vor einem Schultor, an welchem unzählige Schüler ihren Schulfrust mit Edding hinterlassen hatten. Lesbar waren nur einzelne Botschaften, aber die genügten. Ich bekam eine erste Vorstellung von dem, was mich an meiner neuen Schule erwartete.
Eine düstere Vorstellung!
Mit Beinen, die so schwer wie mein Rucksack waren, schlich ich durch das schmale Tor hindurch. Vor mir wuchs ein Koloss von einem Schulgebäude empor. Ich blieb stehen. Beeindruckt starrte ich nach oben. Die Morgensonne hinderte mich daran, den grauen Klotz bis zum letzten Stockwerk zu erkennen. Die Schüler, die nach mir durch das Tor drangen, und denen ich den Weg versperrte, waren immerhin so freundlich, mich nach vorne zu schieben, statt mich über den Haufen zu rennen.
Meine Mutter meinte mich zu trösten, als sie mir erzählte, dass die Schüler in Berlin schon mit fünf Jahren in die Schule kämen, ich wäre also der Älteste in der Klasse und alle hätten bestimmt Respekt vor mir.
Bestimmt Mama! Ich schlich weiter über den Schulhof. Die meisten Schüler, die sich in Kleingruppen auf dem Hof verteilten, waren zwei Köpfe größer als ich. Mindestens. Und was die für Klamotten trugen. Niemandem sah ich an, dass er auch in eine neunte Klasse ging. Es sei denn, die meisten von denen waren zwei- oder dreimal sitzengeblieben. Das konnte ich mir auf einem Gymnasium aber nur schwer vorstellen ... Die Schulklingel riss mich aus meinen Gedanken. Nachdem der riesige Schwall an Schülern sich durch die Eingangstür gedrängt hatte, betrat ich den gigantischen Klotz. Wobei gigantisch untertrieben war. Dieses graue Ding war so riesig wie die Pyramiden in Ägypten. Mindestens. Alle Schüler stapften die riesigen Treppenstufen hinauf, während ich mich hilfesuchend umsah.
Im Gebäude dominierte nicht die Farbe Grau. Hier war alles hellbraun gestrichen. Und dieser Farbton erinnerte mich an die vollen Windeln meiner Halbschwester. Das war aber auch alles, was ich erkannte. Wo sollte ich hin? Wo war mein Klassenraum?
Eine Frau kam auf mich zu. Wobei sie nicht auf mich zukam, es sah eher aus, als wollte sie an mir vorbeirennen.
»Entschuldigung?« Mit einem genervten Blick blieb die Frau stehen.
War das eine Lehrerin oder ein Tuschkasten? So viel Schminke wie die im Gesicht trug, hatte meine Mutter nicht im Badezimmer stehen.
»Ich ... äh, ich suche die 9e.«
»Fünfter Stock!« Dann marschierte sie weiter. Ich hatte nicht mal die Zeit, mich zu bedanken.
Fünfter Stock. O Mann! Draußen waren schon gefühlte 30 Grad, meine Schultasche war mit Steinen gefüllt und ich malte mir aus, noch bevor ich mich auf den Weg nach oben begab, wie ich dort ankommen würde: Nassgeschwitzt und mir hing die Zunge aus dem Hals. Ich erklomm die letzte Stufe der Treppen. Weiter höher ging es nicht, und natürlich war ich durchgeschwitzt. Ich setzte den Rucksack ab, kramte meine Trinkflasche hervor und sorgte dafür, dass ich für den restlichen Schultag nichts mehr zu trinken hatte. An der Fensterscheibe der Glastür hing ein Zettel. Auf diesen hatte jemand mit blauem Filzer gekritzelt:
Jetzt war ich schlauer. Ich begab mich auf die Suche nach Raum 511 und stand vor 539. Ich arbeitete die Zahlen rückwärts ab. 530, 520. Ich kam meinem Ziel näher. 515, 514. Eisentür. Ich schaute mich erst hilfesuchend um, dann drückte ich vorsichtig die schwere Klinke nach unten. Auf der anderen Seite der Tür hörte ich vereinzelte Stimmen, weshalb ich nun mehr Kraft einsetzte, um diese verdammte Tür zu öffnen. Es gelang mir nicht. Ich hätte mich an die Türklinke hängen können, aber auch das hätte mich meinem Ziel keinen Schritt nähergebracht. Dann lernte auch mein rechter Fuß die ganze Härte der Eisentür kennen.
»Problem?«
Ich zuckte zusammen und drehte mich um. Vor mir erkannte ich einen Jogginganzug mit Halbglatze.
»Ich ..., also ..., ich suche meine Klasse. Die 9e.«
»Neuer Schüler?«
Ich musste mich irgendwo verlaufen haben. Ich wollte doch zur Schule, aber der Mann redete mit mir, als wollte ich zur Armee. Ich nickte eingeschüchtert.
»Raum?«
Raum? Nur Raum? Man sagt uns Ostfriesen ja nach, wortkarg zu sein, aber in Berlin schienen viele Sätze nur aus einem Wort zu bestehen.
»Also ... vorne stand 511 dran.«
»511? Gebäude zwo.«
»Und wie ...?«
»Runter, raus, zweiten Eingang wieder hoch.«
Ich sackte innerlich zusammen. Aber mir blieb keine Wahl. Ich musste die fünf Stockwerke wieder runter und dann wieder hinauf. Während dieser Odyssee dachte ich an den Tuschkasten zurück. Vielleicht war es doch gut, dass ich mich nicht für diese halbe Info bedanken konnte. Natürlich schaffte ich es nicht mehr rechtzeitig in meinen neuen Klassenraum. Aber hey, ich kam aus Ostfriesland, da war das Ding mit der Zeit nicht so wichtig. Daher zitterte ich auch nicht vor Angst, sondern vor Aufregung, als ich vor meinem neuen Klassenraum stand. Schweiß rann meine Stirn herunter. Hätte ich mein T-Shirt ausgewrungen, einen Eimer hätte ich mit der Flüssigkeit bestimmt gefüllt. Ob ich mich deswegen nochmal kurz auf die Treppe setzen sollte, um mich zu beruhigen? Oder klopfte ich lieber gleich an und tat, als wenn nichts wäre? Ich atmete dreimal ein und aus, dann klopfte ich. Meine Nervosität verwechselte meinen Magen mit einem Boxsack. Ich öffnete die Tür mit zitternder Hand. Unzählige Augen drehten sich zu mir. Ich versuchte es mit einem Lächeln.
Dann fragte eine Stimme: »Suchst du was?« Der Ton klang nicht mehr nach Militär. Eher nach Kermit dem Frosch.
»Ich? Ich ... also, ich soll auch in die 9e gehen ...«
»Etwas spät, oder nicht?«, fragte der Lehrer und streckte seinen Kopf in meine Richtung. Nur seinen Kopf. Der Rest seines Körpers blieb kerzengerade.
Eine Minute später saß ich in der letzten Reihe auf dem einzigen Platz, der noch frei war. Vor mir ein Meer aus Köpfen. Und neben mir ... Wollte die mir ihre Zahnspange präsentieren, oder warum lächelte die so blöd?
»Hi, ich bin Jenny. Also eigentlich Jennifer, aber alle nennen mich Jenny. Und du?«
»Äh ..., Ben. Also eigentlich Benjamin, aber alle nennen mich Ben.«
Jenny schaute mich durch zwei Brillengläser an. Die fielen mir vor allem wegen Jennys Hautfarbe auf, die mich an Zartbitterschokolade erinnerte. Trotz der Brille erkannte ich ihre funkelnden Augen, die mich neugierig ansahen. Dann fummelte meine neue Banknachbarin an ihrem Zopf herum. Sofort schnellten ihre lockigen Haare in alle Richtungen. Gebannt beobachtete ich Jenny dabei, wie die ihre Haare kräftig mit beiden Händen durchschüttelte und anschließend wieder zusammenband. Leider bekam ich nicht mit, was in der Zwischenzeit passierte. Abgesehen davon, dass alle lachten. Außer Jenny, die eigentlich Jennifer hieß, und ich. Der Typ, der vorne an der Tafel stand, schaute zu mir. Das Meer an Köpfen tat es ihm nach.
»Dein Name«, flüsterte Jenny.
»Ich bin Ben«, posaunte ich mutig heraus.
»Und hast du auch einen Nachnamen?«
Nein! Das konnte er mir nicht antun. Bitte nicht!
Einige Schüler kicherten. Ich schaute gehemmt zu dem Lehrer, der mit auffallend großen Glubschern vor der Tafel stand.
»Dein Nachname«, flüsterte Jenny wieder.
»Ich weiß«, murmelte ich zurück. Langsam dämmerte es mir. Ich kam aus dieser Nummer nicht mehr heraus. Doch je länger ich wartete ..., es half nichts. Zum zweiten Mal machte ich mich am ersten Tag zum Löffel.
»Grützemacher«, nuschelte ich.
»Geht es vielleicht etwas deutlicher?«
»Grü-tze-ma-cher!«
Und alle, außer Jenny, prusteten los.
03. Kapitel
Erst kam ich zu spät und dann bekam ich nicht mit, dass mein Lehrer mich aufrief. Schon am ersten Tag erarbeitete ich mir so den Status des schwarzen Schafs. Was für ein Erfolg. Meine Erfolgsstory war aber noch nicht zu Ende. Auch in der dritten Stunde, in Mathe, spielte mein neuer Lehrer Frontman.
»So, ich möchte gerne erfahren, was ihr aus dem letzten Schuljahr behalten habt.« Unser Klassenlehrer, der Herr Scholz hieß, setzte ein unschuldiges Lächeln auf. Oder war es ein Gehässiges?
»Bitte alles vom Tisch, außer eure Federtasche.« Herr Scholz drückte einem Schüler die Arbeitsblätter in die Hand.
Ich war komplett geliefert. Und das am ersten Tag. Oder doch nicht? Bei dem Schüler, der die Blätter austeilen sollte, handelte es sich um eine Schülerin. Diese stand auf und dann schwebte sie durch den Klassenraum. Sie hätte die Blätter durchgeben können, aber das wäre diesem Mädchen nicht würdig gewesen. Ihre Haare waren nicht ganz blond. Und sie hatte ein traumhaft schönes Gesicht. Wie eine Fee. Und dieses Lächeln ...
Leider schaute sie mich nicht einmal an, als sie mir das Blatt hinlegte. Daran galt es also noch zu arbeiten.
Der erste Tag endete nach der fünften Stunde. Das war das einzig Gute an diesem Tag. Abgesehen von Fabienne. So hieß das Mädchen, dass mir das Arbeitsblatt auf den Tisch legte. Glück brachte mir Fabienne aber nicht, schleppte ich in meinem Rucksack doch eine Vier minus nach Hause. Ich scheiterte an Geometrie. So ohne Lineal. Und viele Aufgaben, die abgefragt wurden, hatten wir in Ostfriesland in der sechsten Klasse durchgenommen. Woher sollte ich drei Jahre später noch wissen, wie man die rechnete? Und seit wann schafften es Lehrer, schriftliche Leistungskontrollen noch am gleichen Tag zu korrigieren? Ich trottete mit gesenktem Kopf den Heimweg entlang. Bis ich zusammenzuckte. Mein Trommelfell war kurz vorm Reißen. »Heeeyy, naaa? Musst du auch hier lang?« Jenny lächelte und hechelte in meine Richtung.
Nach was sah das denn aus? Nee, ich gehe mit meinem tonnenschweren Schulrucksack spazieren. Was für eine Frage.
»Wie lief dein Mathetest?«
»Ging so.« Jenny hatte die volle Punktzahl. Ich nicht. Deswegen hätte ich über jedes Thema lieber gesprochen, als über diesen blöden Test. Und Jenny schien das zu verstehen, denn sie wechselte ohne Überleitung das Thema.
»Auf welcher Schule warst du vorher?«
»Ulrichs Gymnasium.«
»Kenn ich nicht.«
»Ist auch weit weg.«
»Ach so, dann seid ihr jetzt erst nach Berlin gezogen?
Ich nickte, schaute Jenny dabei aber nicht an. Die nervte. Schon am ersten Tag.
»War ja echt blöd, dass die alle über deinen Nachnamen gelacht haben. So lustig finde ich den gar nicht.«
»Hm«, machte ich. Weil ich auch über meinen Nachnamen nicht sprechen wollte.
»Ich bin schon seit der siebenten Klasse auf der Schule. Ist todlangweilig. Ich schreibe immer nur Einsen, obwohl ich nie lerne. Krass, oder?«
Meine Mutter sagte einmal, dass es Menschen gibt, die müssen nichts tun, denen wird alles in den Hintern gesteckt. Jenny gehörte wohl zu diesen Menschen. Meine Beliebtheitsskala kletterte sie damit nicht hinauf.
»Was hattest du für einen Notendurchschnitt auf deinem letzten Zeugnis?« Ich zuckte mit den Schultern. Notendurchschnitt? Der interessierte mich nicht. Und diese Jenny ging mir gehörig auf den Keks mit ihren Fragen.
Nachdem ich Jennifer an der letzten Straßenecke endlich abschütteln konnte, schloss ich kurz darauf die Haustür auf.
Am Morgen verabschiedete mich das Gebrüll von Annabell, nun empfing es mich wieder. Dank Annabell hielt sich das Interesse an meinem ersten Schultag in Grenzen. Zum Glück.
04. Kapitel
Am zweiten Tag stand in der ersten Stunde das Kosmetikstudio vor der Klasse. Wobei Beautysalon besser passte. Weil die bei uns Englisch unterrichtete. Aber so beauty sah Frau Deutschländer nicht aus, wenn ich die mir ohne eine Tonne Schminke vorstellte. Was folgte, war mein persönliches Drama in zwei Akten. Auch Frau Deutschländer wollte unbedingt erfahren, was wir aus dem letzten Jahr noch konnten. Das zog mir erstmal nicht die Schuhe aus, denn in Englisch hatte ich noch nie Probleme. Ich schlug also meinen Schreibblock auf und riss ein liniertes Blatt heraus. Dann schrieb ich oben links in die Ecke das Datum und in die rechte Ecke meinen Namen.
»Benjamin Grützemacher?«
Irritiert schnellte mein Kopf nach oben.
»Du stehst ganz oben im Klassenbuch und fängst an.«
Moment! Wie bitte? Was meinten Sie?
»Stehe bitte auf!«
Irgendwer sorgte tatsächlich dafür, dass ich aufstand. Ich war es nicht. Ich wollte den Beauty-Salon verbessern. Grützemacher begann doch mit G. Nicht mit A oder B. Vielleicht orientierte die sich an den Vornamen? Da kannte ich aus der Klasse bisher niemanden, dessen Namen mit A anfing. Oder stand ich ganz oben in der Liste, weil ich neu war?
»Bitte antworte in Englisch auf meine Fragen!«
Frau Deutschländer machte ihrem Namen alle Ehre. Meine letzte Englischlehrerin sprach ausnahmslos Englisch mit den Schülern. Frau Deutschländer bevorzugte es scheinbar, ausnahmslos Deutsch zu sprechen.
»Was hast du in deinen Ferien gemacht?«
»Ich? Ich bin ...«
»Bitte auf Englisch.«
Ach ja!
»I moved in the holidays«, antwortete ich. Diese Jenny kicherte über meine Antwort, welche noch meine Beste war. Bei allen weiteren Fragen des Tuschkastens hätte ich mich gerne eingebuddelt. Aber unter mir lag, statt Nordseesand, giftgrüner Linoleumboden. Da war das Einbuddeln schwierig. Nach fünf Minuten Folter, die sich wie fünf Tage anfühlten, setzte ich mich wieder. Mit einer Fünf.
Nach mir kamen noch zwei Schüler dran. All die anderen konnten sich in Ruhe auf ihre Kontrolle am nächsten Tag vorbereiten. Und es waren ausnahmslos die gleichen Fragen. Warum gab meine Mutter mir nach meiner Geburt nicht den Namen Zen oder Zorro? Dann hätte ich auch noch die Möglichkeit gehabt, mich vorzubereiten. Aber so ...
In der zweiten Stunde stand die Klasse in Reih und Glied. Vor uns stand der gleiche Jogginganzug, der mich gestern im Militärton darauf hinwies, dass ich im falschen Gebäude war. Wobei eine Uniform der Bundeswehr besser zu unserem Sportlehrer Herrn Stark gepasst hätte. Beurteile Menschen nie nach Ihrem Äußeren, sagte meine Mutter immer. Aber wie sollte man über jemanden urteilen, dessen Spitzname in der Schule Generalfeldwebel war? Immerhin unterzog uns Generalfeldwebel Stark nicht gleich einem ›Mal schauen, was ihr aus dem letzten Jahr noch könnt‹-Test. Dafür brüllte er Jenny an, als wir zur Erwärmung drei Runden um den Kunstrasenplatz joggten. Sie wäre so langsam, sie müsse aufpassen, nicht von einer Biene befruchtet zu werden. Ich fand den Spruch ziemlich daneben, weshalb ich auch nicht lachte. Im Gegensatz zu den anderen Jungs.
»Mach dir nichts draus«, flüsterte ich ihr zu. Jenny zeigte mir wieder ihre Zahnspange. Aber dieses Lächeln kaufte ich ihr nicht ab.
Als Nächstes standen Sprintübungen auf dem Programm. Und Stark lobte meine Ausdauer und meine Schnelligkeit. Aber dieses Rumgeschleime war mir peinlich. Auch wenn ich durch Starks Loblieder in der Rangliste der Jungs einige Plätze nach oben kletterte. Das merkte ich daran, dass mich einer, der Ronny hieß, fragte, ob ich Bock hätte, nach der Schule mit auf den Fußballplatz zu kommen. Ich verneinte. Weil ich Fußball noch nie mochte. Ich kam aus Ostfriesland. Da boßelte man. Im Winter. Auf der Straße. Oder man spielte Handball. Aber Fußball war da nicht so beliebt. Zumindest bekam ich es nicht mit. Und so rutschte ich in der Rangliste wieder weit, weit nach unten.
»Gehste lieber mit deiner Negertussi mit?«
Was sollte ich darauf antworten?
05. Kapitel
Mein nächster Weg führte mich in die Goethestraße. Meine Mutter gab mir das Versprechen, dass ich weiter Handball spielen durfte, wenn wir nach Berlin ziehen. Sie hielt ihr Versprechen. Ein Versprechen. Von zehn.
Ich war eine Stunde zu früh an der Halle. Egal. Im nahegelegenen Park wandelte ich meine Schultasche zu einem Kissen um und legte mich auf die Wiese. Ich ließ mir die Nachmittagssonne auf das Gesicht scheinen, während das Gras, welches mir am Hals und an den Händen kitzelte, ein Eindösen verhinderte. Zu spät zum ersten Training zu kommen, hätte zwar perfekt zu meinem Start in der Schule gepasst, aber den wollte ich hier auf keinen Fall wiederholen. Es kommt immer so, wie es kommen soll. Noch so ein Spruch meiner Mutter. Das hieß, wäre ich im Park eingeschlafen und deshalb zu spät zum Training gekommen, sollte es genau so kommen? Vor was bewahrte mich das dann bitte? Es bewahrte mich ja auch nichts vor der Schule. Oder vor dieser nervigen Jenny, die mich mit ihrer Brille und ihren komischen Haaren an eine Studentin aus Afrika erinnerte.
Zehn Minuten vor Trainingsbeginn schlich ich zurück zur Halle. Vor der Tür standen neun Jungs, die sich boxten und rempelten. Hoffentlich war das kein Teil meiner neuen Mannschaft.
Es war kein Teil meiner neuen Mannschaft. Es war meine neue Mannschaft. Sie bestand aus neun Jungs. Mit mir also zehn.
Aber wollte ich hier wirklich Handball spielen? Ich wollte. Unbedingt. Mein alter Handballverein war durch unseren Umzug in weite Ferne gerückt und dies hier der einzige Verein in der Umgebung. Ich hatte also keine Wahl. Denk positiv, würde meine Mutter jetzt sagen. Immerhin erkannte ich Marlon. Einen schlaksigen Jungen aus meiner Klasse, der, wie Jenny, eine Brille trug. Ich wechselte mit ihm in der Schule noch kein Wort, aber ich dachte ja positiv. Marlon sah mich und hob seine Hand. Wahrscheinlich, um mich zu grüßen. Ich hob zurück, traute mich aber trotzdem nicht zur Gruppe. Lieber wartete ich auf den Trainer. Und der kam. Sie kam. In einer grünen Trainingsjacke. Ich schlich näher an die Gruppe heran und glotzte meine neue Trainerin an, die so hoch wie breit war. Mein Geglotzte sah bestimmt doof aus. Egal, denn eines wurde mir sofort klar. Wer so eine Frau zur Mutter hatte, der musste keine Angst haben, dass ihm die anderen Jungs das Taschengeld abziehen würden. Die kräftige Frau schob den Schlüssel in das Schloss der Hallentür und die Schafherde folgte der Schäferin. Ich schlich hinterher, kam aber nur bis zur Tür.
»Ach, du bist Ben?«
Eine kräftige Pranke streckte sich mir entgegen. Ich starrte auf die Hand, die so groß wirkte, als könne man mit dieser drei Handbälle auf einmal fangen. Ich wusste, wenn ich diesem Kleiderschrank ebenfalls meine Hand entgegenstrecke, erledigte sich das mit dem Handball spielen. Niemals bekäme ich diese in einem Stück zurück. Die dauergewellten, blonden Haare reagierten gelassen auf meinen verweigerten Handschlag und sagten: »Hi, ich bin Uschi.«
Kein Name auf der Welt passte besser zu dieser Frau. Das war eine wirkliche Uschi. Eine Uschi mit Reibeisenstimme.
Zu dieser Stimme gesellte sich ein breites Grinsen, dass mich an Herrn Scholz erinnerte. Uschi war nicht dick. Ich glaube, sie war tierisch muskulös. Alles andere hätte mich erschrocken. Nur hätte mich jemand nach dem Alter von Uschi gefragt, hätte ich bestimmt gelogen. Ich schätzte, sie war irgendwas zwischen 45 und 60.
»Schon mal Handball gespielt?«
Wieder nickte ich.
»Welche Position?«
Warum schaffte es in Berlin eigentlich niemand, einen richtigen Satz auszusprechen? Aber gut, ich konnte auch in halben Sätzen antworten.
»Im Tor!«
»Super! Das passt. Wir haben im Moment nur einen Torwart.«
Welche Position passte denn bitte nicht bei neun Spielern? Sechs auf dem Feld und nur drei auf der Bank?
»Okay, zieh dich um und dann machst du dich warm.«
Wieder nickte ich und verschwand in der Halle. Die Kabinentür riss ich beinahe aus den Angeln, als ich in der Umkleide verschwinden wollte. Dabei vergaß ich aber, dass sich da noch neun andere Jungs umzogen.
»Hey ...«, murmelte ich peinlich berührt. »Ich bin Ben.«
»Cool, ich wusste gar nicht, dass du auch Handball spielst.«
Ich wollte Marlon für ewig dankbar sein, dass er mich mit diesem Satz aus meiner blöden Situation rettete. Und so waren Marlon und ich für die nächsten fünf Minuten sowas wie Kumpels. Für fünf Minuten. Dann waren es noch vier, drei ... Ich betrat die dunkle Sporthalle. Scheinbar hielt es niemand für nötig, das Licht anzuschalten, weshalb in der Halle die Farbe Grau dominierte. Ich trabte zu den Jungs und wärmte mich mit auf. In der großen Halle wirkte die Gruppe so, als hätte sie hier jemand vergessen. Oder als ob sie noch auf andere Gruppen wartete. Noch zwei Minuten ..., ich joggte und sprintete abwechselnd und wedelte dabei mit meinen Armen, noch eine Minute ..., Uschi stellte die Tore auf. Dann rief sie: »Okay, einen Kreis!« Uschi stellte mich vor. Aber meine Position behielt sie noch für sich. Und wo war eigentlich Marlon?
»Die Torhüter ins Tor, wir beginnen das erste Training der Saison mit Wurftraining.« Ich joggte Richtung Tor. Plötzlich raste ein Junge an mir vorbei. Ein Junge mit festgetackerter Sportbrille. Marlon stellte sich zwischen die Pfosten. Ich wendete direkt und joggte ins gegenüberliegende Tor.
»Gut, wir haben in diesem Jahr zwei Torhüter«, schallte Uschis Reibeisenstimme durch die Halle. »Also zwei Gruppen.«
»Ach, der Neue ist auch Torwart?«, fragte einer, den ich noch nicht kannte. Und in diesem Moment kapierte auch Marlon, dass ich sein neuer Konkurrent war.
Im Tor hatte ich was drauf. In der letzten Saison belegte mein letzter Verein den dritten Platz in der höchsten Liga. Auch dank mir. Das mag eingebildet klingen, war aber so.
Und dann drang wieder die Frage in meinen Kopf, ob ich hier wirklich Handball spielen wollte. Die Würfe meiner neuen Mannschaftskameraden ..., das Warmmachen war doch abgeschlossen? Ich fing viele Bälle direkt, was als Handballtorwart eher unüblich ist. Von den ersten zehn Würfen landete einer im Netz. Von den nächsten zehn keiner. Viele Spieler warfen den Ball aus dem Stand. Ja, Sprungwürfe waren so selten wie die Bälle, die ich aus dem Tor holte. Auweia, das sah alles ziemlich bescheiden aus. Und das war noch nett formuliert. Im abschließenden Trainingsspiel blieb ich bis kurz vor Schluss ohne Gegentor. Auch das ist beim Handball ja eher unüblich. Als dann doch noch ein Ball ins Netz ging, drehte der Typ, der das Tor warf, völlig durch. Wie ein Flugzeug segelte er durch die Halle, grölte und kurz darauf war er unter vier seiner Mitspieler begraben.
Wo bin ich hier gelandet?
06. Kapitel
Es war gegen 19:00 Uhr, als ich vom Training nach Hause kam. Aus dem Wohnzimmer hörte ich Besteck klappern. Ich warf meinen Rucksack und meine Sporttasche ab und wusch mir die Hände. Nur weil ich einen Mega-Hunger hatte, suchte ich mir anschließend einen Platz am Abendbrottisch, der nur von einem Funzellicht beleuchtet wurde. Ich schnappte mir eine Brotscheibe und belegte diese mit Käse. Das wiederholte ich zweimal.
»Kannst du antworten, wenn dir deine Mutter eine Frage stellt?« Ich schaute meinen Stiefvater an.
Wer stellte eine Frage? Ich habe nichts gehört.
»Ich habe dich etwas gefragt, Ben!«
»Entschuldige, ich habe nicht zugehört.«
»Das ist ja nichts Neues«, knurrte Herr Andreas Popelbremse Schuhmacher. »Ich fragte, wie dein Tag war.«
Wie mein Tag war? Seit wann interessierte sich hier jemand für mich. Hallo? Hier hielt man es nicht einmal für nötig, mit dem Abendessen auf mich zu warten. Nicht, dass mich das gestört hätte.
»Ganz okay?«, antwortete ich eher fragend. Hoffentlich bohrten die nicht nach. Was sollte ich dann erzählen? Von einer Vier minus in Mathe und einer Fünf in Englisch? Dass der neue Handballverein an Völkerball für Rentner erinnerte?
Aber, Gott sei Dank, das Interesse an mir war lediglich eine ›Wir fragen jetzt mal, wie es dir geht, um unser Gewissen zu beruhigen‹-Frage.
Annabell erkundete anschließend weiter ihren Daumen, Herr Oberlippenbart genoss sein Bier und meine Mutter schnitt eine Tomate in Scheiben. Am nächsten Tag weckte mich die Morgensonne, was erfreulicher war, als von Andreas Schuhmacher geweckt zu werden. Doch die Morgensonne weckte auch Erinnerungen an meine Hausaufgaben. In Deutsch, Mathe und Biologie. Dieser Tag war verloren. Schon am Morgen.
»Mist, verdammter!«, fluchte ich kaum vernehmlich und begrub meinen Kopf unter meinem Kissen. Jemand donnerte gegen die Tür und brüllte: »Aufstehen!« Am Montag und Dienstag öffnete man wenigstens noch meine Zimmertür, um mich rüde zu wecken, aber auch das ersparte man sich inzwischen. Ich gehorchte dem Befehl, schnappte meine Sachen und flüchtete ins Bad. Vor dem Spiegel stand ein zerknautschter Vierzehnjähriger mit ..., oh Gott, wo kam das denn her? Ich schaute genauer hin. Ein Bartflaum. Nein ..., bitte nicht! Nicht jetzt schon! Wie sollte ich den wieder wegkriegen? Die Rasierer von Schnauzbart Schuhmacher fasste ich nicht an. Nicht freiwillig. Ich griff eine Nagelschere und versuchte, den Milchbart über meiner Oberlippe wieder zu entfernen. Jede noch so winzige Ähnlichkeit mit meinem Stiefvater galt es bedingungslos auszulöschen.
Die Schere führte einen Kampf gegen meinen ersten Bartwuchs. Es war ein schmerzhafter Kampf. Und als ich das Ergebnis im Spiegel betrachtete, konnte ich mir denken, warum mein Herr Stiefvater solch ein Gerät zwischen Oberlippe und Nase trug. Ich versuchte, die zahlreichen Blutungen mit winzigen Klopapierschnipseln auszubremsen, aber das gelang nicht. Wenn ich mit diesem Ergebnis in der Schule erschien, lachten die mich bestimmt aus. Mir kam die Idee, ein Pflaster über meine Lippe zu kleben, doch damit hätte ich ausgesehen wie dieser Irre, der den Zweiten Weltkrieg verursacht hat.